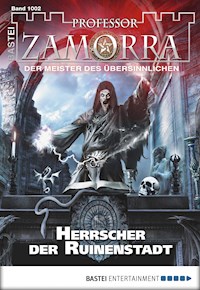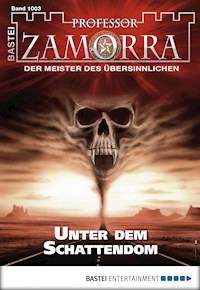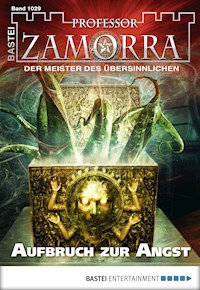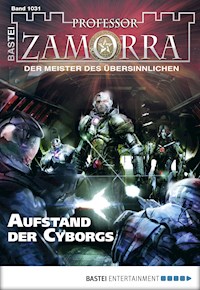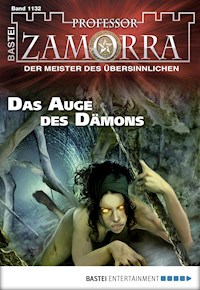
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Auf dem Times Square taucht eine Frau buchstäblich aus dem Nichts auf. Kurz darauf kommt es in der New Yorker Subway zu einem Blutbad. Ein geheimnisvolles Artefakt scheint nicht ganz unschuldig an den unheimlichen Vorgängen zu sein.
Zamorra und Nicole werden zur Hilfe gerufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die beiden Franzosen ahnen nicht, was sie an ihrem Reiseziel erwartet - denn schon bald starren sie in das Auge des Dämons!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Auge des Dämons
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Carlos Villas / Rainer Kalwitz
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5345-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das Auge des Dämons
Von Michael Breuer
Keuchend ließ Cornelius Brunner die Machete sinken. Auf seiner Stirn waren dicke Schweißtropfen zu sehen.
»Das ist schwerer als gedacht«, knurrte er.
Er wischte sich mit dem linken Unterarm über die Stirn, bevor er die Klinge wieder hob, um sich weiter durch den dichten Urwald zu kämpfen.
»Wie weit ist es noch?«, hörte er eine Stimme hinter sich.
Brunner verzog das Gesicht und deutete mit der breiten Klinge vor sich. »Fragen Sie das unseren Führer«, knurrte er.
Aber der Eingeborene war verschwunden. Es schien, als habe ihn der Wald förmlich verschluckt …
Polynesische Inseln, 1820
Fassungslosigkeit breitete sich auf Brunners zerfurchten Gesicht aus.
»Wo steckt der Kerl?«, entfuhr es ihm.
Er wirbelte zornig herum. Mit funkelnden Augen blickte er den Dolmetscher an. »Hast du gesehen, wohin er verschwunden ist?«
Die Antwort bestand in einem heftigen Kopfschütteln.
Brunner mahlte mit den Kiefern und blickte sich um. Die kleine Gruppe, der er angehörte, war von dichtem Urwald umgeben. Ringsum war kein Laut zu hören. Es schien, als seien alle Tiere in der Umgebung plötzlich verstummt. Die Stille jagte Brunner einen kalten Schauer über den Rücken. Mit der freien Hand fuhr er sich durch das schlohweiße Haar und fragte sich, wie zum Teufel er eigentlich hergekommen war.
Technisch gesehen lag das auf der Hand. Er war der Kapitän der Brigg Miranda, die momentan in der malerischen Bucht der kleinen, namenlosen Insel ankerte, auf der sie sich gerade befanden. Er war hochgewachsen. Das Leben auf See hatte tiefe Spuren in seinem Gesicht hinterlassen: Er trug eine Klappe über dem linken Auge. Das Sehorgan darunter erinnerte an ein hartgekochtes Hühnerei. Sehen konnte er damit jedenfalls nicht. Trotz seines Alters von gerade einmal vierzig Jahren war sein Haar bereits schlohweiß.
Die Miranda besaß eine hundertfünfzigköpfige Besatzung. An dem Landgang nahmen jedoch insgesamt nur sechs Personen teil. So hatte es Lord Millquetoast gewünscht. Brunner hielt das für bodenlosen Leichtsinn, aber immerhin bezahlte der exzentrische Lord die Expedition, die sie bisher quer durch das polynesische Inselgebiet geführt hatte. Und er zahlte weiß Gott nicht schlecht.
Unbehaglich blickte sich Brunner um und tastete instinktiv nach seinem Säbel. Die plötzliche Stille drohte ihn zu zermürben. Er machte eine warnende Geste in Richtung seiner Männer.
»Hier stimmt etwas nicht«, merkte er ganz richtig an.
Brunner hörte Schritte hinter sich und einen Moment später tauchte Lord Millquetoast an seiner Seite auf. Dass er selbst angesichts des Marsches durch den Urwald nicht auf seinen Zylinder verzichtete, war grotesk, aber dem Kapitän war nicht zum Lachen zumute.
»Er hat gesagt, es sei nicht mehr weit«, murmelte Lord Millquetoast. Er sah sich unbehaglich um. »Was meinen Sie, Kapitän?«
Brunner warf dem Adeligen einen schiefen Blick zu. »Sie leiten diese Expedition«, erinnerte er Millquetoast.
Bei der Planung der Seereise ans andere Ende der Welt hatte der Lord davon gesprochen, bislang unerforschte Teile der polynesischen Inseln kartografieren zu wollen. Erst auf See war er nach und nach mit der Sprache herausgerückt. Millquetoast war auf der Suche nach einem geheimnisvollen Tempel. Dort, so hieß es, würden die Insulaner einen ihrer merkwürdigen Götter anbeten.
Vermutlich war Millquetoast also hinter irgendwelchen Schätzen her. Brunner konnte sich lebhaft vorstellen, dass die Polynesier ihren Gottheiten mit allerlei Geschmeide huldigten. Für ihn war das etwas Greifbares, denn die Gier nach Gold war nur allzu menschlich. Das Streben nach Reichtum war für ihn jedenfalls nachvollziehbarer als der Wunsch, eine unüberschaubare Anzahl von Inseln zu kartografieren. Während der langen Seefahrt hatte der Lord nächtelang über uralten Folianten gesessen und Kartenwerke studiert. Fast schien es Brunner, als habe Millquetoast schon vorher eine ziemlich genaue Ahnung vom Ziel ihrer Reise gehabt. Dennoch hatten sie vorher eine Handvoll anderer Inseln angesteuert. Auf Tahiti hatten sie einen Dolmetscher an Bord genommen, der sich mit den verschiedenen Inseldialekten auskannte. Kurz vor ihrem endgültigen Ziel war dann der Führer dazugekommen, ein spindeldürres Kerlchen namens Faipa.
Dieser wusste angeblich genau, wo sich der gesuchte Tempel befand und hatte sie zielstrebig zu dieser Insel geführt.
Und nun war er also in den Tiefen des Dschungels verschwunden.
Kapitän Brunner knirschte mit den Zähnen. Er hatte den kleinen Kerl nie gemocht. Er hatte von Anfang an etwas Verschlagenes an sich gehabt. Es hätte ihn nicht sonderlich gewundert, wenn Faipa von Anfang an vorgehabt hatte, sie in eine Falle zu locken.
Aber Brunner hatte nicht die Absicht, sich von irgendwelchen Insulanern zum Lunch verspeisen zu lassen. Er war entschlossen, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen.
»Haltet euch bereit, Männer«, knurrte Brunner über die Schulter nach hinten. »Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl!«
Millequetoast rückte seinen Zylinder zurecht.
»Denken Sie, wir bekommen Ärger?«, fragte er.
Der Kapitän warf ihm einen Seitenblick zu. Wenn man den hageren Adeligen so betrachtete, wirkte er gar nicht wie einer dieser typischen Schatzjäger, aber Brunner war sich natürlich der Tatsache bewusst, wie sehr der äußerliche Anschein trügen konnte.
»Vermutlich Sir«, gab er zurück. »Wir sind besser vorsichtig. Man weiß nie, was diese Eingeborenen im Schilde führen.«
Der Adelige lachte leise, was Brunner angesichts ihrer Situation reichlich unpassend fand. »Es hätte mich auch gewundert, wenn unsere Reise ohne Zwischenfälle ablaufen würde. Der Tempel ist ein Heiligtum. Man wird uns kaum einfach so in sein Inneres lassen!«
Brunner nickte knapp. »Sie rechnen also mit einer Auseinandersetzung. Dann ziehen wir uns zurück und holen Verstärkung!«
Sie waren zwar zu sechst, aber wenn es zu einem Gefecht kam, würden ihnen weder der hühnerbrüstige Dolmetscher noch der exzentrische Adelige etwas nützen. Die Beiden blieben außen vor.
Millquetoasts Augen wurden groß und rund. »Was?«, fragte er. »Natürlich bleiben wir. Denken Sie etwa, wir seien so weit gereist, um jetzt die Flinte ins Korn zu werfen?« Er fasste Brunner an den Schultern. »Lassen Sie uns jetzt nicht aufgeben, Kapitän«, brachte er mit flehendem Tonfall hervor.
Brunner überlegte einen Moment. Ein paar Minuten konnten sie wohl noch weiter marschieren. Vielleicht fanden sie den verdammten Tempel ja tatsächlich. »Beim ersten Anzeichen von Gefahr ziehen wir uns zurück«, erklärte der Kapitän schließlich seufzend. Er wollte die ganze Sache nur noch hinter sich bringen.
Er hatte keine sonderliche Lust darauf, das Schicksal des unglücklichen James Cook zu teilen, der vor gerade mal vierzig Jahren beim Besuch Hawaiis von den örtlichen Eingeborenen zu Porridge verarbeitet worden war.
Brunner sah den Lord ernst an. »Sie halten sich mit Kamelahu in der Mitte der Gruppe. Hawkins und ich gehen voran. Die beiden anderen Männer achten darauf, dass uns niemand in den Rücken fällt.« Der Kapitän blickte in die Runde. »Verstanden, Männer?«, fragte er. »Macht keinen unnötigen Lärm. Falls hier tatsächlich Gefahr lauert, wollen wir nicht unnötig auf uns aufmerksam machen!«
Kollektives Nicken war die Antwort.
Brunner lächelte grimmig. Er wusste, er konnte sich auf seine Crew blind verlassen. Wie es allerdings mit dem Lord und dem Dolmetscher aussah, stand auf einem anderen Blatt.
Er atmete noch einmal tief durch. »Gehen wir«, entschied er dann.
Vorsichtig setzte sich die Gruppe in Bewegung.
Endlose Minuten bahnten sich die Männer ihren Weg durch den dichten Urwald, bis sie schließlich völlig unerwartet auf eine gewaltige Lichtung stießen.
Mit offenem Mund starrte Kapitän Cornelius Brunner auf das sich ihm bietende Bild.
Mitten auf der Lichtung befand sich ein von Schlingpflanzen überwuchertes Gebäude, bei dessen Anblick der Seemann unwillkürlich an die Abbildungen antiker griechischer Tempel denken musste. War es tatsächlich möglich, dass die Insulaner ein solches Bauwerk errichtet hatten? Er wusste es nicht. Dazu kannte er sich mit deren Kultur zu wenig aus. Während Brunner noch staunte, tauchte Lord Millquetoast an seiner Seite auf.
Die Augen des Adeligen begannen fiebrig zu glänzen, als er erkannte, dass er endlich am Ziel seiner Reise angekommen war. »Das ist er«, flüsterte er heiser, »der Tempel des Ikon-Mare!«
Und mit diesen Worten stürmte er hinaus auf die Lichtung.
***
New York City, Gegenwart
Frank Halligan hatte die zu Fäusten geballten Hände tief in den Taschen seines Mantels vergraben, während er die Straße entlangstapfte. Für die grellen Leuchtreklamen und Werbetafeln, die die Gegend rund um den Times Square erhellten, hatte er an diesem Abend keinen Blick. Der dickliche Mittvierziger war ganz in Gedanken versunken.
Und diese Gedanken drehten sich gerade um den Konsum einer frisch erworbenen Flasche Schnaps, die noch jungfräulich in der Innentasche seines weiten Mantels steckte.
Halligan marschierte weiter. Blicklos wanderte er an den zahllosen Nachtlokalen vorbei und wich mit traumwandlerischer Sicherheit den entgegenströmenden Menschenmassen aus, die zu dieser Zeit noch unterwegs waren. Er nahm sie nicht einmal wirklich wahr.
Der dickliche Mann schmatzte voller Vorfreude. Sein Mund war trocken und er konnte es kaum erwarten, den ersten, tiefen Schluck zu sich zu nehmen. Alles in ihm brannte danach, sich wieder einmal gepflegt einen hinter den Knorpel zu schütten. Der Gedanke, dass er in den letzten Monaten vielleicht ein wenig zu viel trank, kam dem Mittvierziger nicht. Das beruhigende Gefühl der frisch erstandenen Flasche füllte sein Hirn völlig aus.
Halligan biss sich auf die Unterlippe. Hastig blickte er nach links und rechts, um sicherzugehen, dass sich in der Nähe keine Cops herumtrieben, dann drückte er seinen Körper in eine der dunklen Seitenstraßen.
Aufseufzend griff er ins Innere seines Mantels und zog die Flasche hervor. Voller Vorfreude leckte er sich über die wulstigen Lippen, während er mit spitzen Fingern die Folie vom Flaschenhals pellte, um sie sogleich achtlos hinter sich zu werfen.
Er konnte einfach nicht mehr warten.
Scheiß auf die Cops!
Der öffentliche Genuss von Alkohol war zwar gesetzlich verboten, aber das kratzte Halligan in diesen Minuten nicht im Geringsten.
Zitternd drehte er die Verschlusskappe auf. Seine Nasenflügel blähten sich auf, als seine Sinne den Geruch des billigen Bourbons wahrnahmen.
Gierig setzte er die Flasche an den Hals, um den Fusel in sich hineinzuschütten. Halligans Kehlkopf hüpfte auf und ab, während er schluckte. Gleich darauf fühlte er, wie sich eine vertraute Wärme in seinem Inneren ausbreitete. Eine tiefe Ruhe überkam ihn. Wieder setzte er die Flasche an und nahm einen zweiten, diesmal kleineren Schluck, bevor er sie vorsichtig wieder zuschraubte und im Inneren seines Mantels verschwinden ließ.
Den Rest wollte er sich für später aufheben.
Halligan atmete tief durch. Sein Zittern klang ein wenig ab. Die Gesichtszüge entspannten sich. Gleichzeitig nahm er seine Umgebung mit neuer Deutlichkeit wahr. Die schäbige kleine Seitenstraße war finster und schmutzig. Dass sie direkt an den belebten Times Square angrenzte, schien kaum vorstellbar.
Halligan lehnte sich an eine Hauswand. Sein Atem wurde flacher.
Es begann zu regnen, aber das störte ihn in seinem jetzigen Zustand nicht mehr.
Der dickliche Mann wartete einen Moment, bis seine Erregung abgeklungen war, dann stieß er sich von der Hauswand ab und setzte sich wieder in Bewegung. Jetzt wollte er nur noch heim, um sich in aller Ruhe den Rest der Flasche zu Gemüte zu führen.
Er kicherte leise, während er sich aus dem trüben Halbdunkel seinen Weg zurück auf die hell erleuchtete Hauptstraße bahnte.
Er kam genau drei Schritte weit, bevor er wie angewurzelt stehenblieb.
Grelle Lichtblitze erfüllten das Innere der kleinen Gasse. Instinktiv hielt sich Frank die Hand vor die Augen, als er solcherart geblendet wurde. Er kam sich mit einem Mal vor wie in einem Science-Fiction-Film. Als das Blitzgewitter abklang, konnte Frank wenige Meter vor sich eine Frau mit dichtem, krausem Haar erkennen, das notdürftig von einem Band zusammengehalten wurde. Sie war ungefähr einen Meter fünfundsiebzig groß. Ihre einzige Bekleidung bestand aus ihrem Geburtstagskostüm. Frank Halligan musterte die splitternackte Frau einen Moment lang mit offenem Mund. Dann erst fielen ihm ihre Augen auf. Diese leuchteten in einem unirdischen Orange.
Dämonenaugen, durchzuckte es Halligan. Er hatte genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass aus dem Nichts auftauchende Frauen mit glühenden Augen nichts Gutes zu bedeuten hatten.
Instinktiv machte er einen Schritt zurück.
Sofort folgte ihm die Unbekannte. Die pupillenlosen Augen fixierten ihn förmlich. Sie musterte ihn, als habe sie einen ganz besonderen Leckerbissen vor sich.
Halligan biss sich auf die Unterlippe. Er zögerte nur Sekunden, dann warf er sich blitzartig herum und begann zu rennen.
Immer näher kamen die grellen Lichter am Ende der kleinen Gasse. Dort befanden sich andere Menschen, die ihm helfen würden – jedenfalls hoffte er das. Ob sie tatsächlich etwas gegen die unheimliche Frau ausrichten konnten, würde sich zeigen.
Schon hörte Halligan das Geräusch von Füßen auf dem nassen Asphalt. Die Nackte hatte die Verfolgung aufgenommen. Und sie bewegte sich rasend schnell.
Halligan erreichte das Ende der Gasse und stürmte hinaus auf den hellerleuchteten Times Square. Passanten blieben verdutzt stehen, als sie seine verzerrte Miene verblickten.
Aber noch verdutzter waren sie, als nur Sekundenbruchteile später die Nackte aus der Gasse trat, deren Augen grell leuchteten. Die Miene der Frau war verzerrt, die Finger krallengleich verkrümmt.
Sie bewegte sich lauernd, wie ein Raubtier, das sich auf dem Sprung befand. Ihre Beute war ausgemacht. Die Nackte hatte keinen Grund mehr, sich zu beeilen.
Halligan hatte keine Chance mehr, ihr zu entkommen und das wusste er genau.
Im nächsten Moment sprang die Frau.
Sie machte einen gewaltigen Satz. Im nächsten Moment hing sie dem dicklichen Mann an der Kehle.
Frank Halligan stieß einen gurgelnden Schrei aus, in den nur Sekundenbruchteile später die umstehenden Menschen einstimmten.
Heißes, dickflüssiges Blut spritzte empor, als ihm die nackte Unbekannte die Zähne in den unrasierten Hals schlug. Ein schwerer, kupfriger Geruch breitete sich aus.
Hilflos ruderte Halligan mit den Armen, als er von der Angreiferin zu Boden gerissen wurde. Er war außerstande, sich gegen sie zu wehren. Ihrem Körper schienen Bärenkräfte innezuwohnen. Hart schlug er mit dem Hinterkopf auf dem Asphaltboden auf. Sein Bewusstsein verdunkelte sich kurz, dann riss ihn das grausige Schmatzen und Kauen zurück in die Wirklichkeit.
Jetzt erst kam Leben in die umstehenden Menschen. Schreie waren zu hören und man versuchte, die Nackte von ihm herunterzureißen.
Aber diese hatte nicht die Absicht, sich den erbeuteten Leckerbissen entgehen zu lassen. Fauchend fegte sie die Menschen beiseite und wieder einmal zeigte sich, wie stark sie war.
Das ist kein Mensch, dachte Frank Halligan noch, bevor sie abermals die Zähne in seinen Hals schlug.
Plötzlich jedoch schien sie genug zu haben. Die unverhoffte Aufmerksamkeit gefiel ihr scheinbar nicht sonderlich. Mit gefletschten Zähnen ließ sie von Halligan ab und erhob sich. Ein drohendes Fauchen ließ die Umstehenden zurückweichen.
All das nahm der Verletzte jedoch nur am Rande wahr. Er wusste, er war am Ende seines Weges angekommen. Mit jedem weiteren Pulsschlag verströmte sich sein kostbarer Lebenssaft auf dem nassen Asphalt. Die grässliche Verletzung an seiner Kehle war zu schwerwiegend.
Die dämonische Unbekannte fauchte noch einmal, dann warf sie sich herum und rannte mit schnellen Schritten fort.
Als Halligan den Kopf neigte, konnte er sehen, wie sie in einem U-Bahn-Eingang verschwand. Dann verdunkelte sich sein Bewusstsein und es wurde für immer Nacht um ihn herum.
***
Château Montagne, Frankreich
Das Schrillen des Telefons riss Professor Zamorra aus seinen Gedanken. Der Parapsychologe blinzelte. Er brauchte einen Moment, um sich darüber klarzuwerden, wo er sich gerade befand.
Ich muss kurz eingenickt sein, stellte er verwundert fest. Er saß an seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer des Châteaus. Dem Stand der Sonne nach war es bereits Mittag. Zamorra stemmte sich hoch, warf kurz einen Blick aus dem riesigen Panoramafenster und rieb sich mit der linken Hand durch das Gesicht. Nach all den aufregenden Abenteuern der vergangenen Zeit war es kein Wunder, wenn er mittlerweile am helllichten Tag einnickte, entschuldigte er sich selbst.
Dann nahm er das Gespräch entgegen.
Das Gesicht seiner Lebens- und Kampfgefährtin Nicole Duval erschien auf dem Bildschirm. Die aparte Französin sah aus, als habe sie gerade in eine Zitrone gebissen.
»Was liegt an, chérie?«, fragte er.