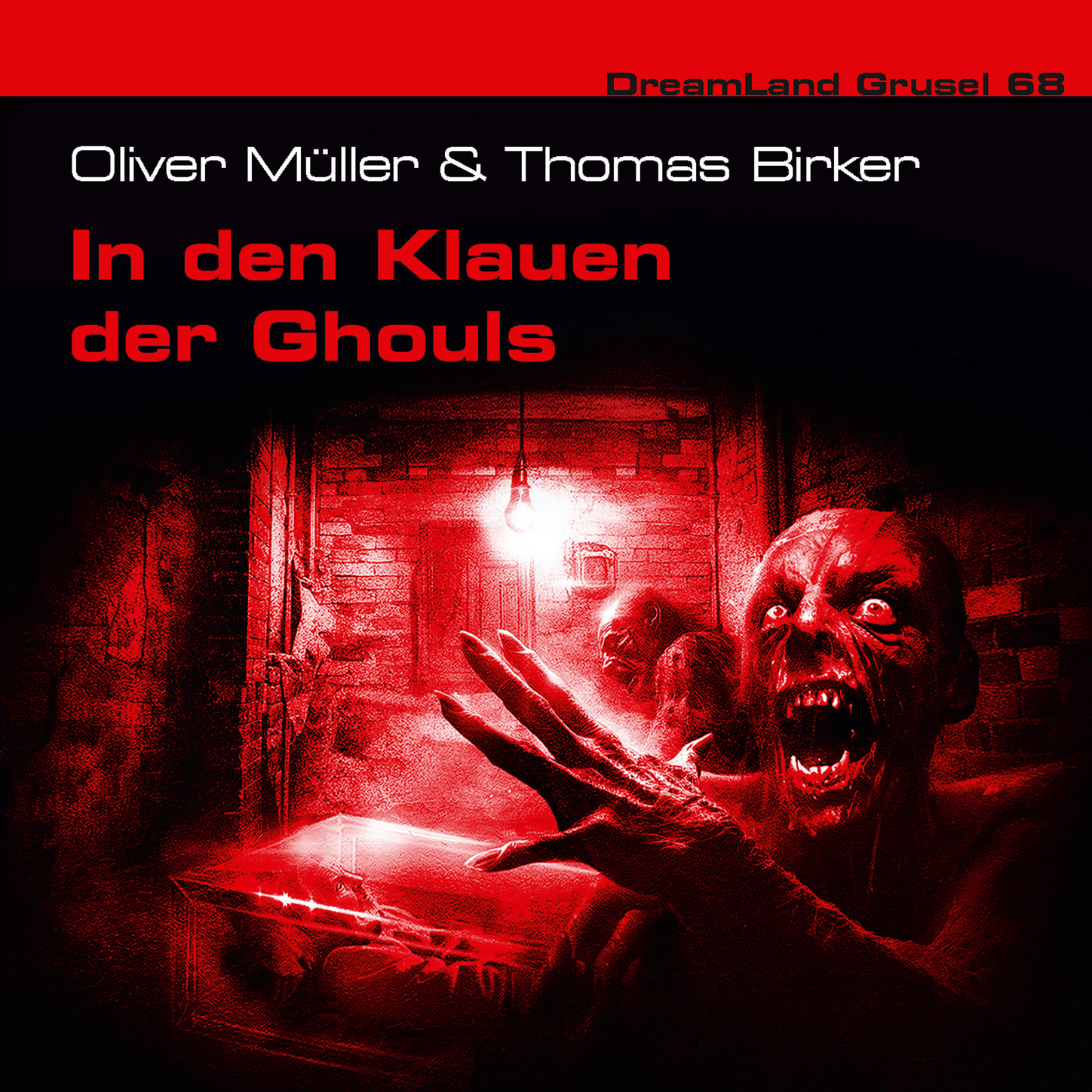1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
"Hilfe! Helfen Sie mir! Sie werden mich umbringen!"
Die Schreie waren in höchster Not ausgestoßen worden. Und sie waren echt, das hörte Zamorra sofort. Niemand konnte solch eine Panik vortäuschen, nicht einmal der beste Schauspieler. Der Mann litt Todesängste.
"Wer will Sie umbringen? Wo sind Sie?"
Zamorra sprach ruhig und eindringlich, doch wenn er gehofft hatte, den Anrufer damit dazu zu bringen, auf seine Fragen zu antworten, wurde er enttäuscht. Er hörte nur noch Keuchen und Schreie.
"Hallo? So sagen Sie mir doch, wo Sie sind!"
Die Schreie wurden zu einem Wimmern, klangen leiser.
Die Verbindung riss ab ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Gefangen im Zeitverlies
Leserseite
Vorschau
Impressum
Gefangen im Zeitverlies
von Oliver Müller
Schritt für Schritt kamen seine drei ehemaligen Zellengenossen näher. Wären sie noch sie, wie in der Zeit ihrer gemeinsamen Gefangenschaft, hätte Antoine sich nicht gefürchtet. Sie hatten sich verändert. Sowohl körperlich als auch von ihrem Wesen.
Der Verfall ihrer Körper war deutlich fortgeschritten. Überall dort, wo die zerfledderte Kleidung einen Blick auf die Haut zuließ, bemerkte er Risse und offene Wunden, aus denen wässriges Blut suppte.
Das Schlimmste waren die Augen der Männer. Sie lagen tief in den Höhlen, kaum noch zu erkennen, nicht mehr als stumpfe Kiesel. Darin brannte ein unheiliges Feuer, das direkt in der Hölle entfacht worden schien.
In der Gaststätte Zum Teufel
Zum wiederholten Male sah Antoine Morel auf seine Armbanduhr. Mittlerweile war es kurz nach acht. Wo blieb nur Bertrand? Hatte er etwa nie die Absicht gehabt, sich mit ihm zu treffen?
Verärgert griff Antoine nach seinem Glas und leerte es mit einem Zug. Es war bereits das zweite Bier in kurzer Zeit.
»Noch eins?«, fragte der geschäftstüchtige Wirt, der wie aus dem Nichts vor ihm auf der anderen Seite des Tresens aufgetaucht war.
Antoine nickte, was eine Haarsträhne dazu verleitete, ihm vor die Augen zu fallen. Wütend blies Antoine sie aus der Stirn. Als das nicht half, fuhr er sich mit der Hand über die dichten, dunklen Haare. Diesmal blieb die Strähne an der gewünschten Stelle.
Während er den Wirt beim Zapfen beobachtete, dachte er nach. Sollte er das Ding auch ohne Bertrand drehen? Das war vielleicht sogar besser, dann brauchte er nicht zu teilen. Andererseits war es manchmal auch hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben. Insbesondere wenn derjenige darin geübt war, Türen auch ohne den passenden Schlüssel öffnen zu können. Und das vor allem leise.
Erneut schob Antoine den Ärmel seiner Lederjacke, die er fast nie ablegte, ein Stück nach oben. Viertel nach acht. Fünfzehn Minuten wollte er Bertrand noch geben, dann würde er ohne ihn losziehen.
Er hatte das frische Bier zur Hälfte geleert, als ihm jemand auf die Schulter schlug. Antoine rutschte vom Barhocker und wirbelte herum, die Arme angriffslustig erhoben.
Sein Gegenüber wich einen Schritt zurück.
»Hey, ganz ruhig, Antoine. Ich bin es nur!«
»Bertrand!«
»Genau der. Was ist denn mit dir los, Mann? Bist ganz schön nervös.«
Antoine schnaubte nur kurz und glitt wieder auf den Hocker. »Du bist spät«, sagte er.
»Ich hatte noch zu tun. Warum hast du mich überhaupt so spontan herbestellt?«
Antoine deutete auf den Hocker neben sich. Bertrand folgte der Aufforderung und setzte sich zu ihm.
»Also?«, fragte er.
Antoine sah sich um, ob jemand zuhörte, aber die Kneipe war beinahe leer. Drüben am Tisch saß ein alter Zecher, der anscheinend eingeschlafen war. Ansonsten befand sich nur der Wirt im Raum. In der Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Umsatz, kam er näher.
»Auch ein Bier?«, fragte er Bertrand.
Antoine übernahm die Antwort. »Mach zwei.« Und an seinen Freund gewandt: »Du bezahlst. Für das Zuspätkommen.«
Bertrand grinste. »Bist wohl mal wieder knapp bei Kasse, was?«
Antoine zuckte nur mit den Schultern. Tatsächlich stimmte die Vermutung haargenau. Gleichzeitig war sie ein Grund dafür, warum er sich mit Bertrand treffen wollte.
»Dann schieß mal los. Was gibt es so Spannendes?«
Antoine wartete ab, bis der Wirt die zwei Gläser auf den Tresen stellte, dann griff er danach und ging wortlos zu einem Tisch in der letzten Ecke der Kneipe. Bertrand folgte ihm. Erst als sie saßen, verriet er Bertrand den Grund für das Treffen.
»Du kennst ja das Schloss«, begann er leise.
»Château Montagne? Klar, das kennt jeder hier. Warum?«
»Auch von innen?«
Bertrand schüttelte den Kopf. »Nein.« Er trank einen Schluck Bier und sah Antoine über den Rand des Glases hinweg an. »Woher auch? Was hab ich damit zu tun?«
Antoine gab eine ausweichende Antwort. »Nun, ich würde es gerne mal besichtigen.«
Sein Freund kniff die Augen zusammen. »Hä? Das ist bewohnt und kein Museum. Wenn es dich so sehr reizt, dann geh einfach mal hin und ...«
»Du kapierst nicht«, zischte Antoine. »Es soll nicht unbedingt jeder wissen, dass ich dort war.«
Bertrand blies die Backen auf und ließ langsam die Luft entweichen. »Ich glaube, jetzt verstehe ich. Du willst da einsteigen.«
»Nicht so laut«, flüsterte Antoine und sah sich um, ob sie jemand belauschte. Der Zecher schlief nach wie vor, und der Wirt polierte hinter der Theke mit einer solchen Hingabe seine Gläser, dass Antoine fast glaubte, er wolle damit einen Preis gewinnen.
Bertrand beugte sich vor. »Was hast du vor?«, fragte er leise.
»In so einer Hütte gibt es sicher einiges zu holen. Wahrscheinlich sogar so viel, dass es gar nicht auffällt, wenn ich mir ein bisschen was davon ausleihe.«
Bertrand schüttelte den Kopf. »Verkauf mich nicht für dumm, Antoine. Dafür kenn ich dich zu gut. Wenn du so etwas planst, dann weißt du mehr. Also?«
Antoine grinste. Vielleicht hatte er sich doch nicht in Bertrand getäuscht.
»Also gut. Es soll da ein wertvolles Amulett geben. Mein Vater hat davon gesprochen.«
»Und wo hat er sein Wissen her?«
»Vom Butler.«
Bertrand sah nicht überzeugt aus. »Ist das alles, was du weißt? Reichlich dürftig.«
Antoines Gesicht verschloss sich wie eine Auster. »Was willst du denn noch hören? Es gibt das Amulett. Der Butler hat es meinem Vater vorgelegt, weil der sich mit alten Schriften und Zeichen auskennt. Er sollte die Zeichen darauf deuten, es ist ihm nicht gelungen.« Antoine zuckte mit den Schultern. »Ist ja auch egal. Wichtig ist nur, es soll aus Silber sein und sehr wertvoll gearbeitet. Mehr brauch ich nicht zu wissen.«
Bertrand nahm sein Glas und trank es aus. »Du vielleicht nicht. Ich schon.«
»Dann bist du nicht dabei?«
»Mann, Antoine! Glaubst du, du kannst da einfach so reinmarschieren? In ein Schloss? Da gibt es sicher eine Alarmanlage. Oder einen Burggraben mit hochgezogener Zugbrücke. Und am Ende stecken sie dich ins Verlies, und du bist für alle Zeiten verschwunden.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, mein Freund. Ich bin raus.«
»Dein letztes Wort?«
Bertrand nickte. »Mein allerletztes.«
Antoine kniff die Lippen so fest zusammen, dass sie nur noch einen Strich bildeten. »Gut, dann verschwinde. Und vergiss besser, über was wir hier gesprochen haben, sonst ...«
»Du brauchst mir nicht zu drohen, Antoine. Ich verpfeif dich schon nicht. Du konntest dich immer auf mich verlassen, das weißt du. Das Ding ist mir eine Nummer zu groß.«
Antoine winkte ab. »Schon gut.«
Bertrand schickte sich an, den Tisch zu verlassen. Weit kam er nicht, denn Antoine hielt ihn am Handgelenk fest.
»Was denn noch?«
»Das Bier ging auf dich.«
Bertrand schüttelte den Kopf, holte aber ein paar Münzen aus der Jackentasche, die er auf den Tisch fallen ließ. Erst dann ließ Antoine ihn los. Stumm sah er dem Freund nach, enttäuscht über dessen Entscheidung.
Sieh es positiv! Dann brauchst du auch nicht zu teilen!
Mit flinken Fingern zählte er die Münzen ab, dann grinste er. Es reichte tatsächlich noch für ein weiteres Glas. Er hob das leere an und winkte damit zum Tresen. Kurz darauf stand ein volles vor ihm auf dem Tisch.
Also dann, prostete er sich in Gedanken zu. Auf eine erfolgreiche Nacht!
Früher ...
Der Klang, wenn das harte Metall des Werkzeugs auf den kaum weniger harten Felsen traf, und das Stöhnen und Ächzen der Männer verschmolz zu einer Melodie der Qual. Minute um Minute, Stunde um Stunde, erklang dieses Lied. Auch wenn Zeit hier unten mehr und mehr an Bedeutung verlor.
Es gab keinen Sonnenauf- oder -untergang für diejenigen, die hier ihr Dasein mit harter Arbeit fristeten. Einzig der Erhalt ihrer kargen Rationen ließ einen Schluss darauf zu, welche Tages- oder Nachtzeit gerade herrschen mochte.
Abgestandenes Wasser stand in Holzeimern bereit, denn man wollte ja nicht, dass die Männer starben. Auch wenn ihr Leben im Grunde nichts mehr wert war. Zum wiederholten Male dachte Gawain genau das, als er die von Schwielen übersäten Hände zu einer Schale zusammengelegt in den Eimer tauchte. Das Wasser schmeckte, als hätte es schon mal ein Pferd getrunken, aber der Durst war noch schlimmer.
Schlurfende Schritte näherten sich ihm von hinten. Er brauchte nicht aufzusehen, der Klang allein reichte ihm, um seinen Kameraden Nouel zu erkennen. Bereitwillig machte er ihm Platz, damit auch er seinen Durst stillen konnte.
Nouel führte die gefüllte Hand zum Mund und trank. Einen Teil spuckte er gleich wieder aus. »Es ist einfach widerlich!«
Gawain zuckte nur mit den Schultern. Es war müßig, darüber zu klagen. »Wenn es dir nicht gefällt, hau einfach ab!« Er zeigte auf Nouels Füße, die ihn Lederschuhen steckten, die wie ihr Träger schon bessere Tage erlebt hatten.
»Nur weil wir keine Ketten tragen, können wir noch lange nicht einfach davongehen, Gawain!«
Damit hatte Nouel zweifelsfrei recht. Das heißt, sie hätten es tun können. Nur wäre dann ihr Leben verwirkt gewesen. Einige hatten es versucht, das wusste Gawain. Am Tag danach hatte man ihre toten Leiber hier unten im Berg gefunden. Das Antlitz zu einer Fratze der Furcht erstarrt, der Körper mit Wunden übersät, eine schlimmer als die andere.
Nein, egal wie schlimm es ihm auch ging, Gawain hing an seinem bisschen Leben. Und was immer den Flüchtenden zugestoßen war, er wollte es gewiss nicht erfahren.
»Kommt endlich wieder arbeiten, ihr zwei!«, rief Hamo, den es nicht zum Wassereimer getrieben hatte. Manchmal fragte Gawain sich, wie Hamo mit dem bisschen, das er zu sich nahm, überlebte. Vermutlich brauchte sein hagerer Körper nicht mehr.
»Wir kommen ja schon«, sagte Nouel und drehte sich um.
Gawain folgte ihm zu der Stelle, die sie zu dritt bearbeiteten. Auch während ihrer kurzen Unterbrechung war es nicht still geworden, denn im Berg arbeiteten unzählige Männer. Gawain konnte nicht zählen, er schätzte, dass es Dutzende waren, vielleicht sogar Hunderte. Auch wenn er hätte zählen können, war es nicht ganz leicht, einen Überblick darüber zu behalten, denn ständig wechselten die Gesichter. Im gleichen Rhythmus, wie Männer starben – und das waren nicht wenige! – tauchten neue auf. Man erkannte sie daran, dass sie noch Hoffnung in den Augen hatten. Nach und nach erlosch die Flamme bei jedem. Bei dem einen früher, bei dem anderen später.
Auch Gawain hatte zuerst geglaubt, schon irgendeinen Ausweg zu finden. Schnell hatte er gemerkt, dass er jegliche Hoffnung begraben musste. Sein Freund Nouel zeigte den gleichen trüben Blick. Einzig in Hamos Augen leuchtete noch ein Rest Zuversicht.
Eine Zeitlang schlugen er, Nouel und Hamo mit den schweren Hämmern gegen den Fels und trieben den Gang weiter voran. Würde der Bereich, in dem sie standen, nicht mehr und mehr von kleinen, abgeschlagenen Steinen gefüllt, wäre gar kein Fortschritt zu erkennen.
Das, was sie dem Berg abtrotzten, verluden sie in Eimer. Andere sorgten dafür, dass der Schutt abtransportiert wurde.
Hamo ließ den Hammer sinken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Ausdünstungen der Männer vermischten sich mit dem Geruch dessen, was sie ausschieden. Gawain fragte sich oft, warum sie nicht erstickten.
»Ich halt das nicht mehr aus!«, fluchte Hamo.
»Dennoch solltest du weiterarbeiten«, zischte Nouel und ließ den Hammer herabfahren. Kleine Gesteinsplitter wirbelten davon und trafen Gawain im Gesicht. Die kleinen Verletzungen spürte er schon kaum noch, so unzählig kamen sie vor.
»Warum? Es ist eine sinnlose Arbeit. Nur geschaffen, um uns zu Grunde zu richten!«, erregte Hamo sich weiter.
»Sei still!«, fuhr Gawain ihm dazwischen.
»Es stimmt. Heute treiben wir den Gang in die Richtung weiter. Und morgen? Morgen geht er in eine andere!«
Bei Hamos Worten ließ Nouel das Werkzeug sinken. »Was meinst du damit?«
»Hast du es etwa nicht bemerkt?«
Gawain wusste, worauf Hamo anspielte. Tatsächlich war es so, dass die Tunnel über Nacht die Richtung wechselten. Wie von Geisterhand. Es musste ein dunkler Zauber sein, der das bewirkte. Ein Grund mehr, darüber nicht zu reden.
»Schweig, Hamo!
»Und wenn...«, begehrte der Leidensgenosse auf.
»Du hast ja recht. Ich habe es auch bemerkt. Trotzdem ist das etwas, worüber man kein Wort verlieren sollte. Glaube mir, es ist besser. Für uns alle. Und für unser Seelenheil.«
Er hatte beschwörend geklungen, den jungen Heißsporn, der erst einige Tage hier die Fronarbeit verrichtete, aber noch nicht überzeugt.
»Wie kannst du das nur so hinnehmen, Gawain? Und du, Nouel? Ich kenne euch, ihr wart immer gottesfürchtige Männer. Und das hier ist Teufelswerk. Es ist der ...«
»Schweig endlich! Nenne seinen Namen nicht.«
Gawain wusste, dass der jüngere Mann nur einen gemeint haben konnte. Nicht den Teufel selbst, aber jemanden, der ihm sehr ähnlich schien. Ihr Dienstherr, wie er sich selbst nannte. Sklavenhalter passte besser. Sein Name war Leonardo deMontagne, wusste Gawain. Er beabsichtigte hier im Loire-Tal ein Bauwerk zu errichten, in dem er fortan leben wollte. Gawain wäre es lieber, wenn er weit fort von hier sein Dasein fristen würde. Dann würde ihm und den anderen Männern diese Arbeit erspart bleiben.
Hamo schüttelte den Kopf. »Ob ich ihn nenne oder nicht, das hat keine Bedeutung. Fest steht nur eins, wenn wir nicht fliehen, werden wir hier umkommen.«
Gawain zuckte resigniert mit den Schultern. »Versuch es. Ich halte dich nicht auf. Ich werde dich auch nicht begleiten.«
»Und du, Nouel?«
Der Angesprochene zögerte.
»Sollen wir denn unser restliches kurzes Leben hier unten verbringen?«, bohrte Hamo weiter in der offenen Wunde.
Nouel schüttelte den Kopf. »Ich will mein Leben nicht in diesen Gewölben verlieren«, sagte er leise.
Gawain wollte seine Freunde gerade davor bewahren, sich noch weiter in Schwierigkeiten zu begeben, indes es war zu spät.
»Oh, keine Sorge, meine Freunde!«, rief jemand hinter ihnen.
Gawain wirbelte herum und zuckte zusammen. Nur drei Schritte hinter ihnen stand Leonardo deMontagne!
Der baldige Burgherr zeigte ein diabolisches Lächeln, das seine Augen nicht erreichte.
»Herr, wir ...«, setzte Gawain an. DeMontagne unterband seinen Versuch mit einer heftigen Handbewegung.
»Da komme ich hier herunter, weil ich mich um euch sorge und auch, weil ich den Fortschritt eurer Bemühungen begutachten möchte, und was muss ich hören? Ihr fühlt euch nicht wohl? Ihr möchtet gehen und mich verlassen? Mich, der ich euch Arbeit gegeben habe? Der ich euch hier unten mit Speis und Trank versorge?«
Bei seinen letzten Worten spielte er wie beiläufig mit den Fingerspitzen im Wassereimer, der auf einem Metallgestell stand. Als ihm niemand antwortete, warf er ihn um.
Gawain zuckte zusammen. Er fragte sich, wie lange deMontagne schon hinter ihnen gestanden hatte.
»Habt ihr nichts zu sagen?«, bohrte der Adelige nach. »Gerade eben wart ihr noch so redselig. Ihr habt von eurem kurzen, bedeutungslosen Leben gesprochen. Und dass ihr es nicht hier unten verlieren wollt.«
»Herr, wir ...«, setzte Gawain erneut an.
Leonardo ließ ihn wieder nicht zu Wort kommen. »Ach, ihr braucht gar nichts sagen. Es ist alles gut. Ja, wirklich.« Seine Stimme hatte einen einschmeichelnden Klang bekommen. Das änderte sich bei dem nächsten Satz. »Und ich verspreche euch, dass ihr euer Leben nicht hier unten verlieren werdet. Niemals!«
Dann begann er zu lachen. So laut und böse, dass es klang, als hätten die in den Fels getriebenen Gänge den Zugang zur Hölle freigelegt und als würden die Bewohner der Unterwelt mit in das Lachen einstimmen.
Gawain lief ein eiskalter Schauer den Rücken hinab. Er sah seinen Kameraden an, dass es ihnen ebenso erging.
Mit Sicherheit hatte deMontagne eher eine Teufelei im Sinn, als ihnen etwas Gutes zu tun. Nur was es war, darauf wäre Gawain bei allem Nachdenken auch in einer Ewigkeit nicht gekommen.
Und dabei stand ihm genau diese Zeitspanne zur Verfügung ...
Den Rest des Tages hatten Gawain, Nouel und Hamo schweigend weitergearbeitet. Leonardo deMontagne war lachend gegangen, er hatte ihnen nichts getan. Dennoch wollte sich bei Gawain kein gutes Gefühl einstellen. Er glaubte nicht, dass die Sache kein Nachspiel haben würde.
Er hat gesagt, das alles gut wäre, gingen ihm die Worte des Burgbesitzers durch den Kopf. Immer wieder hatte er sich die Szene ins Gedächtnis gerufen. Doch das Lachen, das er folgen ließ, konnte er nicht ausblenden. Es klang hinterhältig und böse.
»He, Gawain«, zischte Hamo ihm zu.
Es waren die ersten Worte, die einer der drei seit Stunden sagte.
Gawain sah sich erst um, ob nicht jemand in ihrer Nähe war, der sie belauschte. Er konnte niemand entdecken.
»Was denn?«
»Heute Nacht haue ich ab. Kommst du mit?«