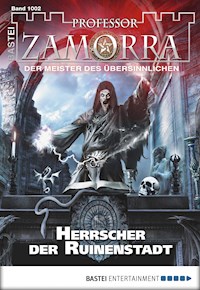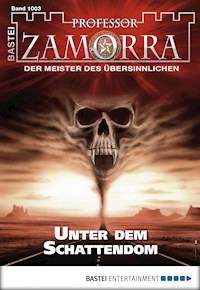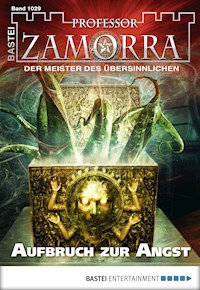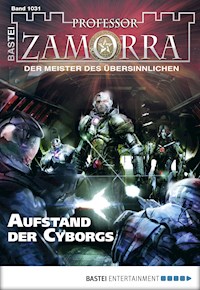1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
"Die Meisterin hat uns nicht erhört." Die Worte des schwarzhaarigen Mannes hallten wie Donnerschlag durch die nächtliche Kathedrale. Wer ihn sah, hätte in dem äußerlich etwa Fünfunddreißigjährigen niemals den neuen Bürgermeister New York Citys vermutet. Und doch war er es. "Vielleicht ist mehr Blut nötig", überlegte Finn Cranston. Ein abschätziges Lächeln umspielte seine Lippen. Als er den Körper der nackten Frau betrachtete, die er zuvor auf dem Kirchenboden abgelegt hatte, glühten seine Augen rot auf. An Blut bestand in dieser Stadt wahrlich kein Mangel! Wenn der Frau mit den ledernen Schwingen danach gelüstete, so sollte sie es bekommen. Finn Cranston zückte seinen Obsidiandolch und versenkte ihn grinsend in der Kehle der Bewusstlosen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Sterbende Welt
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Kalwitz / Luserke
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-8387-4894-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sterbende Welt
Von Oliver Fröhlich und Michael Breuer
»Die Meisterin hat uns nicht erhört.«
Die Worte des schwarzhaarigen Mannes hallten wie Donnerschlag durch die nächtliche Kathedrale.
Wer ihn sah, hätte in dem äußerlich etwa Fünfunddreißigjährigen niemals den neuen Bürgermeister New York Citys vermutet. Und doch war er es.
»Vielleicht ist mehr Blut nötig«, überlegte Finn Cranston. Ein abschätziges Lächeln umspielte seine Lippen. Als er den Körper der nackten Frau betrachtete, die er zuvor auf dem Kirchenboden abgelegt hatte, glühten seine Augen rot auf.
An Blut bestand in dieser Stadt wahrlich kein Mangel! Wenn der Frau mit den ledernen Schwingen danach gelüstete, so sollte sie es bekommen.
Finn Cranston zückte seinen Obsidiandolch und versenkte ihn grinsend in der Kehle der Bewusstlosen.
Phoenix, Arizona
Das Quietschen von Reifen ließ Matt Dunston aus dem Schlaf hochschrecken. Er blinzelte. Als sich seine Sicht klärte, erblickte er einen nachtschwarzen Chevrolet Camaro, der sich in einer gewaltigen Staubwolke seiner Tankstelle näherte. Wahrscheinlich kam er aus Phoenix.
»Na, da hat es wohl jemand sehr eilig«, murmelte Dunston. Ganz im Gegensatz zu ihm selbst.
In aller Gemütsruhe beobachtete Dunston, wie der Camaro neben den Zapfsäulen anhielt. Die grelle Mittagssonne spiegelte sich in der Frontscheibe des Fahrzeugs.
Der sonnengegerbte Tankstellenbesitzer musterte den Sportwagen merklich unbeeindruckt. Matt Dunston war 55 Jahre alt. Das Leben hatte tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben. Schnelle Autos beeindruckten ihn nicht mehr. Davon hatte er im Laufe der Jahre schon zu viele gesehen.
Der Fahrer des Sportwagens stoppte den Motor und blieb hinter dem Lenkrad sitzen. Offenbar wartete er auf Bedienung.
Endlose Sekunden geschah nichts. Matt Dunston saß auf der Bank vor seiner Tankstelle und musterte den schwarzen Camaro. Dann griff er zwischen seine Füße. Dort hatte er vor seiner kleinen Siesta eine mittlerweile lauwarme Dose abgestellt.
Dunston ließ sich den letzten herzhaften Schluck durch die Kehle rinnen und rülpste vernehmlich. Jetzt erst erhob er sich.
»Was kann ich für Sie tun, Mister?«, fragte er, nachdem er sich der Fahrerseite des Wagens genähert hatte.
Er war sich nicht sicher, ob ihn der dunkelhaarige Mann hinter dem Lenkrad überhaupt wahrgenommen hatte, dann fuhr dieser jedoch die Scheibe herunter. Ein stechender Schwefelgeruch drang aus dem Inneren des Wagens.
»Ein Mexikaner?«, fragte sich Dunston. Der dunkle Teint des Mannes schien eine solche Herkunft nahezulegen.
Der Fahrer des Camaros blickte ihn aus dunklen, glühenden Augen an und strich sich mit einer Hand über den dichten Schnurrbart.
»Volltanken«, knurrte er dann knapp. Um seine Laune schien es nicht zum Besten zu stehen.
Dunston stieß ein leises Seufzen aus. So einer hat mir gerade noch gefehlt!
Trotz des unwirschen Befehlstons machte er sich ans Werk. Während Dunston mit routinierten Handbewegungen den Camaro volltankte, stieg dessen Fahrer doch noch aus. Der dunkelhaarige Schnauzbartträger ließ die Gelenke seiner Fingerknöchel knacken und streckte die Glieder.
»Wohl schon ein Weilchen unterwegs, was?«, fragte der Tankstellenbesitzer beiläufig. Eigentlich war ihm die Lust auf Small Talk vergangen, aber die eingetretene Stille passte ihm ebenso wenig.
»Das können Sie laut sagen!«, gab der Andere zurück. Immer noch klang er knurrig, aber immerhin nicht mehr ganz so unfreundlich. »Ich bin ganz schön rumgekommen in letzter Zeit«, fügte er an und ließ ein leises Lachen hören, das auf subtile Weise bösartig klang. Dunston nahm den Unterton genau wahr und runzelte die Stirn.
»Es gibt einiges zu tun«, ließ der Fahrer des Camaros wissen. »Jetzt wird richtig aufgeräumt!«
Fast schien es Dunston, als wolle sich der Andere etwas von der Seele reden. Gespannt spitzte er die Ohren, aber der ominöse Satz blieb in der Luft hängen, ohne dass der Dunkelhaarige weitersprach. Stattdessen entzündete er sich fast beiläufig ein Zigarillo.
Dunston wollte ihn auf das Rauchverbot an der Tankstelle hinweisen, aber die Worte blieben ihm im Halse stecken, als ihm der Rauch des Zigarillos ins Gesicht wehte.
»Herrgottnochmal«, fluchte er angesichts des bestialischen Gestanks. »Was ist das denn für ein Teufelskraut?«
Der Fahrer des Camaros zischte, sodass Dunston unwillkürlich zusammenzuckte. Er blickte den Schnauzbartträger an.
»Nennen Sie nicht diesen Namen«, knurrte dieser.
Gott?, wollte Dunston fragen, biss sich aber wohlweislich lieber auf die Zunge. Offenbar ein Irrer, dachte er stattdessen. Natürlich, heute ist Montag!
An Montagen waren die Kunden, die seine Tankstelle frequentierten, immer etwas spezieller. Das mochte dem Wochenanfang geschuldet sein, wofür Dunston sogar ein gewisses Verständnis aufbrachte.
Der Camaro-Fahrer paffte genüsslich an seinem Zigarillo. Sein Gesicht verschwand fast völlig hinter einer dichten Rauchwolke. Nur die Augen stachen hervor wie glühende Kohlenstücke. Dunston begann sich unwohl in seiner Haut zu fühlen.
Momentan schien die ganze Welt ein Irrenhaus zu sein. Man musste sich nur einmal ansehen, was in der Alten Welt los war! Glaubte man den Nachrichten, ging Europa gerade vor die Hunde. Dunston gab normalerweise nicht viel auf das Weltgeschehen außerhalb der USA, aber momentan überschlugen sich die Meldungen. Es war von nicht näher definierten Todeszonen die Rede. In Frankreich hatte es Paris und Lyon erwischt. Deutschland und Schottland waren ebenfalls betroffen. Dunston glaubte den Medien natürlich kein Wort. In Wirklichkeit, da war er sich ganz sicher, war die Lage gewiss noch viel schlimmer.
Dass der Normalbürger nur die halbe Wahrheit erfuhr, das stand für den alternden Tankstellenbesitzer nämlich fest.
Dunston hängte den Schlauch zurück in die Halterung der Zapfsäule. »Kann ich sonst noch etwas Sie tun, Mister?«, fragte er.
Es schien immer heißer zu werden. Dunston wischte sich über die Stirn. Der Andere schien völlig hinter der Rauchwolke seines Zigarillos zu verschwinden.
»Dios«, stellte er sich unerwartet vor, »Sam Dios!«
»Und jetzt putzen Sie die Frontscheibe«, fügte er gleich darauf an, »aber pronto! Ich habe noch viel vor heute.«
Unbehaglich schlurfte Dunston los, um Wasser und Lappen zu holen. Dann machte er sich ans Werk.
Der Rauch verzog sich ein wenig. Auf den Lippen des Camaro-Fahrers war ein abschätziges Lächeln zu erkennen, als er beobachtete, wie sich Dunston an der völlig verdreckten Scheibe abmühte. Der Tankwart konnte die stechenden Blicke in seinem Rücken wie Feuerlanzen spüren.
Als Dunston sein Werk beendet hatte, blinkte die Frontscheibe des Camaros förmlich.
»Recht so, Mister Dios?«, fragte er.
»Sehr schön«, gab der Schnauzbartträger zurück. Er nestelte an seinem Jackett und zog eine lederne Geldbörse hervor. Dann drückte er dem ältlichen Tankwart einen Geldschein in die Hand.
»Das kann ich nicht wechseln«, brachte Dunston krächzend hervor, als er die Dollar-Note betrachtete.
Ein Madison-Porträt!
Es gab nur eine Banknote, auf der das Gesicht von James Madison, des vierten Präsidenten der USA, prangte und diese hielt Dunston soeben in der Hand.
Er sah noch einmal hin und blinzelte, aber der Geldschein in seiner Hand blieb derselbe.
Fünftausend Mäuse, mein lieber Schwan!
Die entsprechende Banknote wurde in heutigen Tagen nicht mehr ausgegeben, war aber durchaus weiterhin legales Zahlungsmittel. Persönlich hatte Dunston noch nie einen 5000-Dollar-Schein zu Gesicht bekommen. Er fragte sich, ob er gerade einem üblen Scherz aufsaß, und hielt es für ziemlich wahrscheinlich, dass man ihm eine Blüte in die Hand gedrückt hatte.
Leise lachend stieg Dios wieder in seinen Camaro. Er startete den Wagen und ließ den Motor aufheulen.
Stammelnd stolperte der Tankwart um das Fahrzeug herum. »Das ist nicht ihr Ernst, Mister Dios«, brachte er hervor.
»Doch«, lachte dieser gallig. »Behalten Sie den Rest ruhig. Aber beeilen Sie sich mit dem Ausgeben, die Welt geht nämlich bald unter!«
Wieder ließ Dios den Motor aufheulen und deutete dabei mit dem Daumen über seine Schulter.
Als Dunston in die entsprechende Richtung blickte, wurde ihm eiskalt. Über Phoenix hing eine pechschwarze Rauchwolke, die die Stadt völlig einhüllte. Unwillkürlich musste der Tankwart an die Todeszonen in Europa denken.
Dann trat Dios auf das Gaspedal. Mit quietschenden Reifen startete er durch und lenkte den Camaro in einer gewaltigen Staubwolke zurück auf den Highway.
Während sich der Sportwagen entfernte, war das gellende, wahnsinnige Lachen des unheimlichen Fahrers zu hören. Keinerlei Fröhlichkeit schwang darin mit.
Wieder blickte Dunston zurück in Richtung Phoenix.
Mit einem Mal war er sich ganz sicher, dass ihm tatsächlich nicht mehr allzu viel Zeit bleiben würde, sich über seinen neuen Reichtum zu freuen.
***
Silbermond
»Wir müssen leise sein«, flüsterte Uschi Peters.
Die langbeinige Blondine warf ihrer Zwillingsschwester einen warnenden Seitenblick zu. Monica nickte knapp. Schließlich wollten sie die Anderen nicht aufwecken.
Gemeinsam schlichen die beiden Frauen durch die Dunkelheit des nächtlichen Silbermonds. Erst vor wenigen Minuten hatten sie das ihnen zugewiesene Organhaus verlassen, um sich auf den Weg zu machen.
Während sie sich stetig auf ihr Ziel zubewegten, hing Monica ihren Erinnerungen nach. Die zurückliegenden Geschehnisse und Enthüllungen hatten sie förmlich überrollt. Sie waren in Florida von Anka aufgesucht worden. Die Frau, die äußerlich viel jünger als die Zwillingsschwestern wirkte, hatte ihnen Unglaubliches enthüllt.
Bei Anka handelte es sich nämlich um die Mutter der beiden Frauen.
Für Monica und Uschi war diese Eröffnung ein Schock gewesen. Es gab jedoch keinen Grund, an ihrer Erzählung zu zweifeln. Endlich hatte alles einen Sinn ergeben …
Aber das Glück, endlich die lang vermisste Mutter gefunden zu haben, war nur von kurzer Dauer gewesen.
Anka führte die beiden Frauen und Uschis Sohn Julian nach Roanoke Island, wo sie auf Dylan McMour trafen, der sich mit einigen Menschen unter einer von ihm geschaffenen Schattenkuppel verbarg. Wie sich herausstellte, hatte sich nämlich auch Roanoke zu einem der sogenannten Black Spots entwickelt.
Etwas später trafen auch Zamorra und Nicole Duval ein, die Dylan und den Eingeschlossenen zu Hilfe eilen wollten.
Gemeinsam trotzten die Gefährten einem Angriff der überraschend aufgetauchten Stygia. Dabei war das Furchtbare geschehen – im Kampfgetümmel hatte sich Anka in ihre zwei Persönlichkeiten Anne und Kathryne aufgespalten. Ankas böse Hälfte attackierte die ehemalige Ministerpräsidentin der Hölle, die sich das erwartungsgemäß nicht bieten ließ. Anne und Kathryne starben im magischen Blitzgewitter Stygias.
Mit knapper Not war es Zamorra derweil gelungen, ein Weltentor zum Silbermond zu öffnen und die Eingeschlossenen hindurchzuschleusen. Der Kraftaufwand für den Parapsychologen war immens gewesen. Die ganze Aktion hätte Zamorra um ein Haar umgebracht. Immer noch erholte er sich von den Strapazen. Sein magisches Amulett, mit dessen Hilfe er das Tor geöffnet hatte, speiste sich nämlich aus seiner eigenen Kraft. Das Weltentor aufrecht zu erhalten und gleich eine ganze Gruppe von Menschen hindurch zu befördern, war fast zu viel für ihn gewesen.
Neben dem Team um Zamorra war lediglich einer Handvoll Menschen die Flucht von der Insel geglückt. Sie alle hatten hier, auf dem Silbermond, nun ein vorübergehendes Exil gefunden.
Bald jedoch würde die ganze Gruppe zur Erde zurückkehren. Spätestens, wenn Zamorra wieder auf den Beinen war, stand die Stunde des Abschieds an.
Zuvor lag jedoch noch ein ganz anderer Abschied vor den beiden Frauen.
»Hier drüben«, wisperte Uschi und deutete geradeaus. »Gleich sind wir da!«
Monica nickte. Sie hatte gerade dasselbe gedacht. Natürlich!
Die Zwei, die eins sind, so hatte man die Schwestern stets genannt. Nicht ohne Grund, abgesehen von ihrem identischen Äußeren waren Monica und Uschi unzertrennlich und dachten zumeist in den gleichen Bahnen.
Und sie alterten nicht.
Bis jetzt hatten die Zwillinge diesen Umstand auf ein Ereignis im Jahr 1983 zurückgeführt. Damals waren sie zusammen mit Ted Ewigk in einem Dorf namens Glenstairs im schottischen Hochmoor gewesen, wo sie den sagenumwobenen Laird u’Coulluigh Mac Abros, den 17. Earl of Glenstairs, besucht hatten. Dort kam es zu einer Verkostung seines sogenannten Lebenswassers, das in Gestalt eines schwarzgebrannten Whiskys daherkam. Seit jener Stunde waren Monica und Uschi relativ unsterblich. Dass ihre Langlebigkeit möglicherweise eine ganz andere Ursache haben könnte, hatten sie zwar geahnt, aber niemals eine bessere Erklärung zur Hand gehabt und deshalb dieses Märchen all ihren Freunden aufgetischt.
Was für eine schöne Lebenslüge!
Nun waren sie schlauer.
Denn niemand anderes als Anka Crentz war ihre Mutter.
Die Zwei, die eins sind – in gewissem Sinne traf diese Bezeichnung auch auf Anne und Kathryne, also Anka, zu. Durch ein Experiment des Dämons Krychnak vor über zweitausend Jahren war ein Double von Kathryne erschaffen worden, nämlich Anne. Ihre beiden Körper verschmolzen. Außerdem war ein Teil von Krychnaks Regenerationsmagie in sie übergegangen, wodurch die auf diesem Wege neu erstandene Anka unsterblich wurde. Das hatte sich offenbar auch auf ihre Töchter ausgewirkt.
Aber nun war Anka tot, ermordet durch Stygia. Und den Peters-Schwestern blieb nur noch die traurige Aufgabe von ihrer gerade erst wiedergefundenen Mutter Abschied zu nehmen.
»Komm schnell!«
Uschis geflüsterte Aufforderung riss Monica aus ihren Gedanken. Auf ihren Wink hin folgte sie der Schwester ins Innere des Organhauses, in dem man die entsetzlich zugerichteten Körper von Anne und Kathryne aufgebahrt hatte.
Monica sog den Atem scharf ein. Der Anblick war nichts für schwache Nerven. Natürlich hatte sie gewusst, was sie erwartete, denn schließlich war sie Zeuge von Stygias Angriff gewesen. Dennoch fühlte sie ein leichtes Gefühl der Übelkeit in sich aufwallen. Tränen schossen ihr in die Augen. Wie eine Schlafwandlerin nahm sie neben Anne Platz, während auf der anderen Seite Uschi in die Knie ging, um Kathryne sanft über die verbrannte Stirn zu streicheln.
Mit feuchten Augen blickte Monica auf die beiden toten Körper, dann ruckte ihr Kopf hoch. Sie spürte Uschis stechenden Blick. Minutenlang blickten sich die beiden Schwestern an.
Und in diesem Moment blitzte eine Szene aus Ankas Erzählung vor Monicas geistigem Auge auf. Die Schilderung war so plastisch gewesen, als habe sie das Ganze selbst miterlebt.
»Du bist nicht die Richtige, die Kinder zu erziehen«, flüsterte Merlin Kathryne zu. Der Weißbärtige war unmittelbar nach der Geburt der Zwillinge aus dem Nichts erschienen. »Das wäre zu gefährlich!«
Er ging zu der regungslos daliegenden Anne, packte sie an der Hand und zerrte sie ohne Rücksichtnahme auf ihren Zustand zu Kathryne. Dann legte er Annes Hand in die von Kathryne, verschränkte ihre Finger und lächelte wieder.
»Alles wird gut«, sagte er.
Anne und Kathryne verschmolzen durch Merlins Magie wieder zu Anka, während dieser die Kinder einer anderen Familie unterschob, wo sie unbelastet von ihrem Erbe aufwachsen konnten.
Alles wird gut.
Was für ein Hohn!