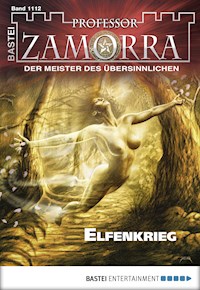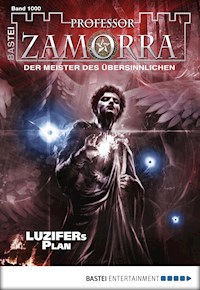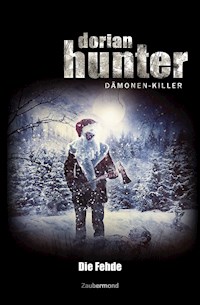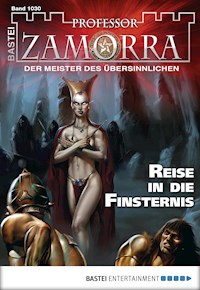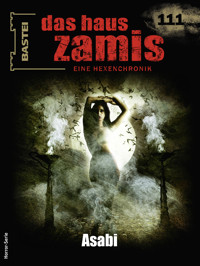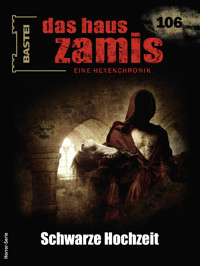1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
In Meersbrug am Bodensee verschwinden junge Frauen. Aber was auf den ersten Blick eher wie ein Krimi aussieht, entpuppt sich für den Professor und seine Gefährtin Nicole schon bald als Ausflug in ein selbst ihnen noch neues Reich. Was haben Elfen damit zu tun? Welche Rolle spielt das alte Grimoire, das an der Yale-Universität plötzlich verschwindet? Und wer steckt hinter dem Hexenzirkel, der am Bodensee sein Unwesen treibt ...?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Voynich-Manuskript
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Frank Fiedler / Rainer Kalwitz
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-3725-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das Voynich-Manuskript
von Adrian Doyle
Asmodis starrte finster auf die Skyline New Yorks, die sich im abendlichen Gegenlicht als scharfer Schattenriss präsentierte.So kann das nicht weitergehen,dachte der ehemalige Fürst der Finsternis und fixierte nun so angelegentlich seine Fingernägel, als enthielten sie die Lösung seines Problems.
Taten sie aber nicht, denn sein Problem – LEGION, der neulich aufgetauchte Superdämon – ging nicht mal auf eine Kuhhaut.Ich werde dich eliminieren, du Höllenhund, bevor du mir ernsthaft in die Quere kommst. Noch bist du nicht unbesiegbar. Auch du musst eine Achillesferse haben. Verlass dich drauf, ich finde sie. Und dann kriegst du von mir ein Rückreiseticket erster Klasse in den ORONTHOS.
Im Moment hatte er aber noch nicht mal die Ahnung einer Idee, wo er ansetzen sollte.
Yale-Universität, New Haven, Connecticut, USA
Das war ganz alleine mein Fehler. Ich muss zugeben, dass ich die Situation unterschätzt habe. Aber Adrian hat recht, ich hab’s in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben. Hm … Vielleicht sollte ich meine Zusage tatsächlich rückgängig machen. Ich werde mal mit Nathan reden, auch wenn er mir dafür sicher den Kopf abreißt. Aber wenn ich ihm reinen Wein einschenke, muss er mich einfach gehen lassen. Was tue ich aber, wenn er nicht darauf eingeht?
Dekanin Jane Tomasson seufzte schwer. Lustlos stocherte sie in ihrem Essen herum, während ihre linke Fußspitze unablässig einen nervösen Takt auf den Boden klopfte. Die zwei Bissen, die sie zu sich genommen hatte, reichten vollkommen aus. Mehr ließ der schmerzhafte Knoten in ihrem Magen nicht zu. Auch der Cappuccino, dessen Schaum langsam zusammenfiel, stand heute bestenfalls als Zierde auf dem kleinen Tischchen. Trotzdem, es war den Versuch wert gewesen, ein bisschen was Essbares zu sich zu nehmen. Immerhin hatte sie das seit über vierundzwanzig Stunden nicht mehr gemacht.
Tomasson schaute den Studenten zu, die sich an der Theke des Health Center Cafés drängten, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Im Meer ihrer Sorgen verschwammen sie zu einer anonymen Masse, ihre gewöhnlich scharfe Beobachtungsgabe setzte im Moment vollkommen aus. Auch der Geräuschpegel aus Gesprächen, Lachen, Geschirrklappern und leiser Musik blieb seltsam dumpf und einförmig.
An der Eingangstür erschien ein Mann und sah sich zögerlich um. Seine Kleidung zwang sie förmlich, ihn zu fixieren. Der Mann trug nämlich einen auffälligen weißen Anzug über einem roten Hemd und stach damit deutlich aus der Masse heraus. Das konnte man auch sonst von ihm behaupten. Er war in den Dreißigern, groß gewachsen und athletisch, wirkte sympathisch und sah unverschämt gut aus. Für einen Moment glaubte Tomasson, der Schauspieler Pierce Brosnan habe das Café betreten. Es gab tatsächlich starke Ähnlichkeiten, aber das war es dann auch schon.
Auch die Studenten, vor allem die weiblichen, gönnten dem Fremden mehr als nur einen Blick. Tomasson sah, wie zwei junge Frauen die Köpfe zusammensteckten, tuschelten und dann kicherten.
Der Fremde schien sein Ziel ausgemacht zu haben. Tomasson runzelte unwillkürlich die Stirn. Er kam genau auf sie zu, blieb vor ihr stehen und lächelte sie an. »Dekanin Tomasson?«
Mein Gott, was er für wunderbare Augen hat. Die sind ja tatsächlich grau. So einen Farbton habe ich noch nie gesehen … Jane Tomasson konnte ihren Blick nicht davon lösen.
»Mrs. Tomasson?«
Seine irritiert klingende Nachfrage brachte sie wieder in die Wirklichkeit zurück. Sie rang sich ein geschäftsmäßiges Lächeln ab. »Oh, entschuldigen Sie bitte, die bin ich, ja. Kann ich etwas für Sie tun?«
»Ich bin Professor Zamorra.« Er lächelte warm.
»Sie sagen das so, als müssten wir uns kennen. Tun wir das?«
Zamorras Lächeln gefror. »Nun, bis jetzt nicht persönlich, aber wir beide sind hier verabredet.« Seine Miene heiterte sich wieder auf. »Ah, ich verstehe, das sollte wohl ein kleiner Scherz sein. Und ich wäre beinahe darauf hereingefallen.«
Der Knoten in ihrem Magen verstärkte sich schlagartig. Sie kannte keinen Professor Zamorra und war dementsprechend auch mit keinem verabredet. Hier musste ein Irrtum vorliegen.
»Bitte entschuldigen Sie, Professor«, erwiderte Tomasson. »Ich wollte tatsächlich einen Scherz machen. Manchmal vergesse ich, dass das nicht bei jedem ankommt. Nehmen Sie doch Platz.«
Warum sage ich das? Bin ich plötzlich verrückt geworden?
»Danke, gerne.«
Panik machte sich in ihr breit, als er sich breit lächelnd zu ihr setzte und sie ansah. Wieder glaubte sie, in diesen wunderbaren Augen versinken zu müssen. Leidenschaft, Zärtlichkeit und Wärme, alles glaubte sie darin zu erblicken. Der Knoten in ihrem Magen verschwand schlagartig, stattdessen machte sich Erregung in ihr breit.
Wenn er mich mit in seine Wohnung nehmen würde, ich würde sofort mitgehen. Und dann … Oh Gott, was denke ich da?
Sie räusperte sich und hoffte, dass er ihre Gedanken nicht von ihrem Gesicht ablesen konnte. Unwillkürlich strich sie ihren Rock glatt. »Also, äh, haben Sie das Café gleich gefunden, Professor?«
»Ja, natürlich, Dekanin. Ihre Wegbeschreibung war so perfekt, da konnte ich mich gar nicht verirren.« Er sagte es so selbstsicher, dass sie an sich zu zweifeln begann.
Wann und wo soll ich dir das gesagt haben?, wollte sie ihn anschreien, zügelte sich aber im letzten Moment. »Das freut mich.«
Zamorra nickte. »Hören Sie, Dekanin, ich will Sie ja nicht drängen, aber ich habe wenig Zeit. Normalerweise hätte ich Sie für dieses große Entgegenkommen zum Essen eingeladen, das wäre das Mindeste gewesen. Na ja, ich verspreche Ihnen, dass wir das nachholen, wenn ich Ihnen das Voynich-Manuskript zurückbringe.«
Jane Tomasson riss die Augen auf. »Das … das Voynich-Manuskript?«, stammelte sie entsetzt, während eine Stressattacke ihren Körper durchtoste. Sie fühlte sich plötzlich entsetzlich schwach und konnte ein Zittern ihrer Hände nur dadurch vermeiden, dass sie sie fest auf den Tisch presste.
Niemand darf das Voynich mitnehmen. Nicht mal der Präsident der Vereinigten Staaten …
Zamorra sah sie erstaunt an. »Sie wirken gerade ein wenig derangiert, Dekanin. Ist etwas nicht in Ordnung?«
Tomasson lächelte verzerrt. »Doch, natürlich, alles in Ordnung, Professor. Ich bin im Moment nur ein wenig überlastet.«
»Kein Problem, das verstehe ich. Wollen wir dann gehen?«
Die Dekanin nickte. Wieder konnte sie sich kaum von seinen Augen lösen, als sie ihn anblickte. Ein ganzes Universum schien sich darin widerzuspiegeln.
Wie komme ich jetzt auf diesen blöden Gedanken?
Zamorra erhob sich und löste dadurch den Blickkontakt. Tomasson stand ebenfalls auf, ihre Verwirrung verschwand schlagartig. Sie konnte sich nun wieder an alles erinnern. Es war, als ob jemand eine dicke schwarze Wolke, die ihre Erinnerungen einhüllte, weggeblasen hätte. Natürlich hatte sie vorgestern zum ersten Mal mit Zamorra telefoniert und ihm dann gestern, nachdem sie sich über ihn kundig gemacht hatte, die Herausgabe des Original-Manuskripts versprochen. Professor Zamorra war absolut seriös, er würde das Buch richtig behandeln und es wieder zurückbringen. Seine Idee, die Schrift auf magischem Weg zu entschlüsseln, war schlichtweg genial.
Seite an Seite gingen sie über das riesige Universitätsgelände, dessen altehrwürdige Gebäude eine eigene kleine Stadt bildeten. Die Sonne brannte von einem wolkenlosen, tiefblauen Himmel, auf den weitläufigen Rasenflächen saßen Hunderte Studenten zum Lernen oder Picknicken.
»Entschuldigen Sie, Dekanin«, sagte Zamorra plötzlich, »ich will nicht aufdringlich erscheinen, aber Sie sehen aus, als ob Sie eine ganze Menge privater Sorgen hätten.«
Jane Tomasson schluckte ein paar Mal schwer. Sie blieb stehen und sah zum Harkness Tower hinüber. Dann nickte sie. »Sieht man mir das so deutlich an, Professor?«, fragte sie leise.
»Wenn Sie mich so fragen, ja. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen?«
Tomasson schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, aber dieses Problem muss ich alleine lösen.«
»Wollen Sie darüber reden?«
Nein! Warum habe ich mich überhaupt auf dieses Gespräch eingelassen? Das geht den Kerl doch gar nichts an!
Die Dekanin ging weiter. Dabei hielt sie den Kopf gesenkt. »Wissen Sie, mein Mann Adrian und ich waren die letzten zehn Jahre nicht mehr gemeinsam im Urlaub«, erzählte sie leise und schleppend. »Es ging nicht, mein Job ließ es einfach nicht zu.« Sie faltete ihre Hände und bewegte nervös die Finger. »Nun, ich … ich meine, wir haben uns deswegen oft gestritten, Adrian war sauer, er sagte immer, ich würde nur meinen Job kennen und sonst nichts. Er fühlte sich in den Hintergrund gedrängt und ein bisschen hatte er ja recht …«
»Ich verstehe.«
»Ja. Vor einem halben Jahr haben wir nun einen gemeinsamen Parisurlaub gebucht. Aber vor zwei Wochen kam Nathan Maloney auf mich zu …«
»Der Präsident von Yale.«
»Ja, genau … Nathan sagte, dass ich meinen Urlaub stornieren müsse. Er brauche mich unbedingt, weil in dieser Zeit wichtige Verhandlungen wegen einer geplanten Privatstiftung für unsere Universität stattfinden …«
»Und? Haben Sie storniert?«
»Ja. Aber … Adrian … mein Mann, er sagte, dass er auf jeden Fall nach Paris reise. Und er erwarte, dass ich wie geplant mitkomme. Wenn nicht, sei dies das Ende unserer Ehe, dann käme er nicht mehr nach Hause zurück.«
»Meint er es ernst?«
»Ja, ich befürchte es. Und ich könnte es sogar verstehen. Dieses … Ultimatum hat mir die Augen geöffnet, er hat mit allem recht, es war ein gewaltiger Fehler meinerseits, Nathan zuzusagen. Ich will meine Ehe nicht riskieren und werde deshalb Nathan bitten, mich von meinem Versprechen zu entbinden.«
Zamorra lachte leise. »Verstehe. Aber möglicherweise ist das eines der kleineren Probleme, die in nächster Zeit auf Sie zukommen werden.«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie werden es sehen, wenn es so weit ist.« Er blieb stehen. »Ah, da vorne, das muss die Beinecke Rare Book and Manuscript Library sein. Bisher kenne ich dieses famose Gebäude nur von Bildern.«
»Sie haben Recht, Professor, das ist sie. Dort haben wir unter anderem das Voynich-Manuskript untergebracht, das Sie gleich in Ihren Händen halten werden.« Jane Tomasson blickte nachdenklich auf den rechteckigen Betonklotz. Er stand im Zentrum des Universitätsgeländes und schützte den sechsstöckigen Turm mit Bibliotheksregalen, der das Herz der gesamten Bibliothek war, samt den weiteren dazugehörigen Räumen. Die Dekanin lauschte in sich hinein. Irgendetwas erschien ihr nicht richtig, ohne dass sie es wirklich hätte greifen können.
»Ich freue mich bereits darauf, Dekanin. Hm, haben Sie eigentlich freien Zugang zu sämtlichen Büchern und Manuskripten der Beinecke-Bibliothek?«
»Ja, ich bin schließlich die Hauptverwalterin hier.«
»Sehr schön. Dann wollen wir mal.« Zamorra rieb sich die Hände und lächelte sie an. Seine Augen strahlten nun heller als die Sonne. Jane Tomasson hätte sie am liebsten geküsst, so hingerissen war sie. In diesem Augenblick hätte sie alles dafür gegeben, in diesen Augen versinken zu dürfen.
Sie betraten die Bibliothek und damit eine Welt, die ausschließlich in diffuser, indirekter Beleuchtung und damit im ewigen Dämmerlicht existierte. Da sich der Professor in Tomassons Begleitung befand, kam er unkontrolliert durch alle Sicherheitseinrichtungen. Die meisten der überaus seltenen Werke, die hier versammelt waren, standen rundum in dem rund zwanzig Meter hohen viereckigen Regalturm, der von Glasscheiben geschützt wurde. Die Dekanin bemerkte, dass sich der Professor interessiert umschaute, und gab ihm einige Erläuterungen. Dann gingen sie durch einige spärlich besetzte Lesesäle und Katalogräume in die Ausstellungshalle. Das Bibliothekspersonal, das sich hier überall aufhielt, grüßte knapp und freundlich, es war Besucher gewohnt.
»Darf ich Ihnen kurz die Gutenbergbibel zeigen, Professor Zamorra?«, fragte Tomasson und deutete auf einen Schaukasten in der Mitte des Raumes. »Das Originalexemplar ist einer unserer größten Schätze und wird vom Bibliothekspersonal jeden Tag umgeblättert.«
»Ein anderes Mal gerne«, brummte der Professor. »Ich hab’s eilig, verstehen Sie?«
»Natürlich, das sagten Sie ja bereits.«
Mit ihrem Gast im Kielwasser durchquerte Jane Tomasson den Bürotrakt und stieg schließlich über eine breite Treppe in die Unterwelt; zwei Etagen der Bibliothek befanden sich unterirdisch. Die Dekanin betrat einen stark gesicherten Raum, dessen Tür sie nur mit Codekarte öffnen konnte. Indirekte Beleuchtung ging an. Sie nahm das auf dem kleinen Tisch liegende Voynich-Manuskript und überreichte es dem Professor. Der strich lächelnd über den braunen Ledereinband und ließ das Buch dann in einer Aktentasche verschwinden, die Tomasson zuvor noch gar nicht aufgefallen war.
»Bringen Sie es bitte heil wieder zurück«, legte sie dem Professor ans Herz. »Es ist wirklich von unschätzbarem Wert.«
»Versprochen.«
Sie gingen den Weg zurück. Außerhalb der Beinecke verabschiedete Jane Tomasson ihren Gast und bedauerte, dass sie seine Augen nun längere Zeit nicht mehr sehen würde.
So, jetzt muss ich noch einige dringende Sachen erledigen und dann rede ich mit Nathan … Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Erschrocken stellte sie fest, dass es bereits zehn Minuten nach zwei Uhr war. Über ihren schweren Gedanken war die Zeit im Health Center Café viel zu schnell verflogen. Ihr anberaumtes Gespräch im Saybrook College, einem von zwölf Colleges, aus denen die Yale-Universität bestand, begann in fünf Minuten. Das schaffe ich nicht, das ist zu weit … Sie kramte ihr Mobiltelefon aus der Handtasche, wählte die Nummer des Sekretariats und kündigte ihre Verspätung an.
Das Gespräch verlief zufriedenstellend. Gerade, als Jane Tomasson das Saybrook College wieder verließ, klingelte ihr Mobiltelefon. Nathan Maloney stand auf dem Display.
Das trifft sich ja gut, dachte Tomasson, fühlte zugleich aber wieder den Knoten im Magen, der in den letzten Tagen ihr ständiger Begleiter geworden war. »Hallo Nathan, was kann ich für dich tun?«
»Sofort zu mir, Jane, ohne Umwege. Egal, was du gerade machst, lass alles stehen und liegen«, erwiderte Nathan Maloney mit leiser, gepresster Stimme. Die Dekanin bemerkte verwundert, dass sich der Präsident nur mühsam beherrschte. So kannte sie ihn gar nicht.
»Ist etwas passiert?«
»Das fragst du? Komm, wir besprechen das hier.« Er unterbrach die Verbindung.
Jane Tomasson konnte sich absolut nicht vorstellen, um was es ging. Über ihr Vorhaben hatte sie noch mit niemandem gesprochen, das konnte Nathan also unmöglich zu Ohren gekommen sein. Eiligen Schrittes ging sie zur Woodbridge Hall, dem Sitz des Präsidenten. Als sie Maloneys Büro betrat, stellte sie verwundert fest, dass Carlos Ruiz, einer der Anwälte der Universität, bei ihm war. Maloney selber wirkte nervös und angespannt. Er stand hinter seinem Schreibtisch und starrte ihr entgegen. Von seiner sonstigen Souveränität schien im Moment nicht viel übrig zu sein. Mit einer knappen Geste wies er sie an, sich zu setzen. Die Dekanin nahm Platz, die Männer setzten sich ihr gegenüber.
»Was ist mit dem Voynich-Manuskript passiert?«, fragte Maloney gefährlich leise und beugte seinen Oberkörper vor.
Jane Tomasson schaute ihn verwundert an. »Was meinst du, Nathan? Ich verstehe deine Frage nicht. Was soll damit sein?«
Maloney ließ sich nach hinten sinken. Er atmete schwer.
Was will er? Er mustert mich, als sei ich eine Zecke oder etwas ähnlich Unappetitliches …
»Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin die Beinecke-Bibliothek betreten haben, Dekanin Tomasson?«, fragte nun der Anwalt.
Tomasson schüttelte verwundert den Kopf. »Da muss eine Verwechslung vorliegen, ich war heute noch gar nicht in der Beinecke.«
»Ach nein?« Maloney wieder. »Du bist aber gesehen worden, Jane!«, brüllte er plötzlich unbeherrscht los und sprang auf. »Was willst du mir also erzählen, hm?« Er ließ sich wieder zurücksinken. Seine Stimme klang einigermaßen normal, als er weitersprach. »In deiner Begleitung war ein fremder Mann, mit dem du in die unteren Räume gegangen bist. Das ist an und für sich schon verboten. Gerade du solltest das ganz genau wissen, Jane. Kurze Zeit später betrat Paul Simmons den Raum mit dem Voynich-Manuskript. Und stell dir vor, das Original ist weg. Verschwunden. Ausgeliehen? Oder gestohlen vielleicht?«
Jane Tomasson durchfuhr es heiß und kalt. »Das … das kann doch nicht sein«, murmelte sie entsetzt.
»Doch, meine Liebe. Simmons kam sofort zu mir. Ich habe daraufhin die Überwachungskamera checken lassen. Was glaubst du wohl, zeigt die?«
»Ich … ich … keine Ahnung.«
Der Anwalt schaltete den im Büro stehenden Hightech-Fernseher an. Bilder der Überwachungskamera flimmerten über den Bildschirm. Jane Tomasson sah sich selbst den Raum mit dem Voynich-Manuskript betreten – zusammen mit einem groß gewachsenen schlanken Mann in weißem Anzug und rotem Hemd. Die Dekanin zitterte plötzlich am ganzen Leib. Kein Zweifel, sie händigte dem Fremden, den sie noch nie zuvor gesehen hatte, das Voynich-Manuskript aus! Er steckte es in eine Aktentasche. Die Datumsanzeige am linken oberen Bildrand ließ keinen Zweifel daran, dass das vor nicht mal zwei Stunden geschehen war.
Die Dekanin war nur noch ein zitterndes Häufchen Elend. Wie in einem kurz aufblitzenden Spot konnte sie sich plötzlich an die Augen des Fremden erinnern, dessen Gesicht auf dem Überwachungsband kein einziges Mal zu sehen war. Lauernd, gemein, gefährlich, hypnotisch. Und sie waren gelb gewesen.
Wie die eines Wolfs.
***
Château Montagne, Loiretal, Frankreich
Professor Zamorra betrat den Trainingsraum des Châteaus. Grinsend betrachtete er das wirbelnde Etwas mit der froschgrünen Kurzhaarfrisur, das sich kreuz und quer über die Bodenmatte bewegte, Tritte und Schläge an die von der Decke hängenden Sandsäcke austeilte, jeden davon mit einem schrillen, furchterregenden Schrei begleitete, sich immer wieder geschmeidig abduckte, einmal sogar über die linke Schulter abrollte und blitzschnell wieder auf die Beine kam. Als die Bewegungen erlahmten, wurde aus dem Schemen wieder eine Gestalt aus Fleisch und Blut.
Schwer atmend stand Nicole Duval vor ihm und boxte noch ein paar Mal in seine Richtung, bevor sie die Arme sinken ließ. »Du kommst gerade recht, chéri«, sagte sie keuchend und lächelte verzerrt. »Ich brauche … ein … Opfer. Jetzt sind die … Selbstverteidigungsgriffe dran.«
»Nichts da. Du weißt schon, wie spät es ist?« Zamorra, in Jeans und dunkelbraunem Sweatshirt, hob den linken Arm und tippte mit dem rechten Zeigefinger demonstrativ auf das Glas seiner Armbanduhr. »Was ist los, Nici? Hast du etwa vergessen, dass heute Stammtisch ist? Mostache und die anderen warten auf uns. Eigentlich wollten wir bereits vor zehn Minuten aufbrechen. Ich dachte, ich finde dich im Bad. Und jetzt bist du noch beim Trainieren.«
Nicoles Augen wurden groß. »Mist, das habe ich tatsächlich verschwitzt.«
»Im wahrsten Sinne des Wortes.« Zamorra grinste erneut. »Wenn ich das richtig sehe, bist du jetzt schon seit über drei Stunden in Action. Seit wann übertreibst du so schamlos?«
Nicole seufzte und sah ihn traurig an. Dann drehte sie sich um und betrachtete sich in dem großen Spiegel, der eine komplette Wand einnahm. Ein schmales, eng anliegendes schwarzes Top und ein ebensolches Höschen betonten ihre durchtrainierte, makellose Figur. Sie fuhr mit beiden Händen über den linken Oberschenkel, übers Knie und dann über die Wade. »Da siehst du den Grund, warum ich künftig noch länger und intensiver trainieren muss als bisher.«
Zamorra runzelte die Stirn. »Was meinst du jetzt genau?«
Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Siehst du’s wirklich nicht? Ich bin viel zu fett, an der Hüfte, an den Oberschenkeln, überall. Eine fette, alte, hässliche Kuh bin ich geworden. Wenn ich nicht trainiere und vor allem Gymnastik mache, wird das noch schlimmer.« Sie hob die Hände und bewegte die Finger. »Weißt du was, chéri? Ich glaube, ich gehe heute nicht mit zum Stammtisch, ich trainiere lieber noch eine Runde. Vielleicht auch noch zwei. Entschuldige mich einfach und sage, ich sei unpässlich. Machst du das für mich?«