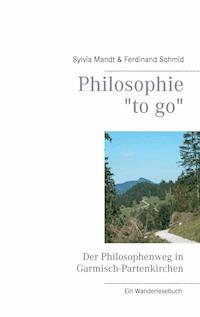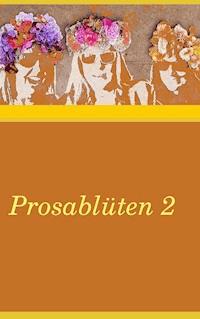
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Prosablüten
- Sprache: Deutsch
Ob der böse Wolf das Rotkäppchen vernascht, die Zwerge an den Grashalmen ziehen, oder wie eine viel versprechende Einladung zum Essen endet, das verraten die Prosablüten in Ihrem zweiten Buch. So unterschiedlich die drei Autorinnen in Stil und Thematik auch sind, so treffsicher gelingen ihnen überraschende Pointen. Dadurch ist ein Strauß spannender, nachdenklicher und amüsanter Geschichten mit bunten Prosa-Blüten entstanden. Lassen Sie sich beim Lesen ans Meer, nach Bethlehem und Prag entführen und verlieren Sie sich dabei im Strudel mitreißender Gefühle!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vom Schreiben
Frau Schlippkötters Spezialdünger
Alles klar
Das Paket
Die Lieferung
Der böse Wolf
Else und Gottfried
Das Ei
Sommer mit Raja
Am Beispiel einer Heckenrose
Zeichen im Sand
Man stirbt nicht gern allein
Keine Wahl
Die Nachricht
Eine Rose
Der Künstler ist anwesend
Die Einladung
Es geht auch ohne Gefühle
Kind
Die Gehenden
Kälte
Du und ich
Wiedersehen
Bahnhöfe sind zum Warten da
Schiefergrau
Die Rückkehr
Die Kälte
Eine Weihnachtsgeschichte
Ein ganz besonderes Essen
Apfelschnittchen
Wenn der Koch zweimal ruft
Von Trüffeln und Schweinen
Der Zwerg, der nachts am Rasen zieht
Das dünne Mädchen
Tage am Meer
Das Tier
Identität
Das Schaufenster
Bethlehem
Ein gelungener Urlaub
Besuch am See
Stiller Abschied
Weihnachten geschenkt
Ich sah
Etwas bleibt
Das Warten hat sich gelohnt.
Der zweite Band der Prosablüten ist da und heißt mit Recht:
Die Fortgeschrittenen
Viel Vergnügen beim Lesen!
Vom Schreiben
- en miniature -
Geschichten sind
Geschenke
wie die Blüten
des Frühlings
sie sind zwar
schnell vorbei
doch immer wieder
zu genießen
solange
wir leben
Sylvia Mandt
Frau Schlippkötters Spezialdünger
Sibylle Wegner
Adele Schlippkötters Parzelle war die schönste im Kleingartenverein „Grüne Linde“, angefangen von dem in Kugelform geschnittenen Kirschlorbeer am Eingang, über die gerade abgestochenen Blumenbeete, auf denen die Blüten wie kleine Soldaten in Reih und Glied standen, weiter über den stets gut gestutzten Rasen, auf dem man vergeblich nach Löwenzahn, Gänseblümchen oder sonstigem Unkraut suchte, bis zum schmucken Gartenhäuschen mit der mit Geranienampeln behängten Regenrinne. Und in der Mitte stand ihr berühmter Rhododendron. Berühmt deshalb, weil er als erster in der Siedlung blühte und seine runden, kräftig rosa Blütenbüschel bis weit in den Sommer hineintrug, was für diese Breitengrade und diese Pflanze sehr ungewöhnlich ist. Oft hing er so voller Blüten, dass kaum ein grünes Blatt erkennbar war. Das brachte ihm jedes Jahr im Frühjahr und im Sommer einen Platz auf der ersten Seite der Vereinszeitung ein.
Dabei waren die Anfänge auf diesem Stückchen Eden gar nicht rühmlich gewesen. Das Ehepaar Schlippkötter hatte den Garten halb verwildert übernommen, mit Wildblumen auf der hohen Wiese, einem Gartenhäuschen, dem schon länger der Anstrich fehlte und einem fast blattleeren Rhododendron, der keine Knospen bildete.
Herrn Schlippkötter gefiel das, er wollte nur eine Bank vor das Häuschen stellen und seinen Feierabend genießen. Frau Schlippkötter war damit nicht einverstanden. Der Vereinsvorstand übrigens auch nicht, aber der traute sich nichts zu sagen, da fast ab dem ersten Wochenende laute Streitgeräusche aus Schlippkötters Garten zu den anderen Parzellen drangen, in denen es um die Unzufriedenheit der Kleingärtnerin mit dem Gartenzustand und ihrem Mann ging. Er weigerte sich, den Rasen zu mähen, das Haus zu streichen oder einfach nur von der Bank aufzustehen. Sie beschimpfte ihn, drohte mit dem Spaten oder warf mit Erde.
Zur Erleichterung der Anrainer kam Herr Schlippkötter eines Tages nicht mehr mit und seine Frau Adele versorgte den Garten allein. Seitdem gedieh dieser und war das Vorzeigegärtchen, was jedem neuen Bewerber um eine Parzelle als Vorbild ans Herz gelegt wurde. Mehr noch, der außergewöhnliche Rhododendron war sogar weit über die städtischen Grenzen hinaus bekannt und mit einem Preis der Zeitschrift „Mein Garten“ ausgezeichnet worden. Die Schlippkötter wurde heiß beneidet.
Bei einem Frühlingsgrillfest fasste der erste Vorsitzende Heinz Blaffke einen Plan. Er schob der Schlippkötter einen Schnaps nach dem anderen unter die Nase, beobachtete ihr stärker werdendes Kichern und fragte sie dann: „Nu ma raus mit der Sprache, Adele. Du hast da doch ein Geheimnis mit dem Busch, dat is ja nich normal so.“
Adele wackelte mit dem Kopf und grinste nur.
„Ich han dich schon mal mit dem Rhododendron quatschen sehen, aber det kann es doch nit sin, oder?“, bohrte Blaffke weiter. Adele stierte vor sich hin. Er stieß sie in die Seite, dass sie leicht schwankte. „Komm, altes Mädel, nu Butter bei die Fische. Hast du da nen extra Dünger?“
„Ja“, lallte Adele, „Spezialdünger.“
„Un, verrätse mir den?“ Blaffke drehte ihren Kopf zu sich. „Komm, ich als Vorstand hab´n Recht drauf!“
„Vielleicht, Heinz“, sagte Adele mit verblüffend klarer Stimme, „später einmal, aber nicht jetzt, da kannst du noch so viel Schnaps in mich rein kippen.“
Blaffke wandte sich beleidigt ab.
Aber ab da liefen tuschelnd Gerüchte und Mutmaßungen über Adeles Spezialdünger durch die Anlage, von Morgenurin bis Eisenspäne, nachts eingegraben, untergemengtem angeschimmeltem Rasenschnitt oder Kaninchenköttel mit frischer Brennnessel gemischt. Einmal waren Adele beim Bücken über die Regentonne unbemerkt aus der Kittelschürze ein paar Cent gefallen. Es dauerte nicht lang, bis sich in allen Gießwassertonnen der „Grünen Linde“ Kupferkleingeld fand. Ein anderes Mal hatte sich Adele mit einem Stuhl neben den Rhododendron auf die Wiese gesetzt, um ein wenig in der Bibel zu lesen. Sie war eingeschlafen und das Buch von ihrem Schoß gerutscht. Beim Aufwachen vergaß sie es dort.
Seitdem tauchten ab und an ausgelegte Exemplare dieses Buches unter Bäumen und Büschen auf, die nicht so wollten wie der Kleingärtner. Eine Nachbarin hatte laut Hörensagen sogar eine Bibel geschreddert unter ihre Erdbeeren gemischt, weil diese nicht groß genug waren.
Adele und ihren Rhododendron interessierte das nicht, bis - ja bis zu jenem Tag, als man Adele auf ihrer Gartenbank fand, sanft entschlafen, mit einem Lächeln auf den Lippen, zwischen ihren Geranienampeln. Der herbeigerufene Orthopäde von Parzelle 36 bescheinigte den Tod und der Bestattungsunternehmer von der Nr. 12 sorgte für einen würdevollen Abtransport.
Blaffke war entsetzt. Sofort machte er sich daran, das Gartenhäuschen nach einem Büchlein oder einem Zettel mit ihrem Düngerrezept zu durchsuchen, erfolglos. Er lief ins Vereinsheim und holte aus dem Mitgliederverzeichnis Adeles Privatadresse heraus. Vielleicht lag es bei ihr zu Hause und überhaupt musste ihr Mann über den Tod informiert werden.
Aber bei den Schlippkötters reagierte niemand auf Blaffkes Klingeln. Er rief: “Herr Schlippkötter, Werner!“ Eine Nachbarin kam ans Fenster. „Der wohnt schon lang nicht mehr hier. Hat die Adele rausgeschmissen.“
„Frau Schlippkötter ist heute verstorben, wissen Sie, wo Werner jetzt wohnt oder gibt es andere Verwandte?“ „Nee.“ Die Nachbarin knallte das Fenster zu.
Blaffke drehte sich mit hängendem Kopf um, setzte sich in seinen Wagen und schlug wütend auf sein Lenkrad. Adeles Geheimrezept war unerreichbar, wahrscheinlich hatte sie ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Er atmete schnaubend aus, dann zückte er sein Handy und rief seinen Sohn an.
Bald zogen neue Mieter auf der Parzelle ein. Blaffke Junior nebst Frau und zwei Kinder erfüllten den Garten mit Lärm und neuem Leben. Und wie alle jungen Leute wollten sie es modern. Der Rhododendron, früher gerühmt, war ihnen jetzt zu kitschig und sollte einem Planschbecken mit Wasserrutsche weichen.
Der große Strauch wurde kurzerhand abgehackt. Beim mühseligen Ausgraben des Wurzelwerks stieß Blaffke Junior allerdings auf etwas Seltsames.
Die eingeleitete kriminaltechnische Untersuchung ergab unter Zuhilfenahme einer alten Haarbürste, dass es sich zweifelsfrei um die Überreste von Werner Schlippkötter handelte. Die Todesursache lautete auf Fremdeinwirkung. Der Schädel war ihm mit einem Spaten gespalten worden.
Alles klar oder eine praktische Deutschstunde, die Malteser Falle
Karla J. Butterfield
„Du die Torte in den Keller bringen!“ Die weiß geschürzte Konditoreiverkäuferin drückte mir eine Platte mit Schwarzwäldertorte in die Hand und zeigte auf die Aufzugstür. Ich fuhr in den Keller hinunter, durchquerte den weißgekachelten Raum voller Tabletts, Tortenformen und abgestellter Schaufensterdekoration und betrat den Kühlraum. Hier waren sie alle: die Obsttorten, Streuselkuchen, Sahne- und Punschtorten, Schokoladen- und Käsetorten. Es roch klebrig und zuckersüß.
Mein erster Arbeitstag im Frühjahr 1969 in der Konditorei Storz am Opernplatz in Frankfurt. Ich war jung, unwissend, voller Tatendrang und hungrig auf den Goldenen Westen. Ja hungrig, denn nachdem ich mir ein Paar Schuhe, einen kunstledernen Minirock und eine bestickte Bluse gekauft hatte, war mein Vorschuss für den kommenden Monat aufgebraucht.
So stillte ich jedes Mal meinen Hunger mit einem Stück Schwarzwäldertorte, während ich langsam mit dem Aufzug in den Keller glitt. Mangels Löffel benutzte ich meinen Zeigefinger. Und leckte die leere Stelle glatt, die das fehlende Stück in der Torte hinterlassen hatte. Bis zur Endstation schaffte ich ziemlich genau eines. Manchmal auch ein zweites, wenn mir angeordnet wurde, zum Beispiel eine Schokoladentorte nach oben in den Laden zu bringen.
Der Aufzug wies alle Vorteile auf, die ich für meine süßen Abenteuer mit den Torten brauchte. Einen STOP Knopf für eventuelle kulinarische Verzögerungen, einen Spiegel, um die Schokoladenreste vom Gesicht zu wischen und ein Schaukeln beim Halten, dass mich daran erinnerte, dass mir schlecht werden würde, wenn ich nicht bald mit der Völlerei aufhörte.
Nach einer Woche des süßen Labsals hatte ich das Gefühl, dass mir bei jedem Blinzeln die Augenlider verklebten. Glücklicherweise wurde ich bald als Servicekraft in das angrenzende Restaurant verlegt. Es war der erste schöne Sonntag seit langem. Die Terrasse musste geöffnet werden, und die Leute strömten hinein, als hätten sie wochenlang gehungert. Es fehlte eindeutig an Servicepersonal.
Bisher hatte ich keinerlei Erfahrung mit der Bedienung und den Wünschen germanischer Gäste, aber ich war damals, wie gesagt, zu allem bereit. Ich blühte sogar auf. Endlich Bewegung und Ablenkung. Außerdem nervte mich diese Konditoreiverkäuferin Frau Meier, die in einer Lautstärke mit mir sprach als wäre ich taub und in Infinitiven als hätte ich einen IQ niedriger als die Ladentheke selbst. Nach zehn Jahren Dienst hatte sie endlich jemanden unter sich und nahm ihre Aufgabe sehr ernst.
Ganz anders war es im Restaurant. Hier war es lustig, hektisch und aufregend. Der Tag verging schnell, und ich bugsierte fröhlich die Eisbecher an den vollbesetzten Tischen vorbei.
Der Inhaber des auf Hochtouren laufenden Gastronomiebetriebes kam normalerweise nur, um die Kassen zu leeren, denn er lebte auf großem Fuß und sozusagen von der Hand in den Mund.
An diesem Tag aber stand er neben dem Tresen mit einem Glas Sekt in der Hand und beobachtete zufrieden das volle Haus. Jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeirauschte, um die Bestellungen aufzugeben, sagte er: „Alles klar?“ und betrachtete mich von oben bis unten. Ich nickte unsicher. Dann, in einer kurzen Verschnaufpause, blätterte ich in meinem Langenscheidt Taschenwörterbuch, um zu ergründen, was „Alles klar“ bedeutete. Ich las, dass „klar“ hell, licht oder durchsichtig hieß. Hatte er etwa meine Sauberkeit bemängelt? „Alles klar?“
Bis auf diese Irritation konnte ich meinen ersten Tag als Erfolg verbuchen. Doch fast am Ende stieß mich eine ganz besondere Bestellung von meiner Erfolgswolke herunter.
Ein Gast bestellte für sich und seine Begleitung „Zweimal These“. Ich brannte mir das Wort ins Gehirn ein und versuchte das Gericht, oder war es ein Getränk? auf der Speisekarte zu finden. Ohne Erfolg. Keine These da. Nicht unter den Speisen, nicht bei den Desserts, es war auch keine Suppe oder Beilage. Was tun? Ich musste meinen Stolz herunterschlucken und fragen. Ich wandte mich vertrauensvoll an einen der netten Kellner: „Was ist These?“
„Wie bitte?“
„Der Tisch sieben hat zweimal These bestellt.“
Er schaute einen Moment verständnislos und fing dann an aus vollem Halse zu lachen.
„Zwei Malteser, du Huhn! Das heißt zwei Malteser!“
Er schenkte mir kichernd zwei von diesen Matrosen ein, und ich erfüllte meine Mission.
„Forelle blau und ein Bier, bitte“, wollte der Tisch neun haben.
Das war zu verstehen und problemlos zu erledigen. Ich bestellte. Der Fisch kam auf einem Silbertablett, mit Paniermehl bestreut und Zitronenringen garniert, die Petersilienkartoffeln in einer weißen Schüssel. Am Vormittag hatte ich gerade gelernt, zwei Teller auf einem Arm zu tragen, also balancierte ich gekonnt das Geschirr in der Rechten, das Bier in der Linken durch den Raum bis zum Forellengast, stellte es schwungvoll vor ihn hin, wünschte guten Appetit und verschwand.
„Hallo!“ rief die Forelle hinter mir her, „was ist?“
„Was ist, was?“
Er zeigte auf das Silbertablett. „Soll ich davon essen?“
Ich: „Ja, warum nicht?“
Er schaute mich an, als hätte ich ihn gerade mit seinem besten Freund betrogen.
Ich schaute zurück, als wäre ich doch nicht ganz unschuldig bei der ganzen Sache. Etwas stimmte nicht. Aber was? Der Gast schob den Fisch zur Seite und zeigte auf den leeren Platz vor sich auf dem Tisch.
„Hier muss ein Teller hin!“
Also brachte ich einen leeren Teller, faltete die Hände auf dem Rücken zusammen und wartete.
„So, und jetzt den Fisch entgräten und mit den Kartoffeln auf meinen Teller servieren.“
„Oh“, ich starrte ihn fassungslos an. Mit einem fragenden Blick zu meinem Gast nahm ich die Schüssel mit den Kartoffeln und häufte diese langsam auf den leeren Teller, um Zeit zu gewinnen. Dann hielt ich inne, als wäre bei mir die Batterie leer. Das Bild des kulturlosen Ost-Immigranten nahm vor meinem inneren Auge klare Formen an. Hier war sie also, die tschechische Schlampe, die keine Ahnung von der Esskultur des Westens hatte.
Aber er war ein netter Mann. Er bedeutete mir, mich hinzusetzen und zeigte, wie man die Forelle aufschneidet, die Gräten herausnimmt und eine Hälfte des Fisches auf den Teller zu den Kartoffeln platziert. Dann flüsterte er mir zu: „Gehen Sie jetzt! Wenn mein Teller leer ist, kommen Sie zurück, fragen Sie, ob ich noch mehr möchte, ich sage ja, und Sie servieren mir den Rest.“
Ich tat wie befohlen. Warum er mir dann noch ein nettes Trinkgeld gab, ist mir bis heute nicht bekannt. Bestimmt nicht für meine Bedienungskünste.
Mit der Zeit wurden meine Sprachkenntnisse besser. Ich kannte mich mit der Speisekarte aus, wusste, wie man serviert, konnte mir die kompliziertesten Bestellungen merken, hatte sogar den Nerv, mit dem Chefkoch zu scherzen und verdiente nicht schlecht.
Wenn nicht eines Abends zwei junge Amerikaner gewesen wären. Sie bestellten das teuerste, was es auf der Karte gab: Mixed Grill für zwei Personen. Ich hatte es nicht mehr nötig, alle Bestellungen phonetisch wiederzugeben und erlaubte mir eine semantische Änderung. Ich rief in die Küche: „Zwei Mixed Grills Chef, knackig und zackig!“
Nach einer halben Stunde hatte ich alle Hände voll zu tun. Zwei riesige Tabletts mit gebratenem Fleisch warteten an der Essensausgabe auf mich. Ich transportierte sie nur mit Mühe aber würdevoll und servierte gekonnt die fleischige Pracht. Die Amerikaner waren begeistert, sie stopften sich die Bäuche voll und gossen auch noch genug Bier hinterher. Erst als sie zahlen wollten und die Kasse mir die Rechnung ausspuckte, bemerkte ich meinen fatalen Fehler: zweimal der Mixed Grill für zwei Personen. Es hatte keinen Sinn, sich ob dieser Laune der Speisekarte zu ärgern. Zwei mal zwei sind bekanntlich vier und das in jeder Sprachregion. Kein Wunder, dass die Portionen so groß waren! Was tun? Die doppelte Summe stand schwarz auf weiß auf dem Kassenzettel. Am Ende des Tages wird das Geld für einen Mixed Grill für zwei Personen fehlen. Außer…außer ich gleiche es mit meinem Trinkgeld aus. Ich musste zahlen! Ein Minirock weniger, aber meine Ehre war gerettet, zumindest vor den Anderen, nicht vor mir selbst. Ich arme Tschechin hatte gerade die glorreiche USA subventioniert.
Das Paket
Sylvia Mandt
Diesen Tag in den Herbstferien werde ich nie vergessen. Die Eltern waren zur Lese in die Weinberge gefahren.
Du bist schon zehn, hatte der Vater gesagt, da kannst du allein im Haus bleiben, bis wir zurück sind.
Bislang hatte ich solche Zeiten bei einer Nachbarin verbracht, wenn sie in Sachen Wein unterwegs waren, was in diesem Beruf häufig der Fall war. Ich malte und las, und als ich mich gerade zu langweilen begonnen hatte, klingelte es an der Haustür.
Ein Paket für Frau Renate Berger, sagte der Mann in der gelben Jacke. Da ist bestimmt ein Goldklumpen drin.
Das Paket war etwas größer als ein Schuhkarton und tatsächlich so schwer, dass ich nachgreifen musste, um es nicht fallen zu lassen. Ich stellte es auf den großen Küchentisch und begutachtete es von allen Seiten. Nur Mutters Name stand darauf und unsere Adresse. Nichts vom Weingut wie sonst auf den Postsendungen. Es gab auch keinen Absender. Ich erinnerte mich nicht, dass die Mutter sonst Post bekommen hätte.
Ich hob den braunen Karton mit den vielen Klebebändern noch einmal hoch und bewegte ihn hin und her. Drin verrutschte ein deutlich schwerer Gegenstand und machte ein dumpfes Geräusch. Ein Goldklumpen? Dann müssten die Eltern nicht mehr so viel arbeiten, hoffte ich und wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr.
Als es schon zu dunkeln begann, hörte ich sie kommen.
Mama, rief ich, beeil dich, während sie sich im Hof die Handschuhe und Stiefel auszog. Da ist ein Paket angekommen, mit einem Goldklumpen drin!
Du träumst, sagte sie, betrachtete den Karton und hob ihn hoch. Dann fügte sie barsch hinzu: Der kommt sofort in den Keller.
Der Vater sagte und fragte nichts. Die Mutter ging über den Hof in den Weinkeller. Den mochte ich nicht. Das hohe Gewölbe mit schummrigem Licht, in dem dunkle Fässer und staubige Flaschenregale herum standen, war sommers wie winters feucht und kühl und roch säuerlich.
Davon leben wir, pflegte der Vater zu sagen. Nun, da dort unten das Paket stand, über das niemand mehr ein Wort sagte, war mir der Keller noch unheimlicher geworden.
Seit meinem Auszug aus dem heimischen Weingut war der Kontakt mit den Eltern spärlich. Ich kann nur einer Lehrerin, die mir sehr zugetan war und sich jahrelang um mich gekümmert hatte, verdanken, dass ich es geschafft habe, mich gegen den Vater durchzusetzen. Er wollte unbedingt, dass ich Weinbau studiere. Immerhin zahlte er eine monatliche Summe, sodass ich mit ein paar Nebentätigkeiten das Psychologiestudium in Landau finanzieren und ausziehen konnte. Irgendwann würde ich meine eigene Praxis für Kindertherapie haben, das war mein Ziel.
Eines Morgens rief der Vater an und bat mich, nach Hause zu kommen. Die Mutter sei verunglückt und liege im Krankenhaus.
Wie ist es denn passiert, fragte ich den Vater.
Die Mutter sei auf der Treppe in den Weinkeller gestürzt, sagte er, habe sich auf den ausgetretenen Steinstufen den Hinterkopf aufgeschlagen, Hüfte, Arm und Bein gebrochen. Neben ihr habe das Paket gelegen, das sie damals dort versteckt hatte.
Die Mutter war nun selbst ein Paket aus Gips und Verbänden, starrte zur Decke und sprach mit uns kein Wort.
Was wissen Sie denn über die Kindheit Ihrer Mutter? fragte der Arzt.
Nichts, sagte ich.
Der Vater ergänzte: Nicht viel. Sie hat nicht gern darüber gesprochen.
Es muss ein Martyrium gewesen sein, erklärte der Arzt. Wir haben bei der Suche nach frischen Frakturen unzählige alte, sehr alte Knochenbrüche und Narben festgestellt. Da kann etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Anscheinend so schrecklich, dass es nicht benannt werden konnte.
Der Vater und ich holten das Paket aus dem Keller. Es war noch immer ungeöffnet. Wir lösten die feuchten Klebestreifen und fanden einen in Papier eingewickelten Hammer. Mit einer stumpfen und einer spitzen Seite. Darunter, am Boden des Pakets, entdeckten wir einen großen Briefumschlag. Darauf war handschriftlich „Renate“ geschrieben.
Ich schaute den Vater an.
Mach auf, sagte er.
Ich las: Meine liebe Renate, hier ist alles, was ich an Unterlagen sicherstellen konnte. Die Frau, die deine Mutter war, ist begraben. Du kannst nun den Hammer begraben, damit du inneren Frieden findest. Lass mich wissen, wie es dir geht. Deine Tante Trude.
Die Unterlagen bestanden unter anderem aus vergilbten Berichten eines Kinderkrankenhauses. Wir hielten die Luft an und lasen stumm. Das Kleinkind Renate war von seiner besorgten Mutter wegen häufiger Verletzungen und Knochenbrüchen immer wieder in eine Klinik gebracht worden. Die Mutter hatte sich den Ärzten und dem Pflegepersonal gegenüber hilfsbereit und unterstützend gezeigt, was die Pflege des Kindes anging. Dadurch war sie lange nicht verdächtigt worden, an den Befunden der Ärzte selbst ursächlich beteiligt gewesen zu sein. Bis eines Tages die Kinderkrankenschwester Gertrude Wiesner Verdacht geschöpft, die Mutter beobachtet und später verklagt hatte. Daraus war die Heimunterbringung des kleinen Mädchens hervorgegangen, das seine Mutter nie wiedersehen sollte.
Der Vater hatte zu weinen angefangen.
Das alles wusste ich nicht. Sie hat nie über sich gesprochen, sagte er.
Wie konntet ihr, ohne zu reden, ohne euch zu kennen, eine Familie gründen? fragte ich, wütend und verzweifelt zugleich.
Sie war so fleißig, sagte er, und sie liebte die Weinberge.
Ich dachte, so eine Frau brauche ich. Sie wollte zunächst kein Kind, aber für mich war ein Stammhalter wichtig.
Dann bekamen wir dich. Komm zurück. Wir brauchen dich jetzt.
Und ich brauche Luft, sagte ich. Verließ den Keller, das Weingut, rannte in die Weinberge, rannte und rannte. Bis ich unser Dorf dort unten liegen sah. Von hier oben sah alles so klein aus…
Die Lieferung
Sibylle Wegner
Sabine öffnete sofort die Tür, als es klingelte. Seit drei Tagen hatte sie schon gewartet. Der Postbote zuckte vor Überraschung zusammen.
„Tach, Frau Winterling. Hier ist wieder was für Sie.“ Lächelnd hielt er ihr ein Paket auf einer Hand balancierend hin.
„Vorsicht!“, rief sie und griff schnell nach dem Karton.
„Ach, ist wieder Porzellan für Ihre Sammlung, was? Hab ich mir schon gedacht bei dem Absender – Auktionshaus de Breuer Schweiz. Was ist es denn diesmal?“
„Echt Meißen.“
„Oh!“ Der Postbote zog sofort seine Hand zurück, als ob sie „Bombe“ gesagt hätte. Sabine stellte das Paket hinter sich.
Der Bote legte die Stirn in Falten. „Hoffentlich ist noch alles heil. Soll ich warten, bis Sie den Inhalt kontrolliert haben?“
„Nicht nötig, aber danke. Wo muss ich unterschreiben?“
Endlich war der Bote fort. Sabine drückte die Tür mit ihrem Rücken zu. Sie atmete durch. Die Idee mit Meissen war gut. Dann würde er in Zukunft vorsichtiger sein. Ihr wurde schlecht bei der Erinnerung, wie leichtfertig er das Paket balanciert hatte.
Vorsichtig nahm sie den Karton auf und trug ihn langsam zum Küchentisch, auf dem drei Fachbücher bereits aufgeschlagen lagen, um sie mit dem Inhalt des Paketes zu vergleichen. So behutsam wie möglich stellte sie den Karton auf die Tischplatte. Sie griff sich ein Cuttermesser und setzte es an dem Klebeband an. Die Aufregung trieb ihr einen Schauer den Rücken hinunter. Gleich würde sie wissen, ob es das war, was sie glaubte.
Zaghaft schob sie die oberste Schicht Luftpolster zur Seite. Ein Briefumschlag kam zum Vorschein. Die Rechnung des Auktionshauses. Sie legte sie zur Seite, ohne sie zu beachten und blickte auf den Gegenstand, der voluminös in Noppenfolie, dick mit Klebeband umwickelt, in der Mitte eines Luftpolsterbettes ruhte.
Unvorstellbar, wenn es echt war, wenn es das war, was sie glaubte. Ihr war heiß. Ein Fieber hatte sie erfasst. Langsam und mit Konzentration hob sie das verpackte Objekt aus dem Karton und begann mit chirurgischer Präzision, die Folien aufzuschneiden. Nur nicht zu tief, warnte die Stimme in ihrem Kopf. Schweißperlen sammelten sich auf ihrer Stirn. Noch eine Folie trennte sie von dem ersten Blick auf dieses einzigartige Objekt. Sie hielt inne. Statt des Cutters nahm sie jetzt ein Skalpell. Erst als sie kein Zittern mehr in ihren Fingern spürte, setzte sie zum Schnitt an. Andächtig zog sie die Folie auseinander. Sie hielt den Atem an, als ob jeder Luftzug dem Fundstück schaden könnte.
Die leuchtenden Farben sahen so frisch aus, als ob der Maler sie erst vor kurzem auf die Reliefplatte aufgetragen hätte. Im Seitenprofil war der nackte Oberkörper eines Mannes sichtbar, die Haut in rot gefärbt. Um den Hals trug er einen breiten Kragen aus drei Reihen gelbgoldener Stäbchen, die in Perlentropfen ausliefen und die Schultern bedeckten. Vor der Brust hing ein Falke mit breit ausgespreizten Flügeln, mit Federn in Blau, Gelb und Rot. In seinen Krallen trug er einen Skarabäus. Das Gesicht des Mannes umrahmte eine schwarze Perücke. Um seinen Kopf wand sich ein goldener Reif mit einer über der Stirn hoch aufragenden Kobra. Links neben dem Kopf war noch das obere Drittel einer Kartusche bis zum Kantenbruch zu sehen. Die Hieroglyphen bildeten den Anfang des Namens Sehotep-taui: Der die beiden Länder zufriedenstellt. Der Thronname Tetis des Zweiten, Begründer der sechsten Dynastie.
Sie stieß einen spitzen Schrei aus. Er war es! Und es sah echt aus. Die Aufregung, die sie seit der Entdeckung des Fragmentes aus der Grabbemalung im Auktionskatalog ergriffen hatte und ihre Nerven bewegte wie eine nicht ausschwingen wollende Stimmgabel, entlud sich schlagartig. Eine Welle des Glücks raste durch ihren Körper. Howard Carter, schoss es ihr durch den Kopf, ja, genau wie er bei der Entdeckung des Grabes von Tutankhamun, so musste es sich angefühlt haben. Jetzt war sie es, die einen Schatz gefunden hatte. Das jahrelange Studium der Bildbände und der Fachzeitschriften, das Lernen, das Verfolgen der Artikel in der ägyptischen Presse über geraubte Artefakte, all das war die Vorbereitung und die Konsequenz für diesen Augenblick gewesen. Sie brauchte gar nicht die leichten Verfärbungen und Stockflecken oder die an zwei Stellen noch durchschimmernden Korrekturen des antiken Vorarbeiters zu sehen. Nein, sie wusste, dass das Fragment echt war. Dass es viertausenddreihundert Jahre alt war und in das Grab von Mereruka, einem der Wesire unter Teti II, gehörte. Dies hier war ein Teil der während der Revolution geraubten Wandmalereien und stammte aus einem der hinteren der 32 Räume, die dieses Grab umfasste.
Und sie hatte es gefunden. Dieser Schatz, so unglaublich alt, er gehörte ihr, nur ihr allein.
Sie zog sich feierlich die bereit gelegten Baumwollhandschuhe an und hob das Stück aus seinem Nest, legte es zärtlich auf ein Samtkissen, das mit Pergamentpapier überdeckt war. Oh Gott, auf der Noppenfolie lag ein kleines Bruchstück des Sandsteins mit Resten des Farbgrundes. Der Versand war doch nicht ohne Folgen geblieben. Sie betrachtete das Stück genau. Auf der Unterseite waren die rohen Schabstellen des Meißels erkennbar, der das Stück aus der Wand gebrochen hatte. Aber an den Rändern erkannte sie die uralten Riefen der Kupfermeißel, mit denen die Handwerker vor Jahrtausenden die Szene in Mererukas Grab aus dem massiven Fels geschlagen hatten. Wenn es noch einen Rest Zweifel gegeben hatte, war er jetzt ausgeräumt. Lachend und tanzend holte sie ihren Fotoapparat und schoss aus verschiedenen Perspektiven Bilder, legte einen Zollstock auf das Kissen, fotografierte wieder und wieder.
Dann sank sie matt und satt auf den Küchenstuhl. Ihr Schatz lag vor ihr, die Farben leuchteten nur für sie. Andächtig fuhr sie mit dem Finger über die Linien der Figur.
Ihr Schatz, wirklich ihrer? Obwohl sie seit drei Jahren nicht mehr rauchte, erfasste sie das unbändige Verlangen nach einer Zigarette. Im Wohnzimmerschrank hinter Omas Kaffeegeschirr waren noch welche versteckt. Sie holte die angebrochene Packung und zündete sich mit einem Streichholz eine Zigarette an. Der erste Zug schmeckte muffig und der Geruch, der ihr in die Nase stieg, roch nach altem, brennendem Sofa. Sie zog erneut. Das Glücksgefühl ließ nach. Sie wusste, dass sie das Stück nicht behalten konnte, durfte. Es war Diebesgut und Weltkulturerbe. Auf welchen Wegen es auch immer in die Schweiz gelangt war, in ein kleines Auktionshaus, das womöglich nicht ahnte, was es da anbot.
Deklariert als Fragment aus einem Beamtengrab ptolemäischer Zeit, 2. Jhd. vor Christus, aus einer deutschen Sammlung vor 1960, war der Zuschlag für lächerliche vierhundertzwanzig Euro erfolgt. Laut Beschreibung sollte es vermutlich Ptolemaios den Vierten darstellen. Keiner außer ihr hatte auf den falschen Thronnamen geachtet. Kein ägyptischer Antikensammler, für die diese Zeit nicht so interessant war, hätte es in dieser Auktion vermutet, die ansonsten mit sogenannten Antiquitäten aus Haushaltsauflösungen bestückt war und neben Vasen aus den Sechzigern auch Teekannenwärmer aus den Vierzigern zur Versteigerung anbot.
Wie war es von Ägypten dorthin geraten?
Entweder von einem Touristen in einer Seitengasse im Halbdunkel von einem Einheimischen gekauft oder mit dem Strom der syrischen Flüchtlinge über die Grenzen gekommen und zu schnellem Geld gemacht. Die Flüchtlinge waren für Antikenraubgut sehr gut geeignet, da ihr Gepäck nicht kontrolliert wurde.
Über die üblichen Wege – durch den Sinai nach Saudi-Arabien, dann mit dem Flugzeug in die Schweiz - war es sicher nicht gekommen. Solche Stücke landeten bei großen Auktionshäusern, mit perfekt gefälschten Papieren über europäische Vorbesitzer aus den vorigen Jahrhunderten, und erreichten Spitzenpreise.
Dieses Stück hier wäre nicht unter vierzigtausend Euro Limitpreis aufgerufen worden.
Sie atmete tief aus. Die Zigarette war bis zum Filter heruntergebrannt. Sie wusste, was sie jetzt tun musste.
Schwerfällig erhob sie sich, legte die Noppenfolie nestartig wieder in den Karton, nahm das Artefakt behutsam hoch und bettete es hinein, die Enden der Folie schlug sie nur leicht über, damit sie keine Berührung mit dem Bildnis hatten. Sie würde es auf keinen Fall mehr mit der Post verschicken.
Der Handapparat des Telefons wog schwer, als sie die Nummer eintippte.
„Auskunft, guten Tag, was kann ich für Sie tun?“
„Ich hätte gern die Nummer der Ägyptischen Botschaft Berlin … “
Der böse Wolf
Karla J. Butterfield
„Liebling!“, mein Mann schaute mich äußerst verliebt an. Das tat er immer, wenn er von mir etwas wollte. „Bitte, du hast doch Zeit!“
„Nein!“ äußerte ich entschieden. „Niemals! Die Krankheit ist vorgeschoben, deine Mutter langweilt sich, sie will nur jemanden, an dem sie herumnörgeln kann.“ Meine Schwiegermutter hatte es faustdick hinter den Ohren, aber auch steinschwer in den Taschen. Es war kein schlechtes Gefühl zu wissen, dass da noch was kommt.
„Liebes, bitte!“ Er drückte mir dreihundert Euro in die Hand. „Bring ihr etwas Leckeres mit und kauf dir was Nettes.“ Und schon war er aus der Tür. In seinem weißen Audi galoppierte er dem Sonnenaufgang entgegen in die weite Welt hinaus.
Nun saß ich im Zug Richtung Hamburg. Im Abteil war es heiß. Ich langweilte mich und betrachtete über mein Buch hinweg den Mann gegenüber. Teurer Anzug, graue Haare, beeindruckende Hakennase, gepflegte Hände. Nach dem dritten Blick kamen wir ins Gespräch. Er kannte das Buch, das ich gerade las: Das Wissen über die Archetypen in Grimms Märchen