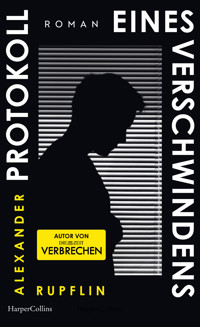
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabriel verlässt Rio, um zu seiner Schwester Isabella nach Deutschland zu ziehen. In Hamburg läuft für ihn zunächst alles nach Plan: Er findet Arbeit in einer IT-Firma und verliebt sich. Doch dann verschwindet er spurlos. Für Isabella beginnt eine verzweifelte Suche in einem Land, das ihr immer fremder wird.
Zur gleichen Zeit versucht der Pfleger Fabio, sein unauffälliges Leben weiterzuführen, bis er nicht mehr ignorieren kann, was in seinem Gästezimmer liegt: eine seit Monaten verwesende Leiche.
Den Fakten treu, gleichzeitig zutiefst menschlich, rekonstruiert Alexander Rupflin die erschütternden Details eines Verbrechens. Er gibt den Angehörigen eine Stimme und taucht in das Selbstbild eines Täters ein, der noch immer seine Unschuld beteuert.
»Protokoll eines Verschwindens« ist eine Geschichte vom Streben nach Glück, der Suche nach Wahrheit, dem Gefühl der Verlorenheit und den Abgründen unserer Triebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Hamburg, Herbst 2019: Die junge Ärztin Isabella überzeugt ihren Bruder aus der Favela Rios, in der beide aufgewachsen sind, zu ihr nach Deutschland zu kommen. Zunächst läuft alles nach Plan, Gabriel findet einen Job und verliebt sich in seine Kollegin. Doch dann verschwindet er spurlos. Für Isabella beginnt eine verzweifelte Suche in einem Land, das ihr immer fremder wird.
Zur gleichen Zeit versucht der Pfleger Fabio, sein unauffälliges Leben weiterzuführen, bis er nicht mehr ignorieren kann, was in seinem Gästezimmer liegt: eine seit Monaten verwesende Leiche.
Alexander Rupflin rekonstruiert in seinem Debütroman einen der am aufsehenerregendsten Kriminalfälle der Gegenwart, indem er eintaucht in das Leben der Angehörigen und eines Serientäters, der an seine Unschuld glaubt.
»Protokoll eines Verschwindes« ist eine Geschichte vom Streben nach Glück, der Suche nach Wahrheit, dem Gefühl der Verlorenheit und den Abgründen unserer Triebe.
Zum Autor
Alexander Rupflin, geboren 1991, lebt in Hamburg. Als Kriminalreporter schreibt er für die ZEIT und das Magazin ZEIT Verbrechen. Er studierte Jura an der Universität Augsburg, verfasste und inszenierte zugleich teils prämierte Theaterstücke. Zudem ist er Mitgründer der Autorenagentur Hermes Baby, die sich der literarischen Reportage widmet.
Alexander Rupflin
Protokoll eines Verschwindens
Roman
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von zero-media.net, München
Coverabbildung von kieferpix / Getty Images
ISBN9783749908349
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Urhebers und des Verlags bleiben davon unberührt.
»Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?«
Friedrich Nietzsche
Vorwort
Während einer Recherchereise vor ein paar Jahren – ich hatte gerade einen freundlich schüchternen Mann im Gefängnis besucht, verurteilt, weil er sein Opfer erhängt und Teile des Leichnams gegessen haben soll – fand ich mich an einer Überführung mitten in der Sächsischen Schweiz wieder. Unter mir Bahngleise, und auf einmal, aus dem Nichts, spürte ich, was es bedeutet, sich selbst ganz und gar zu verlieren. Es war, als implodierte ein Teil meines Bewusstseins. Ohne Vorwarnung, ohne Logik. Kein klarer Gedanke war möglich. Nur eine einzige Gewissheit blieb: Ich würde mich hier hinunterstürzen, sollte ich versuchen, diese Brücke zu überqueren. Ich zwang mich, gleichmäßig zu atmen. Es war ein kurzer Augenblick. Sekunden vielleicht. Dann durchdrang ein banaler, rettender Einfall diese ursprungslose Panik: Du musst einfach einen anderen Weg finden. Einfach einen anderen Weg, der über keine Brücke führt.
Stunden später im Hotelzimmer starrte ich auf die schwarze Fläche des Fernsehers; noch immer befallen von Todesangst. Das Herz raste schmerzhaft. Und gerade weil mir diese Panik so grundlos und unerklärlich vorkam, schien es nichts zu geben, das mich hätte beruhigen können, obwohl ich mich in Sicherheit befand. Es gab keine Hoffnung. Und mir wurde klar: Die Krankheit, die meine Familie seit Generationen heimsuchte, hatte nun auch mich befallen.
Damals, zur etwa gleichen Zeit, zog Gabriel gerade nach Hamburg, zehntausend Kilometer von seiner Heimat Rio de Janeiro entfernt, und fatalerweise glaubte er, hier seine Zukunft zu finden.
Und eine dritte Sache geschah damals zeitgleich: Ein zwanzigjähriger Mann mit langem Haar irrte eines Sonntagmorgens orientierungslos durch den Hamburger Stadtteil St. Pauli. Er konnte kaum begreifen, was ihm nur Stunden zuvor widerfahren war. Der Polizei würde er später erklären, an diesem Tag sei in ihm etwas, wie Glas, zerbrochen.
Fünf Jahre sollten vergehen, bis die Folgen dieser parallelen Ereignisse sich zu etwas verweben würden, was wir gemeinhin eine Geschichte nennen – vom Leben geschrieben, wie man so sagt. Von Wirklichkeit zersetzt.
Das Folgende beruht auf Tatsachen. Während meiner Recherche stieß ich bei mancher Episode teils auf mehrere Versionen und auf einander widersprechende Erinnerungen. Ohne mir anmaßen zu wollen, die letztgültige Wahrheit zu kennen, habe ich in diesen Fällen jeweils die Version gewählt, die mir am wahrscheinlichsten und überzeugendsten zu sein schien. Manche Geschehnisse wurden von mir zugunsten einer stringenteren Darstellung verdichtet. Zitate wurden von mir teilweise grammatikalisch korrigiert und gekürzt.
Wenn ich mithilfe meiner Vorstellungskraft Fakten verbunden, Lücken gefüllt, Dialoge frei rekonstruiert, Szenen ausgemalt oder Gefühlen und Gedanken Ausdruck verliehen habe, dann geschah das auf Grundlage meiner mehrjährigen Nachforschungen, einer über zehntausend Seiten umfassenden Ermittlungsakte und den zahllosen Gesprächen mit all jenen, um die es hier geht. Alle auftretenden Personen gibt es wirklich. Sie gewährten mir tiefe Einblicke in ihr Heiligstes, ihr Leben – und damit auch in das Leben als solches. Um diese Menschen und ihre Familien zu schützen, habe ich die Namen und manche biografischen Details verändert.
A.R.
Lucas
Der graue Himmel hing so tief, als würde er auf die Erde gezogen. Lucas klebte der bittere Geschmack seiner Magensäure im Mund, der Gaumen hing leblos auf der Zunge, sodass er das Gefühl nicht loswurde, sich gleich wieder übergeben zu müssen.
Der kalte Wind vom Hafen durchwühlte sein langes blondes Haar, wehte es ihm ins Gesicht, kitzelte an der Nase. In der Hektik hatte er sein Haargummi in der Wohnung des kleinen Mannes vergessen. Er lief, lief, ohne zu wissen, wohin. Doch mit jedem Meter, den er zwischen sich und diese Wohnung brachte, schien er bloß den Erinnerungen an die vergangene Nacht wiederum näher zu kommen.
Erste verwackelte Bilder vor Augen: Schmale Lippen, umrahmt von einem akkurat getrimmten ergrauten Fünftagebart, schließen sich um seinen schlaffen Penis und saugen an ihm, wie ein Kalb an der Zitze seiner Mutter.
Und er selbst unfähig, sich zu rühren.
Warum hatte er sich nicht gewehrt?
Hatte er es zugelassen?
Hatte er es gewollt?!
Ein älteres Touristenpärchen, neonfarbene Rucksäcke umgeschnallt, kam Lucas entgegen. Die einzigen Menschen, die an jenem Sonntagmorgen durch St. Pauli spazierten, über Scherben der letzten Nacht, an Obdachlosen in Häusernischen vorbei, die unter Decken und Schlafsäcken ihren Rausch ausschliefen, bis der erste grölende Junggesellenabschied in Hawaiihemden an ihnen vorbeiziehen würde, auf dem Weg zum Hafen, wo Männer in Matrosenkostümen auf Booten zur Elbrundfahrt einluden, wo die ersten Buden gerade ihre Fritteusen anwarfen, um bis tief in die Nacht hinein einen Tiefkühlbackfisch nach dem anderen in Fett zu ertränken. Lucas überlegte kurz, ob er die beiden Touristen ansprechen und um Hilfe bitten sollte. Aber was sollte er sagen? Der Mann, dessen kakifarbenes Safarihemd am Bauch spannte, musterte Lucas abschätzig und amüsiert. Dann ging er an ihm vorbei.
Lucas musste einen desolaten Eindruck machen.
Er wankte über die daniederliegende Reeperbahn. Der Asphalt glänzte feucht. Geruch von Bierpisse und kühler Hafenluft umwehte ihn. War er nicht genau hier vor ein paar Stunden erst gewesen? Zusammen mit dem Italiener, der ihm an jedem der zahllosen Straßenläden einen »Mexikaner« ausgegeben, ihn genötigt hatte, diese scharfe Mischung aus Wodka, Tomatensaft, Tabasco und Pfeffer runterzukippen, die ihm jetzt übel aufstieß.
Noch ein Erinnerungsfetzen: eine junge Frau, nicht viel älter als er, Anfang zwanzig vielleicht, mit blond gelocktem Haar, einem Nasenpiercing und einem schmückenden Muttermal unterm Mundwinkel, das sich andere Frauen mit Kajal aufmalen würden. Sie steht ihm gegenüber in irgendeiner Bar. Es ist leer, es muss weit nach Mitternacht sein. Sie lächelt ihn an. Etwas Herausforderndes liegt in diesem Lächeln.
Keine Ahnung, wie er hierhergekommen ist.
Der kleine Mann sitzt in der Nähe, an einem Tisch, darauf mehrere Halbliter-Weinflaschen und Gläser. Auch er lächelt.
Lucas spricht mit der Frau auf Englisch, erzählt, dass er gerade aus Warschau gekommen sei, dass er dort lebe und studiere. »Yes, I’m from Poland, but born in Canada!« Dass er die ganze Strecke per Anhalter bis nach Hamburg gefahren sei, morgen wolle er weiter über Kopenhagen bis nach Göteborg. Dort treffe er seinen Vater, mit dem er ein Eishockeyspiel besuchen wolle. Lucas gibt sich Mühe, vor der Frau nicht so besoffen zu wirken, wie er sich fühlt. Sie fragt, ob ihm Hamburg gefalle, er nickt, obwohl er außer der Reeperbahn nichts gesehen hat. Sie sagt, sie sei »a real Hamburger Deern«, was, wie sie erklärt, bedeute, dass sie hier aufgewachsen sei und auf dem Kiez arbeite. Sie tauschen Facebook-Kontakte aus, wissend, dass sie einander niemals wiedersehen.
Auf einmal ist die Frau verschwunden. In seiner Erinnerung steht Lucas nun allein auf der Tanzfläche, halb wippend, halb wankend zur Musik, Takt und Halt verloren um sich selbst tanzend. Der kleine Mann sieht ihm noch immer lächelnd zu. Ein merkwürdiger Typ mit Glatze, Fünftagebart und einem irgendwie harten, ins Gesicht gemeißelten Lächeln, findet Lucas. Er kippt neben ihn und trinkt. Wein, Wodka, Bier, irgendwie alles durcheinander.
Er hatte den Mann erst an diesem Abend kennengelernt. Sie hatten sich über die Plattform couchsurfing.com verabredet, wo er sich auf einem einzigen unscharfen Handyfoto präsentiert hatte, mit roter Basecap und schwarzem Kapuzenpulli. In seinem Profil stand, er heiße Fabio, sei fünfundvierzig Jahre alt, von Beruf Krankenpfleger. Aufgewachsen in Turin. Sprachkenntnisse: Italienisch, Französisch, Englisch. Kaum hatte Lucas – es muss kurz vor zweiundzwanzig Uhr gewesen sein – die kleine Erdgeschosswohnung betreten, hatte Fabio ihm auch schon ein Weinglas in die Hand gedrückt. Kurz darauf fand er sich in einem recht karg eingerichteten Wohnzimmer wieder, auf einer schmalen Couch mit Holzarmlehnen. Sie unterhielten sich über Belanglosigkeiten, und jedes Mal, wenn Lucas einen Schluck getrunken hatte, schenkte Fabio ihm hastig nach. Irgendetwas stimmt mit dem Typen nicht, dachte Lucas, diese Vertraulichkeit ging zu schnell, war aufdringlich. Statt Widerwillen spürte er aber eine ihn selbst überraschende Neugier. Lass dich einfach drauf ein, sagte er sich, mal schauen, was passiert, vielleicht wird’s ja lustig.
Irgendwann schlug Fabio vor, dass sie noch gemeinsam ausgehen könnten. Lucas zögerte. Eigentlich war er nach der Anreise zu müde dafür. Doch schon ein paar Minuten später liefen sie über die Reeperbahn, und Fabio zeigte ihm, wo die Prostituierten sich anboten. Er erklärte, dass er deren Dienstleistungen nur wärmstens empfehlen könne, und lachte dabei zu laut.
Von den ganzen Mexikaner-Shots fühlte sich Lucas leicht und seltsam wirr, so wie er es noch nie gefühlt hatte, obwohl er eigentlich ziemlich vertraut war mit der Wirkung von Alkohol.
Und dann, wie durchtrennt, war ihm der Faden zwischen Bewusstsein und Gedächtnis gerissen; er wurde geschleudert durch bunte Lichter, warme Bässe und klebrige Körper jener Nacht. Erst in der letzten Bar bei der Frau mit dem Nasenpiercing und dem Muttermal war er sich der Welt wieder halbwegs bewusst geworden. Doch als die Frau verschwunden war, hatte ihm der kleine Mann schon wieder ein Glas in die Hand gedrückt, und Lucas hatte getrunken, so als wäre er am Verdursten – und das Bewusstsein ging ihm erneut verschütt.
Lucas hatte das Bedürfnis, die eigene Haut abzustreifen, die in Fetzen daliegenden Erinnerungen wie Schuppen zurückzulassen.
Die immer gleichen Fragen hämmerten in seinem Schädel:
Warum hatte er sich nicht gewehrt?
Hatte er es zugelassen?
Hatte er es gewollt?!
Er irrte durch die leblosen Straßen von St. Pauli.
Er hatte diese Reise durch Europa unternommen, um zu sich selbst zu finden, nicht, um sich auf so brutale Weise selbst abhandenzukommen. Vor ein paar Wochen hatte er mit seiner Freundin Schluss gemacht, obwohl er sie noch liebte. Sie war seine Jugendliebe, sie wurden ein Paar, da war er sechzehn und natürlich naiv genug, um zu glauben, es könne für immer halten. Vor ein paar Monaten hatte er dann herausgefunden, dass sie ihn betrogen hatte. Keine Ahnung, wie lange sie ihm in die Augen gesehen, ihn geküsst und ihm etwas vorgespielt hatte. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl gehabt, sich im freien Fall zu befinden. Seither betrank er sich, feierte, versuchte sich einzureden, er könne nachholen, was ihm diese Jugendliebe verwehrt hatte. Doch das alles hatte sich bald schal und wenig hilfreich angefühlt, und so war er auf die Idee gekommen, allein durch Europa zu trampen. Letztlich eine Flucht.
Mit zittrigen Händen nahm er sein Handy, wollte nachsehen, wie er zum Hauptbahnhof kam. Dann entschied er sich, über das Internet eine Mitfahrgelegenheit zu suchen, mit der er nach Kopenhagen und von dort aus nach Göteborg gelangen könnte. Er überlegte, ob er seinen Vater anrufen sollte. Aber was sollte er sagen? Dass er besoffen mit einem fremden Kerl rumgemacht hatte, der gut doppelt so alt war wie er?
Noch ein Bild von letzter Nacht: nackt im Bett, rechts neben ihm der kleine Mann, dessen Hand über Lucas’ nackten Arm streichelt, über die Brust, den Bauch. Fabio tastet sich vor, weiter, bis an sein Glied, umfasst es mit den Fingern, massiert die Hoden. Das Gefühl, im eigenen Körper eingeschlossen zu sein. Erstarrt. Nicht aus Angst, sondern aus dem tatsächlichen Empfinden heraus, jemand hätte ihm die Halswirbelsäule durchtrennt. Er spürt alles, das Kribbeln zwischen seinen Beinen, das ihn anwidert, nur ist er dabei wie gelähmt. Mit aller Willenskraft gelingt es ihm schließlich, Fabios Hand wegzuschieben. Er hört neben sich ein enttäuschtes Seufzen: »Come on!«
Wie ist er überhaupt aus der Bar zurück in die Wohnung gekommen?
Keine Ahnung.
Lucas will aus dem Bett des Italieners aufstehen, abhauen, sein Körper gehorcht nicht; eine ungemein schwere, geradezu krankhafte Müdigkeit hält ihn im Griff. Er fällt zurück in einen todähnlichen Schlaf. Als er abermals erwacht, fühlt er wieder die Hand zwischen seinen Beinen. Wieder stößt er sie weg.
Irgendwann der Moment, nur ein loser Bildfetzen, in dem sein Penis im Mund des kleinen Mannes verschwindet.
Dann wieder Finsternis, bis es draußen endlich hell wird.
Als Lucas endgültig zu sich kommt, liegt er auf der Seite, sieht auf eine weiße Wand mit Raufasertapete, zwei kleine schiefe Bilder, die fleischigen Engel der Sixtina, wie gelangweilte dicke Kinder blicken sie in den Raum und würdigen die beiden nackt unter ihnen liegenden Männer keines Blickes. Lucas kämpft sich auf die Beine, hebt vom Linoleumboden seine Kleidung auf und schwankt ins weiß geflieste Badezimmer. Er übergibt sich. Er spritzt sich Wasser ins Gesicht. Auf seiner Hose stellt er noch mehr Erbrochenes fest. Keine Ahnung, wann das passiert ist. Er versucht es notdürftig in der Badewanne auszuwaschen, zieht sich an.
Als er aus dem Bad schleicht, steht der kleine nackte Mann plötzlich vor ihm, lächelt sein gemeißeltes Lächeln und sieht zu ihm auf.
»Willst du echt schon gehen?«, fragt er.
Lucas stammelt, dass er es eilig habe, entschuldigt sich.
Er hat keine Angst vor dem Kerl, ist sich sicher, ihm im Zweifel körperlich überlegen zu sein, selbst in diesem Zustand, aber allein, dass er sich darüber Gedanken macht, ist Grund genug, um abzuhauen.
Allmählich waren auf St. Pauli die ersten Pfandsammler unterwegs, eingehüllt in dicke Parker, trugen sie Plastiktüten mit den angespülten Schätzen der Nacht umher. Ein wenig wirkten die Straßen wie eine Filmkulisse, in der die letzte Szene längst abgedreht worden war, den Komparsen das aber offenbar niemand mitgeteilt hatte.
Auf Lucas’ Handy tauchte eine Nachricht auf: »In flat i still find vomit … Why u didn’t go to the toilet?«
Ohne zu antworten, steckte Lucas das Handy wieder ein.
Was für eine wirre, versoffene Nacht, dachte er. Ein Selbstexperiment mit eindeutigem Ergebnis, so erklärte er sich das jetzt: Ja, klar, du kannst auch Männer echt schön finden, irgendwie anziehend, aber schwul bist du halt offensichtlich nicht, das hat diese Aktion ja wohl bewiesen. Ein Ausrutscher. Vielleicht wird daraus irgendwann mal eine witzige Partygeschichte … Was war schon groß passiert?
In den Tagen darauf erzählte Lucas in Göteborg zwar seinem Vater von dieser Nacht, überzeugte ihn aber, nicht zur Polizei zu gehen. Andernfalls würden sie ja nur das Eishockeyspiel verpassen, sagte er ausweichend, und das sei es echt nicht wert.
Jahre später wird Lucas eine Psychotherapie beginnen. Noch immer wird er unter den Erinnerungsfetzen leiden und nur allmählich begreifen, dass er keine Chance hatte, dass er keine Mitschuld an alldem trug. Die hatte er sich eingeredet, da er geglaubt hatte, sich so wenigstens keinen Kontrollverlust eingestehen zu müssen.
Inzwischen weiß er, dass er in jener Nacht sexuell missbraucht worden ist.
Aussage des toxikologischen Gutachters, aus dem Urteil vom 03.04.2023:
Insbesondere die Beschreibung des Zeugen vom eigenen Zustand beim Aufwachen im Bett des Angeklagten spreche eindeutig und maßgeblich dagegen, dass der zweite »Filmriss« allein auf Alkohol zurückzuführen sei. In Betracht kämen verschiedene Substanzen, vor allem Benzodiazepine, GHB und GBL – sogenannte K.-o.-Tropfen.
Tag 1, Nachmittag
23.9.2019
Tag 1, Nachmittag
Man sagt das später gerne: Es war wie immer. Ein gewöhnlicher Tag. Aber wie hätte es anders sein sollen? Hätte die Sonne nicht aufgehen dürfen? Hätten Krähen erst tot von Bäumen fallen müssen? Oder wenigstens ein plötzlich stechender Kopfschmerz? Die Dinge geschehen einfach, das tun sie immer.
Der silbergraue VW Passat glitt durch eine Wohnsiedlung am Stadtrand, Klinkerfassaden und Rhododendren in Vorgärten; eine Brücke, die über die dunkelbraune Dumme führte, ein Nebenfluss der Jeetzel, die wiederum als Nebenfluss in die Elbe floss und von dort in die Nordsee, hinaus in die Welt.
Es war ein wolkenverhangener, lautloser Nachmittag. Kurz vor siebzehn Uhr. Isabella bog links ab, am Ortsschild vorbei, vorbei an dunkelgrünen Wiesen und Hängebirken, deren Äste die Straße umarmten. Nur wenige Autos kamen ihr entgegen.
Sie fuhr zu schnell, wie immer. Sie merkte es gar nicht.
Durch den Rückspiegel konnte Isabella ihren vierjährigen Sohn Ben beobachten. Während er in seinem Kindersitz aus dem Fenster sah, bewegten sich seine winzigen Finger auf den Beinen unentwegt auf und ab. Sie musste lächeln. Unübersehbar, dass der schmächtige hellblonde Junge das gleiche Temperament wie seine Mutter in sich trug.
Im Radio lief FFN mit den aktuellen Hits von Ava Ben, Michael Schulte und Pink, nur kurz unterbrochen von der Kult-Comedy-Sendung »Günther, der Treckerfahrer«.
Isabellas neues Zuhause, ein winziges Örtchen, in dessen Richtung sie gerade fuhr, lag in Sachsen-Anhalt. Eine Landschaft aus Mooren und Heideflächen wuchs hier seit Jahrhunderten vor sich hin, in der die Äcker und Wälder so flach dalagen wie alte Teppiche. Auf den Landstraßen begegnete einem manchmal minutenlang kein Auto, so still war es dann, dass man das Kläffen der Hunde auf den Höfen weithin hören konnte.
Niemand, der in dieser Gegend wohnt, würde wohl behaupten, dass hier der Nabel der Welt liege. Selbst irgendeine Studie hatte vor ein paar Jahren die Region bei der Bewertung der Zukunftschancen deutscher Gemeinden nur auf den vorletzten Platz gewählt. Wie zum Beleg blätterte von den Fensterläden der mittelalterlichen Fachwerkhäuschen uralte Farbe ab, und über den einst weißen Putz der Wände hatten sich graue Schatten gelegt. An manchen Hausbalken standen eingeritzt Verse aus vergangener Zeit, so was wie: »Allein auf Gott setz dein Vertrauen, auf Menschen Hülf sollst du nicht baun«.
Ausgerechnet in dieser von Vergangenheit durchdrungenen Gegend hatte Isabella wieder zu sich gefunden. Am anderen Ende der Welt – dem richtigen Ende, wie sie fand.
Seit der Trennung von ihrem Mann war sie damit beschäftigt gewesen, die Scherben ihrer Ehe aufzulesen und zu etwas zusammenzukleben, was halbwegs nach glückendem Alltag aussah. Kurz hatte sie sogar mit dem Gedanken gespielt, ganz zu flüchten – wieder fort aus Deutschland. Bloß wohin? Ganz sicher nicht zurück nach Vigário Geral, in die Favela von Rio, der sie vor ein paar Jahren entkommen war. Wo der Puls der ständigen Bedrohung durch die Straßen schlug, wo nicht eine der bunten Fassaden ohne tiefe Narben auskam. Moloch aus Hitze, Gewalt und Armut. An jeder Ecke konnte man dort den Träumen der Jugend lauschen, die nach Veränderung klangen, bis, kaum als Erwachsener erwacht, alle Sehnsucht in Resignation verdorrte. Der Großteil von Isabellas Familie lebte noch dort, in Vigário Geral. Selbst ihre Mutter – diese starke, kämpferische Frau.
Heimat, das ist doch eine sonderbar widersprüchliche Idee, dachte Isabella, während die Tachonadel sich bei 125 km/h einpendelte. Dinge, die einem so vertraut und sicher scheinen, dass man sie gar nicht wahrnimmt, können einen zugleich erschreckend beengen, sobald sie ins Bewusstsein drängen. Es ist wie mit der eigenen Haut. Wird man sich ihrer bewusst, kribbelt der ganze Leib, und man begreift, dass man ganz und gar von ihr umschlungen ist. Sie lässt sich nicht einfach abstreifen wie ein samtiges Sommerkleid.
Demnach ist die Häutung beim Menschen auch ein ganz anderer Prozess als bei Schlangen. Es ist ein schmerzlicher, geradezu lebensbedrohlicher Vorgang. Man verliert viel Blut. Beim unkontrollierten Sichwinden und Schütteln kann es passieren, dass man auf dem Boden aufschlägt und sich Rippen bricht. Die Schmerzen können so durchflutend sein, dass man sich selbst zu vergessen droht. Ist es überstanden, fühlt man sich eine Zeit lang komplett orientierungslos. Es braucht Wochen, in manchen Fällen Jahre, bis man sich im Spiegel wiedererkennt. Umso nachvollziehbarer, dass sich nicht viele Menschen eine solche Häutung zutrauen.
Isabella aber hatte es gewagt.
Nur zu welchem Preis?, fragte sie sich manchmal.
Eigentlich hatte sie damals während ihres Medizinstudiums als Stipendiatin nur ein Auslandssemester in Deutschland machen wollen. Für den Lebenslauf. Dann hatte sie an der Uni diesen schmächtigen Typen mit randloser Brille kennengelernt, bei einem Stammtisch der brasilianischen Studenten, und sich aus irgendwelchen Gründen verliebt. Sie hatte entschieden, ein Semester länger zu bleiben. Dann noch eins. Und inzwischen waren daraus fast zehn Jahre geworden.
Als sie damals, frisch verliebt, ein Foto von sich und ihrem Freund auf Facebook gestellt hatte, hatte Isabellas Mutter in ihrer typisch augenzwinkernden Art kommentiert: »Hübsches Paar! Meine Enkel werden gut aussehen! (Natürlich ziehen sie zur Oma!)« Und tatsächlich hatte Isabella wenig später geheiratet und 2015 einen Jungen zur Welt gebracht, mit dem gleichen strohblonden Haar wie Mutter und Oma.
Erst jetzt, nach der Trennung, hatte sie begriffen, dass sie einen Großteil ihres Lebens in Deutschland an diesen Mann geknüpft hatte, dass er der Anker gewesen war, der sie hier gehalten hatte.
Seit ihr das klar war, hatte sie sich immer öfter gefragt: Was, außer meinem Job im Krankenhaus und meinem Kind, hält mich jetzt noch in diesem verregneten, immer ernsten Land?
Zunehmend hatte eine giftige Frage in ihr gewuchert: War das schon alles, oder darf ich noch träumen?
Dann, inmitten dieser großen Orientierungslosigkeit, hatte sie im Frühling ausgerechnet hier in dieser deutschen Einöde dieses gemütliche Fachwerkhäuschen mit Klinkerfassade, blauen Fensterrahmen und blauem Gartentor entdeckt, das gerade zur Miete angeboten wurde. Im Inneren Terrakottafliesen, krumme Holzbalken und sonnenblumengelbe Wände. In den Zimmern roch es nach Eichenharz. Eine Mischung aus Scheune, mediterraner Finca und Villa Kunterbunt. Früher war es das Gemeindehaus des Örtchens gewesen. Inzwischen gab es ja aber kaum mehr eine Gemeinde hier.
Hinter dem Haus stand eine winzige Feldsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert, aus deren kleinem Glockenstuhl es regelmäßig hell und lautstark bimmelte. Im Garten gegenüber blühte ein alter, etwas schief gewachsener Kastanienbaum, dessen Früchte im Herbst auf der Straße herumlagen und von nun an nur darauf warten würden, von Ben aufgesammelt zu werden.
Isabella verliebte sich neu – in dieses Haus, in diese Gegend.
Als sie ihrem Ex von ihren Plänen erzählte, beschwerte er sich. Sie dürfe nicht so weit wegziehen. Er habe ein Anrecht darauf, sein Kind zu sehen. Isabella antwortete, dass eine Stunde Autofahrt in Brasilien keine Strecke sei, also solle er hier auch keine daraus machen. Wie froh sie in diesem Moment war, der ständigen Gereiztheit dieses inzwischen so dauerunzufriedenen Mannes nicht mehr Tag für Tag ausgesetzt zu sein. Sie hatte seinen ständigen Missmut nicht mehr ertragen, der schleichend nach dem Studium von ihm Besitz ergriffen hatte. Zugleich hatte er sich allmählich als Macho entpuppt, der ihr vorschreiben wollte, dass sie weniger arbeiten und sich mehr um Ben kümmern solle.
Beim Einzug in das Landhäuschen im April hing Isabella als Erstes ein postkartengroßes Gemälde in einem unbehandelten Birkenholzrahmen in den Flur: ein Fischerbötchen mit grünem Steuerhaus, das Segel eingeholt, der kleine dicke Mast in den von Sturmwolken verhangenen Himmel zeigend. Tapfer kämpfte der Kahn gegen die Wellen, die schäumend gegen seinen Bug schlugen und ihn Richtung Ufer trieben. Isabella hatte das Bild bei einem Ausflug auf Usedom gemeinsam mit ihrem Ex gekauft. Bei der Trennung hatte er es behalten wollen, wie er alles hatte behalten wollen – am liebsten ja auch sie. Aber Isabella hatte sich durchgesetzt.
Ein Neuanfang – auch wenn sie sich eingestehen musste, jetzt, wo sie darüber nachdachte, dass sie sich ihr Leben anders vorgestellt hatte. Nicht als alleinerziehende Mutter in dieser so verlassenen, stillen Gegend. Als Jugendliche hatte sie sich noch durch die Metropolen dieser Welt flanieren gesehen: New York, Paris, Berlin, Tokio. Aber was änderte das schon? Am Ende stranden alle irgendwo, gezogen durch die naturgewaltige Kraft des Zufalls.
Isabella war ein Mensch, dem erst Herausforderungen Flügel wachsen ließen. So hatte sie auch ihr Medizinstudium nicht aus humanitärem Eifer gewählt oder weil der menschliche Körper sie so fasziniert hätte – es war schlicht, weil ihr Vater einmal erwähnt hatte, dass Medizin ein besonders schwieriges Studienfach sei. Das hatte ihren Ehrgeiz geweckt. Inzwischen stand sie kurz vor ihrer Facharztprüfung zur Kardiologin. Operationen am Herzen. Alles oder nichts. Den Tod besiegen oder ihm erliegen.
Sie war fast zu Hause.
Sie fuhr noch immer schnell genug, dass sich in ihrem Augenwinkel der Straßenrand zu einem abstrakten grünen Landschaftsbild verzog.
Kurz vor dem Ortsschild klingelte Isabellas Handy. Für einen Sekundenbruchteil schwenkte ihr Blick von der Straße zur Mittelkonsole des Passats. Der Name »Jess« tauchte auf dem Handybildschirm auf; Jasmin – die neuste Ex-Freundin von Isabellas acht Jahre jüngerem Bruder Gabriel. Seltsam. Isabella hatte mit dieser hübschen, etwas labilen jungen Frau eigentlich nichts zu schaffen; erst recht nicht, seitdem sich die beiden vor ein paar Monaten getrennt hatten.
Ein hohles Gefühl breitete sich unter Isabellas Brustbein aus. Sie hatte keine Lust, mit Jasmin zu sprechen, sie heftete ihren Blick wieder auf die Straße, über Jahrzehnte verblasste Mittelstreifen zogen unter ihr vorüber. Sie ließ es klingeln, einmal, zweimal …
Gabriel hatte Jasmin in der IT-Firma kennengelernt, in der er inzwischen arbeitete. Vor gut zwei Jahren, und nach einiger Überzeugungsarbeit, war er aus Rio de Janeiro zu Isabella nach Deutschland gezogen. Anfangs hatte er noch bei ihr gewohnt, hatte sich um Ben gekümmert, während sie wieder im Krankenhaus arbeitete. Ihrem damaligen Mann allerdings war Gabriels ständige Anwesenheit irgendwann auf die Nerven gegangen. Es war zu Streitereien gekommen, die im Nachhinein betrachtet sicherlich mitentscheidend waren für die Trennung.
Nachdem Gabriel etwa ein Jahr bei ihr in Deutschland gelebt hatte, hatte er schließlich ein Jobangebot erhalten und war dafür nach Hamburg gezogen, und kurz darauf war er mit Jasmin zusammengekommen.
Noch im Oktober letzten Jahres war Isabella mit den beiden nach Schottland gereist. Schon da hatte sie bemerkt, dass Jasmin nicht wirklich zu ihrem Bruder passte, auch wenn die beiden sich selbst noch sicher waren, füreinander die große Liebe zu bedeuten. Ständig hatten die zwei gestritten, bis Gabriel nicht unweit der berühmten Burgruine von Glasgow über nasses Kopfsteinpflaster hinweg davongelaufen war.
Isabella kannte ihren Bruder, wusste, er würde sich nur kurz beruhigen müssen und dann vermutlich mit irgendeinem dummen Spruch auf den Lippen zurückkommen und so tun, als sei nichts gewesen. Aber Jasmins anfängliches Schluchzen hatte sich mitten auf der Straße rasch zu einem haltlosen Geheul ausgeweitet. Und noch bevor Isabella sie hätte zurückhalten können, war sie Gabriel nachgerannt.
Selbst jetzt noch musste Isabella bei dem Gedanken daran schmunzeln.
Eigentlich war Jasmin eine ruhige, zurückhaltende Frau, achtundzwanzig Jahre alt, sensibel, melancholisch, manchmal geradezu depressiv, was sie irgendwie auch geheimnisvoll erscheinen ließ. Sie hatte langes rotes Haar, pudrig weiße Haut, trug meist Rouge auf den Wangen, und wenn sie ihr zartes, oft nur angedeutetes Lächeln aufsetzte, blitzten feine Grübchen auf. Sie war groß und schlank und würde mit ihren grünen Augen eine wunderbare Iara abgeben – eine brasilianische Sirenengestalt, die in den Flüssen des Regenwalds lebt, wo sie bei Mondschein mit so rührender Stimme singt, dass Männer ihr bis auf den Grund des Wassers folgen. Isabella hatte gut verstanden, was ihr Bruder an dieser Frau gefunden hatte.
Drei, vier …
Isabella atmete einmal durch, dann nahm sie doch das Handy aus der Mittelkonsole. Sie versuchte freudig überrascht zu klingen: »Wie schön, Jess! Wie geht’s dir?«
»Hast du was von Gabriel gehört?«, fragte Jasmin unumwunden. Ihre Stimme klang zart und gehaucht wie immer, aber etwas Nachdrückliches lag darin, das Isabella überraschte.
Das letzte Mal hatte sie mit Gabriel vor ein paar Tagen auf WhatsApp geschrieben. Wegen einer SD-Karte für eine GoPro-Kamera, die sie ihrer Mutter zum sechzigsten Geburtstag schenken wollten. Es war ein großes Fest geplant, zu dem halb Rio eingeladen war. Isabellas Mutter sprach seit Wochen von nichts anderem mehr. Im Gegensatz zu Isabella liebte es ihre Mutter, im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit zu stehen und sich feiern zu lassen. Isabella hielt sich selbst lieber zurück, sprach leise und wenig – besonders für eine Brasilianerin. Was nicht hieß, dass sie ein unsicherer Mensch war. Vielmehr trug sie die Gewissheit in sich, so gut wie immer genau zu wissen, was zu tun war, erst recht in schwierigen Situationen. Sie sah einfach keine Notwendigkeit darin, sich selbst darzustellen.
Isabella und Gabriel hatten für die Geburtstagsparty ihrer Mutter Flugtickets für den 4. Oktober gebucht, Alitalia, von Frankfurt über Rom nach Rio. Erst wollte Gabriel nicht mitkommen, er hatte sich mit ihrer Mutter einige Wochen zuvor zerstritten, ihr die Schuld für die Trennung von Jasmin gegeben. Aber im letzten Moment hatte er sich besonnen.
»Wieso willst du das wissen?«, fragte Isabella am Telefon. »Habt ihr wieder Kontakt? Ist was passiert?«
Isabella hatte absolut kein Interesse daran, in das Liebesleben ihres Bruders hineingezogen zu werden. Zuletzt war es ein quälendes Hin und Her gewesen zwischen den beiden. Ihr Bruder hatte am Ende leidend ausgesehen wie ein ausgesetzter Welpe. Seine Lider hatten ebenso kummerschwer gehangen wie seine Schultern, und sein großer definierter Körper wirkte zusammengefallen und war ein wenig aus der Form geraten. Als er Isabella vor ein paar Wochen beim Umzug in das Landhäuschen mit den blauen Fenstern geholfen hatte, hatte er sich ausgiebig beschwert, wie einsam er sich fühle in diesem immer trüben Deutschland und dass er seit der Trennung die meiste Zeit allein in seiner Einzimmerwohnung herumsitze. Alles klang nach Vorwurf. Als sei Isabella schuld an seiner Orientierungslosigkeit, weil sie ihn hergelockt hatte. Dabei hatte es Gabriel in Deutschland anfangs gut gefallen. Er mochte die Ordnung hier. Ständig hatte er Isabella ermahnt, sie solle den Müll trennen, weil sich das so gehöre. Du bist so caótico, hatte er ihr gesagt. Isabella hatte erwidert: »Und du bist der Deutscheste aller Deutschen!« Da hatte er gelacht und ein bisschen stolz ausgesehen.
Seit Kurzem aber wirkte Gabriel wieder ausgeglichener und selbstzufriedener. Bei seinem letzten Besuch hatte er sogar eine neue Frau erwähnt, deren Namen Isabella inzwischen aber wieder vergessen hatte. Er meinte, es sei noch zu früh, um wirklich von ihr zu erzählen. Er müsse erst mal sehen, wie sich das alles entwickele, dabei aber hatte er gegrinst und dann rasch das Thema gewechselt.
»Der Chef von Gabriel hat mich vorhin angerufen«, sagte Jasmin jetzt. »Er macht sich große Sorgen. Gabriel ist den ganzen Tag nicht aufgetaucht. Er hat sich weder krankgemeldet noch sonst wie entschuldigt. Ich habe schon versucht, ihn zu erreichen. Er geht nicht ans Handy. Das ist doch überhaupt nicht seine Art.« Isabella bedankte sich mit tonloser Stimme für den Anruf, legte auf und rief direkt selbst bei Gabriel an. Mailbox. War ihr Geist eben noch ganz auf einen gemütlichen Feierabend mit ihrem Sohn eingestellt gewesen, fühlte sie sich jetzt auf einmal wieder hellwach, als hätte sie zwei Koffeintabletten auf einmal geschluckt. Sie umgriff das Lenkrad mit beiden Händen so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Sie wendete den VW Passat mitten auf der Straße, dabei wach und klar, als hätte ihr jemand ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet.
»Mama, wohin fahren wir?«, fragte Ben auf dem Rücksitz. Seine helle Stimme klang weniger besorgt als vielmehr überrascht.
»Nach Hamburg. Wir müssen kurz nach Onkel Gabriel sehen«, antwortete Isabella auf Portugiesisch und drückte das Gaspedal weiter durch.
An jenem Tag verwelkten am Straßenrand bereits die rosafarbenen Blüten der Wegerich-Grasnelken, die hier überall zwischen Feldern und Asphalt wucherten. Später würde Isabella zwar nicht mehr sagen können, ob sie an diesem Tag ihr Haar, wie sonst, zum Zopf gebunden oder welche Kleidung sie getragen hatte, aber für immer würde sie sich an das Gefühl jenes Moments erinnern können – das Gefühl der Beklemmung, das Gefühl, nicht mehr schlucken zu können.
***
Am Vormittag desselben Tages: Alles, alles fühlte sich verdammt weit weg an – sogar er selbst. Er spürte sich nicht mehr.
Als Fabio sich mühsam in seinem Bett aufrichtete, in das kahle Zimmer blickte, war das Erste, worauf er achtete, ob noch irgendwo Blut klebte. Was er sah: den Saum der weißen Gardinen, die müde über dem Boden schleiften, den schwarzen Acapulco-Sessel, den babyblauen Staubsauger, die IKEA-Kleiderstange TURBO, an der seine bunten Hemden hingen, die Ärmel noch vom Tragen bis zum Ellbogen hochgekrempelt, vier aufeinandergestapelte Aufbewahrungsboxen mit T-Shirts und Unterwäsche, darüber einen rahmenlosen Spiegel an der Wand, dann die einst weiße, inzwischen vergilbte Tür zum Flur und schließlich, links von ihm an der Wand, zwei kleine schiefe Bilder ‒ die fleischigen Engel der Sixtina, wie gelangweilte dicke Kinder sahen sie in den Raum hinein. Aber kein Blut.
Bis auf einen etwas ramponierten Nachttisch waren auch sonst keine Spuren mehr auszumachen. Er hatte offenbar alles gereinigt und aufgeräumt, bevor er gestern Abend zu seiner Schicht ins Krankenhaus gegangen war. Er konnte sich nicht erinnern. Sein Körper hatte im Autopiloten gehandelt, während der Verstand sich verflüchtigt hatte, wohin auch immer, um nicht zu bersten. Und vorgestern? Vorgestern war alles in Ordnung gewesen. Vorgestern war Fabio ein anderer gewesen.
Das Zimmer begann sich um ihn zu drehen, so als hätte er sich zu schnell im Bett aufgerichtet. Er spürte Tränen auf seinem Gesicht. Sie flossen aus seinen bernsteinfarbenen Augen, über die in den letzten Jahren allmählich gewachsenen Tränensäcke, die noch jungenhaft rosigen Wangen, bis sie im fast vollständig ergrauten Fünftagebart versickerten, der seinem Gesicht eine gewisse Eleganz verlieh, die es früher nicht besessen hatte.
Düstere Erinnerungen stiegen ihm in den Kopf wie selbst gebrannter Schnaps. Zum Schwindel gesellte sich die Übelkeit.
Er griff nach dem Handy auf dem demolierten, schiefen Nachttisch. Eine Nachricht von Mama: »Buongiorno Fabio buona domenica qui tutto bene. Nuvoloso e un po aria fredda tanti bacioni mamma.« (Guten Morgen Fabio, hier ist alles gut. Bewölkt und ein wenig kalte Luft, viele dicke Küsse, Mutti.)
Sie schrieb ihm jeden Morgen mehr oder minder die gleiche SMS, und er antwortete ihr mehr oder minder das Gleiche: »Buongiorno qui tutto bene sole bacioni a voi.« (Guten Morgen, hier alles gut, Sonnenschein, große Küsse an euch.)
Er stieg aus dem Bett, schlurfte in sein weiß gekacheltes Bad, pinkelte, stellte sich in die Duschwanne, ließ Wasser über die Schürfwunden auf seiner behaarten Brust laufen. Er hielt sich die Hand prüfend vors Gesicht. Sein Daumen war ziemlich angeschwollen, unter dem Nagel hatte sich Blut gestaut, doch Bissspuren konnte man glücklicherweise keine erkennen. Prüfend drückte er mit der anderen Hand auf den Nagel, doch er spürte nichts. Nicht einmal, ob das Wasser die richtige Temperatur hatte.
Er drehte den Hahn zu und zog sich an. Der Schwindel hatte etwas nachgelassen. Er schluckte seine Tablette, Genvoya, 150 mg. Er zwang sich, nicht an den anderen Körper in seiner Wohnung zu denken – auch wenn kein anderer Gedanke möglich schien.
Es dauert nur Augenblicke, eine Welt auszulöschen.
Bald trieb ihn die Stille in den Wahnsinn.
Er kontrollierte die Uhrzeit auf dem Handy, er würde noch Stunden aushalten müssen, bis er wieder zur Arbeit würde gehen können.
Im Wohnzimmer lief er auf und ab, ging in die Küche und zurück, jede Bewegung war ihm so fremd, als steckte er in einem rostigen Astronautenanzug. Selbst zu atmen fühlte sich unnatürlich an. Er ging erneut ins Bad und übergab sich.
Nachdem er den Mund ausgespült hatte, fiel er wieder aufs Bett und schrieb Aatu. Er hatte ihn seit Tagen nicht gesehen. Es schien, als wollte Aatu sich wieder einmal von ihm fernhalten. Er hatte ab und an solche Phasen, in denen er Fabio offenbar das Gefühl vermitteln wollte, dass er ihn nicht länger in seinem Leben wünschte. Meist verging das nach ein paar Tagen. In letzter Zeit aber wurden diese Phasen länger und folgten in immer kürzeren Abständen. Es blieb ein ewiger Kampf um Aatu. Ein Kampf, der Fabio zunehmend zermürbte. Er wollte von diesem Kerl doch einfach nur geliebt werden. Was an ihm war so falsch, dass das anderen Männern nahezu unmöglich zu sein schien?
Die Beziehung, oder was immer das zwischen ihnen beiden war, hatte sich von Anfang an als unnötig kompliziert erwiesen.
Fabio hatte Aatu vor einem Jahr auf Tinder kennengelernt. Für ihr erstes Date hatten sie sich an den Landungsbrücken verabredet, waren entlang der Promenade spazieren gegangen; vor ihnen die Glasfassade der Elbphilharmonie, die sich wie ein riesiger Kristall in den Himmel streckte. Darunter die ölige grünlich blaue Brühe des Elbkanals. Aatu lebte damals erst seit Kurzem in Hamburg. Er stammte aus Finnland und hatte hier eine Stelle als Englischlehrer angetreten. Er trug weißblondes Haar, war blass, deutlich größer als Fabio, was nicht sonderlich schwer war bei 1,68 Metern. Fabio stand auf diesen nordischen Typ. Er hatte sich wirklich schnell verknallt.
Vielleicht darum hatte Fabio gegenüber Aatu zuerst behauptet, er arbeite als Arzt. Aber so recht hatte Aatu ihm das von Anfang an nicht abgekauft, und bald hatte er rausbekommen, dass Fabio in Wahrheit sein Geld als Pfleger verdiente. Das war die erste Lüge. Es waren weitere dazugekommen. Geschichten, mit denen Fabio versucht hatte, Aatu zu beeindrucken. Stattdessen hatte er in Rekordzeit dessen Vertrauen verspielt, weswegen er inzwischen bei so ziemlich allem, was er erzählte, nur noch Aatus misstrauischen Blick erntete. Es war frustrierend.
Anfangs hatten sie noch intensiven, leidenschaftlichen Sex gehabt. Aber auch damit war es längst vorbei. Wenn er Aatu überhaupt noch überreden konnte, die Nacht bei ihm zu verbringen, schliefen sie meist schweigend und eng aneinandergeschmiegt ein. Fabio sog Aatus Geruch ein. Aatu roch frisch und kühl, wie ein Nadelwald im Winter. Ti voglio bene come un amico …Ich liebe dich, wie einen Freund. Ihm hatte das vorerst ausgereicht, und jetzt gerade sehnte er sich mehr denn je danach.
»Wie geht’s dir?«, schrieb er Aatu. Die Antwort kam rasch, kurz und belanglos, keine Gegenfrage.
Fabio fragte, ob sie sich treffen könnten.
Aatu wiegelte ab.
»Ich würde jetzt gern deine Stimme hören«, versuchte es Fabio weiter.
Aatu schrieb, das gehe gerade wirklich nicht.
Fabio warf das Handy zwischen seine Beine auf die Matratze. Er hatte nicht den Nerv, länger rumzubetteln.
Um kurz vor elf Uhr klingelte es an der Tür. Fabio fuhr zusammen. Die Übelkeit kam mit einem Schlag zurück. Kurz wurde ihm schwarz vor Augen.
Dann erinnerte er sich, dass seine Nachbarin, die gute alte Babette, mit der er ab und an ins Kino ging, um gemeinsam alte französische Filme anzusehen, ihn gestern noch vorgewarnt hatte, dass heute Handwerker zu allen Mietern der Wohnanlage kämen.
Es klingelte ein zweites Mal. Länger und nachdrücklicher.
Wie ferngesteuert schlich Fabio zur Tür, öffnete. Der Typ vor ihm hatte gewaltige fleischige Ohren und trug eine Leiter unterm Arm. Hinter ihm stand noch ein weiterer Mann, den Fabio aber gar nicht erst weiter beachtete.
»Moin!«, rief der Typ mit den Fleischohren ausgelassen. »Wir sind wegen den Rauchmeldern hier.«
Fabio kämpfte dagegen an, den beiden vor die Füße zu kotzen. Er nickte, ließ sie eintreten.
Ohne viele Worte und mit einstudierten Handgriffen löste der Kerl mit den Fleischohren im Schlaf- und Wohnzimmer die alten Rauchmelder von der Decke und schraubte neue an, während der andere danebenstand und zuschaute. Waren die beiden nur deswegen gemeinsam unterwegs, um sich im Zweifel gegenseitig Schutz bieten zu können?, fragte sich Fabio. Die Handwerker bewegten sich wie selbstverständlich durch seine Wohnung. Er starrte ihnen nach, spürte ein taubes Kribbeln in seinen Fingern und Beinen. Gut möglich, dass sein Kreislauf jeden Moment kollabieren würde.
Schließlich öffnete der Kerl mit den Fleischohren die Tür zum Gästezimmer, in dem im Grunde nur zwei Schränke mit etwas Kleidung herumstanden. Fabio blieb im Flur. Er bebte am ganzen Leib, bekam kaum Luft, röchelte wie ein Asthmatiker, biss sich auf die Innenseite seiner Wangen, bis er einen metallenen Geschmack schmeckte. Er kämpfte gegen die Ohnmacht an.
Hatten die beiden noch immer nicht die Matratze bemerkt, die direkt neben der Tür an der Wand lehnte, unter der offenbar etwas ziemlich Großes schlaff und leblos verborgen lag?
Sie mussten sie bemerken.
Jeden Augenblick.
Fabio zwang sich, im Flur lauschend, langsam ein- und auszuatmen, und doch hatte er das Gefühl, unter Wasser zu stehen und gerade zu ersticken.
Die beiden Handwerker blieben stumm.





























