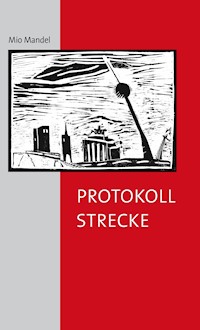
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was war das für ein Land, die DDR? Welche großen und kleinen Geschichten spielten sich darin ab, und wie sieht das Leben seiner einstigen Bewohner heute aus? Ist alles Erlebte von damals jetzt schon nichts weiter als Erinnerung? In den Erzählungen dieses Bandes lässt Mio Mandel den Alltag der DDR lebendig und gegenwärtig werden. Manchmal lakonisch und mit trockenem Humor, dabei immer präzise, einfühlsam und dicht dran an ihren Protagonistinnen, schildert sie eindringlich, wie sehr gesellschaftliche und individuelle Realität miteinander verwoben waren, und macht uns deutlich, wie lebendig die Vergangenheit in der Gegenwart noch immer ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mio Mandel
Protokollstrecke
Impressum
© Mio Mandel 2014 | www.mio-mandel.de
Holzschnitt: Claudia Schön nach einer Idee von Mia Wintel
Gestaltung: BILDART
ISBM 978-3-7323-1116-3 (Paperback)
ISBN 978-3-7323-1117-0 (Hardcover)
ISBN 978-3-7323-1118-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autoren unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationabbliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie, detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http:/dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Geschichten sind mir so oder so ähnlich einfach passiert. Ich habe sie nicht als Journalistin aufgeschrieben, sondern als Autorin – und mir alle damit verbundenen künstlerischen Freiheiten genommen.
inhalt
Protokollstrecke
Enrico
Späte Post
Die Übung
Das Versprechen
Oststifte
Der rote Kurt
Reibungslose Bereitstellung
Schwarzweiß
Es gefällt uns hier
Wie immer
Goldene Mitte
Männergeschichten
Protokollstrecke
1977 lebten wir im Zentrum von Berlin, an der Kreuzung, die drei Stadtbezirke voneinander trennte: Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Es war die größte Kreuzung der Stadt. Eine mit eigenen Spuren für Linksabbieger, Straßenbahngleisen, Bushaltestellen und Ampeln.
Der weiße Neubaublock, in dem wir wohnten, gehörte zu Mitte, deshalb fühlten wir Kinder uns als etwas Besseres. Wir lebten schließlich direkt am Alex. Die aus dem Prenzlauer Berg waren stolz auf ihren Wasserturm, die Gasometer und den kleinen Friedhof hinter der Schule. Und die Hainis, also die aus Friedrichshain, die prahlten mit dem Bunkerberg und der Knochenrodelbahn im Winter. Was war das schon im Vergleich zum Fernsehturm? Wir hatten die Westtouristen auf dem Alex und die Grenzübergangsstelle nach Westberlin, die anderen die Arbeiter vom Gaswerk in der Greifswalder Straße.
Nur eins hatten wir alle gemeinsam: Viktor 70, ein Polizist, der ein Auge auf uns warf, weil er diese Kreuzung bewachte. Wir lebten schließlich an der Protokollstrecke. Wenn Erich Honecker morgens aus Wandlitz zum Staatsratsgebäude fuhr, standen alle Ampeln auf Rot. Der wichtigste Mann des Staates sollte keine Zeit verlieren. Fuhr er kurz nach sieben zur Arbeit, verspäteten sich ganze Schulklassen. Typisch für die Protokollstrecke war, dass unser Rosenbeet zwischen dem Haus und Gehweg immer gepflegt vor sich hin blühte. Kein Butterbrotpapier wehte über die Bürgersteige. Die Müllkörbe waren leer. Die Telefonzellen poliert. Vor allem aber wachte an unserer Kreuzung von morgens bis abends bei jedem Wetter Viktor 70, unser Polizist mit Funkgerät und Pistole. Sommer wie Winter. Er schien nie zu schwitzen oder zu frieren. Er gehörte zum Viertel wie die Litfasssäulen. Immer stand er vor einem hüfthohen grauen Metallkasten, den nur er aufschließen konnte, um darin die Ampelanlage zu bedienen. Wenn die kleine Klappe offen stand, sahen wir im Kasten die leuchtenden grünen und roten Lampen. Unter den Lampen waren Kippschalter. Mit diesen Schaltern regelte Viktor 70 unser Leben. Er konnte die Grünphase in Mitte beenden und den Autos aus dem Prenzlauer Berg die Vorfahrt geben.
Wir rannten oft zum Bäcker, um durch die Scheiben Brötchen kauend zu beobachten, ob Viktor 70 den Straßenbahnfahrer warten ließ oder vorausschauend grün gab.Einmal selbst drücken dürfen … Manchmal tat Viktor 70 so, als würde er uns nicht bemerken. Er würdigte uns keines Blickes. Wir schlichen dann aus unserem Bäcker-Versteck und wagten uns in seine Nähe. Der Kreuzungspolizist hieß bei uns Viktor 70, weil sein Funkgerät so nach ihm rief. Wenn Viktor 70 angefunkt wurde und wir zufällig hinter ihm entlang schlenderten, dann konnten wir erlauschen, wo der wichtigste Mann der DDR sich gerade befand:
»Weiß…ee« oder »Prenz…auer … Viktor 70 hören?«
Viktor 70 hörte und betätigte die roten Knöpfe. Die grünen Lämpchen verloren ihr Licht. Es dauerte genau sechzig Sekunden bis zum völligen Kreuzungsstillstand. Wenig später sauste ein Polizeifahrzeug heran, gefolgt von zwei schwarzen Limousinen, dahinter ein Streifenwagen. Der Protokollstreckenpolizist drückte jetzt die grünen Knöpfe. Aber nicht alle auf einmal. Er durfte bestimmen, welcher Stadtbezirk als erstes wieder losfahren würde. Wir Kinder schlossen Wetten ab, aber es kam meistens anders. Ob er uns gehört hat?
Viktor 70 lächelte nie. Er sprach auch nicht mit uns. Viktor 70 stand gerade vor seinem Kasten und ignorierte uns Kinder wie die Wachsoldaten am Mahnmal unter den Linden. Unter diesem Nicht-Blick wuchs ich auf. Viktor 70 gehörte zu meinem Leben wie mein großer Bruder und Thomas aus dem fünften Stock.
Thomas kannte ich aus dem Kindergarten. Wir hatten gemeinsam den Salzgehalt von Popel bestimmt, im Sand gewühlt und waren zusammen eingeschult worden. Jetzt vertrieben wir uns die Wartezeit an der roten Ampel mit Vorhersagen, ob Honecker diesmal in der ersten oder zweiten Limousine sitzen würde. Und wenn er vorbeisauste, dann versuchten wir, ihn im ersten oder zweiten Wagen zu entdecken. Manchmal winkte Honecker uns tatsächlich zu, obwohl kein Feiertag war. Aber das kam selten vor.
Thomas sorgte dafür, dass mein erster ernst gemeinter Schreibversuch veröffentlich wurde. Ich hatte nach der Schule die Schreibmaschine meiner Mutter in mein Zimmer geschleppt und plante, etwas Wichtiges zu schreiben. Aber worüber? Ich wollte berühmt werden, wie die Wissenschaftler, deren Texte meine Mutter korrigierte. Ich tippte einfach drauf los:
»Achtung! Achtung! Wir haben Sie beobachtet. Zahlen Sie 20 Marg oder wir gehen zur Polizei. Umschlack bei den Rohsen!«
Es war der Anfang für meinen ersten Roman. Thomas klingelte und wir gingen in mein Zimmer. Er las und fand die Forderung stark. Mehr davon! Ich wollte weiter schreiben, aber er meinte, dass das reicht. Ich müsse nur die Zeilen noch ein paar Mal abschreiben.
Ich tippte den Text noch dreißig Mal. Thomas zerschnitt die Blätter. Dann tranken wir rote Brause. In unserem Häuserblock lebten Mitarbeiter der Botschaft, ein Schauspieler, der im Polizeiruf 110 mitspielte, und viele Akademiker. Aber auch ganz normale Leute wie unsere Eltern. Wir rannten die Treppen hinunter ins Erdgeschoss und setzten uns auf die Heizung vor den Briefkästen, bis die Luft rein war. Unsere Post bekamen nur die besonderen Mieter. Danach gingen wir zum Bäcker und beobachteten das Rosenbeet und Viktor 70. Jetzt passten wir auch auf, was sich sehr erwachsen anfühlte.
»Der Schauspieler hat bestimmt wat ausjefressen. Der zahlt!«, versicherten wir uns gegenseitig.
Honecker fuhr nach Hause. Viktor 70 hatte Feierabend. Ansonsten passierte nichts. Wir ließen das Rosenbeet nicht aus den Augen, kauften ein halbes frisches Brot und pulten Stücke aus dem Laib. Wir warteten, aßen, kauften noch ein Brot, hatten irgendwann Bauchschmerzen. Ins Rosenbeet lief niemand. Die Straßenlaternen warfen bereits Licht auf die Kreuzung. Zeit nach Hause zu gehen.
Meine Eltern mussten unerwartet zu einer Hausversammlung. Noch an diesem Abend. Danach standen beide vor meinem Bett und meine Mutter fragte:
»Hast du das …? Auf meiner Maschine?«
Meinen Eltern war wichtig, dass nicht gelogen wurde. Ich gab alles zu. Mein Vater ging wieder zur Hausversammlung, meine Mutter korrigierte die Rechtschreibung.
Ich bekam Fernsehverbot für Sonnabend. Fernsehverbot, das war hart, denn am Sonnabend kam immer ein Kinderfilm bei Professor Flimmrich.
Im Hof waren wir danach ein bisschen die Stars. Wir wurden am Klettergerüst vorgelassen. Jeder wollte wissen, ob es Kloppe gegeben hatte und wurde enttäuscht.
»Kloppe? Nee!«
In der Schule drehte sich alles um unsere Zukunft. Wir waren in der vierten Klasse und unsere Lehrerin fragte jeden von uns nach seinem Berufswunsch. Niemand mochte wie Viktor 70 zweimal am Tag, den Verkehr aufhalten, weil Erich Honecker vorbeifahren würde. Ich wollte Lehrerin werden, einen Bienchenstempel und eine eigene Klasse haben, die dann den ganzen Tag machen würde, was ich wollte. Thomas meldete sich als Kosmonaut. Er mochte Star Wars. Die Serie lief im Westfernsehen. Er konnte schlecht Sternenkrieger als Berufswunsch angegeben.
Meine Eltern legten Wert darauf, dass ich in der Schule über alles reden kann. Darum gab es bei uns kein Westfernsehen. Auch nicht abends, wenn ich im Bett lag. Ich hätte ja etwas hören können und dann lügen müssen. Ich wuchs ausschließlich mit dem Fernsehen der DDR auf, wusste dennoch bestens Bescheid. Ich konnte die Star-Wars-Melodien pfeifen. Ich hörte ja alles aus der Nachbarwohnung. Und Thomas erzählte mir die Details der Folgen. Thomas wollte sich auf seinen Beruf vorbereiten. Sternenkrieger.
Wir besorgten Munition und Waffen. Sein Fenster im fünften Stock war der perfekte Hinterhalt. Hier stopften wir Tempolinsen in unsere Strohhalme und verteidigten pustend den Weltfrieden in unserem Neubaublock gegen die Imperialen, also die Touristen vom Alex und alle, die noch so im Hof herumliefen. Wir spielten: Krieg der Sterne, zielten mit dem Strohhalm, schossen und trafen mit kleinen Linsen die Feinde, zu denen auch Abgeordnete der Volkskammer und Ausländer gehörten, die hier studierten. Wie im richtigen Film gingen wir in Deckung, wenn die Opfer ihren Blick in unsere Richtung warfen, empört nach dem Schützen suchten. Aber sie sahen nur das eine offene Fenster. Die Tempolinsen lösten sich nicht in Luft auf. Sie blieben unter Thomas‘ Fensterreihe liegen und häuften sich dort.
Unsere Eltern mussten am Abend wieder zu einer Hausversammlung. Vorher fragten sie mich, ob ich eine Ahnung hätte? Hatte ich nicht. Wenig später standen sie mit dem Volkskammerabgeordneten aus dem siebten Stock und einem Chilenen in meinem Zimmer. Ich entschuldigte mich, akzeptierte das Fernsehverbot und nach der Schule den Stubenarrest. Am schlimmsten aber war die Aussage meines Bruders: »Ihr seid ja blöder als die Hilfsindianer vom Prenzlauer Berg.« Als Kosmonaut möchte man nicht mit einem Indianern verglichen werden.
Erst am Sonntag durfte ich wieder mit Thomas spielen. Weil frische Luft gesund ist. Vielleicht wollten meine Eltern einfach nur in Ruhe Mittagsschlaf machen. Wer weiß. Das Leben hatte uns wieder vereint, und wir liefen wie ein altes Ehepaar um unseren Häuserblock, werteten die erzieherischen Maßnahmen unserer Eltern aus und verfolgten rauchende Touristen aus dem Westen. Wir hatten beobachtet, dass sie ihre Zigaretten nie zu Ende rauchten und die Kippen einfach wegwarfen. An diesem Tag bargen wir wertvollen Resttabak. Aber nur, weil Viktor 70 uns nicht sehen konnte. Er hatte frei. Am Wochenende kam kein Honecker.
Was tun? Star Wars spielen, ohne schießen zu dürfen … Hilfsindianer. Blöder als die vom Prenzlauer Berg. Thomas hatte gehört, dass die Hainis schon lange an einer Rakete bauten. Raketen – das war es! Wir pulten den Resttabak aus den gefundenen West-Zigaretten, rollten ihn in Zeitungspapier und rauchten Backe. Unsere Zigaretten waren bestimmt besser als die Duett meiner Eltern.
Den ganzen Nachmittag zogen wir durch die Flure der Häuserblocks. Wir besuchten sogar das Hochhaus mit der Bücherei und wagten dort zum ersten Mal einen Blick hinter die Stahltür, die den Keller vom Treppenhaus trennte. Dort fanden wir die optimale Verpackung für unsere Rakete, ein Rohr aus dicker Pappe. Wir mussten jetzt nur noch zwei Flügel ankleben, Brennbares hineinstopfen und dann … Wir durchsuchten unsere Wohnungen. Ich holte die Kneifzange meines Vaters und plünderte die Streichholzvorräte meiner Mutter. Unser Neubaublock hatte Zentralheizung, aber gekocht wurde bei uns mit Stadtgas. Meine Mutter hortete die Zündholzschachteln hinterm Vorhang im Flur. Dort gab es ein Holzregal mit dem Telefon und den Lebensmittelvorräten: Tempolinsen, Kurz-Koch-Reis und ein Karton mit Streichholzschachteln. Zehn Packungen weniger, das fiel gar nicht auf. Ich nahm zwölf.
Zurück im Hausflur köpften wir die Zündhälse und füllten unser Rohr. Obendrauf kamen Sägespäne vom Hamster, Zeitungspapier, Waschpulver, leere Patronen aus dem Füllfederhalter. Weil es spät geworden war, beschlossen wir, unsere Rakete an diesem Abend nicht mehr starten zu lassen.
Tags drauf, in der Schule, erzählten wir allen von unserem Vorhaben. Die Hainis prahlten mit ihrer Rakete. Sogar Kohleanzünder hatten sie eingebaut. Wir dagegen verrieten unsere Mixtour nicht, und die vom Prenzlauer Berg machten lange Gesichter.
Wir gaben ihnen nach der Schule zwei Stunden. Gegen vier würden wir uns alle im Friedrichshain auf dem Bunkerberg treffen. Dann würde die ganze Welt sehen, wer der bessere Raketenbauer war: wir aus Mitte oder die anderen.
Thomas und ich rannten zur Drogerie am Alex und hatten Glück. Sie hatten Kohleanzünder, und neben der Kasse entdeckte ich Wunderkerzen. Wir fragten nach dem Preis, zählten unser Geld und kauften eine Wunderkerze für zehn Pfennige und eine Tüte Anzünder für dreißig. Dann eilten wir wieder nach Hause, öffneten unter der Kellertreppe unser Geschoss, stopften den Kohleanzünder hinein und klebten alles sorgsam zu. Für die Wunderkerze bohrte Thomas mit dem Zirkel ein Loch in das Papierrohr. Vier Zentimeter über dem Raktenboden. Wir schoben die Wunderkerze zur Hälfte durch das Loch. Unsere Zündvorrichtung war perfekt.
Halb vier. Zeit loszulaufen. Thomas versteckte unsere Rakete unter seiner Windjacke. Es galt, möglichst unauffällig an den aufmerksamen Mitbewohnern unseres Hauses vorbeizukommen, vor allem aber durfte Viktor 70 sie nicht sehen.
Alle Ampeln waren rot. Protokollzeit. Erich Honecker schien in Zeitlupe nach Hause zu fahren.
»Viktor 70! Bitte kommen!«
Ich sah auf die Uhr und dann zu Viktor 70. Ich versuchte, einen bittenden Blick, damit er uns nach Honecker als erstes über die Kreuzung lies. Er sah mich diesmal an wie die Aufsicht in der Bibliothek und dann sah er zu Thomas, der die Beule unter seiner Jacke mit dem Arm zu verdecken suchte.
Plötzlich fuhr ein Streifenwagen vorbei. Viktor 70 schlug die Hacken zusammen und hatte jetzt nur noch Augen für die Limousinen. Honecker saß im ersten Wagen. Wir winkten diesmal verlegen der ersten und auch der zweiten Limousine zu. Das war nun wirklich unauffällig.
Wir bekamen zuerst grün, rannten die Straße entlang, an der Kaufhalle vorbei, bis zum Friedrichshain.
Die anderen warteten schon.
Wir rauchten erstmal Backe und suchten nach einem Gebüsch, das groß genug für uns alle war. Das dauerte. Machen wir es hier, sagten wir irgendwann genervt und blieben, wo wir waren: auf der großen Wiese.
Das Ding der Prenzl‘Berger war ein Flop. Sie zündeten ein Streichholz nach dem anderen, aber die Rakete wollte nicht brennen. Sie legten Löschpapier unter ihre Bastelei. Nun fing die Rakete Feuer, doch sie hob nicht ab. Sie fiel auf die Seite und wir sahen zu, wie das Feuer schwach vor sich hin qualmte.
Jetzt waren wir dran. Thomas korrigierte den Sitz der Wunderkerze, die aus unserer Rakete zur Hälfte herausschaute, damit das Feuer von außen nach innen wandern konnte.





























