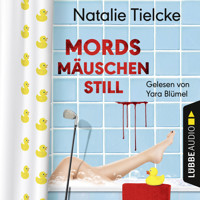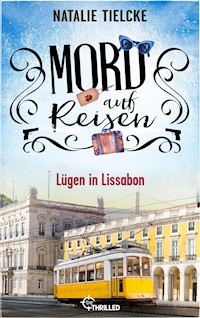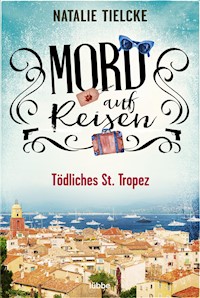4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Emma Mendel wird zu einer Geiselnahme gerufen. Als sie am Tatort eintrifft, erschießt der Geiselnehmer zwei Frauen und flieht. Die Kommissarin ist schockiert: Der Killer hat offenbar nur darauf gewartet, die Frauen direkt vor ihren Augen zu töten.
Emma will den Killer zur Strecke bringen. Und nur einer kann sie dabei unterstützen: Ben Mendel - ihr Noch-Ehemann und der Vater ihrer beiden Kinder. Emma und Ben waren mal das perfekte Paar, privat und bei der Polizei. Bis Emma alles zerstört hat. Doch nun braucht sie seine Hilfe. Denn sie ahnt, dass sie längst selbst eine Spielfigur im Plan dieses eiskalten Serienmörders ist. Emmas Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit, in dem der Killer ihr stets einen tödlichen Schritt voraus ist ...
LESER-STIMMEN ZU "PSYCHOSPIEL" VON NATALIE TIELCKE
"Der Prolog ist ein wahres Appetithäppchen und macht so richtig Lust auf diesen Thriller (...), der mich gefesselt und begeistert hat!" (Igela, Lesejury)
"Das Buch ist was für wahre Thrillerfans! Es geht blutig zu, es gibt viele Leichen und dazu eine passende Portion Spannung!" (Sabalina, Lesejury)
"Ein nicht alltäglicher Thriller mit Gänsehautfeeling. Er zeigt uns die menschlichen Abgründe auf." (Zuzi1989, Lesejury)
"Der Thriller ist bis jetzt der beste, den ich 2019 lesen durfte, und hat mich absolut begeistert." (Annalivia, Lesejury)
Hochspannung und Nervenkitzel garantiert! Alle Thriller dieser Reihe sind voneinander unabhängig lesbar.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
Prolog
1. Kapitel: Emma
2. Kapitel: Ben
3. Kapitel: Emma
4. Kapitel: Ben
5. Kapitel: Emma
6. Kapitel: Ben
7. Kapitel: Emma
8. Kapitel: Dino
9. Kapitel: Ben
10. Kapitel: Emma
11. Kapitel: Ben
12. Kapitel: Emma
13. Kapitel: Ben
14. Kapitel: Franka von Linden
15. Kapitel: Dino
16. Kapitel: Emma
17. Kapitel: Dino
18. Kapitel: Ben
19. Kapitel: Dino
20. Kapitel: Leonard König
21. Kapitel: Emma
22. Kapitel: Dino
23. Kapitel: Emma
24. Kapitel: Ben
25. Kapitel: Dino
26. Kapitel: Emma
27. Kapitel: Dino
28. Kapitel: Ben
29. Kapitel: Emma
30. Kapitel: Dino
31. Kapitel: Ben
32. Kapitel: Emma
33. Kapitel: Dino
34. Kapitel: Ben
35. Kapitel: Emma
36. Kapitel: Ben
37. Kapitel: Dino
38. Kapitel: Emma
39. Kapitel: Dino
40. Kapitel: Emma
41. Kapitel: Ben
42. Kapitel: Emma
43. Kapitel: Dino
Weitere Titel der Autorin
Kaltes Verlangen
Über dieses Buch
Töte – oder werde selbst getötet.
Er nennt sich selbst Spielfreund. Seine Opfer sucht er im Internet. Und er zwingt sie zu einem perfiden Spiel.
Kommissarin Emma Mendel wird zu einem Einsatz gerufen. Doch der Killer hat anscheinend nur auf sie gewartet. Vor ihren Augen erschießt er zwei Frauen und flieht. Emma ist verzweifelt: Hätte sie die Frauen retten können? Und woher wusste der Täter, dass sie vor Ort sein würde?
Emma will den Killer zur Strecke bringen. Und nur einer kann ihr dabei helfen: Ben Mendel – ihr Noch-Ehemann und der Vater ihrer beiden Kinder. Emma und Ben waren mal das perfekte Paar, privat und im Einsatz bei der Polizei. Bis Emma alles zerstört hat. Doch nun braucht sie seine Hilfe. Denn sie ahnt, dass sie längst selbst eine Spielfigur im Plan dieses eiskalten Serienmörders ist. Emmas Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Um den Spielfreund aufzuhalten, geht sie bis an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Doch der Killer ist ihr in diesem tödlichen Spiel immer einen Schritt voraus …
Über die Autorin
Natalie Tielcke wurde 1986 in Aachen geboren. Nach dem Abitur zog sie es zum Fernsehen und dort findet man sie noch heute. Sie schreibt Drehbücher und entwickelt TV-Serien. Die Kölnerin ist schon seit ihrer Kindheit davon begeistert, wenn nicht sogar besessen, sich Geschichten auszudenken. Ohne Stift und Papier geht sie nicht aus dem Haus.
NATALIETIELCKE
PSYCHOSPIEL
THRILLER
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius und Johanna Voetlause
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © FreshPaint/shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6372-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
»Auf das Glück warten ist dasselbewie auf den Tod warten.«
Prolog
Laura S.:
Ich hab das Gefühl, du bist der Einzige, der mich versteht. Ich hasse mein Leben.
Spielfreund:
Keiner kann dich zwingen, dass du es weiterlebst. Du bist ein freier Mensch und kannst selbst entscheiden. Das weißt du doch, oder?
Laura S.:
Ja, aber ich habe Angst.
Spielfreund:
Wovor? Dass es wehtut?
Laura S.:
Ja, auch. Oder, dass ich es bereuen könnte.
Spielfreund:
Glaubst du, nach dem Tod kann man noch bereuen?
Laura S.:
Weiß nicht … Aber meine Eltern würde das bestimmt völlig fertigmachen.
Spielfreund:
Na und? Sie sind es doch, die dich fertigmachen! Tun sie irgendwas, damit es dir besser geht? Du wolltest unbedingt auf dieses Internat, nicht wahr? Aber sie haben dich nicht gelassen.
Laura S.:
Ja, sie haben gesagt, dass es zu teuer ist.
Spielfreund:
Ach was! Wenn sie dich als ihr Kind wirklich lieben würden, dann würden sie alles tun, damit du dorthin kannst. Stattdessen zwingen sie dich, weiter deine Schule zu besuchen, obwohl dich deine Mitschüler und sogar deine Lehrer verachten. Ich hätte dich niemals dazu gedrängt, weiter diesen Ort zu besuchen. Wärst du mein Kind, hätte ich alles getan, um dich zu beschützen. Aber jetzt ist es zu spät. Nichts wird sich mehr ändern. Dein Leben ist verpfuscht. Wurde verpfuscht. Und deine Eltern sind schuld daran. Es tut mir leid, aber es gibt nur einen Ausweg, der dir Erlösung bietet.
Laura S.:
Hast du selbst schon mal darüber nachgedacht?
Spielfreund:
Ja, fast jeden Tag.
Laura S.:
Und warum hast du es dann noch nicht getan?
Spielfreund:
Weil ich erst gehen kann, wenn ich anderen geholfen habe, die meine Hilfe brauchen. So wie dir.
Laura S.:
Ich habe Angst. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie es sonst weitergehen soll. Eigentlich will ich nur, dass alles vorbeigeht.
Spielfreund:
Das verstehe ich. Ich weiß, wie du dich fühlst, und ich bin auf deiner Seite.
Laura S.:
Und es wird wirklich nicht wehtun?
Spielfreund:
Das Leben ist viel schmerzhafter als der Tod.
1. Kapitel: Emma
Das Handy auf ihrem Nachttisch riss sie unbarmherzig aus dem Schlaf. Vier Worte ihres Kollegen reichten aus, schon hatte Emma die Bettdecke umgeschlagen und beide Füße fest auf den Boden gestellt. Sie hatte heute ihren freien Tag und sturmfrei. Nico und Amelie waren bei ihrem Vater. Also hatte sie sich gestern Abend gemeinsam mit Florian fast zwei Flaschen Chardonnay gegönnt und beschlossen, das zu tun, wozu sie sonst nie kam – ausschlafen. Aber daran war jetzt nicht mehr zu denken.
»Ich bin auf dem Weg.«
Ohne Florian erklären zu müssen, was los war – so gut kannte er sie und ihren Job inzwischen –, sprang Emma aus dem Bett. Sie gab ihrem neuen Freund – erst vor einem Monat hatten sie beschlossen, dass es jetzt etwas Festes war – einen flüchtigen Kuss und ging ins Bad. Emma stellte sich für eine halbe Minute unter die Dusche. Selbst das war eigentlich zu lang, denn sie durfte keine Zeit verlieren. Aber sie musste hellwach sein für das, was ihr bevorstand. Und so verkatert, wie sie sich fühlte, brauchte sie dreißig Sekunden eiskaltes Wasser, das sie unter der Dusche von einem Fuß auf den anderen springen ließ. Die Kälte brannte stechend auf ihrer Haut, trotzdem liebte sie ihn, diesen kleinen Kick am Morgen.
Emma hätte sich gerne geschminkt oder wenigstens die Haare geföhnt. Aber mehr als Zähne putzen war nicht drin, und ihre Haare hatten derzeit sowieso eine ziemlich unvorteilhafte Länge. Es war keine attraktive, freche Kurzhaarfrisur mehr, aber ihr Haar war auch noch nicht lang genug, um sich einen anständigen Zopf zu binden. Sie hatte keine andere Wahl, als die blonden Strähnen hinter ihre Ohren zu klemmen und zu hoffen, dass sie dort einigermaßen hängen blieben. Ja, sie hatte schon mal besser ausgesehen, und wenn man ihr eine halbe Stunde im Bad ließ, konnte sie das auch immer noch. Aber das konnte sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Zwei großzügige Spritzer ihres Lieblingsparfüms mussten reichen. Würde sie sich nicht schnell genug auf den Weg machen, war es womöglich ihre Schuld, wenn Menschen ihr Leben verloren. Denn die ersten vier Worte, die sie heute gehört hatte, lauteten: »Wir haben eine Geiselnahme.«
Florian war ein Schatz. Als Emma das Haus verlassen wollte, stand er mit in der Tür und hielt ihr einen Thermobecher entgegen.
»Schwarz mit einem halben Esslöffel Zucker. Stark und süß, so wie du ihn am liebsten magst«, sagte er mit seinem typisch jungenhaften Lächeln, das Emma unglaublich sexy fand.
»Danke, du bist ein Engel.« Emma nahm den Kaffee, drückte Florian einen Kuss auf die Lippen und verschwand durch die Tür ihres idyllischen, freistehenden Einfamilienhauses im Grünen, raus in die kalte raue Welt des Verbrechens. Sobald sie den Vorgarten durchquert und ihr Grundstück verlassen hatte, überkam Emma das Gefühl, plötzlich in einer anderen Welt zu sein. Und auch sie war eine andere. Gestern Nacht war sie in diesem Haus weich und zärtlich gewesen, ein bisschen verrückt und albern sogar. Aber jetzt, als sie in ihr Auto stieg und den Motor startete, war sie hart, klar und kompromisslos.
Auf dem Weg zu der Adresse, die ihr der Kollege durchgegeben hatte, überlegte sie, ob sie schon von einer Geiselnahme an einem solchen Ort gehört oder gelesen hatte. Eigentlich ging es bei Geiselnahmen fast immer um Geld oder Erpressung. Aber Emma war nicht auf dem Weg zu einer Bank oder einem großen Konzern. Sie war auf dem Weg zu einem Ärztehaus. Der Geiselnehmer hatte sich die Frauenarztpraxis für seine Tat ausgesucht. Emma fragte sich, welches Motiv der Täter verfolgte. Handelte es sich vielleicht um eine frustrierte Patientin, die dem Arzt die Schuld für ihr Leid gab? War dem Gynäkologen ein tragischer Behandlungsfehler unterlaufen? Oder war bei einer Geburt etwas schrecklich schiefgegangen? Hatte jemand sein Kind verloren?
Emma war fast angekommen.
Die Beamten an der Straßensperre kontrollierten ihren Ausweis und ließen sie passieren. Sie parkte ihren Wagen und suchte mit den Augen sofort die nähere Umgebung ab, als sie ausstieg. Ihre Kollegen umstellten bereits das Gebäude. Das Ärztehaus besaß etliche Ausgänge, eine Tiefgarage und eine Feuertreppe. Das würde den Einsatz nicht gerade erleichtern. Der Täter hatte viele Fluchtmöglichkeiten, zu viele. Und es war ihre Aufgabe, zu verhindern, dass er entkommen konnte. Der Hauptzugang war bereits mit den Einsatzfahrzeugen abgesperrt, die gleichzeitig einen Sichtschutz bildeten. Dennoch hatten sich bereits zahlreiche Schaulustige eingefunden, und die ersten Presse-Vertreter würden auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Emma wollte sich gerade mit ihren Kollegen besprechen, als sie ihren Vorgesetzten, der den Einsatz leitete, mit schnellen, kurzen Schritten auf sich zukommen sah. Wie gewöhnlich trug Theodor Steinhaus seine Hosenbeine hochgekrempelt, da er für seinen Körperumfang etwas klein geraten war. Und wie immer wippte eine dieser schrecklich gemusterten, bunten Krawatten über seinem Bauch, die seine Frau ihm jährlich zu Weihnachten und zum Geburtstag schenkte, und die ungewollt zu seinem Markenzeichen geworden waren. Theo war der Dienstälteste vor Ort, ein sehr erfahrener Mann, der nur noch wenige Jahre von der Rente entfernt war. Er brachte Emma auf den neusten Stand. »Also, wie es aussieht, haben wir einen Geiselnehmer und eine unbekannte Anzahl an Geiseln. Die Praxis des Gynäkologen ist im dritten Stock. Bis auf diese Etage haben wir das ganze Haus evakuiert und alle Personen, die sich darin aufhielten, in Sicherheit gebracht.«
»Wie lauten die Forderungen? Hat er überhaupt schon Kontakt zu uns aufgenommen?«
»Indirekt. Er wollte, dass wir kommen.«
»Indirekt?« Emma warf Theo einen fragenden Blick zu.
»Die Arzthelferin hat vor knapp dreißig Minuten den Notruf gewählt und gesagt: Hier ist ein Mann, der bedroht uns mit einer Waffe und will, dass sie kommen. Dann hat sie aufgelegt. Ich hab schon mehrmals versucht, in der Praxis anzurufen, aber niemand hebt ab.«
»Ein Mann, der will, dass wir kommen?«, wiederholte Emma skeptisch.
»Ich weiß. Schräg, oder? Wir schätzen, dass er mindestens fünf Geiseln in seiner Gewalt hat, vielleicht noch mehr. Auf jeden Fall den Arzt, vermutlich noch zwei Arzthelferinnen und mindestens zwei Patientinnen.«
»Wie willst du vorgehen?«
»Ich würde am liebsten ein Team reinschicken, aber das ist zu riskant. Jedenfalls im Moment. Wenn er sich innerhalb der nächsten Minuten nicht bei uns meldet, rufe ich in der Praxis an. Irgendwann wird er ja hoffentlich mal mit uns reden. Sonst hätte er uns doch gar nicht erst herbestellt. Oder was meinst du?«
Emma zuckte mit den Schultern. Noch sagte ihr Bauchgefühl ihr gar nichts, obwohl es sich normalerweise als Erstes meldete. Sie bewunderte Theo für seine Gelassenheit in solchen Situationen. Er war ihr Bärentreiber gewesen. So nannte man ältere Kollegen, die die jüngeren am Anfang der Ausbildung an die Hand nahmen. Emma hatte unglaublich viel von Theo gelernt und fühlte sich ihm sehr verbunden. Obwohl er äußerlich stets distanziert blieb und nicht besonders viel Nähe zuließ, wusste Emma, dass auch er sie sehr mochte. Und egal, wie alt sie war oder wie lange sie schon im Dienst war, sie würde immer sein kleiner Polizeizögling bleiben. Also stimmte sie seinem vorläufigen Plan zu. »Okay. Warten wir. Gibt es irgendwelche Videoaufnahmen? Überwachungskameras?«
»Nicht im Gebäude. Aber die Kollegen checken die Umgebung nach Überwachungskameras von Geldautomaten und so weiter ab.«
Emma beobachtete die Scharfschützen, die sich auf den Dächern der umliegenden Gebäude positionierten. Nur ein geschultes Auge wie das ihre erkannte, wo sich die Schützen aufhielten. Gelegentlich blitzte der schmale Lauf ihrer Waffen auf. Entdeckte ein flüchtender Täter dieses Blitzen, war es in aller Regel zu spät. Wer ins Visier eines dieser Profis geriet, hatte keine Chance.
Das Klingeln ihres Handys riss Emma aus ihren Gedanken. Sie nahm es aus der Tasche und stellte verwundert fest, dass ein anonymer Anrufer angezeigt wurde. Da erst begriff sie, dass es ihr privates Handy war, das sie in Händen hielt. Seltsam, die Nummer kannten eigentlich nur ihre Kinder und ihre engsten Freunde. Trotzdem nahm sie den Anruf entgegen, bereit, irgendeinen Callcenter-Mitarbeiter abzuwürgen. Doch schon der erste Ton der künstlich verfremdeten, männlichen Stimme ließ sämtliche Alarmglocken bei Emma schrillen. »Wollen wir ein Spiel spielen?«, fragte die Stimme. Emma warf Theo einen alarmierten Blick zu, stellte das Telefon auf laut und bedeutete mit einer Geste allen umstehen Kollegen, ruhig zu sein. »Wer ist da?«
»Beantworte meine Frage, Emma!«, befahl die verzerrte Stimme am anderen Ende der Leitung. »Wollen wir ein Spiel spielen?« Emma sah, wie ihr Vorgesetzter seine Augen weit aufriss, als ihr Name fiel.
Sie selbst spürte augenblicklich, wie sich ihr Magen zusammenzog und ihr Puls zu rasen begann. »Wer sind Sie? Woher haben Sie diese Nummer?« Wieso kannte der Mann ihren Namen? Emma wurde heiß und sie sehnte sich augenblicklich unter ihre eiskalte Dusche zurück.
»Ach, Emma, Schatz. Beantworte einfach meine Frage. Wollen wir ein Spiel spielen: Ja oder nein?«
Emma hätte ihn am liebsten angeschrien. Wie konnte er sie einfach Schatz nennen? Sie sah aufgewühlt zu Theo, der völlig konzentriert wirkte und angestrengt zu überlegen schien. Dann schrieb er schnell etwas auf einen Notizblock, den er, oldschool wie er nun mal war, immer zusammen mit einem kleinen Stift in seiner Brusttasche aufbewahrte. Er notierte nur ein Wort und zeigte es Emma: Geiselnehmer?
»Mit wem spreche ich da? Wo sind Sie? Was wollen Sie?« Zu viele Fragen auf einmal. Theo machte mit seiner Hand eine beschwichtigende Bewegung, die Emma bat, ruhig zu bleiben.
»Mit wem spreche ich?«
»Darum geht es hier nicht, Emma. Spielst du mit oder lässt du die Leute sterben?«
»Wen?« Emma gab sich alle Mühe, beherrscht und sicher zu klingen.
»Alle. Alle, die sich in diesem Moment in der Arztpraxis aufhalten, vor der du gerade stehst«, sagte die verzerrte Stimme. Es handelte sich also eindeutig um den Geiselnehmer. Sie mussten unbedingt rausfinden, mit wem sie es zu tun hatten und was er wollte. Wenn er eine Forderung stellte, ließ sich ein Motiv erahnen, und das brachte oft Aufschluss über die Person selbst.
»Was ist das für ein Spiel?«
»Ah, sehr schön. Richtige Frage, Emma. Warte einen Augenblick.« Er legte auf.
»Verdammt!« Emma hätte ihr Handy fast auf den Boden geschmettert. Sie hatte ihn länger in der Leitung halten wollen, um mehr zu erfahren. In diesem Moment bemerkte sie, dass vor dem Haus etwas vor sich ging. Die Tür öffnete sich langsam und eine in Weiß gekleidete junge Frau trat heraus. Sie trug einen langen, dunklen Pferdeschwanz und ein helles Stirnband. Ihre Kleidung verriet, dass es sich um eine der Arzthelferinnen handeln musste. Als sie ein paar Schritte nähergekommen war, erkannte Emma, dass das viele Make-up der Sprechstundenhilfe übers ganze Gesicht verschmiert war, vermutlich hatte sie im wahrsten Sinne des Wortes Rotz und Wasser geheult. Die Frau wirkte gänzlich verstört und brach sofort zusammen, als zwei Polzisten auf sie zuliefen, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie hockte auf dem Boden und umklammerte panisch etwas mit ihren Fingern, deren lange Nägel knallpink lackiert waren. Es war ein kleines Notebook, das auf ihrem Schoß lag. Die junge Frau wirkte, als wolle sie schreien oder wenigstens etwas sagen, aber sie tat es nicht. Ihr Kopf bewegte sich wild hin und her. Es wirkte, als halte ihr jemand den Mund zu. Aber da war niemand. Und ihr Mund war auch nicht verbunden. Einer der uniformierten Kollegen nahm ihr das Gerät aus den Händen und brachte es zu Emma. Der andere Polizist führte die Arzthelferin zu einem der Rettungswagen, wo sie von Sanitätern medizinisch versorgt werden würde. Obwohl sie sicherlich noch unter Schock stand und kaum vernehmungsfähig war, rannte Theo zu ihr, um ein paar wichtige Fakten abzufragen. »Du kümmerst dich um das da«, rief er Emma zu und deutete auf das Notebook in ihren Händen.
Auf dem Notebook blinkte auf schwarzen Grund ein weißer Button, in dem das Wort ›Play‹ zu lesen war. Darüber stand: ›Für Emma. Drück Play. Sofort! Sonst sterben alle! Dein Spielfreund.‹
Für Emma? Was hatte sie mit der Sache zu tun? Sie war noch nie in dieser Praxis gewesen. Und wer war dieser Mann, der nicht nur ihren Namen und ihre Telefonnummer kannte, sondern auch ganz genau zu wissen schien, dass sie heute hier sein würde? Emma spürte ihren unruhigen Herzschlag. Eigentlich wurde sie selbst in Ausnahmesituation nur selten nervös. Doch hier ging es um sie persönlich. Sie spürte, dass dieser Fall ihr alles abverlangen würde. Vielleicht sogar mehr, als sie geben konnte. Eine dunkle Vorahnung, die nach Schmerz, Verlust und Angst schmeckte, überkam sie. Doch sie durfte sich nicht verleiten lassen, sie musste im Moment bleiben, wach und konzentriert.
»Von der Frau werden wir so schnell nichts erfahren.« Theo war schneller zurück, als Emma vermutet hätte.
»Kein Wunder. Sie muss vollkommen unter Schock stehen«, sagte Emma.
»Ja, das bestimmt auch. Aber nicht deshalb. Der Mistkerl hat ihr den Mund zugeklebt. Vermutlich mit Sekundenkleber. Sie bekommt die Lippen nicht auseinander, sie würde sich dabei die ganze Haut herunterreißen. Die Sanitäter meinen, das geht mit Pflanzenöl, Wasser und Seife oder zur Not auch mit einem Lösungsmittel wieder ab. Aber das dauert. Und bis dahin werden wir nichts von ihr erfahren.«
Emma wurde wütend. Wütend auf einen Fremden. Wie konnte der Geiselnehmer der Frau so etwas antun? Außerdem hatte sie natürlich auf Informationen gehofft, damit sie sich ein besseres Bild von der aktuellen Lage im Inneren des Gebäudes machen konnte. Wie viele Menschen befanden sich in der Praxis? Gab es mehr als einen Täter? »So lange können wir aber nicht warten.«
Ihr Chef nickte, auch er wusste, dass es oft nur ein Bruchteil von Sekunden war, der über Leben und Tod entschied. »Sie wollte uns aber irgendetwas mitteilen«, sagte Theo. »Ich wollte, dass sie es aufschreibt, aber sie hat viel zu sehr gezittert. Außerdem haben die Rettungssanitäter darauf bestanden, sie sofort ins Krankenhaus zu fahren. Aber so hektisch, wie sie versucht hat, etwas zwischen den zugeklebten Lippen hervorzupressen, war es auf jeden Fall wichtig.«
»Ich denke, der Geiselnehmer hat sie vor allem gehen lassen, weil er uns eine Nachricht überbringen wollte.« Emma drehte das Notebook so, dass ihr Chef den Bildschirm sehen konnte. »Für Emma?«, las Theo fragend vom Screen ab. »Hast du irgendeine Idee, wer …«
»Nein«, unterbrach sie ihren Boss sofort. Er nickte ihr verständnisvoll zu, und sie betätigte vorsichtig das Touchpad und drückte auf den weißen Button, auf dem in roter Schrift ›Play‹ stand. Plötzlich poppte ein Fenster auf und ein Video erschien. Emma erkannte sofort, dass es sich um einen Livestream aus der Arztpraxis handeln musste. Zu sehen waren zwei vollkommen verängstigte Frauen, vermutlich Patientinnen, da sie keine Praxiskleidung trugen. Eine brünette Frau, Emma schätzte sie auf Mitte vierzig, und ein blondes, dünnes Mädchen knieten nebeneinander auf dem Boden vor dem Empfangstresen. Der Geiselnehmer selbst schien zu filmen. Emma vermutete, dass er eine Knopfkamera an seinem Hemd trug, zumindest passte das vom Winkel her zu den Aufnahmen. Emma erschrak. Ihr Handy klingelte erneut. Anrufer: Anonym. Ihre Hände zitterten, als sie den Anruf annahm und die verzerrte Stimme hörte, die ihr seltsamerweise schon irgendwie vertraut vorkam.
»Weißt du, Emma … Es gibt eine Sache, die unser Leben maßgeblich beeinflusst. Mehr als es irgendetwas anderes könnte. Es sind die Entscheidungen, die wir treffen. Nichts bestimmt uns mehr als das. Doch wie schon Charlie Chaplin einmal sagte: ›An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser.‹ Und das ist es, was uns ängstigt. Wir müssen uns ganz alleine entscheiden, was bedeutet, dass nur wir allein für die Konsequenzen unseres Handelns die Verantwortung tragen. Eine Wahl für etwas treffen, bedeutet auch immer Veränderung. Haben wir eine Wahl getroffen, so wird sich etwas verändern und, ob wir es zugeben oder nicht, jeder Mensch fürchtet die Veränderung. Also fürchtet er bereits die Entscheidung, die dazu führt. Wir plagen uns herum, sind nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, und weil wir Angst haben, lassen wir es lieber gleich bleiben. Diese Möglichkeit aber werde ich dir heute nehmen, Emma.«
Die Qual der Wahl. Vielen Menschen fiel es schwer, Entscheidungen zu treffen. Emma zählte sich eigentlich nicht dazu. Sie hätte am liebsten augenblicklich aufgelegt und blindlings das Gebäude gestürmt. Doch sie musste sich innerlich zusammenreißen und ihre Stimme zügeln. »Wie soll ich das verstehen?« Emma sah auf den Bildschirm des Notebooks und erkannte die nackte Angst in den Augen der älteren Frau. In dem schmalen Gesicht des Mädchens spiegelte sich noch eine andere Emotion, die Emma irritierte, denn sie konnte nicht genau ausmachen, was es war.
Die verfremdete Stimme fuhr in einem ruhigen, gelassenen Ton fort. »Also, erst mal möchte ich dir die Spielregeln erklären. Darf ich vorstellen? Die zwei Damen, die du gerade auf dem Bildschirm siehst, sind Frau Winter und ihre Tochter Leila. Um die beiden geht es heute, sie sind unsere Spielfiguren.«
Spielfiguren? Es ging um Menschenleben! Emma sah die blanke Panik in dem angstverzerrten Gesicht der Mutter. Sie flehte den Mann an und weinte. Die Tochter hingegen, die groß gewachsen und schlank war, kniete mit gesenktem Kopf neben ihr und wimmerte vor sich hin. Gelegentlich hob sie den Kopf, starrte beinahe genau in die Kamera und suchte dann den Blickkontakt zu ihrer Mutter. Sie wirkte entsetzlich hilflos, nicht nur weil eine Waffe auf sie gerichtet war, sondern auch, weil ihre eigene Mutter, deren breite Schultern und leicht faltiges Gesicht einen recht robusten Eindruck erweckten, ihr vermutlich zum ersten Mal im Leben nicht helfen konnte. Seinem eignen Kind nicht beistehen können, war wohl das Schlimmste, was man Eltern antun konnte. »Die Regeln sind ganz einfach. Du entscheidest, wer stirbt. Wen soll ich abknallen? Die Mutter oder die Tochter? Du hast sechzig Sekunden Zeit, sonst töte ich beide. Verstanden?« Emma schwieg, ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ihr wurde übel. Sprachlos versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Was verlangte er da von ihr?
Die Stimme sprach unaufgefordert weiter. »Ich gehe mal davon aus, dass du alles begriffen hast. Du bist ja ein kluges Mädchen. Also, liebe Emma, die Zeit läuft.«
Das Video verschwand und auf dem Computerbildschirm erschien ein Countdown. Sechzig Sekunden Zeit für eine unmögliche Entscheidung. Theo schüttelte den Kopf. Emma stellte das Handy auf stumm, damit der Unbekannte sie nicht hören konnte. Ihr Chef war wütend. »Auf so etwas lassen wir uns nicht ein. Was will der Kerl?«
Was sollte sie tun? Emma stellte ihr Handy wieder auf laut. »Sind Sie noch dran? Ich bin mir sicher, dass wir das klären können.« Sie hielt ihre Stimme möglichst ruhig, auch wenn ihr viel mehr nach Brüllen zu Mute war. »Ohne, dass jemand stirbt. Noch ist nichts passiert, was drastische Konsequenzen nach sich ziehen müsste. Noch ist niemand ernsthaft verletzt worden. Lassen Sie uns reden.«
»Wer sagt denn, dass es noch keine Verletzten gibt? Oder Tote?«, antwortete der Mann und lachte dabei höhnisch. Seine verzerrte Stimmte ging Emma direkt unter die Haut und sie merkte, wie sie sich schon jetzt in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte. Oder hörte sie diese Stimme gar nicht zum ersten Mal? »Noch dreißig Sekunden, Emma.«
Ihr Kopf suchte einen Ausweg, ihr Geist wollte fliehen. Und auf einmal fühlte sich diese Situation an wie ein Déjà-vu, aber Emma konnte sich nicht erklären, was genau sie zu dieser Annahme verleitete. Sie zwang sich, sich zu konzentrieren. »Warum eine Frauenarztpraxis?«, fragte sie, in der Hoffnung, Zeit schinden zu können.
Der Mann seufzte. »Das Spielfeld habe ich mir nicht selbst ausgesucht.«
Was zur Hölle meinte der Kerl damit? Spielfeld? Sie war überfordert und hasste sich augenblicklich dafür. Scheiße, fluchte sie innerlich. Was konnte sie jetzt tun? Selbst Theo, auf den sie sich bisher immer verlassen konnte, war keine große Hilfe. In seinem Gesicht stand dieselbe Verzweiflung und Ratlosigkeit, die Emma innerlich spürte. Sie wollte diese Entscheidung einfach nicht treffen. Sie konnte doch nicht zustimmen, dass jemand erschossen wurde. Auch wenn sie damit ein anderes Leben retten konnte. Sie musste an Nico und Amelie denken, daran, dass sie selbst Mutter war und sie nicht den geringsten Zweifel hatte, dass das Überleben ihrer Kinder ausnahmslos wichtiger war als ihr eigenes Leben. Aber hier ging es um zwei Menschen, die Emma nicht kannte, denen sie mit der Wahl ihres Berufs als Kommissarin aber versprochen hatte, sie zu beschützen. Der Scheißkerl wollte sie erpressen und zu einer Mörderin machen. Aber wenn sie nichts unternahm, dann würden zwei Menschen sterben. Die Zeit lief ab. Noch zehn Sekunden. Emma schwieg.
Noch fünf Sekunden.
Noch vier.
Drei.
Zwei.
Noch eine.
Die letzte Sekunde lief ab. Als der Countdown auf null sprang, stellte Emma ihr Telefon lauter und lauschte angespannt. »Schade, Emma. Ich dachte, du wolltest mitspielen. Aber wie es aussieht, glaubst du mir anscheinend nicht. Ich muss dir wohl zeigen, dass ich es ernst meine.« Trotz der Verzerrung meinte Emma Enttäuschung in der Stimme wahrzunehmen.
»Warten Sie!« Was konnte sie jetzt tun? Sie hatte keine Zeit, nach Protokoll vorzugehen, zumal es für eine derartige Situation keins gab. Sie musste eine Art Verbindung zu diesem Mann herstellen, und zwar schnell. »Okay, wir spielen. Aber nicht so. Ich komme zu Ihnen rein, okay? Lassen Sie uns darüber reden, was Sie wollen. Wenn es ein Problem gibt, lässt sich das bestimmt irgendwie klären, ohne dass jemand sterben muss.«
»Aber das ist doch das Spiel. Hätte ich die Regeln besser erklären müssen, liebe Emma?«
»Ich komme jetzt zu Ihnen und Sie erklären mir die Regeln ganz in Ruhe. Was halten Sie davon?«
»Nichts. Die Zeit ist abgelaufen.« Er legte auf. Im selben Moment erschien wieder der Livestream auf dem Bildschirm. Frau Winter und ihre Tochter knieten in derselben Haltung wie zuvor vor dem Empfangstresen der Praxis. Plötzlich sah Emma den Lauf einer Waffe aufblitzen. Sie schrie laut auf, genau wie die Frauen. Emma starrte auf den Bildschirm. Es war die Perspektive des Täters. Ihr wurde bewusst, dass sie quasi durch seine Augen blickte. Und was sie sah, war so grauenvoll, dass es sie ihr Leben lang verfolgen würde. Das schmerzverzerrte Gesicht einer Frau, die wusste, dass sie diesen Tag nicht überleben würde. Neben ihr ihre Tochter, die vor Panik nur noch einatmete, wie ein Asthmatiker, und zu ersticken drohte. Der Unbekannte zielte auf den Kopf der Mutter – und drückte ab. Der Körper flog zurück, prallte gegen den Empfangstresen und sackte leblos in sich zusammen. Die Tochter schrie vor Entsetzen, doch ihr Gesicht erstarrte zu einer leblosen Maske, als sich eine Sekunde später der Lauf der Waffe auf sie richtete. Ohne zu zögern, drückte der Täter ab. Der schlanke Körper der Tochter fiel seitlich nach hinten und landete auf dem der Mutter. Im selben Moment brach die Verbindung ab. Emma hätte das Notebook beinahe fallen gelassen, aber ein junger Kollege in Uniform nahm es ihr vorsichtig ab. Was gut war, denn das Teil würde sofort von den IT-Experten der Kriminaltechnik geprüft werden müssen.
»Zugriff!«, brüllte Theo neben ihr und es dauerte nur wenige Sekunden, da stürmte das Spezialeinsatzkommando das Gebäude. Emma und Theo folgten den Einsatzkräften, auch wenn Theo mit seinen kurzen Beinen deutlich mehr Mühe hatte, bei dem Tempo mitzuhalten, als sie. Während sie die Treppe in den dritten Stock hochsprinteten, traf Emma die Erkenntnis wie ein Blitzschlag. Irgendetwas an den Aufnahmen stimmte nicht. Das sagte ihr ihr Ermittlerinstinkt, auch wenn sie noch nicht herausfiltern konnte, was genau sie daran störte. Doch. Sie wusste es. Es war das Geräusch gewesen. Oder eher, das fehlende Geräusch. Emma wusste, wie sich ein Schuss aus einer Pistole anhörte. Es war ein ohrenbetäubend lauter Knall, nicht umsonst trugen sie und ihre Kollegen beim Schießtraining Ohrschützer. Emma hatte in dem Video zwar echte Schüsse gehört, das schon. Aber nur einmal und auch zu leise. Emma wusste noch nicht, was das zu bedeuten hatte. Sie hatte jetzt aber keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Sie hatten den Eingang der Praxis erreicht.
Der erste Polizist, der – geschützt durch schusssichere Weste, Helm, Schutzbrille und Handschuhe – die Praxis betrat, hielt einen Revolver in den Händen und keine Pistole, wie Emma es tat. Der größte und lebenswichtigste Unterschied war, dass Emmas Pistole mit einem Magazin geladen wurde, wogegen ein Revolver eine Trommel hatte, die mit einzelnen Patronen geladen wurde. Darum waren bei einem Revolver Ladehemmungen so gut wie ausgeschlossen. Sollte der Täter also sofort das Feuer eröffnen, konnte der Kollege blitzschnell reagieren und die Wahrscheinlichkeit, dass ein technischer Fehler ihn sein Leben kostete, weil die Waffe nicht richtig funktionierte, war quasi gleich null.
»Gesichert«, rief der Mann in Schwarz und seine Kollegen rückten nach. Einer nach dem anderen betraten sie die Praxis, sicherten nach und nach alle Räume.
»Gesichert«, hörte Emma einen anderen SEK-Beamten rufen.
Emma und Theo konnten nun die Praxis betreten und in diesem Moment wusste Emma, was das fehlende Geräusch in dem Video zu bedeuten hatte.
Alles sah aus, wie sie es auf dem Notebook gesehen hatte. Frau Winters lebloser Körper lag am Boden vor dem Empfangstresen, unter ihrem Kopf hatte sich eine Blutlache ausgebreitet und ihre Haare völlig durchtränkt. Die Tochter lag halb auf ihr. Emma ging weiter ins Wartezimmer, wo sich die SEK-Kollegen bereits um den Arzt, eine weitere Arzthelferin und zwei Patientinnen kümmerten. Die Geiseln waren gefesselt, weinten und flehten laut hinter fest aufeinandergepressten Lippen. Der Scheißkerl hatte tatsächlichen allen Geiseln den Mund mit Sekundenkleber zugeklebt. Emma sah in die angstverzerrten Gesichter und spendete ihnen einen tröstenden Blick, der sagen sollte: Alles wird gut.
Emma fragte sich, wie die Arzthelferin es geschafft hatte, einen Notruf abzusetzen, obwohl ihr Mund verklebt war, als plötzlich Theo hinter ihr stand. »Hier ist niemand. Der Täter muss es irgendwie geschafft haben, zu fliehen.«
»Ja, und das wahrscheinlich lange bevor wir überhaupt hier waren. Er ist hier ganz gemütlich rausspaziert.« Emma seufzte frustriert und spürte Ärger in sich aufsteigen. Ärger über sich selbst, aber auch über die Tat an sich, Ärger über die grausame Welt, in der sie alle lebten, Ärger über die gestörten Menschen, die frei herumliefen und anderen grundlos Leid zufügten. Manchmal hasste sie diese Welt, obwohl es weniger die Welt war als die Menschen darin. Erst jetzt bemerkte sie, dass Theo sie fragend anstarrte.
»Es sieht so aus, dass er uns komplett hinters Licht geführt hat. Die Aufnahmen waren nicht live.«
»Wie kommst du darauf?«, wollte Theo wissen.
»Ich könnte mich ohrfeigen dafür, dass es mir erst jetzt auffällt. Als wir eben gesehen haben, wie er auf die beiden geschossen hat, da fehlte ein zweiter Knall. Wir hätten doch eigentlich zwei laute Schüsse aus dem Gebäude hören müssen und zeitgleich oder sogar leicht verzögert über die Lautsprecher des Notebooks. Aber wir haben die Schüsse nur über das Notebook gehört.«
Theo erstarrte kurz, dann fuhr er sich mit beiden Händen durch sein immer lichter werdendes, grau meliertes Haar. Eine Geste, die Emma schon oft an ihm beobachtet hatte, wenn er der Verzweiflung nah war. Es war so offensichtlich und trotzdem war es ihnen beiden entgangen.
Emma fummelte in ihrer Jackentasche herum, fand, was sie gesucht hatte, und zog sich den dünnen Einweghandschuh über. Sie ging zurück zum Empfangstresen und kniete sich zu den beiden Leichen, um ihre Temperatur zu prüfen. Sie war zwar kein Rechtmediziner, aber sie wusste, dass Menschen nach dem Tod etwa ein Grad pro Stunde abkühlten. Je kälter Frau Winter und ihre Tochter sich also anfühlten, desto länger war der Täter schon auf der Flucht. Emma berührte vorsichtig den blutverschmierten Hals der Tochter. Und was sie spürte, ließ ihr Herz einen Moment aussetzen. Leila Winter fühlte sich warm an und Emma vernahm ein Pochen unter ihren Fingern. »Sie hat einen Puls!«, schrie Emma. Und im gleichen Moment erkannte sie, dass das Mädchen angestrengt versuchte, zu blinzeln.
2. Kapitel: Ben
Ben war hundemüde. Die ganze Nacht lang hatte er, gemeinsam mit einem Kollegen von der Fahndung, einen Obdachlosen observiert, der sie schließlich zum Ziel geführt hatte. Zum Händler, wie sie ihn nannten. Sie wussten jetzt, wer den Obdachlosen Geld für ihre Organe bot, und noch vor Sonnenaufgang hatten sie sich einen Haftbefehl ausstellen lassen. Der Richter war äußerst kooperativ gewesen, schließlich hatte er ein persönliches Interesse an dem Fall. Sein komplett anders geratener Bruder lag zurzeit ohne Leber im Krankenhaus. Er hatte sich direkt nach der Operation dorthin geschleppt, noch halb narkotisiert von dem Eingriff, den der Händler stümperhaft im eigenen Keller durchgeführt hatte. Die Beweise lagen auf dem Tisch und Ben hoffte, dass die Staatsanwaltschaft den Kerl zerfleischte. Er hatte zwei Obdachlose und vier Junkies auf dem Gewissen. Zwei weitere Opfer hatten es geschafft, rechtzeitig in ein Krankenhaus zu gelangen, und konnten dort im letzten Moment gerettet werden. Sie würden gegen den Händler aussagen. Es war vorbei.
Ben hatte gerade mal dreieinhalb Stunden geschlafen und war bereits auf dem Weg zu seinem nächsten Fall, was unüblich war, denn sein Chef hatte ihm eine Pause zugesagt. Und auf Theodor Steinhaus war Verlass, er hielt seine Versprechen immer. Außer in Ausnahmesituationen wie dieser. Es ging um einen seiner alten Fälle, der durch eine Geiselnahme heute Morgen wieder ins Rollen geraten war. Noch konnte er sich die Zusammenhänge nicht erklären, denn sein Chef wollte am Telefon nicht damit rausrücken, um welchen seiner alten Fälle es sich konkret handelte. Doch Ben hatte bereits eine böse Vorahnung.
Als er die Tür des Besprechungsraums öffnete, strömte ihm ein wohlbekannter Duft in die Nase, der sich unter den Geruch von Kaffee und Schweiß mischte. Es war Emma. Das war der typische Emma-Duft, den Ben immer und überall identifizieren konnte. Er wusste nicht, wie es hieß, aber er kannte ihr Parfüm. Und es war nicht bloß der Geruch des Parfüms selbst, sondern der perfekte Einklang des Duftes mit Emmas unverkennbarem, eigenem Geruch, der Ben sofort ein wohliges Gefühl bescherte, das neuerdings aber nur von kurzer Dauer war. Denn zwischen ihnen hatte sich einfach alles verändert. Warum war seine Frau hier? Oder war sie schon seine Ex-Frau? Sie lebten aktuell im letzten Monat ihres Trennungsjahres. Scheidung eingereicht ja, Scheidung durch nein. Ein Jahr warten. Wer auch immer sich das ausgedacht hatte, musste ein hoffnungsloser Romantiker gewesen sein. Also war sie jetzt offiziell noch seine Frau oder nicht? Vielleicht sollte Ben ihr besser einen anderen Titel geben und sie in seinem Kopf einfach als Mutter seiner Kinder abspeichern. Aber dafür begehrte er sie noch viel zu sehr. Selbst jetzt, mit ihrer seltsamen neuen Frisur. Kurz nach ihrer Trennung hatte sie sich die Haare abgeschnitten. Was für ein Klischee, hatte er gesagt. Was bist du für ein Arschloch, hatte sie geantwortet. Ben wollte sich einbilden, dass es eigentlich nur im Spaß gemeint war, so wie früher. Zu ihren besten Zeiten hatte sie ihn oft ganz liebevoll Arschloch, Blödmann oder Idiot genannt, es aber nie ernst gemeint. Heute war das vermutlich anders.
Ben stand in der offenen Tür. Er war mit allen anwesenden Kollegen vertraut und grüßte in die Runde. Er lächelte Emma unsicher an und sie prostete ihm mit ihrem Kaffeebecher zu. Freundlich, aber reserviert. Das war Emmas Meisterdisziplin. Im einen Moment konnte sie einem das Gefühl geben, ihr ganz nah zu sein, und im nächsten Moment schaffte sie wieder eine riesige Distanz. Bens Mutter hatte das an Emma stets kritisiert. »An diese Frau kommt man einfach nicht ran!«, hatte sie geschimpft. Ben hatte meist milde gelächelt und sich gedacht, dass er eben der Einzige war, der ihr wirklich nah war, der ihre Wärme und ihre Liebe ganz für sich allein hatte. Abgesehen von den Kindern, die sie wie eine Bärenmutter beschütze und mit Liebe umhüllte. Doch jetzt bekam Ben die Kälte, die Emma ausstrahlen konnte, am eigenen Leib zu spüren.
Irritiert blieb er in der Tür stehen und sah zu Theodor. Ein Blick genügte, und sein Chef kam auf ihn zu und schob ihn ein Stück raus aus dem Raum in den Flur.
»Was macht sie hier?« Ben deutete mit dem Kopf in Emmas Richtung, was nicht nötig war, sein Chef hatte ihn auch ohne diese Geste verstanden.
»In diesem Fall brauche ich euch beide. Das lässt sich, so wie ich das sehe, nicht vermeiden. Tut mir leid«, flüsterte er, obwohl Bens Noch-Frau bestimmt längst ahnte, warum er und der Chef die Köpfe zusammensteckten. Wahrscheinlich hatten sie und Theodor zuvor dasselbe Gespräch geführt.
»Ernsthaft? Du willst, dass wir wieder zusammen ermitteln? Ich glaube nicht, dass das gut geht.«
»Ihr werdet euch zusammenreißen. Ihr seid schließlich beide erwachsen. Außerdem wart ihr früher ein ausgezeichnetes Team«, zischte Theo und klang leicht gereizt.
»Die Sache ist, wir waren ein gutes Team, wir sind es aber nicht mehr.« Ben musste sich bemühen, nicht zu laut zu sprechen. Er spürte Aggressionen in sich hochsteigen, die auf der Arbeit nichts zu suchen hatten.
»Wenn du hörst, um was es geht, siehst du das vielleicht anders. Ich denke, das wird deine Meinung ändern.«
»Müssen wir wieder verdeckt ermitteln? Geht es darum?«
»Es geht um mehr als das. Komm jetzt mit rein und setz dich erst mal.«
Ben und Emma hatten früher fast ausschließlich gemeinsam ermittelt. Über längere Zeit sogar verdeckt. Und diese Arbeit hatte das Ende ihrer Ehe bedeutet. Aber das musste er jetzt vorläufig vergessen, denn Theodor Steinhaus setzte eine ernste Miene auf, die Ben signalisierte, dass er über das Thema nicht länger mit ihm diskutieren würde, und ging zurück in den Besprechungsraum.
»Okay«, Ben trat ein und ließ die Tür hinter sich zufallen. »Um was geht es?«
»Setz dich. Am besten, ihr setzt euch alle.« Theodor erhob seine Stimme, alle im Raum verstummten kurz und kamen seiner Aufforderung nach. Steinhaus strahlte, trotz seines rundlichen Gesichts und seiner leicht untersetzen Figur, eine gewisse Dominanz aus. Jeder, der den Raum neu betrat, hätte sofort gewusst, dass er hier der Ranghöchste war. Trotzdem war Steinhaus kein überheblicher oder tyrannischer Chef. Vor allem konnte er zugeben, wenn er einen Fehler gemacht hatte, was Ben bei einem Menschen schon immer für eine außergewöhnlich große Stärke gehalten hatte. Er selbst war nicht besonders gut darin, sich seine Fehler einzugestehen. Geschweige denn, Fehltritte anderer zu verzeihen. So wie bei Emma.
»Also«, setzte Theodor an, »ich denke, wir haben es hier mit einem Psychopathen zu tun. Vielleicht auch mit einem Soziopathen, aber dafür kommt er mir zu kühl und kontrolliert vor.« In diesem Moment hob ein junger Kollege mit lockigem, vollem Haar die Hand, von dem Ben nur den Nachnamen kannte.
»Was genau ist denn der Unterschied? Sind nicht beide einfach geistesgestört?«, fragte Schmitz.
»Jein«, sagte Steinhaus. »Haben wir jemanden hier, der das unserem jungen Kollegen erklären möchte?«