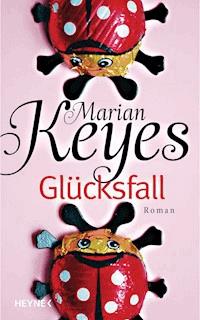4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie entkommt man der Dekadendepression, wenn man die 30 überschritten hat? Für Tara, Katherine und Fintan ist das ein heißes Thema. Single bleiben oder den Antrag forcieren? Als Fintan schwer erkrankt, steht die Freundschaft der drei an allererster Stelle.
«Witzig, mitunter anrührend, aber nie rührselig.»
DIE WOCHE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Freunde fürs Leben – für Tara, Fintan und Katherine sind das nicht nur leere Worte. Sie kennen sich seit ihrer gemeinsamen Kindheit im irischen Küstenort Knockavoy, und auch wenn sie mittlerweile um die Dreißig sind und in London leben, sind sie unzertrennlich. Tara ist Sorgenkind Nummer eins. Im ständigen Ringen gegen überflüssige Pfunde und die Ignoranz ihres Freundes hofft sie täglich auf einen Heiratsantrag. Jenseits der Dreißig ist irgendein Mann allemal besser als gar keiner … Fintan hat in Sachen Liebe mehr Glück: Der neue Nachbar entpuppt sich als der Mann seines Lebens. Katherine dagegen ist sich in ihrem perfekt eingerichteten Alltag selbst genug. Warum sich mit Männern herumschlagen, wenn der Fernseher mindestens genausoviel Unterhaltung verspricht? Doch als Fintan überraschend schwer erkrankt, wird die Freundschaft der drei auf eine harte Probe gestellt. Und plötzlich entdecken Tara und Katherine, daß es das Leben auch jenseits der Dreißig noch in sich hat.
»Witzig, mitunter anrührend, aber nicht rührselig erzählt die irische Autorin … von Projektions- bzw. Identifikationsfiguren also, die so sind wie wir – oder wie wir gerne wären.«
Die Woche
Die Autorin
Marian Keyes, 1963 als ältestes von fünf Kindern in Limerick geboren, lebte nach ihrem Jurastudium lange Zeit in London. Seit ihrer Rückkehr nach Irland widmet sie sich der Schriftstellerei. Mit ihrem Erstlingsroman Wassermelone landete sie einen phänomenalen Erfolg. Zuletzt bei Heyne erschienen: Der hellste Stern am Himmel.
Inhaltsverzeichnis
Das Gestern ist nur ein Traum, Und das Morgen eine Vision, Aber der heutige Tag, gut gelebt, Macht aus jedem Gestern einen Traum vom Glück Und aus jedem Morgen eine Vision der Hoffnung.
Daher achte gut auf den heutigen Tag.
Sprichwort aus dem Sanskrit
1
Das magere Mädchen am Empfang des Restaurants in Camden – einer Konstruktion aus Chrom und Glas – fuhr mit dem purpurfarbenen Fingernagel an den Namen auf der Liste entlang und murmelte: »Casey, Casey, wo bist du denn? Ah, hier, Tisch zwölf. Sie sind –«
» – die erste?« beendete Katherine den Satz für sie. Sie war ziemlich enttäuscht, denn obwohl es ihr widerstrebte, hatte sie sich allergrößte Mühe gegeben, fünf Minuten zu spät zu kommen.
»Sind Sie Jungfrau?« Die Purpurlackierte schwor offensichtlich auf Astrologie.
Als Katherine nickte, fuhr sie fort: »Es ist Ihr Schicksal, krankhaft pünktlich zu sein. Finden Sie sich damit ab.«
Ein Kellner mit Namen Darius, der sich seine Dreadlocks wie die Hepburn zu einem Knoten aufgesteckt hatte, führte sie zu dem reservierten Tisch. Katherine setzte sich, schlug die Beine übereinander, warf ihr zu einem gestuften Pagenkopf geschnittenes Haar aus dem Gesicht und hoffte, den Eindruck kühler Gelassenheit zu vermitteln. Sie tat, als studiere sie die Speisekarte, wünschte, sie würde rauchen, und nahm sich fest vor, das nächste Mal zehn Minuten zu spät zu kommen.
Vielleicht sollte sie, wie Tara immer wieder anregte, zu den Anonymen Ordnungsfetischisten gehen.
Kurz darauf erschien Tara – fast pünktlich, was nicht ihrem Wesen entsprach. Mit wogendem weizenblondem Haar und klappernden Absätzen kam sie über das Buchenparkett. Sie trug ein asymmetrisch geschnittenes Kleid, das den Glanz des Neuen hatte, nach viel Geld aussah und – leider – ein wenig spannte. Ihre Schuhe hingegen waren phantastisch. »Tut mir leid, daß ich nicht zu spät komme«, sagte sie. »Ich weiß, daß du dich lieber moralisch überlegen fühlst, aber der Verkehr hatte sich gegen mich verschworen.«
»Da kann man nichts machen«, sagte Katherine ernst. »Laß es bloß nicht zur Gewohnheit werden. Alles Gute zum Geburtstag!«
»Was ist da gut dran?« fragte Tara bekümmert. »Wie hast du dich an deinem einunddreißigsten Geburtstag gefühlt?«
»Ich habe zehn Gesichtsmassagen gebucht«, bekannte Katherine. »Aber sei ganz beruhigt, du siehst keinen Tag älter aus als dreißig. Na ja, vielleicht einen Tag …«
Darius kam eilfertig an den Tisch, um Katherines Getränkebestellung aufzunehmen. Als er Tara erkannte, erschrak er sichtlich. Nicht sie schon wieder, dachte er und machte sich stoisch darauf gefaßt, daß es ein langer Abend werden würde.
»Was nimmst du?« fragte Tara Katherine. »Vino? Oder von dem harten Zeug?«
»Gin Tonic.«
»Klingt gut. Zwei Gin Tonic.« Tara rieb sich freudig erregt die Hände. »Und? Wo sind meine Buntstifte und mein Malbuch?«
Tara und Katherine waren von Kindesbeinen an beste Freundinnen, und Tara achtete genau darauf, daß die Traditionen eingehalten wurden.
Katherine schob ein bunt verpacktes Geschenk über den Tisch, Tara riß das Papier auf. »Von Aveda!« rief sie erfreut.
»Aveda-Kosmetik sind Buntstifte und Malbuch der Frau über dreißig«, erklärte Katherine.
»Manchmal vermisse ich die Buntstifte irgendwie«, sagte Tara nachdenklich.
»Meine Mutter kauft dir zu jedem Geburtstag welche«, meinte Katherine.
Tara sah erwartungsvoll auf.
»Im übertragenen Sinn«, fügte Katherine schnell hinzu.
»Du siehst toll aus.« Tara zündete sich eine Zigarette an und ließ neidisch ihren Blick über Katherines Karen-Millen-Hosenanzug gleiten.
»Du aber auch.«
»Red keinen Scheiß.«
»Doch. Dein Kleid ist super.«
»Mein Geburtstagsgeschenk für mich selbst. Weißt du was?« Taras Gesicht überschattete sich. »Ich hasse diese Geschäfte, wo sie solche Spiegel haben, die nach vorn gekippt sind. Dann glaubt man, das Kleid macht einen gertenschlank und elegant. Wie eine Blöde denke ich jedesmal, daß es an dem raffinierten Schnitt liegt und es sich deshalb lohnt, sich in riesige Schulden zu stürzen, die man jahrelang abstottern muß.« Sie machte eine Pause und nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. »Und kaum bist du zu Hause und stehst vor einem Spiegel, der nicht nach vorn gekippt ist, dann siehst du aus wie Schweinchen Dick im Sonntagskleid.«
»Du siehst nicht aus wie ein Schwein.«
»Und ob. Und umtauschen kann ich es nur, wenn es einen Fehler hat. Ich habe gesagt, es hat alle möglichen Fehler, zum Beispiel sehe ich darin aus wie Schweinchen Dick im Sonntagskleid, aber sie haben gesagt, das zählt nicht. Nur wenn der Reißverschluß kaputt wäre, zum Beispiel. Jetzt, wo ich meine Visa-Karte ganz ausgeschöpft habe, kann ich es auch ruhig anziehen.«
»Aber du hattest sie schon ausgeschöpft.«
»Nein, nein«, erklärte Tara ernsthaft. »Ich hatte sie nur bis zum offiziellen Limit ausgeschöpft. In Wirklichkeit ist es ungefähr zweihundert Pfund darüber. Aber das weißt du doch!«
»Schon«, sagte Katherine nicht ganz überzeugt.
Tara nahm die Speisekarte. »Oh, Mann«, stöhnte sie, »das hört sich alles so köstlich an. Lieber Gott, gib mir die Kraft, keine Vorspeise zu bestellen. Obwohl ich einen Riesenhunger habe und ganze Wagenladungen verschlingen könnte!«
»Wie kommst du mit der Diät klar, bei der nichts verboten ist?« fragte Katherine, obwohl sie die Antwort schon erraten konnte.
»Gar nicht mehr«, sagte Tara und blies mit beschämter Miene den Rauch aus.
»Macht auch nichts«, tröstete Katherine sie.
»Genau.« Tara war erleichtert. »Überhaupt nichts. Thomas war außer sich, das kannst du dir ja vorstellen. Aber, ich meine, eine Diät, bei der man einem Vielfraß wie mir sagt, daß nichts verboten ist. Da ist das Unheil vorprogrammiert.«
Katherine gab beschwichtigende Laute von sich, wie sie das seit fünfzehn Jahren machte, wenn Tara von ihrer nicht zu zügelnden Eßlust sprach. Katherine konnte alles essen, was sie wollte, einfach, weil sie das meiste nicht essen wollte. Ihr durchgestyltes Äußeres ließ eine Frau vermuten, die nirgends Schwierigkeiten hatte. Die kühlen grauen Augen sahen ruhig und überlegen unter dem dunklen Pony hervor. Sie war sich dessen bewußt. Wenn sie allein war, übte sie das.
Als nächstes kam Fintan, der auf seinem Weg durch das Restaurant von den Blicken der Kellner und der meisten Gäste verfolgt wurde. Er war groß und kräftig und sah gut aus, die dunklen Haare hatte er zu einer gelglänzenden Tolle nach hinten gekämmt. Die Ärmel seines grell-lila Anzugs waren über und über mit Knopflöchern durchsetzt, durch die sein limonengrünes Hemd blinkte. Das Revers war so ausladend, daß es als Landeplatz für Flugzeuge hätte dienen können. »Wer ist das wohl…?«, »Bestimmt ein Schauspieler …!«, »Oder ein Model…?« flüsterten die Gäste raschelnd wie Herbstlaub, und ihr freitagabendliches Wohlbefinden verstärkte sich. Mein Gott, dachten sie alle, was für ein attraktiver Mann! Er entdeckte Tara und Katherine, die ihn wohlwollend amüsiert beobachtet hatten, und lächelte. Es war, als wären alle Lichter heller geworden.
»Toller Anzug«, sagte Katherine bewundernd.
»Nicht schlecht, was?« erwiderte Fintan und versuchte, einen Londoner Tonfall nachzuahmen, was ihm aber gründlich mißlang. Er konnte seinen weichen irischen Akzent aus County Clare nicht verbergen.
Sein Werdegang war bemerkenswert. Als er zwölf Jahre zuvor aus der Enge einer irischen Kleinstadt nach London gekommen war, hatte er mit Elan begonnen, sich neu zu erfinden. Als erstes nahm er sich seine Ausdrucksweise vor. Tara und Katherine mußten hilflos mit ansehen, wie Fintan mit affektierten Gesten schwule Wendungen in Gespräche einfließen ließ und davon sprach, daß er mit Boy George im Taboo getanzt habe.
Doch in den letzten zwei Jahren hatte er sich zu seinem irischen Akzent bekannt, ihn jedoch abgewandelt. Regionale Einsprengsel galten in seiner Sparte, der Modebranche, durchaus als chic. Die Leute fanden sie amüsant, wie man beispielsweise an Jean Paul Gaultier sehen kann. Aber Fintan begriff, daß es auch wichtig war, verstanden zu werden. Deshalb hatte er sich jetzt eine Art fettarmen irischen Akzent angewöhnt. In diesen zwölf Jahren hatte Taras und Katherines ländliche Ausdrucksweise eine urbane Nuance bekommen.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Fintan zu Tara. Sie küßten sich nicht. Obwohl Tara, Katherine und Fintan fast jeden küßten, mit dem sie verkehrten, gehörte Küssen nicht zu den Umgangsformen untereinander. Sie waren in einer Kleinstadt aufgewachsen, in der man mit Zeichen körperlicher Zuneigung zurückhaltend war. So sagte in Knockavoy der Mann anstelle des Vorspiels: »Beiß die Zähne zusammen, Täubchen.« All dies hatte jedoch Fintan nicht von dem Versuch abgehalten, den Kuß auf beide Wangen in ihrer gemeinschaftlichen Wohnung in Willesden Green einzuführen, wo sie am Anfang ihrer Londoner Zeit lebten. Er wollte sogar, daß sie sich gegenseitig küßten, wenn sie von der Arbeit kamen, aber das traf auf heftigen Widerstand. Er war zutiefst enttäuscht. Seine neuen schwulen Freunde hatten Freundinnen, die sich auf dergleichen einließen, warum nicht er?
»Wie geht es dir?« fragte Tara ihn. »Sieht aus, als hättest du abgenommen, du Glücklicher. Was macht dein Beriberi?«
»Hat mich schwer im Griff und macht mir zu schaffen. Jetzt habe ich’s im Hals«, seufzte Fintan. »Was macht dein Typhus?«
»Den habe ich überwunden«, sagte Tara. »Zwei Tage im Bett, und er war weg. Gestern hatte ich einen Anflug von Tollwut, aber das ist jetzt vorbei.«
»Solche Witze sind einfach nur übel.« Katherine schüttelte angewidert den Kopf.
»Kann ich was dafür, wenn ich mich immer krank fühle?« Fintan war empört.
»Und ob!« sagte Katherine unbeeindruckt. »Wenn du nicht jeden Abend ausgehen und dich besaufen würdest, ginge es dir morgens um vieles besser.«
»Du wirst dir schwere Vorwürfe machen, wenn sich herausstellt, daß ich Aids habe«, brummelte Fintan finster.
Katherine wich die Farbe aus dem Gesicht. Sogar Tara war zusammengezuckt. »Darüber solltest du nicht scherzen.«
»Entschuldigung«, sagte Fintan bedrückt. »Die blanke Angst sitzt einem im Nacken, und dann sagt man dumme Sachen. Gestern abend habe ich einen früheren Freund von Sandro getroffen, der sieht aus wie einer aus dem KZ. Die Liste wird einfach immer länger, und das macht einem ganz schön angst …«
»Bitte nicht«, sagte Tara leise.
»Aber du brauchst doch keine Angst zu haben«, warf Katherine ein. »Du nimmst Kondome, und außerdem hast du eine feste Beziehung. Wie geht es denn dem italienischen Pony?«
»So ein schöner, schöner Knabe!« sagte Fintan mit dröhnender Stimme, so daß die anderen Gäste sich umsahen und befriedigt nickten: Es war tatsächlich ein berühmter Schauspieler, wie sie von Anfang an vermutet hatten.
»Sandro ist einfach wunderbar«, fuhr Fintan mit seiner normalen Stimme fort. »Es könnte nicht besser sein. Er schickt tausend Grüße und diese Karte …« – er reichte Tara die Karte – »und läßt sich entschuldigen, denn während wir hier sitzen, tanzt er in einem Ballkleid aus jadegrünem Taft zu der Musik von ›Show Me The Way to Amarillo‹. Er ist nämlich Brautjungfer bei Peters und Erics Hochzeit, müßt ihr wissen.«
Fintan und Sandro waren schon seit vielen Jahren ein Paar. Sandro war Italiener, aber er war so klein, daß man ihn nicht als Hengst bezeichnen konnte. Deswegen nannten sie ihn Pony. Er war Architekt und lebte mit Fintan in einer prachtvollen Wohnung in Notting Hill.
»Kannst du mir mal was sagen?« fragte Tara vorsichtig. »Gibt es zwischen dir und dem Pony auch mal Streit?«
»Streit!« Fintan war entsetzt. »Ob es Streit gibt! Wie kannst du so etwas fragen! Wir sind verliebt!«
»Entschuldigung«, murmelte Tara.
»Wir streiten die ganze Zeit«, sagte Fintan dann, »und liegen uns dauernd in den Haaren, von morgens bis abends.«
»Ihr seid also verrückt nach einander«, sagte Tara neidvoll.
»Ich sag es mal so«, gab Fintan zurück, »der Typ, der Sandro gemacht hat, war an dem Tag in Höchstform. Warum fragst du, ob es Streit gibt?«
»Ach, nur so.« Tara reichte ihm ein kleines Päckchen. »Das ist dein Geschenk für mich. Du schuldest mir zwanzig Pfund.«
Fintan nahm das Päckchen, bewunderte die Verpackung und gab es Tara zurück. »Herzlichen Glückwunsch, Süße! Welche Kreditkarten nimmst du?«
Tara und Katherine waren mit Fintan übereingekommen, daß jeder seine eigenen Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke kaufte. Entstanden war die Regelung, nachdem Tara und Katherine sich quasi verschuldet hatten, um Fintan zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag eine gebundene Ausgabe von Oscar Wildes Gesammelten Werken zu kaufen. Er nahm ihr Geschenk mit überschwenglichem Dank, aber einem merkwürdig ausdruckslosen Gesicht entgegen. Und ein paar Stunden später, als die Party in vollem Gange war, fand man ihn, schluchzend und wie ein Fötus zusammengerollt, auf dem Küchenfußboden, inmitten von Chipskrümeln und leeren Getränkedosen. »Bücher«, heulte er, »was soll ich denn mit Büchern? Ich weiß, ich bin undankbar, aber ich dachte, ihr schenkt mir ein T-Shirt aus Gummi von Galliano!«
Nach diesem Abend trafen sie ihre Vereinbarung, die immer noch galt.
»Was habe ich dir geschenkt?« fragte Fintan.
Tara riß das Papier auf und zeigte den Lippenstift. »Aber es ist kein normaler Lippenstift«, sagte sie aufgeregt. »Dieser hier ist nämlich wirklich kußfest. Das Mädchen in dem Geschäft hat gesagt, er würde sogar einen nuklearen Angriff überstehen. Ich glaube, meine lange Suche ist endlich abgeschlossen.«
»Wird auch Zeit«, sagte Katherine. »Wie viele untaugliche Lippenstifte hast du wohl schon gekauft?«
»Viel zu viele«, sagte Tara. »Und alle versprechen, daß die Lippen die Farbe annehmen und der Stift kußecht ist, und dann ist doch das Glas verschmiert oder die Gabel, wie bei jedem anderen Lippenstift auch. Man könnte weinen!«
Als nächstes kam Liv. Sie trug einen Mantel von Agnès b., der den Neid aller Frauen erweckte. Sie legte großen Wert auf Label, wie es sich für jemanden, der in der Welt des Designs zu Hause war, gehörte, auch wenn sie Innenarchitektin war. Liv war Schwedin – groß, mit einem kräftigen Knochenbau, strahlendweißen Zähnen und hüftlangen, glatten, weißblonden Haaren. Männer dachten oft, daß sie sie aus einem Pornofilm kannten.
In Taras und Katherines Leben trat sie vor fünf Jahren, als Fintan zu Sandro zog. Sie suchten eine neue Mitbewohnerin, aber niemand war an dem winzigen Zimmer interessiert. Und daß die Schwedin es nehmen würde, erschien ihnen auch nicht sehr wahrscheinlich, sie war einfach zu groß. Doch als Liv erfuhr, daß die beiden aus Irland und, noch besser, vom Land kamen, leuchteten ihre blauen Augen. Unverzüglich holte sie das Geld für die Kaution aus ihrer Handtasche und gab es ihnen.
»Aber du hast noch gar nicht gefragt, ob wir eine Waschmaschine haben«, sagte Katherine überrascht.
»Das ist ja nicht so wichtig«, sagte Tara, die auch ganz erschrocken war, »aber du weißt doch gar nicht, wie weit es bis zur Spirituosenhandlung ist.«
»Kein Problem«, sagte Liv mit ihrem leichten Akzent. »Solche Dinge sind nicht so wichtig.«
»Wenn du meinst…« Tara überlegte schon, ob Liv schwedische Freunde in London hatte – große, blonde, braungebrannte Männer, die sie ihnen vorstellen würde.
Aber wenige Tage, nachdem Liv eingezogen war, wurde ihnen der Grund für Livs Begeisterung klar. Zu Taras und Katherines Bestürzung fragte Liv sie, ob sie mit ihnen zur Messe kommen oder den Rosenkranz beten könne. Es stellte sich heraus, daß Liv auf Sinnsuche war. Mit der Psychotherapie war sie vorübergehend auf Grund gelaufen und setzte jetzt alle ihre Hoffnungen auf geistige Erleuchtung und darauf, daß der katholische Glaube der beiden jungen Frauen auf sie übergehen würde.
»Es tut mir leid, daß wir dich enttäuschen müssen«, erklärte Katherine sanft, »aber wir sind abtrünnige Katholiken.«
»Abtrünnig!« rief Tara. »Wovon redest du?«
Katherine sah Tara verdutzt an. Ihr war nicht aufgefallen, daß ihre Freundin in letzter Zeit zum Glauben zurückgefunden hatte.
»Abtrünnig ist nicht stark genug«, erklärte Tara schließlich. »Eher abgefallene Katholiken.«
Schon bald überwand Liv ihre Enttäuschung. Und obwohl sie unverhältnismäßig viel Zeit damit zubrachte, mit dem Zeitungshändler, einem Sikh, über die Frage der Wiedergeburt zu diskutieren, war sie in jeder anderen Hinsicht normal. Sie hatte Liebhaber und gelegentlich einen Kater, sie bekam Drohbriefe von ihrer Bank und hatte einen Kleiderschrank voller Kleider, die sie im Ausverkauf billig erstand und dann nie anzog.
2
Wir sind also nur zu viert?« rief Fintan überrascht.
Tara nickte. »Ich bin zu labil für ein wildes Fest. Ich brauche den Trost von ein paar guten Freunden an diesem traurigen Tag.«
»Eigentlich wollte ich damit sagen: Wo ist Thomas?« Ein Glitzern stand in Fintans Augen.
»Ach, er wollte es sich zu Hause gemütlich machen«, sagte Tara ein bißchen verlegen.
Es erhob sich lautstarker Protest. »Aber es ist dein Geburtstag! Er ist dein Freund!«
»Er ist nie dabei, wenn wir uns treffen«, beschwerte sich Fintan. »An deinem Geburtstag sollte der alte Miesepeter sich mal aufraffen.«
»Ich finde das nicht so schlimm«, sagte Tara, »und morgen geht er mit mir ins Kino. Laß ihn doch. Ich gebe ja zu, daß er nicht der umgänglichste Mensch unter der Sonne ist, aber er ist nicht gemein, er hat nur seine Schwierigkeiten –«
»Ich weiß, ich weiß«, unterbrach Fintan sie. »Wir wissen Bescheid. Seine Mutter hat ihn im Stich gelassen, als er sieben war, deshalb kann er nichts dafür, daß er ein alter Miesepeter ist. Aber er sollte dich besser behandeln. Du hast nur das Beste verdient.«
»Aber ich bin glücklich, so, wie es ist«, verteidigte sich Tara. »Wirklich. Ihr seid viel zu … viel zu…« – Sie suchte nach dem richtigen Wort – »… ehrgeizig, was mich angeht. Ihr seid wie Eltern, die aus ihrem Kind einen Gehirnchirurgen machen wollen, obwohl es nur das Zeug zum Müllmann hat. Ich liebe Thomas.«
Fintan verstummte frustriert. Die Liebe war blind, daran war nicht zu zweifeln. In Taras Fall war sie auch taub und stumm und Legasthenikerin, hatte ein schlimmes Hüftgelenk und beginnenden Alzheimer.
»Und Thomas liebt mich«, sagte Tara fest. »Und bevor ihr anfangt, mir zu erzählen, daß ich einen besseren finden könnte, möchte ich euch daran erinnern, daß ich Torschlußpanik habe. Mit einunddreißig und jenseits von Gut und Böse habe ich sowieso keine Chance, einen anderen zu finden.«
Liv überreichte ihre Karte und das Geschenk. Die Karte war mit handbemalter Seide bespannt, und das Geschenk war eine schmale, elegante kobaltblaue Vase aus Glas.
»Phantastisch! Du hast soviel Gefühl für Stil, daß es einem weh tut«, rief Tara und versuchte, ihre Enttäuschung darüber, daß es nicht die Anti-Zellulitis-Creme war, die sie sich so dringend gewünscht hatte, zu verbergen. »Danke!«
»Möchten Sie bestellen?« Darius erschien an ihrem Tisch, den Stift in der Hand.
»Ja, meinetwegen«, murmelte jeder. »Kann jemand anders anfangen?«
»Also gut.« Tara sah lächelnd von der Speisekarte auf. »Ich nehme das Holzofen-Mars mit den Butterrosinen und den Petersilienwurzeln à la Cappuccino.«
Darius sah sie ohne ein Lächeln an. Sie hatte das schon beim letzten Mal gemacht.
»Entschuldigung.« Tara kicherte. »Ich finde es einfach lustig, diese verrückten Kombinationen.«
Darius starrte sie weiterhin unbewegt an.
»Bitte«, murmelte Katherine, »bestell einfach normal.«
»Entschuldigung.« Tara räusperte sich. »Gut, ich nehme das Bœuf brulé mit Koriander-Pesto und geschredderten Rote Bete in Currysauce, und dazu eine Portion Schokoladenpüree.«
»Tara!« Katherine explodierte.
»Ist schon gut«, beruhigte Fintan sie eilig. »Das steht wirklich auf der Karte.«
Katherine sah auf die Speisekarte: »Ach so, stimmt. Dann nehme ich das auch.«
Nachdem das Essen auf dem Tisch stand – ein Teller kunstvoller dekoriert als der nächste –, kamen sie auf das Altern zu sprechen. Schließlich hatte ja jemand Geburtstag.
»Im Gegensatz zu dem, was alle immer sagen«, fing Katherine an, »sind es nicht die Falten, die mich deprimieren. Sondern die Tatsache, daß mein Gesicht in den letzten zehn Jahren –«
»Abgesackt ist«, sagten Tara und Liv im Chor. Sie hatten dieses Spiel schon viele Male gespielt.
»Ich weiß genau, was du meinst.« Mit der Wendigkeit einer Staffelläuferin griff Tara das Thema auf. »Wenn man sich das Photo in meinem Paß ansieht, das vor neun Jahren gemacht worden ist, da war mein Mund knapp unter der Stirn, aber jetzt sind meine Augen fast am Kinn – welches Kinn? höre ich euch fragen –, und meine Schläfen sind schon nah an der Taille.«
»Was für ein Glück, daß es die Schönheitschirurgie gibt«, sagte Liv mit Inbrunst.
»Ich weiß nicht recht«, sagte Fintan nachdenklich. »Ich finde es schön, mit Gelassenheit alt zu werden und der Natur ihren Lauf zu lassen. Ein gealtertes Gesicht ist doch sehr ausdrucksstark.«
Die drei Frauen sahen ihn mißmutig an. Offensichtlich konnte er sich nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn sich die Erdanziehungskraft auch in seinem Gesicht bemerkbar machen würde. Aber was konnten sie schon erwarten? Er war zwar schwul, aber er war trotzdem ein Mann. Und weil er mit hohen Collagen-Mengen gesegnet war, dachte er, er wäre Dorian Gray. Sollte er mal zehn Jahre warten, dann würde sich dieser Unsinn vom Altern in Gelassenheit ganz anders anhören. Spätestens dann würde er darum betteln, sich in die Hände eines Schönheitschirurgen begeben zu können.
»›Ein gealtertes Gesicht ist so ausdrucksstark‹«, wiederholte Tara. »Das klingt gut, von einem, der praktisch in eine größere Wohnung ziehen mußte, um seine Clinique-Sammlung unterzubringen. Dein Badezimmer braucht doch einen Kurator. Du könntest ein Museum daraus machen.«
»Gute Idee!« Fintan lachte.
Dann kamen sie unweigerlich auf das Ticken ihrer biologischen Uhren zu sprechen.
»Ich möchte gern ein Kind«, sagte Liv verlegen. »Es gefällt mir nicht, daß ich eine unbenutzte Gebärmutter habe.«
»Bloß nicht!« stöhnte Katherine. »Du wünschst dir Erfüllung und handelst dir nichts als Ärger ein.«
»Keine Angst. Es wird nicht dazu kommen«, sagte Liv traurig. »Nicht, solange mein Freund mit einer anderen Frau verheiratet ist. Und außerdem in Schweden lebt.«
»Du hast wenigstens einen Freund«, sagte Fintan fröhlich. »Nicht wie Katherine hier. Wie lange ist es her, Katherine, seit du es gemacht hast?«
Katherine lächelte nur geheimnisvoll, und Fintan seufzte. »Was sollen wir nur mit dir machen? Es ist ja nicht so, daß du keine Angebote von sexy Typen bekommst.«
Wieder lächelte Katherine, diesmal etwas angespannter.
»Wißt ihr, ich würde auch gern ein Kind haben«, gab Fintan zu. »Das ist das einzige, was ich am Schwulsein bedauere.«
»Du kannst doch trotzdem ein Kind bekommen«, sagte Tara munter. »Such dir eine Frau, die mitmacht, schließ mit ihr einen Vertrag als Leihmutter ab, und die Sache ist geritzt.«
»Gute Idee. Wie wär’s mit einer von euch? Katherine?«
»Nein«, sagte Katherine knapp. »Ich will keine Kinder.«
Fintan lachte angesichts ihres angewiderten Ausdrucks. »Wenn du dich in den Richtigen verliebst, denkst du anders darüber. Und du, Tara? Meldet sich deine Gebärmutter bei dem Gedanken, ein Kind auszutragen?«
»Ja, nein… ich weiß nicht, vielleicht«, sagte Tara vage. »Aber eins steht fest: Ich kann kaum für mich selber sorgen. Wenn ich ein anderes Wesen waschen, füttern und anziehen müßte, wäre das mein Untergang. Ich bin einfach zu unreif.«
»Guckt euch doch an, wie es Emma ergangen ist«, pflichtete Katherine ihr bei. Emma war eine alte Freundin, die ihr Leben in vollen Zügen genossen hatte, bis sie kurz hintereinander zwei Kinder bekam. »Früher hatte sie Stil, und jetzt sieht sie aus wie eine Öko-Tante.«
»Für uns ist das ein trauriger Verlust«, sagte Tara. »Keine Zeit zum Haarewaschen, weil sie ständig Kinderpopos abwischen muß. Aber sie ist glücklich.«
»Und wenn man Gerri sieht«, erinnerte Katherine sie. Auch Gerri war eine begeisterte Partygängerin gewesen, aber seit sie ein Kind hatte, war sie selbst zum Baby mutiert. »Sie hat jede Fähigkeit, sich wie eine Erwachsene zu unterhalten, verloren.«
»Aber sie geht schon auf den Topf und kann bis zehn zählen«, sagte Liv. »Und sie ist auch glücklich.«
»Und Melanie erst mal«, sagte Katherine finster. »Früher war sie so tolerant. Jetzt gehört sie zu den Rechtsextremen und würde der National Front ihr Geld geben. So kann es einem gehen, wenn man ein Kind kriegt. Sie macht so eifrig bei Aktionen gegen Kinderschänder mit, daß sie ganz vergessen hat, wer sie eigentlich ist.«
»Aber stellt euch doch mal vor, wie das ist, wenn man sein eigenes Kind in den Armen hält«, sagte Liv zärtlich. »Die Freude! Das Glücksgefühl!«
»Vorsicht!« kicherte Tara. »Sie wird sentimental. Kann jemand sie mal aufhalten?«
»Was hat Thomas dir eigentlich zum Geburtstag geschenkt, Tara?« Katherine sprach, ohne nachzudenken, um zu verhindern, daß Liv in Tränen ausbrach.
»Einen Zehn-Schilling-Schein?« war Fintans Vermutung.
»Zehn Schillinge?« höhnte Tara. »Sei realistisch! So würde er nie mit seinem Geld um sich werfen. Ein Penny, das wäre eher sein Stil.« Sie schlug mit der Hand auf den Tisch und sagte mit einem nordenglischen Akzent: »Ich bin nicht geizig, ich achte nur aufs Geld.« Sie klang genau wie Thomas.
»Einen Blumentopf, den er mit Muscheln beklebt hat? Oder einen gebrauchten Kugelschreiber?« Fintan ließ nicht locker.
»Er hat mir eine Thomas Holmes Special gegeben.« Tara sprach wieder mit ihrer normalen Stimme. »Eine Dose Magnoliencreme und einen Gutschein für Liposuction, wenn er im Lotto gewinnt.«
»Ist er nicht zum Schreien?« sagte Fintan sarkastisch.
»War es eine neue Dose?« fragte Katherine mit unbewegter Miene. »Oder hat er sie aus der Damentoilette in der Schule gestohlen?«
»Ich bitte dich!« Tara war entrüstet. »Sie war natürlich nicht neu. Es war die, die er mir zu Weihnachten geschenkt hat. Ich hatte sie ganz hinten in den Schrank gestellt, und er hat sie offenbar gefunden und auf diese Weise wiederverwertet.«
»Was für ein Geizknopf!« platzte es aus Liv heraus.
»Er ist kein Geizknopf«, widersprach Tara.
Liv war überrascht. Normalerweise war Tara die erste, die erklärte, wie knauserig Thomas war, und mit ihren Übertreibungen zeigen wollte, daß ihr das nichts ausmachte.
»Er ist ein Geizhals«, sagte Tara. »Komm, Liv, sag es mir nach.«
»Thomas ist ein Geizhals«, sagte Liv brav. »Danke, Tara.«
»Man kann es ja auch verstehen«, sagte Tara. »Es geht immer nur um den Kommerz – Weihnachten, Valentinstag, Geburtstage, alle diese Festtage. Ich bewundere ihn, weil er sich konsequent verweigert. Und das heißt ja nicht, daß er mir keine Geschenke macht. Vor ein paar Wochen hat er mir von sich aus eine wunderschöne flauschige Wärmflasche gekauft, für meine Menstruationsbeschwerden.«
»Einfach nur zu geizig, um dir jeden Monat Schmerztabletten zu kaufen«, spottete Fintan.
»Ach, hört auf«, sagte Tara halb lachend. »Ihr seht ihn nicht so wie ich.«
»Wie siehst du ihn denn?«
»Ich weiß, daß er brummig wirkt, aber in Wirklichkeit kann er sehr süß sein. Manchmal«, fuhr sie leicht verlegen fort, »erzählt er mir sehr schöne Gutenachtgeschichten, von einem Bären, der Ernst heißt.«
»Ist das ein Euphemismus für seinen Pimmel?« fragte Fintan mißtrauisch. »Versteckt sich Ernst gern in dunklen Höhlen?«
»Ich sehe schon, ich verschwende nur meine Zeit«, kicherte Tara. »Gibt es irgendwas Neues? Irgendwelchen Klatsch über eine Berühmtheit?«
Als rechte Hand von Carmella Garcia, einer koksenden spanischen Modedesignerin, die gleichzeitig als genial und verrückt gehandelt wurde, erhielt Fintan interessante Einblicke in das Leben der Reichen und Schönen.
»Ich finde, zuerst sollten wir noch was zu trinken bestellen.«
»Ist der Bär katholisch?«
Eine geraume Weile und mehrere Espressi später bemerkte Katherine, daß die mit den Purpurnägeln Kasse machen und nach Hause gehen wollte. Oder, besser gesagt, Kasse machen und dahin gehen wollte, wo sie sich mit Drogen zuknallen konnte. »Ich glaube, wir sollten bezahlen«, sagte sie in das betrunkene, laute Gelächter hinein.
»Ich bezahle«, sagte Fintan mit der Großzügigkeit eines Beschwipsten. »Ich bestehe darauf… keine Widerrede.«
»Kommt nicht in Frage«, sagte Katherine.
»Du beleidigst mich.« Fintan klatschte seine Kreditkarte auf den Tisch. »Du beleidigst meine Ehre.«
»Wie willst du deine Bankschulden auf eine achtstellige Zahl reduzieren, wenn du anderen Leuten das Essen bezahlst?« fragte Katherine mahnend.
»Sie hat recht«, pflichtete Tara ihr bei. »Du hast mir erzählt, daß man dich einsperren wird, wenn du deine Kreditkarte noch mehr belastest. Dann kommen die Männer in Uniform mit ihren Schlagstöcken und Handschellen und holen dich …«
»Großartig!« riefen Fintan und Liv gleichzeitig und stießen sich kichernd in die Rippen.
»… und dann holen sie dich, und wir werden dich nie wiedersehen. ›Ihr müßt mich daran hindern, daß ich zuviel Geld ausgebe‹, hast du gesagt.« Tara schnipste ihm die Karte wieder zu.
»Du kannst doch gar nicht mitreden«, begehrte Fintan auf.
»Wenn zwei das Falsche denken, wird es deshalb noch lange nicht richtiger.«
»Wieso bin ich so pleite?« wollte Fintan wissen. »Ich verdiene doch schließlich genug.«
»Genau deswegen«, erklärte Tara mit betrunkener Logik. »Je mehr ich verdiene, desto ärmer werde ich. Wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, erhöhen sich auch meine Ausgaben, nur in viel größerem Umfang. Diäten machen einen fett? Wenn’s weiter nichts ist – Gehaltserhöhungen machen einen arm!«
»Warum können wir nicht alle so wie Katherine sein?« fragte Fintan.
Katherine hatte einmal gestanden, daß sie bei einer Gehaltserhöhung einen Dauerauftrag für den Nettobetrag der Erhöhung einrichtete, weil sie nach dem Prinzip handelte, daß sie das, was sie nie gehabt hatte, auch nicht vermissen könnte. Sie sah von der Rechnung auf, die sie durch vier teilte. »Weil ich Menschen wie euch brauche, damit ich mich überlegen fühlen kann.«
Schließlich gingen sie.
Darius, der Kellner, beobachtete Katherine auf dem Weg über das Parkett. Sie war nicht sein Typ, aber etwas an ihr faszinierte ihn. Er wußte, wieviel sie getrunken hatte, aber sie stolperte nicht kreischend durch den Raum, wie die anderen, und hielt sich an ihren Freunden aufrecht. Außerdem hatte ihn ihr Verhalten beeindruckt, als sie gekommen war. Er war Experte für Frauen, die, wenn sie warten mußten, ihre Nervosität hinter künstlicher Gelassenheit zu verbergen versuchten, und Katherines kühle Haltung war echt gewesen. Er versuchte, eine angemessene Beschreibung für sie zu finden, aber Worte waren nicht seine Stärke. Mysteriös war das Wort, das er suchte, wenn es ihm nur eingefallen wäre.
»Wohin jetzt?« fragte Tara unternehmungslustig, als sie bibbernd draußen standen. Es war zwar erst Anfang Oktober, aber schon kalt. »Gibt’s irgendwo eine Party?«
»Nein, heute nicht.«
»Überhaupt nichts? Normalerweise fällt einem doch irgendwas ein.«
»Wir könnten in die Bar Mundo gehen?« schlug Katherine vor.
Tara schüttelte den Kopf. »Wir gehen mittwochs immer dorthin, deswegen hat das für mich mit Arbeit zu tun.« »Ins Blue Note?«
»Das ist jetzt rammelvoll, da kriegen wir keinen Tisch mehr.«
»Ins Happiness Stans?«
»Letztens hatten sie lausige Musik.«
»Subterrania?«
»Ich bitte dich!«
»Das heißt wohl nein.« Katherine war fast die ganze Liste der von ihnen besuchten Clubs durchgegangen.
»Wie wär’s mit Torture Chamber?« meinte Fintan fröhlich. »Da gibt es laute nette Jungs, die an der Leine herumgeführt werden.«
»Das geht nicht«, sagte Katherine. »Erinnerst du dich nicht? Letztes Mal wollten sie uns nicht reinlassen, weil wir Frauen sind.«
»War das der Grund?« sagte Liv überrascht. »Ich dachte, es lag daran, daß wir keine rasierten Schädel hatten.«
»Eigentlich habe ich gar keine Lust, in einen Club zu gehen«, gab Tara zu. »Mir ist gar nicht nach Menschenmassen und Lärm. Ich will mich lieber bequem an einen Tisch setzen, mir nicht den Weg zur Bar freikämpfen müssen und hören können, was wir uns erzählen … o nein!« Entsetzt hob sie die Hand zum Mund. »Es fängt schon an. Seit weniger als einem Tag bin ich einunddreißig, und schon kommt das Alter. Ich muß in einen Club gehen, einfach um mir zu beweisen, daß ich es noch will.«
»Ich habe eigentlich auch keine Lust auf einen Club«, tröstete Liv sie. »Aber ich bin jetzt einunddreißigeinhalb und habe mich damit abgefunden.«
»Nein!« Tara war entsetzt. »Schlimm genug, keine Lust zu haben, aber sich damit abzufinden! Ich hasse es, alt zu werden, wirklich.«
»Demnächst wünschst du dir, einfach im Bett zu bleiben und fernzusehen, statt irgendwas zu unternehmen.« Katherines Augen funkelten frech. »Und du denkst dir Entschuldigungen aus, damit du nicht ausgehen mußt. Es gibt sogar ein offizielles Wort für dieses Syndrom, man nennt es Cocooning. Du wirst noch ein inniges Verhältnis zu deiner Fernbedienung entwickeln. Ich liebe meine. Und dann kaufst du dir nicht mehr Vogue, sondern Living Etc.«
»Ist das eine Zeitschrift für Inneneinrichtungen?«
Katherine nickte und grinste niederträchtig, und Tara wand sich. »O nein.«
»Wir können zu einem von uns gehen.« Fintan wollte die Party wieder in Schwung bringen. »Wir tun einfach so, als wäre es ein Club.«
»Wir können zu mir gehen«, schlug Tara vor. Sie dachte an Thomas und hoffte, die anderen würden ablehnen. Sie war betrunken, aber so betrunken nun auch wieder nicht.
»Oder zu mir«, sagte Katherine, auch mit dem Gedanken an Thomas.
»Zu Katherine!« sagten Liv und Fintan wie aus einem Mund bei dem Gedanken an Thomas.
»Hast du was zu trinken da?« fragte Tara.
»Ja, natürlich«, erwiderte Katherine pikiert.
»Meine Güte, wir sind wirklich erwachsen«, murmelte Tara düster.
Katherine hielt ein Taxi an, was zwei Männer, die in einiger Entfernung schon länger versucht hatten, eins zu bekommen, ärgerlich registrierten.
»Gospel Oak«, sagte sie zu dem Fahrer.
»Da können Sie doch laufen«, brummelte der.
»Ich nicht«, sagte Tara fröhlich. »Ich bin blau.«
Als alle vier im Wagen saßen, sagte sie: »Erinnert ihr euch noch? Als wir zusammen gewohnt haben, hat sich Alkohol keine fünf Minuten gehalten. Wenn wir nach Irland gefahren sind«, sagte sie mit einem Blick auf Katherine und Fintan, und mit einem Blick auf Liv »oder du nach Schweden, und wir haben frietidu eingekauft, äh, ich meine duty-free, hatten wir es immer schon getrunken, bevor wir richtig zu Hause waren.«
»Das lag an unserer Armheit«, sagte Liv.
3
Während Fintan und die drei Frauen im Restaurant gesessen hatten, fand nur zwei Minuten entfernt eine Party statt. Natürlich fanden viele Partys statt, weil dies London war und dazu noch der Bezirk Camden, und weil es Freitag abend war. Doch auf dieser Party war Lorcan Larkin einer der Gäste.
Lorcan Larkin war ein Mann, der rundum gelungen war. Das einzige, was nicht so gelungen war, war sein Name – da hatten die Eltern versagt. Er war eins fünfundachtzig und hatte einen breiten Brustkorb, einen flachen Bauch, lange Beine und schmale Hüften. Seinen Körper pflegte er, indem er nach Herzenslust aß und trank und rauchte. Sein kupferfarbenes Haar fiel ihm in weichen Locken auf die Schultern, er hatte schmale, sherrybraune Augen und einen der schönsten und sinnlichsten Münder in und um Camden.
Tausende von Frauen fanden sich in große Verwirrung gestürzt, wenn sie Lorcan begegneten, und sahen ihn mit lustvollen Blicken an. »Dabei finde ich rothaarige Männer gar nicht attraktiv«, hörte man überall. »Mir ist das so peinlich!«
Lorcan war ein ganz besonderer Rotschopf. Man pfiff ihm nicht nach und sagte: »Sieh dir den scharfen Rothaarigen an!« Eher folgten ihm verzückte Blicke.
Und für den seltenen Fall, daß jemand noch zögerte, ihm zu verfallen, statt sich dem Gefühl einfach zu ergeben, hatte er seine Geheimwaffe. Seinen irischen Akzent. Es war nicht der platte, bauernhafte Akzent, mit dem die Leute sich über die Iren lustig machten, indem sie die Vokale zerdehnten und einen unterwürfigen Ton anschlugen. Lorcans Stimme war weich, schmeichelnd, melodiös und vor allem gebildet. Und er schreckte nicht davor zurück, gelegentlich eine Gedichtzeile einzuflechten, wenn es ihm opportun schien. Frauen waren wie hypnotisiert von seiner Stimme. Und genau darauf legte er es an.
Genau in dem Moment, als Tara zwei Portionen Nachtisch bestellte (»Schließlich ist heute mein Geburtstag!« hatte sie trotzig erklärt.), beschloß Lorcan, daß er Kelly, die sechzehn Jahre alte Tochter seiner Gastgeberin, vögeln würde. Ganz offensichtlich war sie scharf auf ihn; schon den ganzen Abend machte sie ihn an, warf ihm heiße Blicke aus großen feuchten Augen zu und streifte ihn jedesmal, wenn sie an ihm vorbeiging, mit ihren festen jungen Brüsten. Gut möglich, daß Angeline, ihre Mutter, sauer sein würde, aber es wäre nicht das erste Mal, daß Mutter und Tochter sich seinetwegen in die Haare gerieten, und es würde auch nicht das letzte Mal sein. Er musterte wohlgefällig Kellys prächtige jugendliche Fülle. Sie hatte lange, schlanke Beine und einen kleinen runden Po. Er sah, daß sie der Typ war, der schnell in die Breite gehen würde. In wenigen Jahren würde ihre Figur unter Fettmassen verschwinden, und sie würde sich verzweifelt fragen, wie das geschehen konnte. Aber jetzt war sie einfach vollkommen.
»Wir sollten gehen«, drängte Benjy und versuchte, nicht besorgt zu klingen. Lorcan hätte schon vor Stunden bei der Geburtstagsparty seiner Freundin Amy sein sollen.
Lorcan winkte ab. »Jetzt noch nicht.«
»Aber …«, hob Benjy an.
»Laß mich in Ruhe«, fuhr Lorcan ihn an.
Benjy war Lorcans ehemaliger Mitbewohner und inoffizieller gesellschaftlicher Begleiter. Er hielt sich immer in Lorcans Nähe auf, weil er hoffte, daß Lorcans ungeheurer Erfolg bei Frauen auf ihn abfärben würde. Sollte das nicht klappen, so wollte er zur Stelle sein, um den von Lorcan abgelegten Frauen – und davon gab es massenhaft – über die Enttäuschung hinwegkommen zu helfen, und zwar möglichst im Bett.
Mit geschmeidigen Bewegungen stand Lorcan vom Sofa auf und streckte sich. Mit einem strahlenden Lächeln näherte er sich Kelly, die prompt ihren Blick sittsam senkte, doch Benjy hatte das triumphierende Leuchten in ihren Augen gesehen. Benjy konnte nicht hören, was Lorcan zu Kelly sagte, aber er konnte die Worte erraten. Lorcan hatte ihm einmal aus reiner Gutmütigkeit ein paar seiner Eröffnungssätze für eine Verführung gesagt.
»Versuch, möglichst nah an ihr Ohr ranzukommen und zu murmeln: ›Du mit deinen verführerischen Augen, sie sind die reine Folter für mich‹«, hatte er Benjy empfohlen. »Oder – und dabei mußt du verlegen stottern, als wärst du schrecklich nervös: ›Entschuldigung, wenn ich mich aufdränge, aber ich muß dir einfach sagen, daß du einen wunderschönen Mund hast. Tut mir leid, wenn ich dich unterbrochen habe, ich bin auch schon wieder weg.‹ Das erhöht deine Chancen um hundert Prozent.«
Aber eine hundertprozentige Steigerung von nichts ist immer noch nichts. Und die Sätze, die Lorcan zum Erfolg führten, brachten Benjy nur erstaunte Blicke oder spöttisches Gelächter ein. Und einmal bekam er einen Schlag mit dem Gürtel quer übers Gesicht, worauf er drei Tage Tinnitus im rechten Ohr hatte.
»Was mache ich nur falsch?« fragte Benjy voller Verzweiflung, als er wieder richtig hören konnte. Wenn Benjy nicht klein und dicklich gewesen wäre, mit sandfarbenem Haar, das schon schütter wurde, hätte er sicherlich bessere Chancen gehabt, aber das sagte Lorcan nicht. Er gefiel sich in der Rolle des Wohltäters.
»Also gut«, sagte Lorcan und grinste, »hör gut zu, was der Meister zu sagen hat. Du machst zwei Frauen an, die eine richtig süß, die andere nicht ganz so scharf, das gibt’s ja öfter. Dann machst du dich an das häßliche Entlein ran und belaberst sie, die andere läßt du links liegen. Das Entlein ist hoch erfreut, daß es der anderen den Rang abläuft. Die Scharfe ist sauer, weil sie übergangen wird, und versucht, dich anzumachen. Und du kannst dir eine aussuchen.«
Benjy sah seine Hoffnungen steigen. Was Lorcan sagte, klang so einleuchtend. »Und worauf soll ich noch achten?«
Lorcan dachte einen Moment nach. »Jede Frau hat etwas, worauf sie stolz ist«, sagte er. »Einen Pluspunkt. Den mußt du finden – und das ist verdammt leicht, das kannst du mir glauben –, und dann machst du ihr deswegen Komplimente.«
Benjy nickte nachdenklich. »Sollte ich sonst noch etwas wissen?«
»Ja. Dicke geben sich mehr Mühe.«
Nur Augenblicke nachdem Lorcan und Kelly verschwunden waren, kam Angeline, eine attraktive Frau, die unglücklich über ihren dicken Bauch war, auf Benjy zu. »Wo ist Lorcan?« fragte sie besorgt. »Und wo ist Kelly?«
»Ehm, ich weiß nicht«, stammelte Benjy und fügte hinzu: »Aber keine Angst. Weit können sie ja nicht sein.« Er wußte selbst nicht, warum er das sagte.
Sie waren tatsächlich nicht weit, sondern in Kellys rosa eingerichtetem Kinderzimmer, in dem die Decke auf dem Bett unter einer Vielzahl von Kuscheltieren fast verschwand. Kelly hatte zwar den Körper einer Frau, aber sie war längst noch nicht erwachsen.
Die Sache mit Lorcan entwickelte sich viel zu schnell für sie. Sie hatte sich vorgestellt, daß er sie küssen würde, damit sie ihrer Mutter triumphierend ins Gesicht schleudern konnte: »Da siehst du mal, du mit deinem Dickbauch – ich komme viel besser an als du!« Sie hatte sich noch nicht entschieden, ob sie ihm erlauben würde, ihre Brüste zu berühren – natürlich durch die Kleidung –, denn eigentlich war ihr der Gedanke nicht ganz recht. Als Lorcan also anfing, sich die Hose aufzuknöpfen, war sie ziemlich schockiert. Und als er die Hose halb herunterließ und ihr mit seiner großen, aggressiven Erektion über das Gesicht strich, war sie erst recht schockiert.
»Ich möchte wieder zu den anderen gehen«, sagte sie voller Entsetzen.
»Jetzt noch nicht«, antwortete Lorcan mit einem gefährlichen Lächeln, und mit festem Griff umfaßte er ihren Hinterkopf und das seidige Haar.
Als Lorcan wieder in den Raum kam und praktisch im Triumphzug um die Möbel stolzierte, sah Benjy ihn mit einer Mischung aus Bewunderung und eifersüchtigem Haß an. »Du widerlicher Glückspilz«, brummelte er.
»Ich habe sie nicht gevögelt«, sagte Lorcan mit feuchten Augen, so gerührt war er von seiner eigenen Gutmütigkeit. »Ihre Ehre ist noch intakt.«
»Na klar. Du hast sie nicht angefaßt«, höhnte Benjy. »Und was ist mit Amy? Es ist ihr Geburtstag.«
»Ich kann nichts dafür«, entschuldigte sich Lorcan grinsend und zuckte die Achseln auf eine Weise, die viele Frauen schwach gemacht hätte. »Ich liebe eben die Frauen.«
»Das kommt mir nicht so vor«, murmelte Benjy unterdrückt. »Scheint mir eher, daß du sie haßt.«
»Komm«, sagte Lorcan. »Wir müssen gehen. Beeil dich, wir sind spät dran!« Und damit verließ er das Haus und ging an Kelly, die weinend und gedemütigt auf der Treppe saß, achtlos vorbei.
»Wieso behandelst du Frauen immer wie den letzten Dreck?« fragte Benjy, als sie draußen standen und in der kalten Oktobernacht auf ein Taxi warteten. »Was hat deine Mutter dir angetan? Hat sie dir zu lange die Brust gegeben? Oder nicht lange genug?«
»Meine Mutter war eine wunderbare Frau«, sagte Lorcan mit weicher Stimme, die in starkem Kontrast zu Benjys schrillem Zorn stand. Warum suchten alle immer nach dummen freudianischen Erklärungen für seine Unfähigkeit, lange bei einer Frau zu bleiben? Es war doch eigentlich ganz einfach. »Es ist die alte Geschichte, Benjy, du weißt doch.«
»Was für eine alte Geschichte?« rief Benjy erzürnt, und als Lorcan ihm nicht antwortete, folgte er dessen Blick zu einer Gruppe von drei Frauen und einem Mann, die vor einem Restaurant standen.
»Was für eine alte Geschichte?« rief Benjy erneut, noch wütender, weil die vier in das Taxi stiegen, das er haben wollte.
»Warum lecken Hunde sich die Eier?« fragte Lorcan zurück.
4
Liv, Tara, Fintan und Katherine tranken Gin Tonic und tanzten zu Wham!, was Roger, Katherines Nachbar einen Stock tiefer, ziemlich ärgerte.
»Ist das nicht toll?« sagte Tara mit leuchtendem Gesicht. »Wißt ihr noch, wie wir zu dieser Musik getanzt haben, als wir fünfzehn waren? Weißt du noch, Fintan? Erinnerst du dich, Katherine?«
»Doch, schon«, sagte Fintan verlegen, »aber hör auf damit, sonst fühlt Liv sich ausgeschlossen.«
»Nein, nein«, sagte Liv so fröhlich sie konnte. »Das macht nichts. Ich fühle mich immer ausgeschlossen.«
»Außer bei Leuten, die du sehr gut kennst«, sagte Fintan.
»Nein, bei denen besonders.«
Schließlich, zur selben Zeit wie immer, wurde Liv von einer Welle der Melancholie überflutet und beschloß, nach Hause zu gehen.
»Bist du sicher, daß du gehen möchtest?« fragte Katherine, die Liv zur Tür begleitete.
Liv nickte unglücklich. »Ich stopfe mich mit Chips voll, dann schlafe ich achtzehn Stunden, und dann geht es mir wieder besser.«
»Die Ärmste«, sagte Tara voller Mitleid, als Liv gegangen war. »Ich kriege auch ab und zu meine Anfälle, aber nach ihren kannst du die Uhr stellen.«
»Ich glaube, ich mache mich auf den Weg«, sagte Fintan.
»Was? Du setzt deinen Ruf als ältester Partygänger der Stadt aufs Spiel«, warnte Tara ihn.
»Aber ich bin müde«, sagte er, »und ich habe Halsschmerzen und spüre irgendwas da, wo meine Leber mal war.«
Danach wurde es ruhiger, sehr zu Rogers Erleichterung. »Ich glaube, ich habe mich nüchtern getanzt«, sagte Tara. Wham! wurden zum Schweigen verdonnert, ein Taxi für Tara wurde bestellt, und Katherine machte sich fertig fürs Bett.
»Ein Schmuckkästchen«, sagte Tara voller eifersüchtiger Bewunderung und ließ den Blick durch Katherines aufgeräumtes und wohlduftendes Schlafzimmer gleiten. Der Bettbezug war sauber und unzerknittert, die Topfpflanzen leuchtend grün und gut gepflegt, Staub nirgendwo zu sehen. Die vielen Cremetuben auf der Kommode waren voll und neu. Alte, schäbige, die schon ewig herumlagen, mit einem kläglichen Rest Lotion, fand man hier nicht. Und in Katherines blinkendem Badezimmer konnte man zu jeder Hautcreme die entsprechende Seife oder das passende Duschgel auf der Ablage finden.
Katherine liebte Sets. Einzeldinge gefielen ihr nicht so gut, doch paarweise geordnet konnten sie Katherines Begeisterung erregen. Schals brauchten passende Handschuhe; zu einem Talkumpuder mußte es auch Seife geben; ein kleines Schälchen war völlig sinnlos, wenn es dazu nicht ein zweites, kleineres, aber ansonsten identisches Schälchen gab. Tara witzelte manchmal, daß der ideale Mann für Katherine gut aussehen müßte, mit einem tollen Körper und einem Zwillingsbruder.
Tara hatte noch nicht alles gesehen. »Ich fühle mich so unzulänglich«, sagte sie verzagt, »du hast das Bett gemacht, obwohl du gar nicht wußtest, daß heute Besuch kommen würde.«
Sie hatte vergessen, wie wichtig Katherine ihre Wohnung war, denn seit einem Jahr lebten sie nicht mehr zusammen. Katherine hatte eine Wohnung gekauft, und Thomas hatte Tara bei sich einziehen lassen, und da sie nun schon einmal da war, ließ er sie auch die Hälfte seines Darlehens abzahlen.
Tara konnte sich nicht zurückhalten und öffnete die Schubladen. Alles war gefaltet, gebügelt, sauber und gepflegt. Katherine war eine von den seltenen Frauen, die regelmäßig ihren Wäscheschrank durchgingen und die ausgeleierte, mit einem Grauschleier versehene Unterwäsche aussortierten.
»Sehe ich alles doppelt wegen des Alkohols, oder hast du wirklich immer zwei Paar gleiche Unterhosen?« fragte Tara.
»Zwei Paar zu jedem Büstenhalter«, bestätigte Katherine.
Tara konnte das nicht begreifen. Sie machte sich nichts aus Unterwäsche. Ihr war nur das wichtig, was die Leute auch sehen konnten. Natürlich sah Thomas sie in ihren vorsintflutlichen Höschen und BHs, aber sie kannten sich schon seit zwei Jahren. Eine mystische Aura länger als drei Monate aufrechtzuerhalten war viel zu anstrengend. Außerdem war er selbst auch kein leuchtendes Beispiel, was die Unterhosen anging, sagte sie sich und wartete darauf, daß die Schuldgefühle nachlassen würden.
Tara öffnete eine weitere Schublade und entdeckte eine Auswahl hübscher Pyjamas. Sie waren allerdings eher niedlich als sexy. Katherine war nicht der Typ für schwarze Polyester-Babydolls mit Tanga-Höschen.
»Ich finde es cool«, sagte Tara, »daß du soviel Zeit bei Knickerbox verbringst und dein ganzes Geld dort ausgibst.«
»Macht das nicht jeder?«
»Vielleicht. Aber niemand kauft Sachen für sich.«
Tara legte sich aufs Bett und beobachtete Katherine, wie sie ihre Beine – durchtrainiert und muskulös vom Steptanzen – in ein Paar weiße Shorts mit blauen Punkten steckte. Dann kam ein passendes Hemdchen. Sie zog es auf links an und mit dem Schild nach vorn, so daß die Waschanweisungen unter ihrem Kinn in die Höhe ragten, und nur daran konnte man erkennen, daß sie betrunken war.
»Es wird langsam Zeit, daß du einen Typen kennenlernst, damit jemand was von deiner schönen Reizwäsche hat«, bemerkte Tara.
»Mir geht es auch so gut.«
»Aber all die schönen Unterhosen«, sagte Tara, »und kein Mann bekommt sie zu Gesicht. Ich finde das schade.«
»Ich finde es nicht schade«, gab Katherine zurück. »Und es sind meine Unterhosen.«
»Ich finde es schade.«
»Dann solltest du was dagegen tun.«
»Ich brauche nichts dagegen zu tun«, sagte Tara mit einem Gefühl schwindelerregender Dankbarkeit. »Ich habe einen Freund.«
»Und wenn es plötzlich vorbei wäre…?« fragte Katherine aufrührerisch.
»Hör auf damit!« sagte Tara entrüstet. »Was würde dann aus mir?« Sie dachte einen Moment nach. »Ich würde sicherlich komisch.«
»Fang nicht wieder damit an«, sagte Katherine und seufzte.
Tara befürchtete, daß Frauen ab dreißig, die keinen Freund hatten, exzentrische Neigungen entwickelten; je länger sie allein blieben, desto exzentrischer würden sie. Und wenn schließlich der perfekte Mann vorbeikäme, wären sie, so meinte Tara, zu sehr in sich selbst gefangen, um die Hand nach dem Mann auszustrecken, der sie befreien könnte.
»Ich würde wahrscheinlich zu einer dieser verrückten Schrullen, die allen möglichen Unsinn sammeln«, meinte Tara. »Und alles aufheben, von Kartoffelschalen bis zu jahrzehntealten Zeitungen.«
»Das machst du doch praktisch so auch«, sagte Katherine.
»Und wenn die Leute vom Gesundheitsamt kämen, würde ich nicht aufmachen«, spann Tara ihre apokalyptische Phantasie weiter. »Und man würde den Gestank aus meiner Wohnung schon aus einer Entfernung von hundert Metern riechen. Das wäre mein Schicksal, wenn ich keinen Mann hätte.«
»Dann ist es ja gut, daß du einen hast«, sagte Katherine.
Es klingelte: Taras Taxi war da.
»Mist, es tut mir leid, Katherine, wenn ich dich beleidigt habe.« Plötzlich war Tara zerknirscht. »Du bist meine beste Freundin, und ich mag dich sehr, und ich wollte nicht andeuten, daß du zu einer komischen Schrulle würdest…«
5
Tara saß im Taxi, rauchte eine Zigarette und starrte, von Schuldgefühlen geplagt, vor sich hin. Nicht nur war sie verachtenswert, weil sie schwach war und einen Mann brauchte, es bestand außerdem die Möglichkeit, daß sie Katherine verärgert hatte. Katherine war so ausgeglichen und unabhängig, daß Tara manchmal vergaß, daß auch sie Gefühle hatte.
Aber als das Taxi in die Straße einbog, in der Alasdair wohnte, vergaß Tara Katherine. Sie war plötzlich hellwach. Es passierte automatisch. Sie starrte zu den Fenstern hoch und versuchte einen Blick zu erhaschen. Aber alles lag in tiefer Dunkelheit, und Tara konnte nicht erkennen, ob Alasdair und seine Frau schon im Bett lagen oder ob sie noch aus waren.
Es ist verrückt, daß ich das immer wieder mache, dachte Tara. Vielleicht wohnte er gar nicht mehr da. Leute, die heirateten, gaben häufig ihre schicken Wohnungen in London auf, wo sie gute Bars und Restaurants in der Nähe hatten, und zogen hinaus ins Grüne, in eine Doppelhaushälfte mit Garten, jenseits von Heathrow.
Ihr Magen zog sich vor Unmut zusammen. Tara liebte Thomas, aber sie hatte immer noch ein ausnehmendes Interesse an Alasdair. Der Gedanke, daß er große Veränderungen in seinem Leben vornehmen könnte, ohne daß sie davon wüßte, beunruhigte sie. Alasdair war vor Thomas ihr Freund gewesen. Ein ganz anderer Mensch als Thomas. Großzügig, spontan, wild, zärtlich, gesellig. Er ging gern in Restaurants, und nie sagte er mit einem Blick auf die Speisekarte: »Zehn Pfund? Zehn Pfund für eine Hühnerkeule? Im Supermarkt kriege ich die für fünfzig Pence«, so wie Thomas.
Als Tara nach einer Reihe von flüchtigen Geliebten sechsundzwanzig wurde, lernte sie Alasdair kennen. Sie war entzückt von seinem schottischen Akzent, seinen kurzgeschorenen schwarzen Haaren und dem etwas wilden Blick hinter einer Drahtgestellbrille. Sogar seinen Namen fand sie verführerisch. Es dauerte nicht lang, bis Tara zu dem Schluß kam, daß er der Mann war, den sie heiraten würde. Alle Anzeichen deuteten darauf hin.
Sie fand auch, daß sie in dem richtigen Alter zum Heiraten war. Und da er zwei Jahre älter war als sie, war er auch im richtigen Alter. Sie hatten beide eine gute Stelle und kamen vom Land. Doch das wichtigste war, daß sie vom Leben das gleiche wollten – viel Spaß und viele Restaurantbesuche mit gutem Essen. Obwohl sie sehr häufig essen gingen, war Tara längst nicht so dick, wie man vermuten könnte.
Sie waren ein typisches Beispiel der Balsamico-Generation – ein gutaussehendes Paar Mitte Zwanzig, das sich gern mit Freunden zum Essen traf, Cappuccino aus Alasdairs Espressomaschine trank, in Alasdairs rotem MG in London herumbrauste, mindestens einmal in der Woche Champagner trank und samstags zu Paul Smith oder Joseph ging. (Manchmal kauften sie sogar etwas, ein Paar Socken zum Beispiel oder eine Krawattennadel.)
Als Tara im Sommer für eine Woche nach Irland fuhr, kam Alasdair mit. Plötzlich sah sie Knockavoy mit seinen Augen: die Herrlichkeit des Atlantiks, der mächtige Stücke aus den Klippen herausbrach, den endlosen Strand mit goldenem Sand, die Luft, die so weich und sauber war, daß man sie beinahe sehen konnte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie die Stadt, in der sie aufgewachsen war, gehaßt. Ein kleiner, abgelegener Ort, in dem nie etwas passierte, außer für ein paar Monate im Sommer, wenn die Touristen kamen.
Taras Mutter war von Alasdair begeistert. Ihr Vater nicht, aber er war von nichts begeistert, was mit Tara zu tun hatte, warum sollte Alasdair da eine Ausnahme sein? Anschließend nahm Alasdair Tara mit auf die Insel Skye, um sie seiner Familie vorzustellen, was Tara sehr beruhigend fand. Sie hatte oft das Gefühl, daß die Menschen, die sie in London kennenlernte, Dinge vor ihr verheimlichten. Daß sie sich bis zu einem gewissen Grad neu erfanden. Was leicht war – denn die wenigsten stammten aus London, folglich waren ihre Familien nicht in der Nähe, die die Phantasiegeschichten, mit denen sie ihre Freunde zu beeindrucken versuchten, als Lügengespinste entlarvten. Und obwohl sie eine Woche brauchte, um sich von den exzessiven Feiern, die Alasdairs Familie für sie veranstaltete, zu erholen, wußte sie doch jetzt, woher er kam und wo seine Wurzeln waren.
Kurz nach ihrer Rückkehr von Skye feierten sie das zweijährige Bestehen ihrer Beziehung, und Tara fand, daß man sich jetzt Gedanken übers Heiraten machen konnte. Oder wenigstens das Zusammenleben. Sie lebte ohnehin praktisch in seiner Wohnung und war der Ansicht, daß es ein rein formaler Schritt war, die Sache offiziell zu machen.
Doch als sie ihm den Vorschlag unterbreitete, war er zu ihrer Überraschung entsetzt. »Aber…«, sagte er, und seine flackernden Augen wichen ihr nicht aus. »Aber es geht doch prima so, wir brauchen doch nichts zu überstürzen …«
Stark verunsichert und weil sie nicht zugeben wollte, wie verletzt sie war, trat Tara den Rückzug an. »Du hast ganz recht«, pflichtete sie ihm sofort bei, »alles ist bestens so. Wir brauchen nichts zu überstürzen.« Dann stellte sie sich auf einen Zermürbungskrieg ein. Wer wartet, bekommt das, was er will. Nur wußte sie, daß für sie im Alter von achtundzwanzig Jahren Zeit etwas war, das ihr nicht im Übermaß zur Verfügung stand.
Sie beschwichtigte ihre Hysterie, indem sie sich sagte, daß er sie liebe. Dessen war sie sich sicher. Sie klammerte sich an diese Gewißheit, als hinge ihr Leben davon ab.
Alles ging ungefähr für ein halbes Jahr anscheinend weiter wie gehabt. Aber das war nicht der Fall. Alasdair vermittelte den Eindruck, als würde er gejagt, und das durchdrang alles, färbte auf alles ab und verdarb den Spaß. Und Tara wurde argwöhnisch und machte sich Sorgen. Sie war sich bewußt, daß sie nicht mehr Mitte Zwanzig war, daß alle ihre früheren Schulkameradinnen, mit Ausnahme von Katherine, verheiratet waren und Kinder hatten, daß es um sie herum weniger verfügbare Männer gab als früher, daß sie auf die dreißig zuging. Sie hatte viel Zeit und Hoffnung in Alasdair investiert – all ihre Zeit und Hoffnung –, und die Vorstellung, daß sie alles auf einen Verlierer gesetzt hatte, war unerträglich.
Ich bin zu alt, um noch einmal von vorn anzufangen, dachte sie oft und wurde von erdrückender Panik ergriffen, wenn sie mitten in der Nacht aufwachte. Ich habe nicht die Zeit. Es muß diesmal klappen.
Da Geduld noch nie ihre Stärke war, fragte sie ihn schließlich, welche langfristigen Absichten er hinsichtlich ihrer Beziehung verfolge. Sie wußte, daß das verkehrt war. Wenn er überhaupt Absichten hegte, würde er es ihr schon sagen. Und wenn sie die Dinge zu erzwingen versuchte, würden sie sich nur zuspitzen und das Ende beschleunigen, was sie nicht wollte.
Sie hatte recht. Er war erbost, weil sie mit ihrer unnötigen Forderung etwas Gutes zerstörte, und erklärte ihr ziemlich brüsk, daß er sie nicht heiraten wolle. Er liebe sie, aber er wolle sich einfach nur gut amüsieren und sei nicht an langweiliger Häuslichkeit interessiert.
Tara mußte eine Woche zu Hause bleiben, um sich von dem Schock zu erholen.
»Laß es damit gut sein«, wurde ihr von allen Seiten geraten, als sie fassungslos und verrückt vor Schmerz ziellos umherirrte. »Gib auf, es läßt sich nicht wieder einrenken.« Aber das konnte sie nicht. Sie konnte zweieinhalb gemeinsamen Jahren nicht einfach den Rücken kehren. Sie konnte sich nicht eingestehen, daß sie möglicherweise eine Zukunft ohne ihn vor sich hatte.
Sie versuchte zu retten, was zu retten war, zuerst, indem sie so tat, als wäre die Frage nie aufgekommen und alles wäre beim alten. Und als es zu anstrengend wurde, mit der künstlichen Normalität zu leben, versuchte sie ein weiteres Mal, Alasdair zu einer Meinungsänderung zu bewegen, indem sie ihm in einem Überraschungsangriff mit dem Ende der Beziehung drohte. Sie hatte von anderen Fällen gehört, wo dem Mann, sobald er mit der Tatsache konfrontiert wurde, daß die Frau gehen könnte, das Bekenntnis zu der Frau plötzlich nicht mehr schwergefallen war. Aber auch das klappte nicht. Statt dessen sagte Alasdair traurig: »Geh, wenn du gehen mußt. Ich mache dir keinen Vorwurf. Das würde keiner.«
»Aber du liebst mich doch, oder?« fragte sie atemlos und schrill, als ihr mit Entsetzen klar wurde, wie falsch sie die Situation eingeschätzt hatte. »Wirst du mich nicht vermissen?«
»Ja, ich liebe dich«, erwiderte er sanft, »und natürlich werde ich dich vermissen. Aber ich habe kein Recht, dich zu halten, wenn du gehen möchtest.«
Verstört brach Tara ihren dramatischen Auftritt ab, in dem sie das Ende beschwor. Diese Taktik hatte genau das Gegenteil bewirkt. In einer raschen Kehrtwendung bekannte sie sich zu dem Status quo, in der Hoffnung, niemand habe ihren Vorstoß bemerkt. Doch die Beziehung, die vor einem Jahr so wunderbar gewesen war, verlor ihren Charme und ihren Reiz. Sie wurde zu einem Behelf, sie war nur noch eine halbe Beziehung, dachte sie verbittert. Aber es war besser als nichts.
Aber auch das stimmte nicht. Wenigstens nicht für Alasdair. »Es hat keinen Sinn mehr«, sagte er einen Monat später zu Tara. Sie sah ihn erschrocken an. Plötzlich, da sie bedroht wurde, erschien die spöttisch betrachtete Behelfsbeziehung sehr erstrebenswert.
»Aber es hat sich doch nichts verändert«, stammelte sie verwirrt, weil eigentlich sie die moralische Oberhand haben müßte: Sie müßte doch die Macht haben, mit dem Ende der Beziehung zu drohen, weil er ihr weh getan hatte, nicht andersherum. »Es tut mir leid, daß ich das mit dem Heiraten wieder angeschnitten habe, und es tut mir leid, daß ich mich so dumm deswegen benommen habe, aber laß uns doch einfach weitermachen.«
Aber er schüttelte den Kopf. »Wir können nicht mehr zurück.«
»Doch, das können wir wohl«, beharrte sie, und ihre Stimme überschlug sich fast. Sie fragte sich, warum schlimme Dinge immer dann passierten, wenn man schon gebrochen am Boden lag.