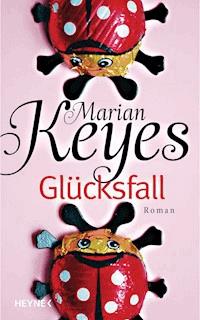
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Walsh-Familie
- Sprache: Deutsch
Wenn der Absturz zum Glücksfall wird
Für Helen Walsh kommt es knüppeldick: Sie ist so mittellos, dass sie ihre Wohnung räumen und wieder bei ihren Eltern, den berüchtigten Walshs, einziehen muss. So deprimiert, dass sie statt Möwen schon Aasgeier über der Tankstelle kreisen sieht. Und so verzweifelt, dass sie einen beruflichen Auftrag ihres attraktiven Exfreundes annimmt. Doch am Ende erweist sich der Job, der als Höllenfahrt beginnt, unerwartet als Glücksfall ...
Eigentlich galt Helen, die fünfte und jüngste der Walsh-Schwestern, immer als die coolste. Aber jetzt hat das Leben auch ihr übel mitgespielt: Die Privatdetektivin kann kaum noch einen Auftrag an Land ziehen und verliert darüber ihre Wohnung. Die einzige, schreckliche Lösung: wieder bei ihren Eltern einziehen und sich mit ihrer Mutter abplagen, die alles besser weiß und über ihre fünf missratenen Töchter schimpft. Da bietet Helen ausgerechnet ihr Exfreund Jay einen lukrativen Job an: Eine ehemalige Teenieband steht kurz vor dem Revival-Konzert, aber einer der Musiker ist plötzlich spurlos verschwunden. Zähneknirschend macht sich Helen auf die Suche und stößt schnell auf viele Ungereimtheiten. Noch erschreckender: Sie stößt im Haus ihres neuen Freundes auf dessen Exfrau im Negligé. Helen spürt, wie ihr langsam alles zu entgleiten droht. Doch dann nimmt der Fall eine spektakuläre Wendung und mit ihm Helens Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Marian
Keyes
Glücksfall
ROMAN
Aus dem Englischenvon Susanne Höbel
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelThe Mystery of Mercy Close bei Michael Joseph,einem Imprint von Penguin Books
Copyright © 2012 by Marian KeyesCopyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung und -illustration: Eisele Grafik·Design, MünchenRedaktion: Angelika LiekeSatz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-10450-4
www.heyne.de
Für Tony
Mir kann es ja egal sein – ich meine, wenn das keine Ironie ist! –, aber ich bin weit und breit die Einzige, die nicht der Meinung ist, es wäre einfach göttlich, sich »irgendwo« einweisen zu lassen, um einmal »zur Ruhe zu kommen«. Man sollte mal meine Schwester Claire hören, wie sie darüber redet – als würde es sich um die erfreulichste Erfahrung der Welt handeln, eines Morgens in einer psychiatrischen Klinik aufzuwachen.
»Ich habe eine tolle Idee«, sagte sie zu ihrer Freundin Judy. »Wir kriegen beide zur gleichen Zeit einen Nervenzusammenbruch.«
»Fantastisch«, sagte Judy.
»Wir nehmen uns ein Doppelzimmer. Das wird herrlich.«
»Erzähl mir, wie es sein wird.«
»Alsoooo: freundliche Menschen … weiche, zarte Hände … sanft murmelnde Stimmen … weiße Bettwäsche … weiße Sofas … weiße Orchideen … alles in Weiß …«
»Wie im Himmel«, sagte Judy.
»Genau, wie im Himmel!«
Kein bisschen wie im Himmel, wollte ich protestierend dazwischenfahren, aber sie ließen sich nicht beirren.
»… sanft plätscherndes Wasser …«
»… süß duftender Jasmin …«
»… irgendwo eine tickende Uhr …«
»… ein helles Glockenläuten …«
»… und wir liegen im Bett, zugedröhnt mit Xanax …«
»… und blicken verträumt den Staubkörnchen nach …«
»… oder lesen Grazia …«
»… oder kaufen uns ein Magnum Gold von dem Eismann, der von Station zu Station geht …«
Aber es gibt dort keinen Eismann, der Magnum Gold verkauft! Und auch nicht die ganzen anderen netten Dinge.
»Und eine weise Stimme würde sagen …« Judy machte eine bedeutungsvolle Pause und fuhr dann fort: »›Wirf deine Bürde ab, Judy.‹«
»Und eine bezaubernde Krankenschwester würde leise vorbeischweben und alle deine Termine absagen«, sagte Claire. »Sie würde alle auffordern, uns in Ruhe zu lassen, und den undankbaren Mistkerlen würde sie sagen, es sei ihre Schuld, dass wir einen Nervenzusammenbruch haben, und sie müssten sehr viel liebevoller mit uns umgehen, falls wir jemals wieder rauskommen.«
Sowohl Claire als auch Judy hatten enorm vollgepackte Leben: Kinder, Hunde, Ehemänner, Berufe und die schwierige und zeitaufwendige – selbst gestellte – Aufgabe, zehn Jahre jünger auszusehen, als sie waren. Unablässig fuhren sie mit ihren Kleinbussen durch die Gegend, brachten Söhne zum Rugby-Training, holten Töchter vom Zahnarzt ab, rasten quer durch die Stadt von einem Termin zum anderen. Sie hatten das Multitasking zu einer Kunstform entwickelt: Die wenigen Sekunden an einer roten Ampel nutzten sie, um sich die Waden mit Bräunungscreme einzureiben, im Kino beantworteten sie während des Vorspanns ihre E-Mails, und um Mitternacht backten sie weiche rote Muffins und ließen sich gleichzeitig von ihren halbwüchsigen Töchtern als »fette Kuh« verspotten. Keine Minute wurde verschwendet.
»Wir kriegen bestimmt Xanax.« Claire gab sich weiter ihren Träumereien hin.
»Oh, wie schön.«
»So viel wir wollen. Sobald der Glückszustand nachlässt, läuten wir, und dann kommt eine Krankenschwester und gibt uns einen Nachschlag.«
»Und wir müssen uns nie anziehen. Jeden Morgen bringen sie uns einen frischen Baumwollschlafanzug, ganz neu, direkt aus der Packung. Und wir schlafen sechzehn Stunden am Tag.«
»Ach, schlafen …«
»Es wird sich anfühlen, als wären wir in ein großes Marshmallow gebettet und schwebten glücklich dahin …«
Es war höchste Zeit, den großen Irrtum in ihren köstlichen Träumereien aufzudecken. »Aber ihr wärt in einer psychiatrischen Klinik.«
Claire und Judy sahen verstört auf.
Dann sagte Claire: »Ich spreche nicht von einer psychiatrischen Klinik. Ich spreche von einem Ort, wo man … zur Ruhe kommen kann.«
»Der Ort, wo Leute hingehen, um zur Ruhe zu kommen, ist aber eine psychiatrische Klinik.«
Sie schwiegen. Judy biss sich auf die Unterlippe. Offensichtlich dachten sie darüber nach.
»Was dachtet ihr denn, wo man hingehen kann?«, fragte ich.
»Na ja … in so eine Art Kurhotel«, sagte Claire. »Wo man, also, wo man diese Pillen verschrieben bekommt.«
»Da sind Verrückte drin«, sagte ich. »Echt Verrückte. Total Kranke.«
Wieder schwiegen sie, dann sah Claire mich an, ihr Gesicht war rot angelaufen. »Mein Gott, Helen«, rief sie aus. »Du bist so gemein. Kannst du uns nicht einmal was Nettes gönnen?«
Donnerstag
1
Ich dachte ans Essen. Immer, wenn ich im Verkehr stecke, denke ich ans Essen. Das macht jeder normale Mensch, klar, aber nachdem ich jetzt daran gedacht hatte, fiel mir ein, dass ich seit heute Morgen sieben Uhr, also seit gut zehn Stunden, nichts mehr gegessen hatte. Im Radio spielten sie einen Song von den Laddz – schon der zweite an dem Tag, wenn das kein Pech ist! –, und während die sentimentalen, sirupzähen Klänge das Auto füllten, hatte ich einen Moment lang den überaus heftigen Wunsch, gegen einen Pfosten zu fahren.
Zur Linken kam eine Tankstelle in Sicht, vor der das rote Schild, das eine Cafeteria ankündigte, einladend in der Luft baumelte. Ich konnte mich aus diesem Stau herausstehlen und mir einen Donut kaufen. Nur dass die Donuts, die man an solchen Tankstellen kaufen kann, ungefähr so gut schmecken wie die Schwämme, die am Meeresboden liegen; es wäre besser, sich damit zu waschen. Außerdem kreiste über den Zapfsäulen ein riesiger Schwarm schwarzer Aasgeier, die mich irgendwie nervös machten. Nein, dachte ich, ich bleibe im Stau stehen, geduldig, und …
Moment mal! Aasgeier?
In einer Stadt?
Bei einer Tankstelle?
Ich blickte wieder in den Himmel – es waren keine Geier. Es waren Möwen. Ganz gewöhnliche irische Möwen.
Dann dachte ich: O nein, bitte nicht das wieder.
Eine Viertelstunde später hielt ich vor dem Haus meiner Eltern, sammelte mich einen Moment und suchte dann nach dem Hausschlüssel. Als ich drei Jahre zuvor ausgezogen war, wollten sie, dass ich ihn dalasse, aber vorausschauend, wie ich bin, habe ich ihn behalten. Mum redete davon, dass sie das Schloss austauschen würden, aber wenn man bedenkt, dass es acht Jahre gedauert hat, bis sie und Dad sich zum Kauf eines gelben Eimers durchringen konnten, wie standen da die Chancen, dass sie eine so komplizierte Sache wie ein neues Schloss organisiert bekommen würden?
Ich traf sie in der Küche an, wo sie Tee tranken und Kuchen aßen. Alte Leute. Was für ein fantastisches Leben sie hatten. Auch die, die kein Tai-Chi machten. Sie sahen auf und starrten mich mit kaum verhohlenem Unmut an.
»Ich habe euch etwas mitzuteilen«, sagte ich.
»Was machst du hier?«, fragte Mum.
»Ich wohne hier.«
»Nein, du wohnst nicht hier. Wir sind dich endlich losgeworden. Wir haben dein Zimmer neu gestrichen. Wir waren noch nie so glücklich.«
»Ich habe gesagt, ich habe euch etwas mitzuteilen. Das ist es, was ich euch mitzuteilen habe: Ich wohne hier.«
Jetzt bekam sie es mit der Angst. »Du hast deine eigene Wohnung.« Sie sträubte sich, verlor aber an Überzeugungskraft. Wahrscheinlich hatte sie schon damit gerechnet.
»Das stimmt nicht«, sagte ich. »Seit heute Morgen habe ich keine Wohnung mehr.«
»Die Leute von der Hypothekenbank?« Unter der Standard-Grundierungscreme für irische Mütter war sie aschfahl.
»Was ist denn los?« Dad war taub. Außerdem häufig verwirrt. Man konnte nur schwer feststellen, welche Beeinträchtigung jeweils im Vordergrund stand.
»Sie ist mit ihren Zahlungen im RÜCKSTAND«, sagte Mum in sein gesundes Ohr. »Die Bank hat sich ihre Wohnung ZURÜCKGEHOLT.«
»Ich konnte mir die Rückzahlungen nicht mehr leisten. So wie du es sagst, klingt es, als wäre es meine Schuld. Außerdem ist es viel komplizierter.«
»Du hast doch einen Freund«, sagte Mum mit einem Fünkchen Hoffnung. »Kannst du denn nicht bei dem einziehen?«
»Das sind ja ganz neue Töne, von dir, der strengen Katholikin.«
»Wir müssen schließlich mit der Zeit gehen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Bei Artie kann ich nicht wohnen. Seine Kinder erlauben das nicht.« Das stimmte nicht ganz. Nur Bruno wollte das nicht. Er hasste mich, aber Iona war ganz freundlich, und Bella verehrte mich sogar. »Ihr seid meine Eltern. Bedingungslose Liebe, wenn ich euch erinnern darf. Meine Sachen sind im Auto.«
»Was? Alles?«
»Nein.« Ich hatte für den Tag zwei Männer angeheuert, die bar auf die Hand bezahlt wurden. Was mir noch an Möbelstücken blieb, war jetzt in einem Lagerhaus jenseits des Flughafens untergebracht und wartete dort auf bessere Zeiten. »Nur meine Klamotten und ein paar Sachen für meine Arbeit.« Ziemlich viele, um ehrlich zu sein, denn mein Büro hatte ich schon im letzten Jahr aufgegeben. Und ich hatte auch eine Menge Klamotten dabei, obwohl ich beim Packen schon unglaublich viel aussortiert hatte.
»Aber wann hat das denn mal ein Ende?«, fragte Mum in einem Jammerton. »Wann kommen wir endlich in den Genuss unserer goldenen Jahre?«
»Nie.« Dad sprach plötzlich mit großer Überzeugung. »Sie ist Teil eines Syndroms. Die Generation Bumerang. Erwachsene Kinder, die wieder bei ihren Eltern einziehen. Ich habe davon in Grazia gelesen.«
Gegen Grazia konnte man schlecht etwas einwenden.
»Ein paar Tage kannst du bleiben«, willigte Mum schließlich ein. »Aber ich warne dich. Vielleicht verkaufen wir das Haus und machen eine Kreuzfahrt in der Karibik.«
In Anbetracht der niedrigen Immobilienpreise würde der Erlös für das Haus wahrscheinlich nicht einmal für eine Kreuzfahrt zu den Aran-Inseln reichen. Aber als ich zum Auto ging, um meine Sachen zu holen, beschloss ich, ihnen ihre Illusionen nicht zu zerstören. Schließlich gewährten sie mir ein Dach über dem Kopf.
»Wann gibt es Abendessen?« Nicht dass ich Hunger hatte, aber ich wollte mich mit den Abläufen vertraut machen.
»Abendessen?«
Es gab kein Abendessen. »Wir kochen eigentlich nicht mehr«, gestand Mum. »Jetzt, wo wir nur noch zu zweit sind.«
Das waren bedrückende Neuigkeiten. Mir ging es so schon schlecht genug, da fehlte es noch, dass meine Eltern sich plötzlich so aufführten, als säßen sie im Wartezimmer des Todes. »Aber was nehmt ihr dann zu euch?«
Sie sahen sich überrascht an, dann wanderten ihre Blicke zu dem Kuchen vor ihnen. »Na ja, Kuchen, oder?«
Zu einer anderen Zeit wäre mir das gerade recht gewesen – in meiner Kindheit hatten meine Schwestern und ich es als hochriskant erachtet, etwas zu essen, das Mum gekocht hatte –, aber jetzt war ich in keiner sehr guten Verfassung.
»Und wann gibt es den Kuchen?«
»Jederzeit, wann immer du möchtest.«
Das ging überhaupt nicht. »Ich brauche eine feste Zeit.«
»Also, um sieben.«
»In Ordnung. Übrigens … über der Tankstelle habe ich einen Schwarm Geier gesehen.«
Mum verzog die Lippen zu einem dünnen Strich.
»In Irland gibt es keine Geier«, sagte Dad. »Der heilige Patrick hat sie vertrieben.«
»Da hat er recht«, sagte Mum mit Nachdruck. »Es waren keine Geier.«
»Aber …« Ich sprach nicht weiter. Wozu auch? Ich machte den Mund auf und schnappte nach Luft.
»Was machst du?« Mum klang besorgt.
»Ich …« Ich wusste es selbst nicht. »Ich versuche zu atmen. Meine Brust ist so eng. Es ist kein Platz für die Luft da.«
»Natürlich ist da Platz. Atmen ist die natürlichste Sache der Welt.«
»Ich glaube, meine Rippen sind zusammengeschrumpft. Wie wenn man alt wird und die Knochen schrumpfen.«
»Du bist dreiunddreißig. Warte, bis du so alt bist wie ich, dann kannst du über geschrumpfte Knochen reden.«
Obwohl ich nicht wusste, wie alt Mum wirklich war – sie log ständig darüber und erzählte die unwahrscheinlichsten Geschichten, manchmal erwähnte sie die wichtige Rolle, die sie bei dem Aufstand von 1916 gespielt hatte (»Ich habe geholfen, die Unabhängigkeitserklärung zu tippen, die der junge Padraig auf den Stufen des Postamts verlesen hat«), dann wieder schwärmte sie von ihrer Jugend, in der sie zu den Klängen von »The Hucklebuck« getanzt hatte, als Elvis in Irland war (Elvis war nie in Irland, und er hat auch nicht »The Hucklebuck« gesungen, aber wenn man ihr das sagte, wurde es nur schlimmer, und sie beharrte darauf, dass Elvis auf seinem Weg nach Deutschland einen geheimen Besuch in Irland gemacht und den Song speziell auf ihren Wunsch hin gesungen hatte) –, schien sie mir so groß und kräftig wie schon immer.
»Atme tief ein, mach schon, jetzt mach, das kann doch jeder«, drängte sie mich. »Jedes Kind kann das. Was hast du heute Abend vor? Nach dem … Kuchen? Sollen wir fernsehen? Wir haben neunundzwanzig Folgen von Come Dine With Me aufgenommen.«
»Ah …« Ich wollte Come Dine With Me nicht sehen. Normalerweise sah ich mir zwei Fernsehshows am Tag an, aber plötzlich war ich sie leid.
Bei Artie hatte ich eine offene Einladung. Seine Kinder würden da sein, und ich war mir nicht sicher, dass ich die Kraft hatte, mit ihnen zu sprechen, außerdem verhinderte ihre Anwesenheit meinen freien, umfassenden sexuellen Zugang zu ihm. Aber er hatte die ganze Woche in Belfast gearbeitet, und ich … ja, warum es nicht zugeben? … ich vermisste ihn.
»Wahrscheinlich gehe ich zu Artie«, sagte ich.
Mums Gesicht hellte sich auf. »Kann ich mitkommen?«
»Auf keinen Fall! Ich habe dich gewarnt!«
Mum war überaus angetan von Arties Haus – man kennt den Typ, wenn man Zeitschriften für Einrichtung und Design liest: Von außen wirkt es wie ein bodenständiges Arbeiterhaus, das direkt am Gehweg steht und aussieht, als würde es seine Mütze ziehen und sich an die etablierte Ordnung halten. Das Schieferdach sackt ein wenig durch, und die Haustür ist so niedrig, dass nur Menschen, die offiziell als Zwerge klassifiziert sind, durch sie hindurchgehen können, ohne sich den Schädel an dem Balken zu zerschmettern.
Ist man aber erst mal drin, stellt man fest, dass jemand die ganze rückwärtige Mauer weggenommen und durch ein futuristisches Wunderland aus Glas, einem schwebenden Treppenhaus, Schlafzimmern wie Schwalbennester und Fenstern im Dach ersetzt hat.
Mum war bisher erst einmal da gewesen, zufällig – ich hatte ihr verboten, aus dem Wagen zu steigen, aber sie hatte sich frech darüber hinweggesetzt –, und war von dem Haus so beeindruckt, dass sie mich in arge Verlegenheit gebracht hatte. So einen Vorfall würde es nicht noch einmal geben.
»In Ordnung, ich komme nicht mit«, sagte sie. »Aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten.«
»Was denn?«
»Dass du mit mir zu dem Laddz-Comeback-Konzert gehst.«
»Bist du des Wahnsinns?«
»Ich,des Wahnsinns? Du hast es gerade nötig, du mit deinem Gerede von Geiern.«
2
Ein umgewandeltes, für Zwerge geeignetes ehemaliges Arbeiterhaus ist ja schön und gut, nur dass es da meistens keine praktische Tiefgarage gibt. Ich brauchte länger, bis ich einen Parkplatz fand, als ich für die drei Kilometer zu Arties Haus gebraucht hatte. Schließlich zwängte ich meinen Fiat 500 (schwarz mit weißer Innenausstattung) zwischen zwei enorme SUVs und öffnete die Tür zu der verglasten Kokon-Welt. Ich hatte einen eigenen Schlüssel – erst sechs Wochen zuvor hatten Artie und ich einen feierlichen Schlüsseltausch vorgenommen. Er gab mir einen Schlüssel zu seinem Haus, und ich gab ihm einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Denn damals hatte ich noch eine Wohnung.
Von dem hellen Licht des Juniabends geblendet, folgte ich den Stimmen durch das Haus und die magische, schwebende Treppe hinunter zu der holzgetäfelten Veranda, wo eine Gruppe gut aussehender blonder Menschen versammelt war, die ein Puzzle zusammensetzten. Artie, mein attraktiver Wikinger Artie. Und Iona, Bruno und Bella, seine hübschen Kinder. Und Vonnie, seine hübsche Exfrau. Sie saß neben Artie auf den Holzbohlen, ihre schmale gebräunte Schulter rieb sich an seiner großen, kräftigen. Ich hatte nicht damit gerechnet, sie zu sehen, aber sie wohnte ganz in der Nähe und kam oft vorbei, meistens zusammen mit ihrem neuen Freund Steffan.
Sie bemerkte mich als Erste. »Helen!«, rief sie mit großer Herzlichkeit.
Ein Begrüßungschor empfing mich, strahlende Gesichter wandten sich mir zu, Arme streckten sich mir entgegen, und ich wurde von allen geküsst. Eine herzenswarme Familie, diese Devlins. Nur Bruno hielt sich zurück, und er brauchte gar nicht zu glauben, dass mir das nicht aufgefallen war. Im Kopf führte ich eine Liste der vielen, vielen Male, die er mich schroff behandelt hatte. Mir entging nichts. Wir alle haben unsere Begabungen.
Bella, die von Kopf bis Fuß in Rosa gekleidet war und nach Kirschkaugummi roch, war ganz aus dem Häuschen, als sie mich sah. »Helen, Helen.« Sie warf sich mir in die Arme. »Dad hat gar nicht gesagt, dass du kommst. Kann ich dir die Haare kämmen?«
»Bella, lass Helen doch erst mal Luft holen«, sagte Artie.
Bella war neun und von liebendem Naturell, und damit war sie das jüngste und schwächste Mitglied in der Gruppe. Dennoch wäre es dumm, sie zurückzuweisen, aber zunächst musste ich mich um ein paar Dinge kümmern. Ich sah zu der Stelle, wo Vonnies Oberarm den von Artie berührte. »Rück zur Seite«, sagte ich. »Du bist zu nah an ihm dran.«
»Sie ist seine Frau.« Brunos mädchenhafte Wangen leuchteten empört … oder hatte er Rouge aufgetragen?
»Exfrau«, sagte ich. »Und ich bin seine Freundin. Er gehört mir.« Dann machte ich schnell »Hahaha«, aber das war nicht aufrichtig. (Doch sollte mich jemand kritisieren, dass ich egoistisch oder unreif war, und mich vorwurfsvoll fragen: »Was ist denn mit dem armen Bruno?«, dann konnte ich jederzeit sagen: »Meine Güte, das war ein Witz. Er wird doch wohl einen Witz verstehen.«)
»Ehrlich gesagt, Artie hat sich an mich gelehnt«, sagte Vonnie.
»Das stimmt nicht.« Heute ging mir dieses Spiel, das ich jedes Mal mit Vonnie spielen musste, auf die Nerven. Ich fand kaum die Worte für eine Fortsetzung dieses Getues. »Du machst das dauernd. Hör endlich auf damit. Er ist verrückt nach mir.«
»Ach, recht hast du.« Gutmütig rutschte Vonnie so weit von ihm ab, dass jetzt viel Platz zwischen ihr und Artie war. Ihre Art war nicht meine, aber irgendwie mochte ich sie.
Und welche Rolle spielte Artie in dem Spiel? Seine ganze Aufmerksamkeit galt der unteren linken Ecke des Puzzles, das war seine Rolle. Ohnehin war er der Typ, dessen Stärke im Schweigen lag, aber wenn Vonnie und ich mit unserem Alphaweibchen-Gerangel anfingen, hielt er sich – so wie ich es ihm aufgetragen hatte – vollständig heraus.
Anfangs hatte er mich vor ihr in Schutz nehmen wollen, aber das hatte mich zutiefst gekränkt. »Das ist ja, als wolltest du sagen, sie sei furchterregender als ich.«
Aber das eigentliche Problem war Bruno. Er war zickiger als das gemeinste Mädchen und hatte, ich weiß es wohl, gute Gründe dafür, denn seine Eltern hatten sich getrennt, als er zarte neun Jahre alt war, und jetzt war er dreizehn und wurde von Wut erzeugenden Hormonen überschwemmt. Das drückte er aus, indem er sich im Faschisten-Look kleidete: taillierte schwarze Hemden, enge schwarze Hosen, die er in kniehohe, glänzend schwarze Lederstiefel steckte. Das sehr, sehr blonde Haar trug er, von einem schräg in die Stirn fallenden Achtzigerjahre-Pony abgesehen, kurz geschnitten. Außerdem benutzte er Wimperntusche, und jetzt sah es so aus, als würde er es auch mit Rouge versuchen.
»Ja, gut!«, sagte ich mit einem etwas angespannten Lächeln in die versammelten Gesichter. Artie hob den Blick von dem Puzzle und sah mich aus blauen Augen intensiv an. Himmel. Ich schluckte. Ich wollte auf der Stelle, dass Vonnie nach Hause ging und die Kinder sich in die Betten verzogen, damit ich mit Artie allein sein konnte. Ob es unhöflich war, sie zum Gehen aufzufordern?
»Was zu trinken?«, fragte er und ließ meinen Blick nicht los. Ich nickte stumm.
Ich rechnete damit, dass er aufstehen würde und ich ihm dann in die Küche folgen könnte, um schnell an ihm zu schnuppern.
»Ich hole dir was«, sagte Iona verträumt.
Ich verkniff mir ein frustriertes Aufheulen und sah ihr nach, wie sie die Treppe zur Küche hinunterglitt. Iona war fünfzehn. Ich fand es erstaunlich, dass man sie beauftragen konnte, ein Glas Wein von einem Zimmer ins nächste zu tragen, ohne dass sie es bis auf den letzten Tropfen leerte. Als ich fünfzehn war, habe ich alles getrunken, was ich in die Finger bekam. »Hast du Hunger, Helen?«, fragte Vonnie. »Im Kühlschrank ist noch Fenchelsalat mit Vacherin Mont-d’Or.«
Mein Magen verschloss sich, auf keinen Fall würde etwas hineingelangen. »Ich habe schon gegessen.« Das stimmte nicht. Nicht mal eine Scheibe von dem Abendkuchen meiner Eltern hatte ich in mich hineinzwingen können.
»Sicher?« Vonnie musterte mich von oben bis unten. »Du siehst ein bisschen dünn aus. Nicht dass du irgendwann dünner bist als ich.«
»Keine Angst, das passiert schon nicht.« Aber vielleicht doch. Die letzte richtige Mahlzeit hatte ich … ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, vielleicht vor einer Woche oder so zu mir genommen. Anscheinend hatte mein Körper aufgehört, meinem Gehirn zu melden, dass er Nahrung brauchte. Oder vielleicht war mein Kopf so voll mit Sorgen, dass er die Information nicht mehr aufnahm. In den seltenen Fällen, wo doch eine Meldung durchgekommen war, hatte ich mich außerstande gesehen, etwas so Kompliziertes zu tun, wie Milch über eine Schale Cheerios zu gießen. Selbst das Popcorn, das ich am Abend zuvor zu essen versucht hatte, erschien mir höchst merkwürdig. Warum würde man diese pappigen kleinen Styroporkugeln essen wollen, die einem den Gaumen zerschnitten und dann Salz in die Wunden rieben?
»Helen!«, sagte Bella. »Lass uns was spielen!« Sie brachte einen rosa Plastikkamm und eine rosa Plastikschachtel mit rosa Haarklipsen und rosa Haargummis zum Vorschein. »Nimm doch Platz.«
O nein. Friseur. Na ja, wenigstens spielten wir nicht wieder Autoanmeldung beim Verkehrsamt. Das war das schlimmste Spiel überhaupt: Ich musste stundenlang anstehen, während sie in einer imaginären Glaskabine saß. Ich hatte versucht zu erklären, dass ich das Auto doch online anmelden konnte, aber Bella protestierte und sagte, dann wäre es ja kein Spiel mehr. »Hier ist dein Wein«, sagte sie, und dann zischend zu Iona: »Schnell, gib ihr das Glas, du siehst doch, dass sie Stress hat.«
Iona hielt mir ein Glas Rotwein hin und ein großes Glas mit einem Getränk und klimpernden Eiswürfeln. »Shiraz oder selbst gemachten Baldrian-Eistee. Ich wusste nicht, was dir lieber ist, deshalb habe ich beides gebracht.«
Eine Sekunde lang liebäugelte ich mit dem Wein, dann entschied ich mich dagegen. Ich befürchtete, ich könnte nicht mehr aufhören, wenn ich erst einmal angefangen hatte, und ein grauenvoller Kater war mehr, als ich ertragen konnte.
»Keinen Wein, danke.«
Ich wappnete mich innerlich gegen den Ausbruch der Proteste, der gewöhnlich auf so eine Aussage folgte: »Was? Keinen Wein! Hat sie wirklich gesagt, keinen Wein? Was ist in sie gefahren?« – Ich rechnete fest damit, dass die Devlins mich zu Boden ringen und in den Schwitzkasten nehmen und mir das Glas Shiraz durch einen Trichter einflößen würden, aber niemand sagte etwas. Einen Moment lang hatte ich vergessen, dass ich nicht bei meiner eigenen Familie war.
»Oder lieber eine Cola light?«, fragte Iona.
Meine Güte, die Devlins waren die perfekten Gastgeber, selbst ein exzentrisches Mädchen wie Iona. Sie hatten immer Cola light für mich im Kühlschrank, von ihnen trank das niemand.
»Nein danke, so ist es gut.«
Ich nahm einen Schluck von dem Baldriantee – nicht unangenehm, aber auch nicht besonders angenehm – und ließ mich auf einem der dicken Bodenkissen nieder. Bella kniete sich neben mich und fing an, mir den Kopf zu streicheln. »Du hast so schöne Haare«, murmelte sie.
»Danke.«
Allerdings war sie der Auffassung, dass alles an mir schön war, auf ihre Wahrnehmung war nicht unbedingt Verlass.
Mit ihren kleinen Fingern fuhr sie durch mein Haar und trennte es in Strähnen, nach und nach entspannten sich meine Schultern, und zum ersten Mal seit ungefähr zehn Tagen konnte ich richtig atmen. Meine Lungen füllten sich mit Luft, die dann wieder ausströmte. »O Gott, tut das gut.«
»War es ein harter Tag?«, fragte sie teilnahmsvoll.
»Du machst dir keine Vorstellung, meine kleine rosa Amiga.«
»Erzähl’s mir.«
Ich wollte schon mit der ganzen traurigen Geschichte loslegen, doch da fiel mir ein, dass sie erst neun war.
»Na ja«, sagte ich und gab mir Mühe, dem Ganzen einen fröhlichen Klang zu geben. »Ich konnte meine Rechnungen nicht bezahlen, und deshalb musste ich aus meiner Wohnung ausziehen …«
»Was?« Artie war fassungslos. »Wann denn?«
»Heute. Aber es ist in Ordnung.« Ich sprach mehr zu Bella als zu ihm.
»Aber warum hast du mir nichts gesagt?«
Ja, warum eigentlich nicht? Zwar hatte ich, als ich ihm vor sechs Wochen den Schlüssel gegeben hatte, so etwas angedeutet, aber ich hatte es wie einen Witz klingen lassen. Schließlich war das ganze Land mit Hypothekenrückzahlungen im Rückstand und bis zum Anschlag verschuldet. Aber letztes Wochenende hatte er die Kinder bei sich gehabt, dann war er die ganze Woche weg gewesen, und mir fiel es schwer, schwierige Dinge am Telefon zu besprechen. Ehrlich gesagt hatte ich mit niemandem darüber gesprochen.
Als mir gestern Morgen klar wurde, dass ich am Ende war – und zwar schon längst, aber ich hatte bis zuletzt die Hoffnung, dass irgendetwas geschehen würde und es doch noch weiterginge –, hatte ich für heute die beiden Packer bestellt. Wahrscheinlich hatte ich aus Scham nichts gesagt. Oder vor lauter Traurigkeit? Oder aus Schock? Schwer, es genau zu sagen.
»Und was machst du jetzt?« Bella klang erschüttert.
»Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen, nur für eine Weile. Sie haben zurzeit eine Phase, wo sie sich sehr alt fühlen, deswegen gibt es bei ihnen nichts Richtiges zu essen, aber das geht sicherlich vorüber …«
»Warum wohnst du nicht bei uns?«, fragte Bella.
Sofort stieg Zornesröte in Brunos pfirsichzartes Gesicht. Im Normalzustand war er so zornig, dass man denken würde, er müsste von Pickeln geradezu übersät sein, sozusagen als äußere Manifestation, aber nein, seine Haut war weich, glatt, zart.
»Weil dein Dad und ich uns erst seit Kurzem kennen …«
»Seit fünf Monaten, drei Wochen und sechs Tagen«, sagte Bella. »Das sind fast sechs Monate. Das ist ein halbes Jahr.«
Ich sah besorgt in ihr eifriges kleines Gesicht.
»Und ihr passt gut zusammen«, sagte sie mit Begeisterung. »Das sagt Mum. Stimmt doch, Mum, oder?«
»Das stimmt in der Tat«, sagte Vonnie mit einem kleinen ironischen Lächeln.
»Ich kann nicht hier einziehen.« Ich gab mir Mühe, fröhlich zu klingen. »Bruno würde mich in der Nacht erdolchen.« Und dann mein Make-up stehlen.
Bella war entsetzt. »Nein, das würde er nicht tun.«
»Doch«, sagte Bruno.
»Bruno!«, fuhr Artie ihn an.
»Entschuldigung, Helen.« Bruno wusste, was sich gehörte. Er wandte sich ab, aber da hatte ich schon gesehen, dass seine Lippen stumm die Worte »Verpiss dich, du Schlampe« geformt hatten.
Es bedurfte meiner ganzen Selbstbeherrschung, nicht zurückzugeben: »Nein, verpiss du dich, du kleiner Faschist.« Ich war immerhin fast vierunddreißig, sagte ich mir. Und Artie könnte mich dabei sehen.
Das Aufleuchten meines Handys lenkte mich ab. Eine neue Nachricht. Mit einem interessanten Betreff: »Untertänigst«. Dann sah ich, wer sie geschickt hatte: Jay Parker. Beinah hätte ich das Telefon fallen lassen.
»Liebste Helen, mein kleiner Drachen. Obwohl es mich fast umbringt, es zu sagen: Ich brauche deine Hilfe. Wie wär’s, wenn wir die Vergangenheit begraben und du dich bei mir meldest?«
Eine Ein-Wort-Antwort reichte. Ich brauchte keine Sekunde, um sie zu tippen. »Nein.«
Ich erlaubte Bella, mit meinen Haaren zu spielen, und trank meinen Baldriantee, ich sah den Devlins zu, wie sie ihr Puzzle zusammensetzten, und ich wünschte mir, dass alle – ausgenommen Artie, natürlich – abhauen würden. Könnten wir nicht wenigstens reingehen und den Fernseher anschalten? Da, wo ich aufgewachsen bin, betrachteten wir den Aufenthalt im Freien mit Misstrauen. Selbst im Hochsommer gingen wir nicht in den Garten, schon allein deswegen nicht, weil das Kabel für den Fernseher nicht so weit reichte. Im Leben der Familie Walsh hatte das Fernsehen immer eine wichtige Rolle gespielt; nichts, aber auch gar nichts – Geburten, Todesfälle, Hochzeiten – hatte sich je ereignet, ohne dass im Hintergrund der Fernseher gelaufen wäre, am besten mit einer lautstarken Seifenoper. Wie hielten die Devlins das nur aus – dauernd miteinander zu sprechen?
Vielleicht lag das Problem aber auch gar nicht bei ihnen. Vielleicht war ich das Problem. Die Fähigkeit, mich mit anderen zu unterhalten, schien aus mir zu entweichen wie Luft aus einem Ballon. Es fiel mir jetzt bereits schwerer als noch vor einer Stunde.
Mit ihren weichen Fingern strich Bella mir über die Kopfhaut, und sie murmelte und brabbelte vor sich hin und hatte schließlich einen Punkt erreicht, wo sie mit ihrem Werk zufrieden war.
»Schön! Du siehst aus wie eine Prinzessin von den Maya. Guck mal.« Sie hielt mir den Handspiegel vors Gesicht. Ich erhaschte einen Blick von meinem Haar, das zu zwei langen Zöpfen geflochten war, und einem handgewebten Band, das unter meine Ponyfransen gewunden war. »Guckt mal, wie Helen aussieht.« Sie ließ ihren Blick über die anderen schweifen. »Ist sie nicht schön?«
»Sehr schön«, sagte Vonnie und klang überzeugend ehrlich.
»Wie eine Prinzessin von den Maya«, wiederholte Bella.
»Stimmt es, dass die Maya das Magnum erfunden haben?«, fragte ich.
Es entstand ein kurzes, überraschtes Schweigen, dann ging die Unterhaltung weiter, als hätte ich nichts gesagt. Hier war ich weit von meiner Wellenlänge entfernt.
»Sie sieht genau wie eine Maya-Prinzessin aus«, sagte Vonnie. »Nur dass Helens Augen grün sind, und eine Maya-Prinzessin hätte sicherlich braune Augen. Aber die Haare sind genau richtig. Hast du gut gemacht, Bella. Möchtest du noch Tee, Helen?«
Zu meiner eigenen Überraschung war ich – wenigstens gerade jetzt – die Devlins gründlich leid, mit ihrem guten Aussehen und ihrer anmutigen Wohlerzogenheit und ihren Brettspielen und freundschaftlichen Trennungen und den Kindern, die zum Essen ein halbes Glas Wein bekamen. Ich wollte mit Artie allein sein, aber es würde nicht dazu kommen, und ich hatte nicht einmal die Energie, sauer zu sein – er konnte schließlich nichts dafür, dass er drei Kinder und eine anspruchsvolle Arbeit hatte. Er wusste nicht, wie es mir heute ergangen war. Oder gestern. Oder wie meine Woche verlaufen war.
»Keinen Tee mehr, Vonnie, danke. Ich sollte besser gehen.« Ich stand auf.
»Du gehst?« Artie sah mich eindringlich an.
»Wir sehen uns am Wochenende.« Oder wenn die Kinder das nächste Mal bei Vonnie waren. Ich hatte den Überblick über ihren Zeitplan verloren, der sehr kompliziert war und zum Ziel hatte, dass die drei Kinder mit beiden Elternteilen gleich viel Zeit verbrachten, nur dass die Tage von Woche zu Woche wechselten, je nachdem ob Artie oder Vonnie (meistens Vonnie, um ehrlich zu sein) einen Kurzurlaub planten, zu einer Hochzeit eingeladen waren oder dergleichen.
»Ist alles in Ordnung?« Ein besorgter Ausdruck zeigte sich auf seinem Gesicht.
»Bestens.« Ich konnte jetzt nicht davon anfangen.
Er umfasste mein Handgelenk. »Bleib doch noch ein bisschen.« Und leise fügte er hinzu: »Ich sage Vonnie, sie soll gehen. Und die Kinder müssen irgendwann ins Bett.«
Aber das konnte noch Stunden dauern. Artie und ich gingen nie vor den Kindern ins Bett. Natürlich war ich morgens oft da, sodass es offenkundig war, dass ich die Nacht dort verbracht hatte, aber wir alle taten so, als würde ich in einem imaginären Gästebett schlafen und Artie hätte allein in seinem Bett gelegen. Obwohl ich Arties Geliebte war, gaben wir vor, ich wäre einfach nur eine Freundin der Familie.
»Ich muss gehen.« Ich hielt es nicht länger aus, draußen rumzusitzen und darauf zu warten, dass ich mit Artie allein sein und ihm die Klamotten von seinem schönen Körper reißen konnte. Eher würde ich platzen.
Aber erst das Abschiednehmen. Das dauerte ungefähr zwanzig Minuten. Ich halte nicht viel von langen Abschiedsreden; ginge es nach mir, würde ich leise murmeln »Ich muss mal«, und mich dann einfach aus dem Staub machen.
Sich zu verabschieden finde ich geradezu unerträglich langweilig. In meinem Kopf bin ich schon längst weg, sodass mir das ganze »Mach’s gut« und »Bis dann« und dazu das ewige Lächeln wie reine Zeitverschwendung vorkommt. Manchmal möchte ich die Menschen von mir abschütteln, mir ihre Hände von der Schulter reißen und davonstürzen, in die Freiheit. Aber bei den Devlins war es immer eine große Sache – Umarmungen, Küsse auf beide Wangen –, selbst Bruno machte dabei mit, offensichtlich konnte er seine bürgerliche Erziehung nicht ganz abschütteln. Dann vierfache Küsse von Bella, auf beide Wangen, Stirn und Kinn, und der Vorschlag, dass ich bald einmal bei ihr übernachten solle.
»Ich leihe dir auch meinen Schlafanzug, den mit den Erdbeertörtchen drauf«, versprach sie mir.
»Du bist neun«, sagte Bruno oberhochnäsig. »Und sie ist alt. Wie soll ihr dein Schlafanzug denn passen?«
»Wir sind gleich groß«, sagte Bella.
Und so komisch es auch war, es stimmte beinah. Ich war für mein Alter klein und Bella für ihres ziemlich groß. Sie waren alle groß, die Devlin-Kinder, das hatten sie von Artie.
»Meinst du wirklich, du solltest jetzt allein sein?«, fragte Artie mich auf dem Weg zur Haustür. »Dein Tag war doch ziemlich schlimm.«
»Ja, ja, mir geht es prächtig.«
Er nahm meine Hand und rieb die Handfläche über seine Brustmuskeln unter dem T-Shirt, dann tiefer, über seinen Bauch.
»Aufhören.« Ich zog meine Hand zurück. »Besser nichts anfangen, was wir nicht zu Ende bringen können.«
»Ist gut. Aber lass mich das hier entfernen, bevor du gehst.«
»Artie, ich meinte …«
Zärtlich löste er das Maya-Stirnband, das Bella mir umgebunden hatte, schwenkte es durch die Luft und ließ es auf den Boden fallen.
»Oh«, sagte ich. Und dann wieder »oh«, als er mit der Hand über meinen Haaransatz strich und anfing, die beiden Zöpfe zu öffnen. Ich schloss die Augen und erlaubte seinen Händen, in meinen Haaren zu wühlen. Mit seinen Daumen massierte er mir die Schläfen, dann meine Stirn und die steilen Falten zwischen den Augenbrauen, dann die Stelle, wo mein Hinterkopf in den Nacken überging. Langsam entspannte sich mein Gesicht, meine Kiefer lockerten sich, und als er aufhörte, war ich in einem so seligen Zustand, dass eine weniger standfeste Frau umgefallen wäre.
Ich schaffte es, stehen zu bleiben. »Habe ich auf dich draufgesabbert?«, fragte ich.
»Diesmal nicht.«
»Gut. Ich gehe jetzt.«
Er beugte sich zu mir hinunter und küsste mich, und sein Kuss war zurückhaltender, als ich es mir gewünscht hatte, aber es war besser, kein Feuer zu entfachen.
Ich ließ meine Hand zu seinem Hinterkopf gleiten. Ich fuhr gern mit den Fingern durch sein Nackenhaar und zupfte daran, nicht so, dass es wehtat. Nicht richtig weh.
Als wir uns losließen, sagte ich: »Ich mag dein Haar.«
»Vonnie sagt, es muss geschnitten werden.«
»Ich sage, muss es nicht. Und ich treffe hier die Entscheidungen.«
»Gut«, sagte er. »Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich ruf dich später an.«
In den letzten Wochen hatten wir ein – ja, ich denke schon, man kann es Ritual nennen – entwickelt, wobei wir uns kurz anriefen, bevor wir einschliefen.
»Und was deine Frage angeht«, sagte er, »so lautet die Antwort Ja.«
»Welche Frage?«
»Ob die Maya das Magnum erfunden haben.«
3
Kaum saß ich im Auto, wurde mir klar, dass ich kein Ziel hatte. Ich fuhr auf die Autobahn, aber als ich an die Ausfahrt zu dem Stadtteil kam, wo meine Eltern wohnten, ließ ich sie links liegen und fuhr einfach weiter.
Ich fuhr gern Auto. Ein bisschen war es, als säße man in einer Blase. Ich war nicht mehr da, wo ich weggegangen war, und noch nicht da, wo ich hinfuhr. Es war, als hätte ich beim Weggehen aufgehört zu existieren und würde erst wieder zu existieren beginnen, wenn ich ankam. Und das gefiel mir, dieser Zustand des Nicht-Seins.
Beim Fahren holte ich tief Luft durch den Mund und versuchte die Luft zu schlucken, um zu verhindern, dass meine Brust sich wieder verschloss.
Als mein Handy klingelte, brach mir der Angstschweiß aus. Ich nahm es und warf schnell einen Blick auf das Display: Nummer unterdrückt. Das konnten alle möglichen Leute sein – in letzter Zeit hatte ich jede Menge unwillkommener Anrufe gehabt, wie das bei Menschen mit unbezahlten Rechnungen eben so ist, aber ein Gefühl im Bauch sagte mir, wer dieser geheimnisvolle Anrufer war. Und ich würde ihm nicht antworten. Nach fünfmal Klingeln schaltete sich die Mailbox ein. Ich warf das Handy auf den Beifahrersitz und fuhr weiter.
Ich drehte das Radio an, das immer auf Newstalk eingestellt war. Um diese Zeit am Abend gab es Off the Ball, eine Sportsendung mit Beiträgen, die mich nicht interessierten – Mannschaftsspiele, Laufsport und so. Mit halbem Ohr hörte ich zu, wie Sportler und Trainer redeten, und erkannte an ihren Stimmen, wie wichtig das alles für sie war. Ich dachte: Für euch ist das so wichtig, aber mich berührt das überhaupt nicht. Und meine Sachen sind lebenswichtig für mich und bedeuten euch nichts. Gibt es denn etwas, das an sich wichtig ist?
Einen Moment lang sah ich die Dinge im rechten Maß. Für die Leute im Radio bricht eine Welt zusammen, wenn sie am Samstag nicht das Finale um den Lokalpokal gewinnen. Schon jetzt haben sie riesige Angst vor einer Niederlage. Und sie üben ihre Verzweiflung. Aber es ist nicht wichtig.
Nichts ist wichtig.
Mein Handy klingelte wieder: Nummer unterdrückt. Wie beim Mal davor hatte ich eine starke Vermutung, wer es war. Nach fünfmal Klingeln hörte es auf.
Die Autobahn war um diese Tageszeit – kurz vor zehn – fast leer, und die Sonne ging endlich unter. So war das Anfang Juni, die Tage waren endlos, und ich hasste dieses ewig dauernde Licht. Wieder klingelte das Telefon. Mir wurde klar, dass ich darauf gewartet hatte. Fünfmal klingeln, dann Ruhe. Wenige Minuten später das Gleiche noch mal. Klingeln, Ruhe, Klingeln, Ruhe, immer wieder, so wie er es früher schon gemacht hatte. Wenn er etwas wollte, dann musste es sofort sein. Schließlich griff ich nach dem Handy, und weil ich es unbedingt zur Ruhe bringen wollte, waren meine Finger anscheinend auf das Zehnfache ihres Umfangs geschwollen, sodass ich die Tasten nicht drücken konnte.
Endlich hatte ich es abgeschaltet und Jay Parker zum Schweigen verdonnert. Ich atmete auf und fuhr weiter.
Merkwürdige Wolken hingen am Horizont. Ich konnte mich nicht erinnern, schon einmal solche Formationen gesehen zu haben. Der Himmel wirkte fremdartig und bedrohlich, die Dämmerung blieb und blieb, das Licht wollte überhaupt nicht verschwinden, und ich glaubte es nicht länger aushalten zu können. Eine Welle furchtbaren Entsetzens wogte durch mich hindurch.
Ich war auf halbem Weg nach Wexford, als die Sonne endlich unterging und ich mich imstande fühlte, umzukehren und zu Mum und Dad zu fahren.
Als ich mich meinem neuen Zuhause näherte, erlaubte ich mir – für den Bruchteil einer Sekunde nur – die Vorstellung, wie es wohl wäre, wenn ich mit Artie zusammenlebte. Sofort, als wäre eine Guillotine runtergesaust, schnitt ich den Gedanken ab. Ich konnte nicht darüber nachdenken, es ging nicht, es war einfach zu furchterregend. Nicht dass Artie etwas in der Richtung erwähnt hätte. Bella war die Einzige, die bisher davon geredet hatte. Aber was wäre, wenn ich feststellte, ich wollte mit ihm leben und er nicht mit mir? Oder schlimmer noch, dass er es doch wollte?
Meine Wohnung zu verlieren war so schon schlimm genug, ohne dass es zu Verwerfungen mit Artie führte. Es war zart, das Ding zwischen ihm und mir, aber wir kamen gut klar. Müssten wir notgedrungen über ein Zusammenleben nachdenken und dann feststellen, dass es zu früh dazu war – das würde uns nicht guttun. Auch wenn wir die Entscheidung einfach verschoben, würde es sich trotzdem wie ein Misstrauensvotum anfühlen. Oder angenommen, ich zog bei ihm ein, und dann merkten wir, dass es keine gute Idee war. Gab es aus einer solchen Situation überhaupt ein Zurück?
Ich seufzte schwer. Ich wollte, ich hätte meine Wohnung nicht verloren. Ich wollte, dass Artie zu mir in meine Wohnung kommen konnte, wann immer mir danach war. Aber diese Möglichkeit gab es jetzt nicht mehr, würde es nie mehr geben. Auf gar keinen Fall würden er und ich zusammen bei Mum und Dad sein – womöglich miteinander schlafen, während sie in ihrem Zimmer gegenüber waren! Das wäre zu schrecklich! Das würde nicht funktionieren. Dass es solche Veränderungen überhaupt geben musste. Ich hasste es, wie sie alles auf den Kopf stellten.
Ein mir unbekannter eleganter, niedriger Sportwagen stand vor dem Haus von Mum und Dad, und ein Mann lauerte im Schatten. Es hätte ein durchgeknallter Vergewaltiger sein können, aber als ich ausstieg, war es keine große Überraschung (aber dennoch eine von der unangenehmen Sorte), dass sich der Mann, als er ans Licht trat, als Jay Parker herausstellte. Ich hatte ihn fast ein Jahr lang nicht gesehen – nicht, dass ich nachgerechnet hätte –, und er war völlig unverändert. Mit seinem schmal geschnittenen Hipster-Anzug, seinen dunklen, tänzelnden Augen und seinem beflissenen Lächeln sah er genau aus wie das, was er war: ein Hochstapler.
»Ich habe angerufen«, sagte er. »Gehst du nie dran?«
Ich verlangsamte meine Schritte nicht. »Was willst du?«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Die bekommst du nicht.«
»Ich bezahle dafür.«
»Ich bin viel zu teuer für dich.« Ich hatte nämlich auf der Stelle eine sehr teure Sonderrate für Jay Parker erfunden.
»Stell dir vor, du bist mir nicht zu teuer. Ich kenne deine Sätze. Ich gebe dir das Doppelte. Im Voraus. Bar auf die Hand.« Er zog ein dickes Bündel Banknoten hervor. So dick, dass ich stehen blieb.
Ich blickte auf das Geld, ich sah Jay Parker an. Ich wollte nicht für ihn arbeiten. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben.
Aber es war sehr viel Geld.
Benzin im Tank, Telefonguthaben aufgestockt, ein Besuch beim Arzt.
Misstrauisch fragte ich ihn: »Worum geht es?«
Mit Sicherheit war es etwas Heikles.
»Ich möchte, dass du jemanden für mich findest.«
»Wen?«
Er zögerte. »Das ist vertraulich.«
Ich sah ihm in die Augen. Wie sollte ich jemanden finden, dessen Identität so vertraulich war, dass ich sie nicht erfahren durfte?
»… Ich meine, es ist eine heikle Sache …« Mit der Spitze seines spitzen Schuhs schob er ein paar Kieselsteine umher. »Die Presse darf nichts davon erfahren.«
»Wer ist es?« Jetzt war ich wirklich neugierig.
Seine Miene war besorgt.
»Wer?«, fragte ich noch einmal.
Plötzlich kickte er einen der Kieselsteine, der darauf in einem hohen eleganten Bogen durch die Luft flog. »Ach, Scheiß drauf, ich kann’s dir ruhig sagen. Wayne Diffney.«
Wayne Diffney! Von dem hatte ich gehört. Ich wusste sogar eine ganze Menge über ihn. Vor sehr langer Zeit, wahrscheinlich Mitte der Neunzigerjahre, war er bei den Laddz gewesen. Damals waren die Laddz eine der beliebtesten irischen Boygroups. Nicht ganz dieselbe Liga wie Boyzone oder Westlife, aber trotzdem ein riesiger Erfolg. Ihre ruhmreichen Tage lagen weit zurück, versteht sich, und jetzt waren sie so alt und untalentiert und lachhaft, dass sie, nachdem sie völlig untergegangen waren, auf der anderen Seite wieder hochkamen, denn viele Menschen dachten mit großer Zuneigung an sie. Die Gruppe war eine Art Nationalschatz geworden.
»Du weißt es bestimmt schon, die Laddz treten nächste Woche in drei megagroßen Comeback-Konzerten auf. Mittwoch, Donnerstag, Freitag.«
Ein Laddz-Comeback! Nein, davon hatte ich nichts gewusst – ich hatte ja ein paar andere Sorgen im Kopf –, aber plötzlich wurde mir das eine oder andere klar: alle paar Sekunden ihre Lieder im Radio, und meine Mutter, die mich überreden wollte, mit ihr in das Konzert zu gehen.
»Hundert Euro pro Karte, Merchandising-Produkte an den Ausgängen«, sagte Jay wehmütig. »Quasi die Lizenz zum Gelddrucken.«
Alles sehr typisch für Jay Parker, schmuddeliger kleiner Abzocker, der er war.
»Und?«, hakte ich nach.
»Ich bin ihr Manager. Aber Wayne wollte – will – nicht mitmachen. Er …« Jay brach ab.
»… schämt sich?«
»… ziert sich.«
Er ziert sich. Das konnte ich mir vorstellen. Bei den Laddz gibt es, wie in allen Boygroups, fünf Typen: Der Talentierte. Der Süße. Der Schwule. Der Verrückte. Und der Sonderling.
Wayne war immer der Verrückte gewesen. Seine Verrücktheit zeigte sich am deutlichsten an seinen Haaren: Man hatte ihm eine Frisur verpasst, mit der sein Haar aussah wie das Opernhaus in Sydney, und er hatte es mit sich machen lassen. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass er damals sehr jung war und es nicht besser gewusst hat, und in den letzten Jahren hatte er es mit einer völlig normalen Frisur wiedergutgemacht.
All das lag natürlich mehrere Leben zurück. Viel Wasser war den Fluss runtergeflossen, seit sie einen Nummer-eins-Hit gehabt hatten. Die Fünfergruppe der Laddz war zu einem Quartett geschrumpft, als sich der Talentierte nach zwei erfolgreichen Jahren abgesetzt hatte. (Er war zu einem Weltstar geworden, der seine trübe Herkunft in einer Boygroup nie, niemals erwähnte.) Die zurückgelassenen vier machten noch eine Weile weiter, und als sie sich irgendwann trennten, interessierte es niemanden.
Unterdessen brach Waynes Privatleben zusammen. Seine Frau Hailey verließ ihn und tat sich mit einem echten Rockstar, einem gewissen Shocko O’Shaughnessy, zusammen. Als Wayne einmal auf Shockos Landsitz auftauchte und seine Frau zurückholen wollte, erfuhr er, dass sie von Shocko schwanger war und keinerlei Absicht hatte, zu Wayne zurückzukehren. Zur gleichen Zeit war Bono zu Gast bei seinem Freund Shocko und stellte sich schützend vor ihn, und in dem ganzen Aufruhr schlug der aufgebrachte Wayne Bono mit einem Schlagstock aufs linke Knie und brüllte: »Das ist für Zooropa!«
Nach so viel Unglück beschloss Wayne, sich als richtiger Künstler neu zu erfinden, er trennte sich also von seiner verrückten Frisur, ließ sich ein Spitzbärtchen wachsen, sagte ein- oder zweimal in Sendungen des öffentlichen Radiosenders »fuck« und nahm ein paar Alben mit Akustikgitarre und Songs über unerwiderte Liebe auf. Wegen der weggelaufenen Frau und der Attacke gegen Bono gab es in der Öffentlichkeit viel Zuspruch für Wayne, und er hatte einigen Erfolg, aber offenbar nicht genug, denn sein Label ließ ihn nach wenigen Alben fallen, und kurze Zeit später verschwand er völlig aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit.
Dann war es ziemlich lange still um ihn … doch inzwischen schien genug Zeit vergangen zu sein. Der eisige Schnee des Winters war getaut, der Frühling gekommen. Die kreischenden Teenie-Fans der Laddz von damals waren jetzt erwachsene Frauen, die Kinder und einen Hang zur Nostalgie hatten. Genau betrachtet war das Comeback-Konzert nur eine Frage der Zeit gewesen.
Und so, erzählte Jay Parker mir, hatte er sich vor drei Monaten den vier Männern als Manager angeboten und ihnen (das vermute ich nur, aber ich kenne ihn ja) ungeheure Reichtümer versprochen, wenn sie sich für eine Weile wieder zusammentun würden. Sie alle hatten sich bereit erklärt und umgehend genaue Anweisungen bekommen, Kohlehydrate aus ihrer Ernährung zu streichen und täglich ein Lauftraining von acht Kilometern zu absolvieren. Und ein bisschen zu üben. Bloß nicht übertreiben.
»Die angekündigten Konzerte schlagen unglaublich hohe Wellen«, sagte Jay. »Und wenn alles gut geht, machen wir eine Tournee durchs ganze Land, vielleicht kriegen wir ein paar Auftritte in England, eine DVD zu Weihnachten, wer weiß, was noch … Die Jungs könnten ein bisschen Kohle gut gebrauchen.«
Soweit ich gehört hatte, waren die Laddz bankrott oder mehrfach verheiratet oder klassischen Oldtimern verfallen, von allem etwas.
»Aber Wayne ist nicht richtig eingestiegen«, sagte Jay. »Vielleicht am Anfang, aber in der vergangenen Woche war es … schwierig mit ihm. In den letzten Tagen ist er nicht zu den Proben gekommen. Jemand hat ihn mit einer Feigen-Focaccia und einem Glas Nutella gesehen … Außerdem hat er sich den Kopf kahl rasiert …«
»Was?«
»Beim Beten hat er geweint.«
»Beim Beten!«
Jay machte eine abfällige Handbewegung. »John Joseph besteht darauf.«
Stimmte ja. John Joseph Hartley – der Süße, wenigstens war er das vor fünfzehn Jahren gewesen – war irgendwie gläubig. »Was genau meinst du mit Beten?«, fragte ich. »Buddhistisches Mantra-Singen?«
»Nein, nein. Alte Schule. Hauptsächlich Rosenkranz. Schadet ja nicht. Wahrscheinlich ist es eine gute Übung, um einander näherzukommen. Aber einmal, wir waren mitten im dritten schmerzhaften Geheimnis, da ist Wayne plötzlich in Tränen ausgebrochen. Hat wie ein Mädchen geheult. Rennt weg, kommt am nächsten Tag – also gestern – nicht zu den Proben, und als ich bei ihm zu Hause klingele, trägt er ein T-Shirt mit Schokoladenflecken und hat sich eine Glatze rasiert.«
Sein berühmtes Haar. Sein ehemals und neuerdings wieder verrücktes Haar. Armer Wayne. Offensichtlich wollte er wirklich nicht mehr mitmachen.
»Ich meine, das mit dem Haar, das würden wir hinkriegen«, sagte Jay. »Und der Bauchansatz. Er hat mir versprochen, er würde sich zusammennehmen, aber heute Morgen ist er wieder nicht gekommen. Und ist auch nicht ans Telefon gegangen, weder Festnetz noch mobil. Wir haben beschlossen, mit den Proben weiterzumachen. Soll er doch einen Tag aussetzen und seinen kleinen Protest ausleben, dachten wir …«
»Wer ist wir?«
»Ich. Und John Joseph, gewissermaßen. Nach der Probe habe ich bei Wayne angerufen, da war sein Mobiltelefon abgestellt, also bin ich wieder bei ihm zu Hause vorbeigefahren, als hätte ich so nicht schon genug zu tun. Und er ist weg. Er ist einfach … verschwunden. Und deswegen bin ich bei dir.«
»Nein.«
»Doch.«
»Es gibt Dutzende von Privatdetektiven in dieser Stadt. Alle suchen verzweifelt Aufträge. Geh zu einem von ihnen.«
»Hör zu, Helen.« Plötzlich klang er leidenschaftlich. »Ich könnte jede alte Spürnase darauf ansetzen, die Buchungen der Fluggesellschaften der letzten vierundzwanzig Stunden anzuzapfen. Ich könnte mich sogar persönlich hinsetzen und jedes Hotel im Land anrufen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass da nichts bei rumkommt. Wayne ist ein schwieriger Typ. Jeder andere hätte sich in einem Hotel versteckt, mit Zimmerservice und Massagen. Golf.« Er unterdrückte einen Schauder. »Aber Wayne … ich habe keine Ahnung, wo er ist.«
»Und?«
»Ich brauche dich, weil du in Waynes Kopf gucken sollst. Ich brauche jemanden, der ein bisschen abseits des Normalen denkt, und du, Helen Walsh, bist auf deine eigene, unangenehme Weise ein Genie.«
Daran war etwas Wahres. Ich bin träge und unlogisch. Meine sozialen Fähigkeiten sind begrenzt. Ich langweile mich schnell und bin leicht gereizt. Aber ich habe brillante Augenblicke. Sie kommen und gehen, ich kann mich nicht auf sie verlassen, aber es gibt sie.
»Wo immer sich Wayne versteckt hat«, sagte Jay Parker, »er ist direkt vor unserer Nase.«
»Ach wirklich?« Ich machte die Augen groß auf und sah von rechts nach links, von oben nach unten und um mich herum. »Direkt vor unserer Nase, sagst du? Siehst du ihn? Nein? Ich auch nicht. Damit wäre diese These widerlegt.«
»Ich will nur sagen, dass er sich nicht richtig versteckt, nicht wie ein normaler Mensch. Er versteckt sich, das schon, aber wenn wir ihn dann finden, schlagen wir uns an die Stirn und denken, das war doch die logischste Stelle überhaupt.«
»Jay, es klingt, als wäre Wayne … unter Stress. Wenn er sich die Haare abrasiert und so. Ich weiß, dass du es kaum erwarten kannst abzukassieren. Mit den Laddz-Geschirrtüchern und den Laddz-Brotdosen, aber wenn Wayne Diffney irgendwo da draußen mit dem Gedanken spielt, sich etwas anzutun, dann ist es deine Verantwortung, es jemandem zu sagen.«
»Sich etwas anzutun?« Jay starrte mich überrascht an. »Wer sagt das denn? Du hast das alles ganz falsch verstanden. Wayne schmollt einfach nur.«
»Wer weiß …«
»Er ist beleidigt, das ist alles.«
Vielleicht. Vielleicht übertrug ich die Gedanken in meinem Kopf in den von Wayne.
»Ich glaube, du solltest zur Polizei gehen.«
»Die machen da nichts. Er ist freiwillig abgehauen, er ist seit höchstens vierundzwanzig Stunden weg … Und die Presse darf nichts erfahren. Ich habe eine Idee, Helen Walsh. Komm mit, wir gehen zu ihm nach Hause und gucken mal, ob du dich da hineinfühlen kannst. Gib mir eine Stunde, und ich bezahle dich für zehn. Zum doppelten Tarif.«
Eine Stimme in meinem Kopf sagte immer wieder: Jay Parker ist ein schlechter Mensch.
»Haufenweise Zaster«, sagte Jay verführerisch. »In diesen mageren Zeiten für Privatdetektive.«
Da hatte er nicht unrecht. Die Zeiten waren nie magerer gewesen. Zwei schlimme Jahre lagen hinter mir, die Aufträge wurden immer weniger, ich hatte kaum etwas zu tun und verdiente schließlich gar kein Geld mehr. Aber um ehrlich zu sein, war es gar nicht die Verlockung des Geldes, die mein Herz höher schlagen ließ, es war der Gedanke, dass ich etwas zu tun bekäme, dass da ein Rätsel war, auf das ich mich konzentrieren konnte, und dass ich mich in meinem Kopf nicht dauernd mit mir selbst beschäftigen musste.
»Wie sieht es aus?«, fragte Jay und sah mich direkt an.
»Erst das Geld.«
»Okay.« Er gab mir ein Bündel Scheine, und ich zählte nach. Er hatte mir das Geld für zehn Stunden zum doppelten Tarif gegeben, wie er versprochen hatte.
»Fahren wir jetzt zu Waynes Haus?«
»Einbruch ist nicht mein Ding.« Na ja, manchmal schon. Es ist gegen das Gesetz, aber was wäre das Leben ohne den einen oder anderen kleinen Adrenalinstoß?
»Keine Angst, ich habe den Schlüssel.«
4
Wir fuhren in Jays Auto, einem dreißig Jahre alten Jaguar, wie sich herausstellte. Hätte ich mir auch denken können. Einen Jaguar-Oldtimer fahren »Geschäftsleute«, die immer irgendwelche obskuren Pläne schmieden und gelegentlich kleine Unstimmigkeiten mit dem Finanzamt haben.
Ich schaltete mein Handy wieder an, dann feuerte ich einen Haufen Fragen auf Jay ab.
»Hatte Wayne Feinde?«
»Die Friseurinnung war hinter ihm her wegen Verbrechen gegen das Haar.«
»Nimmt er Drogen?«
»Soweit ich weiß, nicht.«
»Hatte er sich Geld von unabhängigen Finanzexperten geliehen?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























