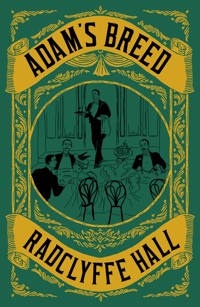1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Quell der Einsamkeit" von Radclyffe Hall ist ein stilistisch meisterhafter Roman, angesiedelt in der anglo-europäischen Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Mit bemerkenswerter psychologischer Feinfühligkeit zeichnet Hall das Porträt von Stephen Gordon, einer Frau, die sich gegen die Normen und Erwartungen ihrer Zeit auflehnt und ihre Identität sowie die Liebe zu einer anderen Frau verteidigt. Halls Prosa ist geprägt von klarer, analytischer Sprache und einer tiefen literarischen Empathie, die geprägt ist vom literarischen Kontext der Moderne und dem Ringen um Geschlechtsidentität und sexuelle Selbstbestimmung. Das Werk nimmt eine Pionierrolle in der LGBTQ-Literatur ein und thematisiert eindringlich das existenzielle Gefühl der Isolation. Radclyffe Hall, eine bedeutsame englische Autorin des frühen 20. Jahrhunderts, war selbst offen homosexuell und befasste sich in ihrem Leben intensiv mit Fragen sexueller Identität und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Diese persönlichen Erfahrungen und ihr Wunsch, das Schweigen und die Stigmatisierung lesbischer Frauen zu durchbrechen, haben maßgeblich zur Entstehung dieses Romans beigetragen. Ihre literarische Courage, einem Tabuthema der damaligen Zeit literarischen Raum zu geben, verlieh dem Werk eine nachhaltige gesellschaftliche Sprengkraft. "Quell der Einsamkeit" ist unerlässlich für alle LeserInnen, die sich für Literatur interessieren, die gesellschaftliche Tabus hinterfragt und die Entwicklung individueller Identität reflektiert. Hall eröffnet damit nicht nur einen einzigartigen Einblick in die historische Realität lesbischer Frauen, sondern stellt zudem zeitlose Fragen nach Zugehörigkeit, Liebe und Mut, die bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Quell der Einsamkeit
Inhaltsverzeichnis
Gewidmet
UNSEREN DREI SELBST
KOMMENTAR
Ich habe „Quell der Einsamkeit“ mit großem Interesse gelesen, weil es – abgesehen von seinen Qualitäten als Roman einer versierten Autorin – eine bemerkenswerte psychologische und soziologische Bedeutung hat. Soweit ich weiß, ist es der erste englische Roman, der einen bestimmten Aspekt des Sexuallebens, wie es heute bei uns existiert, in einer völlig ehrlichen und kompromisslosen Form darstellt. Die Beziehung bestimmter Menschen – die sich zwar von ihren Mitmenschen unterscheiden, aber manchmal den höchsten Charakter und die besten Fähigkeiten besitzen – zu der oft feindseligen Gesellschaft, in der sie leben, wirft schwierige und noch ungelöste Probleme auf. Die ergreifenden Situationen, die sich daraus ergeben, werden hier so anschaulich und doch so völlig unanstößig dargestellt, dass wir Radclyffe Halls Buch auf eine hohe Stufe stellen müssen.
Havelock Ellis
ANMERKUNG DES AUTORS
Alle Figuren in diesem Buch sind rein fiktiv, und wenn die Autorin mal Namen verwendet hat, die auf echte Personen hindeuten könnten, dann war das echt nicht so gemeint.
ERSTES BUCH
Kapitel 1
1
Nicht weit von Upton-on-Severn – genau genommen zwischen diesem Ort und den Malvern Hills – liegen die Landgüter der Gordons von Bramley: gut bewaldet, mit hübschen Häuschen, gut umzäunt und mit viel Wasser, denn ein Bach teilt sich genau an der richtigen Stelle, um zwei große Seen auf dem Gelände zu speisen.
Das Haus selbst ist aus rotem Backstein im georgianischen Stil gebaut und hat charmante runde Fenster in Dachhöhe. Es strahlt Würde und Stolz aus, ohne protzig zu sein, Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu wirken, Ruhe, ohne träge zu sein, und eine sanfte Zurückhaltung, die für diejenigen, die seinen Charakter kennen, seinen Wert als Zuhause noch erhöht. Es ist in der Tat wie mit bestimmten liebenswerten Frauen, die jetzt alt sind und einer vergangenen Generation angehören – Frauen, die in ihrer Jugend leidenschaftlich, aber sittsam waren, schwer zu gewinnen, aber wenn man sie gewonnen hatte, erfüllten sie alle Wünsche. Sie sterben, aber ihre Anwesen bleiben, und ein solches Anwesen ist Morton.
Nach Morton Hall kam Lady Anna Gordon als Braut, gerade etwas über zwanzig Jahre alt. Sie war so schön, wie nur eine irische Frau sein kann, mit einer Haltung, die von stiller Würde zeugte, mit Augen, die von großer Sehnsucht sprachen, und mit einer Ausstrahlung, die auf ein glückliches Leben hindeutete – der Inbegriff der vollkommenen Frau, die Gott geschaffen und für gut befunden hatte. Herr Philip hatte sie in der Grafschaft Clare kennengelernt – Anna Molloy, die schlanke Jungfrau, ganz Keuschheit, und seine Müdigkeit war zu ihr geflogen wie ein erschöpfter Vogel zu seinem Nest – wie tatsächlich einmal ein solcher Vogel zu ihr geflogen war, erzählte sie ihm, auf der Flucht vor den Gefahren eines Sturms.
Sir Philip war ein großer Mann und äußerst gutaussehend, aber sein Charme lag weniger in seinen Gesichtszügen als in einem gewissen offenen Ausdruck, einem toleranten Ausdruck, den man fast als edel bezeichnen könnte, und in etwas Traurigem und doch Galanterem in seinen tief liegenden haselnussbraunen Augen. Sein Kinn, das fest war, hatte eine ganz leichte Grübchen, seine Stirn war intellektuell, sein Haar war rotbraun gefärbt. Seine breite Nase verriet sein temperamentvolles Wesen, aber seine Lippen waren wohlgeformt, sensibel und leidenschaftlich – sie verrieten ihn als Träumer und Liebhaber.
Als sie heirateten, war er neunundzwanzig und hatte schon einiges erlebt, doch Annas gesunder Menschenverstand ließ sie ihm vollkommen vertrauen. Ihr Vormund mochte ihn nicht und war gegen die Verlobung, aber letztendlich setzte sie sich durch. Und wie sich herausstellte, war ihre Wahl glücklich gewesen, denn selten hatten zwei Menschen einander mehr geliebt als sie; sie liebten sich mit einer Leidenschaft, die durch die Zeit nicht gemindert wurde; so wie sie reiften, reifte auch ihre Liebe mit ihnen.
Herr Philip wusste nie, wie sehr er sich nach einem Sohn sehnte, bis seine Frau etwa zehn Jahre nach der Hochzeit schwanger wurde; da wusste er, dass dies die vollständige Erfüllung bedeutete, auf die sie beide gewartet hatten. Als sie es ihm sagte, fand er keine Worte, um seine Gefühle auszudrücken, und musste sich einfach umdrehen und an ihrer Schulter weinen. Es schien ihm nie in den Sinn zu kommen, dass Anna ihm eine Tochter schenken könnte; er sah in ihr nur die Mutter von Söhnen, und auch ihre Warnungen konnten ihn nicht beunruhigen. Er taufte das ungeborene Kind Stephen, weil er den Mut dieses Heiligen bewunderte. Er war von Natur aus kein religiöser Mensch, vielleicht weil er zu sehr Student war, aber er las die Bibel wegen ihrer schönen Sprache, und Stephen hatte seine Fantasie beflügelt. So redete er oft über die Zukunft ihres Kindes: „Ich denke, ich werde Stephen in Harrow anmelden“, oder: „Ich würde Stephen gerne im Ausland ausbilden lassen, das erweitert den Horizont.“
Und Anna hörte ihm zu und wurde auch überzeugt; seine Gewissheit zerstreute ihre vagen Bedenken, und sie sah sich schon mit dem kleinen Stephan im Kinderzimmer spielen, im Garten, auf den duftenden Wiesen. „Und er selbst, dieser schöne junge Mann“, sagte sie und dachte an die sanfte irische Aussprache ihrer Bauern: „Und er selbst, mit dem Licht der Sterne in den Augen und dem Mut eines Löwen im Herzen!“
Wenn sich das Kind in ihr regte, dachte sie, dass es sich wegen des tapferen männlichen Wesens, das sie in sich trug, so stark bewegte; dann wuchs ihr Geist mit einem mächtigen neuen Mut, weil ein männliches Kind geboren werden würde. Sie saß mit ihrer Handarbeit auf den Knien, während ihr Blick zu der langen Hügelkette schweifte, die sich hinter dem Severn-Tal erstreckte. Von ihrem Lieblingsplatz unter einer alten Zeder aus sah sie diese Malvern Hills in ihrer ganzen Schönheit, und ihre sanften Hügel schienen eine neue Bedeutung zu haben. Sie waren wie schwangere Frauen, vollbusig, mutig, große, grün umgürtelte Mütter prächtiger Söhne! So saß sie all diese Sommermonate lang da und schaute auf die Hügel, und Herr Philip saß bei ihr – sie saßen Hand in Hand. Und weil sie dankbar war, gab sie viel an die Armen, und Herr Philip ging in die Kirche, was er sonst selten tat, und der Pfarrer kam zum Abendessen, und gegen Ende kamen viele ältere Damen, um Anna gute Ratschläge zu geben.
Aber: „Der Mensch denkt – Gott lenkt“, und so kam es, dass Anna Gordon am Heiligabend eine Tochter zur Welt brachte; ein kleines, schmalhüfig, breitschultriges Baby, das drei Stunden lang ununterbrochen schrie, als wäre es empört darüber, ins Leben geworfen worden zu sein.
2
Anna Gordon hielt ihr Kind an die Brust, aber sie trauerte, während es trank, wegen ihres Mannes, der sich so sehr einen Sohn gewünscht hatte. Als er ihre Trauer sah, verbarg Herr Philip seinen Ärger, liebkoste das Baby und untersuchte seine Finger.
„Was für eine Hand!“, sagte er. „Es hat tatsächlich Nägel an allen zehn Fingern: kleine, perfekte, rosa Nägel!“
Dann trocknete Anna ihre Augen, streichelte es und küsste die winzige Hand.
Er bestand darauf, das Kind Stephen zu nennen, ja sogar, es unter diesem Namen taufen zu lassen. „Wir haben sie schon so lange Stephen genannt“, sagte er zu Anna, „dass ich wirklich nicht einsehen kann, warum wir nicht so weitermachen sollten ...“
Anna hatte Zweifel, aber Herr Philip war hartnäckig, wie er es manchmal sein konnte, wenn er eine Laune hatte.
Der Pfarrer meinte, das sei ziemlich ungewöhnlich, also mussten sie, um ihn zu besänftigen, weibliche Namen hinzufügen. Das Kind wurde in der Dorfkirche auf den Namen Stephen Mary Olivia Gertrude getauft – und sie gedieh prächtig, wirkte kräftig, und als ihr Haar wuchs, sah man, dass es rotbraun war wie das von Herrn Philip. Sie hatte auch eine winzige Grübchen am Kinn, das zunächst so klein war, dass es wie der Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens aussah; und nach einer Weile, als ihre Augen die für Welpen und andere junge Wesen typische Bläue verloren, sah Anna, dass ihre Augen haselnussbraun werden würden – und fand, dass ihr Ausdruck dem ihres Vaters ähnelte. Insgesamt war sie ein recht braves Baby, was zweifellos ihrer guten Konstitution zu verdanken war. Abgesehen von diesem ersten energischen Protest bei der Geburt hatte sie nur sehr wenig geweint.
Es war schön, ein Baby in Morton zu haben, und das alte Haus schien mit dem Kind, das nun schnell wuchs und laufen lernte, weicher zu werden, während es auf den Böden, die schon lange die Gewohnheiten von Kindern kannten, taumelte, stolperte oder sich ausstreckte. Herr Philip kam von der Jagd ganz schlammig nach Hause und stürzte in das Kinderzimmer, bevor er seine Stiefel auszog, dann ging er auf alle viere, während Stephen auf seinen Rücken kletterte. Herr Philip tat so, als würde er sich wehren, bockte und sprang und trat wild um sich, sodass Stephen sich an seinen Haaren oder seinem Kragen festhalten und ihn mit seinen kleinen, arroganten Fäustchen schlagen musste. Anna, die von dem seltsamen Trubel angelockt worden war, kam hinzu und zeigte auf den Schlamm auf dem Teppich.
Sie sagte: „Jetzt, Philip, jetzt, Stephen, das reicht! Es ist Zeit für euren Tee“, als wären beide Kinder. Dann streckte Herr Philip die Arme aus, löste Stephen von sich und küsste Stephens Mutter.
3
Der Sohn, auf den sie warteten, ließ lange auf sich warten; er war noch nicht da, als Stephen sieben Jahre alt war. Auch hatte Anna keine weiteren Töchter bekommen. So blieb Stephen der Hahn im Korb. Es ist fraglich, ob ein Einzelkind beneidenswert ist, denn ein Einzelkind neigt dazu, introvertiert zu werden; da es niemanden seiner Art hat, dem es sich anvertrauen kann, neigt es dazu, sich sich selbst anzuvertrauen. Man kann nicht sagen, dass ein siebenjähriges Kind schon mit ernsthaften Problemen zu kämpfen hat, aber es tastet bereits um sich, kann schon kleine Anfälle von Niedergeschlagenheit haben, kann schon darum ringen, das Leben – das begrenzte Leben seiner Umgebung – in den Griff zu bekommen. Mit sieben gibt es kleine Lieben und kleine Hassgefühle, die jedoch einen großen Webstuhl bilden und äußerst beunruhigend sind. Es kann sogar ein vages Gefühl der Frustration vorhanden sein, und Stephen war sich dieses Gefühls oft bewusst, obwohl sie es nicht in Worte fassen konnte. Um damit fertig zu werden, gab sie jedoch manchmal plötzlichen Wutausbrüchen nach und regte sich über alltägliche Kleinigkeiten auf, die sie normalerweise kalt ließen. Es erleichterte sie, mit den Füßen zu stampfen und dann beim ersten Anzeichen von Widerstand in Tränen auszubrechen. Nach solchen Ausbrüchen fühlte sie sich viel fröhlicher und fand es fast leicht, fügsam und gehorsam zu sein. Auf eine vage, kindliche Weise hatte sie dem Leben zurückgeschlagen, und diese Tatsache hatte ihr Selbstwertgefühl wiederhergestellt.
Anna holte dann ihren unruhigen Sprössling zu sich und sagte: „Stephen, mein Schatz, Mama ist nicht wirklich böse – sag Mama doch, warum du dich so aufregst; sie verspricht dir, dass sie versuchen wird, dich zu verstehen, wenn du es ihr sagst ...“
Aber ihre Augen würden kalt blicken, auch wenn ihre Stimme sanft sein könnte, und ihre Hand, wenn sie sie streichelte, wäre zögerlich, unwillig. Die Hand würde sich bemühen, sie zu streicheln, und Stephen wäre sich dieser Anstrengung bewusst. Dann schaute Stephen zu dem ruhigen, lieblichen Gesicht auf und wurde von einer plötzlichen Reue erfüllt, von einem plötzlichen tiefen Gefühl ihrer eigenen Unzulänglichkeit; sie sehnte sich danach, all das ihrer Mutter zu sagen, doch sie stand da sprachlos und sagte kein Wort. Denn die beiden waren seltsam schüchtern miteinander – fast schon grotesk, diese Schüchternheit zwischen Mutter und Kind. Anna spürte das, und durch sie wurde sich Stephen, jung wie sie war, dessen bewusst; so hielten sie ein wenig Abstand, wenn sie sich eigentlich hätten näherkommen sollen.
Stephen, der sehr empfänglich für Schönheit war, sehnte sich vage danach, Ausdruck für ein Gefühl zu finden, das fast Verehrung war und das das Gesicht seiner Mutter in ihr geweckt hatte. Aber Anna, die ihre Tochter ernst ansah und ihr üppiges rotbraunes Haar, die mutigen haselnussbraunen Augen, die denen ihres Vaters so ähnlich waren, wie übrigens der ganze Ausdruck und das ganze Wesen des Kindes, bemerkte, wurde von einer plötzlichen Abneigung erfüllt, die fast an Wut grenzte.
Sie würde nachts aufwachen und über diese Sache nachdenken, sich in einem Anfall von Reue geißeln und sich selbst der Hartherzigkeit und Unmütterlichkeit bezichtigen. Manchmal würde sie langsame, bittere Tränen vergießen, wenn sie sich an den sprachlosen Stephen erinnerte.
Sie dachte: „Ich sollte stolz auf die Ähnlichkeit sein, stolz und glücklich und froh, wenn ich sie sehe!“ Dann kam wieder dieser seltsame Widerstand zurück, der fast Wut war.
Anna kam es vor, als würde sie verrückt werden, denn diese Ähnlichkeit mit ihrem Mann empfand sie als Beleidigung – als wäre der arme, unschuldige siebenjährige Stephen in gewisser Weise eine Karikatur von Herrn Philip, eine fehlerhafte, unwürdige, verstümmelte Kopie – und doch wusste sie, dass das Kind hübsch war. Aber jetzt gab es Momente, in denen ihr das weiche Fleisch des Kindes fast zuwider war; in denen sie es hasste, wie Stephen sich bewegte oder stillstand, eine gewisse Plumpheit hasste, eine gewisse Ungeschicklichkeit in seinen Bewegungen, eine gewisse unbewusste Trotzigkeit. Dann wanderten die Gedanken der Mutter zurück in die Zeit, als dieses Wesen sich an ihre Brust geklammert hatte und sie durch seine eigene Schwäche dazu gezwungen hatte, es zu lieben; und bei diesem Gedanken füllten sich ihre Augen wieder mit Tränen, denn sie stammte aus einer Familie hingebungsvoller Mütter. Das Ding hatte sich wie ein Feind in der Dunkelheit an sie herangeschlichen – langsam, heimtückisch, tödlich; es war stark geworden, so wie Stephen selbst stark geworden war, da es in gewisser Weise ein Teil von Stephen war.
Unruhig hin und her wälzend, betete Anna Gordon um Erleuchtung und Führung; sie betete, dass ihr Mann niemals ihre Gefühle gegenüber seinem Kind ahnen möge. Er wusste alles, was sie war und gewesen war; auf der ganzen Welt hatte sie kein anderes Geheimnis als dieses eine höchst unnatürliche und monströse Unrecht, das stärker war als ihr Wille, es zu zerstören. Und Herr Philip liebte Stephen, er vergötterte sie; es war fast so, als hätte er instinktiv geahnt, dass seine Tochter heimlich betrogen wurde, dass sie eine unverdiente Last trug. Er sprach nie mit seiner Frau über diese Dinge, doch wenn sie die beiden zusammen beobachtete, wurde sie sich jeden Tag sicherer, dass seine Liebe zu dem Kind etwas enthielt, das dem Mitleid sehr nahe kam.
Kapitel 2
1
Ungefähr zu dieser Zeit wurde Stephen sich zum ersten Mal bewusst, dass sie dringend jemanden lieben musste. Sie verehrte ihren Vater, aber das war etwas ganz anderes; er war ein Teil von ihr, er war immer da gewesen, sie konnte sich eine Welt ohne ihn nicht vorstellen – bei Collins, dem Hausmädchen, war das anders. Collins war das, was man „die Zweite von dreien“ nannte; sie könnte eines Tages auf eine Beförderung hoffen. In der Zwischenzeit war sie blühend, vollmundig und vollbusig, für ein junges Mädchen von zwanzig Jahren sogar ziemlich üppig, aber ihre Augen waren ungewöhnlich blau und auffällig, sehr hübsche, neugierige Augen. Stephen hatte Collins zwei Jahre lang beim Treppenfegen beobachtet und war an ihr vorbeigegangen, ohne dass sie ihn bemerkt hatte; aber eines Morgens, als Stephen gerade etwas über sieben Jahre alt war, sah Collins auf und lächelte plötzlich, und in diesem Moment wusste Stephen, dass sie sie liebte – eine erschütternde Offenbarung!
Collins sagte höflich: „Guten Morgen, Fräulein Stephen.“
Sie hatte immer „Guten Morgen, Fräulein Stephen“ gesagt, aber diesmal klang es verführerisch – so verführerisch, dass Stephen sie berühren wollte, und mit einer etwas unsicheren Hand begann sie, ihren Ärmel zu streicheln.
Collins nahm die Hand und starrte sie an. „Oh mein Gott!“, rief sie aus, „was für schmutzige Fingernägel!“ Daraufhin errötete ihre Besitzerin schmerzlich und eilte nach oben, um sie zu reparieren.
„Leg sofort die Schere weg, Fräulein Stephen!“, rief die Krankenschwester mit strenger Stimme, während ihre Schützling noch eifrig mit ihrer Toilette beschäftigt war.
Aber Stephen sagte fest: „Ich putze meine Nägel, weil Collins sie nicht mag – sie sagt, sie seien schmutzig!“
„Was für eine Frechheit!“, schnauzte die Kinderfrau, völlig verärgert. „Ich werde ihr sagen, sie soll sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern!“
Nachdem Frau Bingham endlich die große Schere an sich gebracht hatte, machte sie sich auf die Suche nach der Übeltäterin; sie war nicht jemand, der eine Beeinträchtigung ihrer Würde dulden würde. Sie fand Collins immer noch auf der obersten Treppenstufe und begann sofort, sie zu beschimpfen: „Sie an ihren Platz zu weisen“, wie die Kinderpflegerin es nannte; und sie tat dies so gründlich, dass in weniger als fünf Minuten der „Zweitältesten“ alle Fehler vorgehalten wurden, die eine Beförderung ausschließen könnten.
Stephen stand regungslos in der Tür zum Kinderzimmer. Sie spürte, wie ihr Herz vor Wut und Mitleid für Collins, die kein Wort erwiderte, gegen ihre Brust hämmerte. Dort kniete sie stumm, die Bürste in der Hand, den Mund leicht geöffnet und die Augen voller Angst; und als sie endlich sprechen konnte, klang ihre Stimme demütig und verängstigt. Sie war von Natur aus schüchtern, und die scharfe Zunge der Kinderfrau war im ganzen Haus bekannt.
Collins sagte: „Mich in Ihr Kind einmischen? Oh nein, Frau Bingham, niemals! Ich hoffe, ich weiß, wo mein Platz ist – Fräulein Stephen hat mir selbst die schmutzigen Nägel gezeigt und gesagt: “Collins, sehen Sie nur, sind meine Nägel nicht furchtbar schmutzig!„ Und ich sagte: “Darüber müssen Sie Nanny fragen, Fräulein Stephen.„ Wie könnte ich mich in Ihre Arbeit einmischen? So bin ich nicht, Frau Bingham.“
Oh, Collins, Collins, mit diesen hübschen blauen Augen und diesem lustigen, verführerischen Lächeln! Stephens Augen weiteten sich vor Erstaunen, dann trübten sie sich mit plötzlichen, enttäuschten Tränen, denn weit schlimmer als Collins' armselige Gesinnung war die schreckliche Ungerechtigkeit dieser Lügen – doch gerade diese Ungerechtigkeit schien sie zu Collins hinzuziehen, denn obwohl sie sie verachtete, konnte sie sie dennoch lieben.
Den Rest des Tages grübelte Stephen düster über Collins' Unwürdigkeit nach; und doch wollte sie Collins den ganzen Tag über immer noch, und wann immer sie sie sah, ertappte sie sich dabei, wie sie lächelte, ganz unfähig, den Mut aufzubringen, ihre angeborene Ablehnung zu zeigen. Und Collins lächelte auch, wenn die Krankenschwester nicht hinsah, und sie hielt ihre molligen roten Finger hoch, zeigte auf ihre Nägel und schnitt der Krankenschwester, die sich zurückzog, eine Grimasse. Als Stephen sie beobachtete, fühlte sie sich unglücklich und verlegen, nicht so sehr für sich selbst als für Collins; und dieses Gefühl verstärkte sich, so dass Stephen beim Gedanken an sie ein Schauer über den Rücken lief.
Am Abend, als Collins den Tee servierte, gelang es Stephen, sie allein zu erwischen. „Collins“, flüsterte sie, „du hast nicht die Wahrheit gesagt – ich habe dir nie meine schmutzigen Fingernägel gezeigt!“
„Natürlich nicht!“, murmelte Collins, „aber ich musste doch etwas sagen – das macht Ihnen doch nichts aus, Fräulein Stephen, oder?“ Und als Stephen sie zweifelnd ansah, beugte sich Collins plötzlich vor und küsste sie.
Stephen stand sprachlos vor lauter Freude da, alle ihre Zweifel waren wie weggeblasen. In diesem Moment kannte sie nichts als Schönheit und Collins, und die beiden waren eins, und dieses Eine war Stephen – und doch nicht Stephen, sondern etwas Größeres, für das der Verstand einer Siebenjährigen keinen Namen fand.
Die Kinderfrau kam murrend herein: „Na, beeilt euch, Fräulein Stephen! Steht nicht da wie eine Närrin! Geht euch vor dem Tee das Gesicht und die Hände waschen – wie oft muss ich euch das noch sagen?“
„Ich weiß nicht“, murmelte Stephen. Und tatsächlich wusste sie es nicht; sie wusste in diesem Moment nichts von solchen Kleinigkeiten.
2
Von nun an betrat Stephen eine völlig neue Welt, die sich um Collins drehte. Eine Welt voller aufregender Abenteuer, voller Hochgefühle, voller Freude, voller unglaublicher Traurigkeit, aber dennoch ein schöner Ort, an dem man wie eine Motte, die um eine Kerze tanzt, herumfliegen konnte. Die Tage vergingen wie im Flug; sie glichen einer Schaukel, die hoch über die Baumwipfel schwang, dann in die Tiefe fiel, aber selten, wenn überhaupt, in der Mitte hängen blieb. Und mit ihnen ging Stephen, sich an die Schaukel klammernd, morgens mit einem vagen Gefühl der Aufregung aufwachend – der Art von Aufregung, die eigentlich zu Geburtstagen, Weihnachten und einem Besuch der Pantomime in Malvern gehörte. Sie öffnete die Augen und sprang schnell aus dem Bett, noch zu verschlafen, um sich daran zu erinnern, warum sie sich so beschwingt fühlte; aber dann kam die Erinnerung – sie wusste, dass sie heute tatsächlich Collins sehen würde. Dieser Gedanke ließ sie in ihrem Sitzbad planschen, in ihrer Eile die Knöpfe von ihren Kleidern reißen und ihre Fingernägel so rücksichtslos und energisch reinigen, dass sie sich dabei ziemlich wehtat.
Sie begann, im Unterricht sehr unaufmerksam zu sein, kaute auf ihrem Bleistift herum, starrte aus dem Fenster oder, was noch viel schlimmer war, hörte überhaupt nicht zu, außer auf Collins' Schritte. Die Krankenschwester schlug ihr auf die Hände, stellte sie in die Ecke und nahm ihr die Marmelade weg, aber alles ohne Erfolg; denn Stephen lächelte und hütete ihr Geheimnis umso mehr – für Collins war es die Strafe wert.
Sie wurde unruhig und konnte nicht dazu gebracht werden, still zu sitzen, selbst wenn ihre Kinderfrau ihr vorlas. Früher hatte sie es sehr gemocht, wenn man ihr vorgelesen wurde, besonders aus Büchern, in denen es um Helden ging; aber jetzt weckten solche Geschichten ihren Ehrgeiz so sehr, dass sie sich intensiv danach sehnte, sie selbst zu erleben. Sie, Stephen, wollte jetzt Wilhelm Tell oder Nelson oder die ganze Ladung von Balaklava sein; und das führte dazu, dass sie viel in der Kinderzimmer-Klamottenkiste stöberte, viel nach Kleidungsstücken suchte, die einmal für Scharaden verwendet worden waren, viel prahlte und Lärm machte, viel herumstolzierte und posierte und viel in den Spiegel starrte. Es folgte eine Zeit allgemeiner Verwirrung, in der das Kinderzimmer aussah, als hätte es ein Erdbeben gegeben, und die Stühle und der Boden mit Kleinigkeiten übersät waren, die Stephen herausgesucht, aber wieder verworfen hatte. Sobald sie angezogen war, ging sie jedoch würdevoll davon, winkte die Kinderfrau entschlossen beiseitesprechen und machte sich wie immer auf die Suche nach Collins, den sie möglicherweise bis in den Keller verfolgen musste.
Manchmal spielte Collins mit, besonders mit Nelson. „Meine Güte, du siehst aber gut aus!“, rief sie dann. Und dann zur Köchin: „Komm her, Frau Wilson! Sieht Fräulein Stephen nicht genau wie ein Junge aus? Ich glaube, sie muss ein Junge sein mit diesen Schultern und diesen lustigen, schlaksigen Beinen, die sie hat!“
Und Stephen sagte dann ernst: „Ja, natürlich bin ich ein Junge. Ich bin der junge Nelson, und ich sage: 'Was ist Angst?' Weißt du, Collins – ich muss ein Junge sein, denn ich fühle mich genau wie einer, ich fühle mich wie der junge Nelson auf dem Bild oben.“
Collins würde lachen, ebenso wie Frau Wilson, und nachdem Stephen gegangen war, würden sie sich unterhalten, und Collins könnte sagen: „Sie ist ein seltsames Kind, immer verkleidet und schauspielerisch – das ist lustig.“
Aber Frau Wilson könnte ihre Missbilligung zeigen: „Ich halte nichts von soem Unsinn, nicht für eine junge Dame. Fräulein Stephen ist ganz anders als andere junge Damen – sie hat nichts von ihrer hübschen Art – das ist schade!“
Es gab jedoch Zeiten, in denen Collins mürrisch wirkte, wenn Stephen sich vergeblich als Nelson verkleiden konnte. „Jetzt stören Sie mich nicht, Fräulein, ich habe zu arbeiten!“ oder: „Geh und zeig es der Kinderfrau – ja, ich weiß, dass du ein Junge bist, aber ich habe zu arbeiten. Lauf weg.“
Und Stephen musste völlig niedergeschlagen, seltsam unglücklich und überaus demütig nach oben schleichen und die Kleider, die sie so gerne trug, ausziehen, um sie durch die Kleidungsstücke zu ersetzen, die sie hasste. Wie hasste sie weiche Kleider und Schärpen, Bänder und kleine Korallenperlen und durchbrochene Strümpfe! In Hosen fühlten sich ihre Beine so frei und bequem an; sie liebte auch Taschen, und diese waren verboten – zumindest richtige Taschen. Sie schmollte im Kinderzimmer, weil Collins sie brüskiert hatte, weil sie sich so falsch fühlte, weil sie sich so sehr danach sehnte, jemand ganz Echtes zu sein, statt nur Stephen, die vorgab, Nelson zu sein. In einem rasenden Wutanfall ging sie zum Schrank, holte ihre Puppen heraus und begann, sie zu quälen. Sie hatte diese idiotischen Geschöpfe, die jedoch zu jedem Weihnachtsfest und Geburtstag kamen, immer verachtet.
„Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich!“, murmelte sie und schlug auf ihre harmlosen Gesichter.
Aber eines Tages, als Collins noch wütender als sonst war, schien sie von plötzlicher Reue erfüllt zu sein. „Es ist das Knie meiner Hausmädchen“, vertraute sie Stephen an, „nicht du bist es, sondern das Knie meiner Hausmädchen, mein Lieber.“
„Ist das gefährlich?“, fragte das Kind erschrocken.
Dann sagte Collins, ihrer Klasse treu, „vielleicht – vielleicht muss ich operiert werden, und ich will nicht operiert werden.“
„Was ist das?“, fragte Stephen.
„Na ja, sie würden mich aufschneiden“, jammerte Collins, „sie müssten mich aufschneiden, um das Wasser rauszulassen.“
„Oh, Collins! Was für Wasser?“
„Das Wasser in meiner Kniescheibe – du kannst es sehen, wenn du draufdrückst, Fräulein Stephen.“
Sie standen allein in dem geräumigen Nachtzimmer, wo Collins schlaff das Bett machte. Es war einer dieser seltenen und wunderbaren Momente, in denen Stephen ungestört mit ihrer Göttin sprechen konnte, denn die Krankenschwester war hinausgegangen, um einen Brief zur Postzustellung zu bringen. Collins rollte einen groben Wollstrumpf herunter und zeigte ihr das betroffene Körperteil; es war fleckig und geschwollen und alles andere als attraktiv, aber Stephens Augen füllten sich mit Tränen, als sie mit dem Finger das Knie berührte.
„Da!“ rief Collins, „siehst du die Delle? Das ist das Wasser!“ Und sie fügte hinzu: „Es tut so weh, dass mir ganz schlecht wird. Das kommt alles vom Bodenputzen, Fräulein Stephen; ich hätte den Boden nicht putzen sollen.“
Stephen sagte ernst: „Ich wünschte, ich hätte es – ich wünschte, ich hätte das Knie Ihrer Hausangestellten, Collins, denn dann könnte ich es an Ihrer Stelle ertragen. Ich möchte für Sie schrecklich leiden, Collins, so wie Jesus für die Sünder gelitten hat. Wenn ich ganz fest bete, könnte ich es dann vielleicht bekommen? Oder wenn ich mein Knie an Ihrem reibe?“
„Gott segne dich!“, lachte Collins, „das ist nicht wie die Masern; nein, Fräulein Stephen, das steckt man sich nicht von den Fußböden ein.“
An diesem Abend wurde Stephen ziemlich nachdenklich, und sie schlug das Kinderbuch mit Geschichten aus der Bibel auf und betrachtete das Bild von Jesus am Kreuz, und sie hatte das Gefühl, ihn zu verstehen. Sie hatte sich oft Gedanken über ihn gemacht, da sie selbst Angst vor Schmerzen hatte – wenn sie sich im Garten das Schienbein am Kies aufschürfte, fiel es ihr nicht immer leicht, die Tränen zurückzuhalten – und doch hatte Jesus beschlossen, für die Sünder Schmerzen zu ertragen, obwohl er all die Engel hätte rufen können! Oh ja, sie hatte sich viele Gedanken über ihn gemacht, aber jetzt wunderte sie sich nicht mehr.
Als ihre Mutter sie vor dem Schlafengehen wie üblich ihr Gebet sagen wollte, klangen Stephens Worte nicht sehr überzeugend. Aber nachdem Anna sie geküsst und das Licht ausgeschaltet hatte, betete Stephen aus tiefstem Herzen – so inbrünstig, dass ihr der Schweiß in Strömen lief.
„Bitte, Jesus, gib mir statt Collins die Knie einer Hausmagd – tu es, tu es, Herr Jesus. Bitte, Jesus, ich möchte Collins' ganzen Schmerz so tragen, wie du es getan hast, und ich will keine Engel! Ich möchte Collins in meinem Blut waschen, Herr Jesus – ich möchte so gerne Collins' Retterin sein – ich liebe sie und möchte so leiden wie du; bitte, lieber Herr Jesus, lass es mich tun. Bitte gib mir ein Knie, das ganz voller Wasser ist, damit ich Collins' Operation haben kann. Ich möchte es anstelle von ihr haben, denn sie hat Angst – ich habe überhaupt keine Angst!“
Diese Bitte wiederholte sie, bis sie einschlief, um zu träumen, dass sie auf seltsame Weise Jesus war und dass Collins kniete und ihre Hand küsste, weil sie, Stephen, es geschafft hatte, sie zu heilen, indem sie ihr mit einem Knochenmesser das Knie abgeschnitten und es ihr selbst aufgepfropft hatte. Der Traum war eine Mischung aus Verzückung und Unbehagen und blieb Stephen noch lange in Erinnerung.
Am nächsten Morgen wachte sie mit einem Hochgefühl auf, wie man es nur in Momenten vollkommenen Glaubens empfindet. Aber eine genaue Untersuchung ihrer Knie im Bad ergab, dass sie bis auf alte Narben und eine knusprige, braune Kruste von einem kürzlichen Sturz makellos waren – was natürlich sehr enttäuschend war. Sie zog die Kruste ab, was ein wenig wehtat, aber nicht, da war sie sich sicher, wie ein echtes Dienstmädchenknie. Sie beschloss jedoch, weiter zu beten und sich nicht so leicht entmutigen zu lassen.
Mehr als drei Wochen lang schwitzte und betete sie und nervte den armen Collins täglich mit endlosen Fragen: „Ist dein Knie schon besser?“ „Findest du nicht, dass mein Knie geschwollen ist?“ „Hast du Vertrauen? Denn ich habe ...“ „Tut es weniger weh, Collins?“
Aber Collins antwortete immer gleich: „Es ist nicht besser, danke, Fräulein Stephen.“
Am Ende der vierten Woche hörte Stephen plötzlich auf zu beten und sagte zu Jesus: „Du liebst Collins nicht, Jesus, aber ich liebe ihn, und ich werde ein Hausmädchenknie bekommen. Du wirst schon sehen!“ Dann bekam sie Angst und fügte demütig hinzu: „Ich meine, ich will es doch – das macht dir doch nichts aus, oder, Herr Jesus?“
Der Boden im Kinderzimmer war mit Teppich ausgelegt, was für Stephen natürlich ziemlich unglücklich war; wäre er wie im Salon und im Arbeitszimmer mit Parkett ausgelegt gewesen, hätte er ihr besser zu ihrem Zweck gedient. Trotzdem war es hart, wenn sie lange genug kniete – so hart, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste, wenn sie länger als zwanzig Minuten auf den Knien blieb. Das war viel schlimmer, als sich im Garten die Schienbeine aufzuschürfen; es war sogar viel schlimmer, als eine Kruste abzukratzen! Nelson half ihr ein wenig. Sie dachte: „Jetzt bin ich Nelson. Ich bin mitten in der Schlacht von Trafalgar – ich habe Schüsse in den Knien!“ Aber dann fiel ihr ein, dass Nelson solche Qualen erspart geblieben waren. Trotzdem war es eigentlich ganz schön, zu leiden – es schien Collins jedenfalls viel näher zu bringen; Stephen hatte das Gefühl, dass sie ihr durch diese fleißigen Schmerzen ein Recht auf sie hatte.
Auf dem alten Teppich im Kinderzimmer gab es unzählige Flecken, und Stephen konnte so tun, als würde sie diese reinigen; dabei achtete sie stets darauf, Collins' Bewegungen nachzuahmen, indem sie vor und zurück rieb und dabei ein wenig stöhnte. Als sie endlich aufstand, musste sie ihr linkes Bein halten und humpeln, immer noch ein wenig stöhnend. In ihren Strümpfen waren riesige neue Löcher, durch die sie ihre schmerzenden Knie betrachten konnte, was zu einer Zurechtweisung führte: „Hör auf mit dem Unsinn, Fräulein Stephen! Es ist skandalös, wie du deine Strümpfe zerreißt!“ Aber Stephen lächelte grimmig und machte mit dem Unsinn weiter, von der Liebe zu einer offenen Trotzreaktion angetrieben. Am achten Tag jedoch wurde Stephen klar, dass Collins den Beweis ihrer Hingabe sehen musste. Ihre Knie waren an diesem Morgen besonders zerkratzt, also humpelte sie los, um die ahnungslose Hausangestellte zu suchen.
Collins starrte sie an: „Meine Güte, was ist denn los? Was haben Sie denn gemacht, Fräulein Stephen?“
Dann sagte Stephen, nicht ohne verzeihlichen Stolz: „Ich habe mir ein Hausmädchenknie geholt, genau wie du, Collins!“ Und als Collins dumm und ziemlich verwirrt dreinschaut – „Siehst du, ich wollte dein Leiden teilen. Ich habe viel gebetet, aber Jesus hört nicht auf mich, also muss ich mir auf meine Weise ein Hausmädchenknie holen – ich kann nicht länger auf Jesus warten!“
„Oh, still!“ flüsterte Collins, zutiefst schockiert. „Sie dürfen so etwas nicht sagen: Das ist böse, Fräulein Stephen.“ Aber sie lächelte ein wenig trotz ihrer selbst, dann umarmte sie das Kind plötzlich herzlich.
Trotzdem fasste Collins an diesem Abend ihren Mut zusammen und sprach mit der Krankenschwester über Stephen. „Ihre Knie waren ganz rot und geschwollen, Frau Bingham. Haben Sie jemals so ein seltsames Kind gesehen? Sie hat auch für mein Knie gebetet. Sie ist eine Warnung! Und jetzt versucht sie, sich selbst eines zu verschaffen! Nun, wenn das keine echte Liebe ist, dann weiß ich auch nichts mehr.“ Und Collins begann schwach zu lachen.
Danach stand Frau Bingham auf, so gut sie konnte, und die selbst auferlegte Qual wurde gewaltsam beendet. Collins wurde ihrerseits angewiesen, zu lügen, falls Stephen weiterfragen sollte. Also log Collins edel: „Es ist besser, Fräulein Stephen, es muss Ihr Gebet gewesen sein – sehen Sie, Jesus hat Sie erhört. Ich nehme an, es tat ihm leid, Ihre armen Knie zu sehen – ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich sie gesehen habe!“
„Sagst du mir die Wahrheit?“, fragte Stephen sie, immer noch zweifelnd, immer noch an den ersten Tag ihres jungen Liebesraums denkend.
„Aber natürlich sage ich Ihnen die Wahrheit, Fräulein Stephen.“
Und damit musste Stephen sich zufrieden geben.
3
Collins wurde nach dem Vorfall mit dem Knie der Hausangestellten liebevoller; sie konnte nicht umhin, ein neues Interesse an dem Kind zu empfinden, das sie und die Köchin nun als „seltsam“ bezeichneten, und Stephen sonnte sich in vielen heimlichen Liebkosungen, und ihre Liebe zu Collins wuchs von Tag zu Tag.
Es war Frühling, die Zeit der sanften Gefühle, und Stephen wurde zum ersten Mal bewusst, dass Frühling war. Auf eine stumme, kindliche Weise nahm sie den Duft wahr, und das Haus ärgerte sie zutiefst, und sie sehnte sich nach den Wiesen und den Hügeln, die weiß von Dornenbäumen waren. Ihr lebhafter junger Körper war ständig in Bewegung, aber ihr Geist war in eine Art sanften Dunst gehüllt, den sie nie ganz in Worte fassen konnte, obwohl sie versuchte, Collins davon zu erzählen. Es war alles Teil von Collins, und doch irgendwie ganz anders – es hatte nichts mit Collins' breitem Lächeln zu tun, auch nicht mit ihren roten Händen oder ihren blauen, sehr auffälligen Augen. Doch all das, was Collins ausmachte, Stephens Collins, war auch Teil dieser langen, warmen Tage, Teil der Dämmerung, die hereinbrach und noch stundenlang nach Stephen ins Bett gebracht worden war, Teil, hätte Stephen es nur gewusst, ihrer eigenen lebhaften kindlichen Wahrnehmung. In diesem Frühling war sie zum ersten Mal ganz aufgeregt, als sie den Kuckuck hörte, und stand ganz still da, um zu lauschen, den Kopf zur Seite geneigt; und die Faszination dieses fernen Rufs sollte sie ihr ganzes Leben lang begleiten.
Es gab Zeiten, in denen sie Collins entfliehen wollte, doch dann sehnte sie sich wieder intensiv nach ihrer Nähe, sehnte sich danach, die Reaktion zu erzwingen, nach der sich ihre Liebe verlangte, die ihr jedoch, ganz klug, nur sehr selten gewährt wurde.
Sie sagte: „Ich liebe dich so sehr, Collins. Ich liebe dich so sehr, dass ich weinen könnte.“
Und Collins antwortete: „Sei nicht albern, Fräulein Stephen“, was nicht zufriedenstellend war – überhaupt nicht zufriedenstellend.
Dann könnte, könnte Stephen sie plötzlich vor Wut stoßen: „Du bist ein Biest! Wie ich dich hasse, Collins!“
Und nun blieb Stephen jede Nacht wach, um sich Bilder auszumalen: Bilder von sich selbst in Begleitung von Collins in allen möglichen glücklichen Situationen. Vielleicht würden sie Hand in Hand im Garten spazieren gehen oder auf einem Hügel stehen bleiben, um dem Kuckuck zu lauschen; oder vielleicht würden sie in einem seltsamen kleinen Schiff mit einem Segel aus einem Schafsfuß, wie in einem Märchen, über den blauen Ozean gleiten. Manchmal stellte Stephen sich vor, wie sie allein in einem niedrigen, strohgedeckten Häuschen am Ufer eines Mühlbachs lebten – sie hatte ein solches Häuschen nicht weit von Upton gesehen –, und das Wasser floss schnell und rauschte, und manchmal lagen tote Blätter auf dem Wasser. Dieses letzte Bild war sehr intim und detailreich, bis hin zu den roten Porzellanhunden, die jeweils an einem Ende des hohen Kaminsimses standen, und der laut tickenden Standuhr. Collins saß mit ausgezogenen Schuhen am Kamin. „Meine Füße sind so geschwollen und tun weh“, sagte sie. Dann ging Stephen hin und schnitt reichlich Butterbrote – wie man sie im Salon aß, wenig Brot und viel Butter – und setzte den Wasserkessel auf und kochte Tee für Collins, die ihn sehr stark und fast kochend heiß mochte, damit sie ihn aus der Untertasse schlürfen konnte. In diesem Bild war es Collins, die von Liebe sprach, und Stephen, die sie sanft, aber bestimmt zurechtwies: „Na, na, Collins, sei nicht albern, du bist ein seltsamer Fisch!“ Und doch sehnte sie sich die ganze Zeit danach, ihr zu sagen, wie wunderbar es war, wie Geißblattblüten – etwas sehr Süßes wie das – oder wie Felder, die in der Sonne stark nach frisch gemähtem Heu dufteten. Und vielleicht würde sie es ihr sagen, ganz am Ende – kurz bevor dieses letzte Bild verblasste.
4
In diesen Tagen klammerte sich Stephen noch mehr an ihren Vater, und das lag in gewisser Weise an Collins. Sie hätte nicht sagen können, warum das so war, sie spürte es einfach. Herr Philip und seine Tochter spazierten auf den Hügeln, zwischen Schwarzdorn und jungem grünem Farn, sie gingen Hand in Hand, mit einem tiefen Gefühl der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses.
Sir Philip wusste alles über Wildblumen und Beeren und das Leben von jungen Füchsen, Kaninchen und ähnlichen Tieren. Auf den Hügeln bei Malvern gab es auch viele seltene Vögel, auf die er Stephen aufmerksam machte. Er brachte ihr die einfacheren Gesetze der Natur bei, die ihn, obwohl sie einfach waren, immer mit Staunen erfüllt hatten: das Gesetz des Saftes, der durch die Äste floss, das Gesetz des Windes, der den Saft in Bewegung setzte, das Gesetz des Vogellebens und des Nestbaus, das Gesetz des wechselnden Rufs des Kuckucks, der sich im Juni in „Kuckuck-kuck!“ verwandelte. Er unterrichtete aus Liebe zu seinem Fach und zu seiner Schülerin, und während er so unterrichtete, beobachtete er Stephen.
Manchmal, wenn das Herz des Kindes vor Gefühlen überfloss, musste sie ihm in kleinen, stockenden Sätzen ihre Probleme erzählen. Sie erzählte ihm, wie sehr sie sich danach sehnte, anders zu sein, jemand wie Nelson zu sein.
Sie sagte: „Glaubst du, ich könnte ein Mann sein, wenn ich ganz fest daran denken würde – oder wenn ich beten würde, Vater?“
Dann lächelte Herr Philip und neckte sie ein wenig und sagte ihr, dass sie eines Tages hübsche Kleider haben wolle, und sein Neckerei war immer überaus sanft, so dass es überhaupt nicht wehtat.
Aber manchmal beobachtete er seine Tochter ernst, sein starkes, gespaltenes Kinn fest in die Hand gestützt. Er sah ihr zu, wie sie mit den Hunden im Garten spielte, beobachtete die seltsame Kraft in ihren Bewegungen, die langen Linien ihrer Glieder – sie war groß für ihr Alter – und die Haltung ihres Kopfes auf ihren breiten Schultern. Dann runzelte er vielleicht die Stirn und versank in Gedanken, oder er könnte sie plötzlich rufen:
„Stephen, komm her!“
Sie würde freudig zu ihm gehen und gespannt darauf warten, was er sagen würde; aber wahrscheinlich würde er sie nur einen Moment lang an sich drücken und dann abrupt loslassen. Er würde aufstehen, sich zum Haus und seinem Arbeitszimmer wenden und den Rest des Tages mit seinen Büchern verbringen.
Eine seltsame Mischung, Herr Philip, teils Sportler, teils Student. Er hatte eine der besten Bibliotheken Englands und hatte seit kurzem die Gewohnheit, die halbe Nacht zu lesen, was er bisher nicht getan hatte. Allein in seinem ernst wirkenden, ruhigen Arbeitszimmer öffnete er eine Schublade seines großen Schreibtisches, holte einen dünnen, kürzlich erworbenen Band heraus und las ihn in der Stille immer wieder. Der Autor war ein Deutscher, Karl Heinrich Ulrichs, und beim Lesen wurden Sir Philips Augen verwirrt; dann tastete er nach einem Bleistift und machte sich kleine Notizen an den makellosen Rändern. Manchmal sprang er auf und ging schnell im Zimmer auf und ab, hielt ab und zu inne, um ein Bild anzustarren – das Porträt von Stephen, das Millais im vergangenen Jahr zusammen mit ihrer Mutter gemalt hatte. Er bemerkte die anmutige Schönheit von Anna, die so vollkommen und so vollkommen beruhigend war; und dann diese undefinierbare Eigenschaft von Stephen, die sie in den Kleidern, die sie trug, so unpassend aussehen ließ, als hätten sie und sie kein Recht aufeinander, vor allem aber kein Recht auf Anna. Nach einer Weile schlich er sich ins Bett, wobei er darauf achtete, ganz leise zu gehen, aus Angst, seine Frau zu wecken, die fragen könnte: „Philip, Schatz, es ist schon so spät – was hast du gelesen?“ Er wollte nicht antworten, er wollte es ihr nicht sagen; deshalb musste er ganz leise gehen.
Am nächsten Morgen war er sehr zärtlich zu Anna – aber noch zärtlicher zu Stephen.
5
Als der Frühling immer kräftiger wurde und in den Sommer überging, wurde Stephen bewusst, dass Collins sich veränderte. Die Veränderung war zunächst fast nicht wahrnehmbar, aber der Instinkt von Kindern lässt sich nicht täuschen. Es kam ein Tag, an dem Collins sich ihr gegenüber ziemlich schroff verhielt, ohne dies mit ihrem Knie zu erklären.
„Sei mir nicht immer auf den Fersen, Fräulein Stephen. Folge mir nicht und starre mich nicht ständig an. Ich hasse es, beobachtet zu werden – geh zurück ins Kinderzimmer, der Keller ist kein Ort für junge Damen.“ Danach kam es häufig zu solchen Zurückweisungen, wenn Stephen sich ihr näherte.
Ein elendes Rätsel! Stephens Gedanken tasteten danach wie ein kleiner blinder Maulwurf, der immer in der Dunkelheit lebt. Sie war völlig verwirrt, während ihre Liebe durch die harte Behandlung immer stärker wurde, und sie versuchte, Collins mit Bull's-Eye-Bonbons und Schokoladendrops zu umwerben, die die Magd nahm, weil sie sie mochte. Collins war auch nicht so schuldig, wie sie schien, denn sie war ihrerseits eine Marionette ihrer Gefühle. Der neue Diener war groß und äußerst gutaussehend. Er hatte Collins mit anerkennenden Blicken bedacht. Er hatte gesagt: „Halt diesen verdammten Jungen von dir fern, sonst plaudert sie noch alles aus.“
Und nun verspürte Stephen eine tiefe Verzweiflung, weil sie niemanden hatte, dem sie sich anvertrauen konnte. Sie schreckte sogar davor zurück, es ihrem Vater zu erzählen – er würde es vielleicht nicht verstehen, er könnte lächeln, er könnte sie necken – und wenn er sie neckte, auch noch so sanft, wusste sie, dass sie ihre Tränen nicht zurückhalten könnte. Selbst Nelson war plötzlich ganz distanziert geworden. Was hatte es für einen Sinn, zu versuchen, Nelson zu sein? Was hatte es für einen Sinn, sich noch schick zu machen – was hatte es für einen Sinn, so zu tun als ob? Sie wandte sich vom Essen ab, wurde blass und matt, bis Anna, völlig beunruhigt, den Arzt rief. Er kam und verschrieb eine Dosis Gregory-Pulver, da er nichts Ernstes bei der Patientin feststellen konnte. Stephen trank das widerliche Gebräu ohne ein Wort – fast so, als würde es ihr schmecken!
Das Ende kam, wie so oft, ganz plötzlich, als das Kind allein im Garten war und immer noch verzweifelt über Collins grübelte, der sie seit Tagen mied. Stephen war zu einem alten Geräteschuppen gewandert, und dort sah sie Collins und den Diener; sie schienen sich sehr ernsthaft zu unterhalten, so ernsthaft, dass sie sie nicht hörten. Dann passierte etwas wirklich Schreckliches, denn Henry packte Collins grob am Handgelenk, zog sie zu sich heran, immer noch grob mit ihr umgehend, und küsste sie voll auf den Mund. Stephen wurde plötzlich heiß und schwindelig, sie war von einer blinden, unverständlichen Wut erfüllt; sie wollte schreien, aber ihre Stimme versagte ihr völlig, so dass sie nur stammeln konnte. Doch schon im nächsten Moment hatte sie einen zerbrochenen Blumentopf ergriffen und ihn mit aller Kraft direkt auf den Diener geworfen. Er traf ihn im Gesicht, riss ihm die Wange auf, und das Blut tropfte langsam herunter. Er stand wie betäubt da und tupfte sich vorsichtig die Wunde ab, während Collins Stephen sprachlos anstarrte. Keiner von beiden sagte etwas, sie fühlten sich zu schuldig – und sie waren auch zu sehr erschrocken.
Dann drehte sich Stephen um und floh wild von ihnen. Weg, weg, egal wohin, nur sie dürfe ihn nicht sehen! Sie rannte schluchzend davon, hielt sich die Augen zu und zerriss dabei ihre Kleider an den Büschen, riss sich die Strümpfe und die Haut an den Beinen auf, als sie gegen die Äste stieß, die ihr den Weg versperrten. Doch plötzlich wurde das Kind von starken Armen gepackt, ihr Gesicht wurde gegen das ihres Vaters gedrückt, und Herr Philip trug sie zurück ins Haus und durch den breiten Flur in sein Arbeitszimmer. Er hielt sie auf seinem Knie, ohne Fragen zu stellen, und zuerst kauerte sie dort wie ein kleines stummes Wesen, das sich irgendwie verletzt hatte. Aber ihr Herz war zu jung, um dieses neue Leid zu ertragen – es fühlte sich zu schwer an, zu überlastet, sodass das Leid aus ihrem Herzen sprudelte und sich Herrn Philip anvertraute.
Er hörte ihr sehr ernst zu und strich ihr nur über das Haar. „Ja, ja“, sagte er leise, und dann: „Fahre fort, Stephen.“ Und als sie fertig war, schwieg er einen Moment lang, während er ihr weiter über das Haar strich. Dann sagte er: „Ich glaube, ich verstehe dich, Stephen – diese Sache scheint schrecklicher zu sein als alles, was jemals passiert ist, absolut schrecklich – aber du wirst sehen, dass es vorübergehen und völlig vergessen sein wird – du musst versuchen, mir zu glauben, Stephen. Und jetzt werde ich dich wie einen Jungen behandeln, und ein Junge muss immer mutig sein, denk daran. Ich werde nicht so tun, als wärst du ein Feigling; warum sollte ich, wo ich doch weiß, dass du mutig bist? Ich werde Collins morgen wegschicken; verstehst du, Stephen? Ich werde sie wegschicken. Ich werde nicht unfreundlich zu ihr sein, aber sie wird morgen weggehen, und in der Zwischenzeit möchte ich nicht, dass du sie wieder siehst. Du wirst sie zuerst vermissen, das ist ganz natürlich, aber mit der Zeit wirst du sie vergessen, und diese ganze Aufregung wird dir wie nichts vorkommen. Ich sage dir die Wahrheit, mein Lieber, das schwöre ich dir. Wenn du mich brauchst, denk daran, dass ich immer in deiner Nähe bin – du kannst jederzeit in mein Arbeitszimmer kommen. Du kannst mit mir darüber reden, wann immer du unglücklich bist und jemanden zum Reden brauchst.“ Er hielt inne und schloss dann ziemlich abrupt: „Mach deiner Mutter keine Sorgen, komm einfach zu mir, Stephen.“
Und Stephen, die noch nach Luft rang, sah ihn direkt an. Sie nickte, und Herr Philip sah seine eigenen traurigen Augen aus dem tränenüberströmten Gesicht seiner Tochter zurückblicken. Aber ihre Lippen waren fester zusammengepresst, und die Vertiefung in ihrem Kinn wurde deutlicher, mit einer neuen, kindlichen Entschlossenheit.
Er beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie in absoluter Stille – es war wie das Besiegeln eines traurigen Pakts.
6
Anna, die zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause gewesen war, kam zurück und fand ihren Mann im Flur auf sie wartend.
„Stephen war ungezogen, sie ist oben im Kinderzimmer; sie hatte wieder einen ihrer Wutanfälle“, sagte er.
Obwohl er offensichtlich darauf gewartet hatte, Anna abzufangen, sprach er jetzt ganz locker. Collins und der Diener müssten gehen, sagte er ihr. Was Stephen angeht, habe er schon lange mit ihr gesprochen – Anna solle die Sache einfach auf sich beruhen lassen, es sei nur kindischer Jähzorn gewesen –
Anna eilte nach oben zu ihrer Tochter. Sie selbst war kein unruhiges Kind gewesen, und Stephens Ausbrüche machten sie immer hilflos; dennoch war sie auf das Schlimmste gefasst. Aber sie fand Stephen mit dem Kinn auf die Hand gestützt vor, ruhig aus dem Fenster starrend; ihre Augen waren noch geschwollen und ihr Gesicht sehr blass, aber ansonsten zeigte sie keine großen Anzeichen von Erregung; tatsächlich lächelte sie Anna sogar an – es war allerdings ein eher steifes Lächeln. Anna redete freundlich auf sie ein, und Stephen hörte zu und nickte ab und zu zustimmend. Aber Anna fühlte sich unbehaglich, als ob das Kind sie aus irgendeinem Grund beruhigen wollte; dieses Lächeln sollte beruhigend wirken – es war ein so unkindliches Lächeln gewesen. Die Mutter redete ununterbrochen. Stephen wollte nicht über ihre Zuneigung zu Collins sprechen; zu diesem Thema schwieg sie hartnäckig. Sie entschuldigte ihr Verhalten, dem Diener einen zerbrochenen Blumentopf an den Kopf geworfen zu haben, nicht und verteidigte es auch nicht.
„Sie versucht, etwas zu verbergen“, dachte Anna und war mit jeder Sekunde verwirrter.
Schließlich nahm Stephen ernst die Hand ihrer Mutter und streichelte sie, als wolle sie sie trösten. Sie sagte: „Mach dir keine Sorgen, denn das macht Vater Sorgen – ich verspreche dir, dass ich mich bemühen werde, nicht mehr so aufbrausend zu sein, aber du versprichst mir, dass du dir keine Sorgen mehr machst.“
Und so absurd es auch schien, Anna hörte sich selbst sagen: „Na gut, ich verspreche es, Stephen.“
Kapitel 3
1
Stephen ging nie ins Arbeitszimmer ihres Vaters, um mit ihm über ihren Kummer wegen Collins zu reden. Eine für ein so junges Kind seltsame Zurückhaltung und ein neuer, hartnäckiger Stolz legten ihr die Zunge auf, sodass sie ihren Kampf allein austrug, und Herr Philip ließ sie gewähren. Collins verschwand, und mit ihr der Diener, und an Collins' Stelle kam ein neues zweites Hausmädchen, eine Nichte von Frau Bingham, die noch schüchterner war als ihre Vorgängerin und überhaupt nicht redete. Sie war hässlich, hatte kleine, runde schwarze Augen wie Johannisbeeren – keine neugierigen blauen Augen wie Collins.
Mit zusammengepressten Lippen und angespanntem Hals beobachtete Stephen diese Eindringlingin, wie sie hin und her huschte und Collins' Aufgaben erledigte. Sie saß da und blickte Winefred finster an, während sie sich kleine Quälereien ausdachte, um ihr die Arbeit zusätzlich zu erschweren – zum Beispiel trat sie auf Kehrschaufeln und verschüttete deren Inhalt oder versteckte Besen, Bürsten und Lappen, bis Winefred, abgelenkt, sie schließlich an den unpassendsten Stellen wiederfand.
„Wo sind denn die Putztücher hingekommen?“, murmelte sie, als sie sie unter einem Kinderzimmerkissen entdeckte. Und ihr Gesicht wurde vor Angst und Sorge ganz rot, als sie zu Frau Bingham hinüberblickte.
Aber nachts, wenn das Kind einsam und wach dalag, erschienen ihr diese Handlungen, die ihr am Morgen noch Trost gespendet hatten und aus einer verzweifelten Loyalität gegenüber Collins entstanden waren, trivial, albern und nutzlos, da Collins weder davon wusste noch sie sehen konnte, und die Tränen, die sie den ganzen Tag über zurückgehalten hatte, flossen unter Stephens Augenlidern. Auch konnte sie in diesen einsamen Nachtwachen nicht genug Mut aufbringen, um dem Herrn Jesus Vorwürfe zu machen, der ihr, wie sie glaubte, durchaus hätte helfen können, wenn er ihr eine Hausmagd geschenkt hätte.
Sie dachte: „Er liebt weder mich noch Collins – er will den ganzen Schmerz für sich allein, er will ihn nicht teilen!“
Und dann fühlte sie Reue: „Oh, es tut mir leid, Herr Jesus, denn ich weiß, dass du alle elenden Sünder liebst!“ Und der Gedanke, dass sie Jesus vielleicht Unrecht getan hatte, brachte sie noch mehr zum Weinen.
Es waren wirklich schreckliche Nächte, in denen sie weinte und an dem Herrn und seinem Diener Collins zweifelte. Die Stunden vergingen in unerträglicher Finsternis, die Stephens Körper zu umhüllen schien und ihr mal Hitze, mal Kälte bereitete. Die Standuhr auf der Treppe tickte so laut, dass ihr Kopf von dem unnatürlichen Ticken schmerzte – und wenn sie zu jeder vollen und halben Stunde schlug, schien ihre Stimme das ganze Haus vor Schreck zu erschüttern, bis Stephen unter die Bettdecke kroch, um sich vor etwas zu verstecken, das sie nicht benennen konnte. Aber bald wurde das Kind, zusammengekauert unter den Decken, von einem warmen Gefühl der Geborgenheit beruhigt, und ihre Nerven entspannten sich, während ihr Körper von der schläfrigen Weichheit des Bettes schlaff wurde. Dann plötzlich ein großes und höchst beruhigendes Gähnen, und noch eins, und noch eins, bis die Dunkelheit und Collins und die bedrohlichen hohen Uhren und Stephen selbst sich alle vermischten und zu etwas ganz Freundlichem verschmolzen, zu einem harmonischen Ganzen, weder furchterregend noch zweifelnd – zu der gesegneten Illusion, die wir Schlaf nennen.
2
In den Wochen nach Collins' Abreise versuchte Anna, besonders sanft zu ihrer Tochter zu sein, sie öfter bei sich zu haben und Stephen liebevoll zu streicheln. Mutter und Tochter gingen im Garten spazieren oder wanderten zusammen über die Wiesen, und Anna erinnerte sich an den Sohn aus ihren Träumen, der mit ihr auf diesen Wiesen gespielt hatte. Eine große Traurigkeit trübte für einen Moment ihre Augen, ein unendliches Bedauern, wenn sie auf Stephen hinabblickte; und Stephen, der diese Traurigkeit schnell bemerkte, drückte Annas Hand mit kleinen, ängstlichen Fingern; er wollte unbedingt wissen, was seine Mutter bedrückte, aber seine Schüchternheit machte ihn sprachlos.
Die Düfte der Wiesen bewegten die beiden seltsam – der eigenartige, stechende Geruch der Hundsdaisies, der Butterblumenduft, schwach grün wie das Gras, und dann die Wiesenlilie, die dicht an den Hecken wuchs. Manchmal musste Stephen scharf an der Mutterärmel ziehen – es war unerträglich, diesen intensiven Duft allein zu ertragen!
Eines Tages hatte sie gesagt: „Bleib stehen, sonst tust du ihm weh – es ist überall um uns herum – es ist ein weißer Duft, er erinnert mich an dich!“ Und dann war sie rot geworden und hatte schnell aufgeschaut, ziemlich erschrocken, weil sie befürchtete, Anna würde lachen.
Aber ihre Mutter hatte sie neugierig und ernst angesehen, verwirrt von diesem Wesen, das so voller Widersprüche schien – in einem Moment so hart, im nächsten so sanft, ja sogar zärtlich. Anna war ebenso bewegt wie ihr Kind vom Duft der Mädesüß unter den Hecken; denn darin waren Mutter und Tochter eins, hatten sie doch jeweils das warme keltische Blut in ihren Adern, das solche Dinge wahrnimmt – hätten sie es nur ahnen können, hätten solche einfachen Dinge eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können.
Ein großer Wunsch zu lieben hatte Anna Gordon plötzlich erfasst, dort auf dieser sonnigen Wiese – hatte sie beide erfasst, als sie zusammen standen und die Kluft zwischen Reife und Kindheit überbrückten. Sie hatten sich angesehen, als würden sie um etwas bitten, als würden sie etwas suchen, die eine bei der anderen; dann war der Moment vorbei – sie waren schweigend weitergegangen, sich im Geiste nicht näher als zuvor.
3
Manchmal fuhr Anna mit Stephen nach Great Malvern, um einzukaufen und im Abbey Hotel zu Mittag zu essen, wo es kaltes Rindfleisch und gesunden Milchreis gab. Stephen hasste diese Ausflüge, weil er sich dafür schick machen musste, aber sie ertrug sie wegen der Ehre, die sie empfand, wenn sie ihre Mutter durch die Straßen begleitete, besonders durch die Church Street mit ihrem langen, belebten Hügel, weil man in der Church Street von allen gesehen wurde. Die Hüte wurden mit offensichtlichem Respekt angehoben, während ein bescheidener Finger an die Stirn fliegen könnte, Frauen verneigten sich, und einige machten sogar einen Knicks vor der Dame von Morton – Frauen vom Land mit gesprenkelten Sonnenhüten, die wie ihre Hühner aussahen, und freundlichen Gesichtern wie braune, runzlige Äpfel. Dann musste Anna anhalten, um sich nach Kälbern, Babys und Fohlen zu erkundigen, ja nach allen jungen Geschöpfen, die auf Bauernhöfen gedeihen, und ihre Stimme war sanft, weil sie solche jungen Geschöpfe liebte.
Stephen stand ein wenig hinter ihr und dachte, wie lieb und schön sie war; er verglich ihre schlanken, eleganten Schultern mit dem von der Arbeit verhärteten Rücken der alten Frau Bennett und mit dem hässlichen, gekrümmten Rücken der jungen Frau Thompson, die hustete, wenn sie sprach, und dann „Verzeihung!“ sagte, als wäre sie sich bewusst, dass man vor einer Göttin wie Anna nicht hustet.
Bald würde Anna sich nach Stephen umsehen: „Da bist du ja, Schatz! Wir müssen zu Jackson gehen und Mutters Bücher umtauschen.“ Oder: „Nanny braucht noch Untertassen; lass uns weitergehen und sie bei Langley kaufen.“
Stephen sprang plötzlich stramm, besonders wenn sie die Straße überquerten. Sie schaute nach rechts und links, ob ein imaginärer Verkehr kam, und schob eine Hand unter Annas Ellbogen.
„Komm mit mir“, befahl sie, „und pass auf die Pfützen auf, sonst könntest du nasse Füße bekommen – halt dich an mir fest, Mutter!“
Anna spürte die kleine Hand an ihrem Ellbogen und fand die Finger seltsam stark; sie fühlten sich stark und tüchtig an, wie die von Herrn Philip, und das missfiel ihr immer ein wenig. Trotzdem lächelte sie Stephen an, während sie sich von dem Kind zwischen den Pfützen hindurchführen ließ.
Sie sagte: „Danke, mein Schatz, du bist stark wie ein Löwe!“, und versuchte, das Missfallen aus ihrer Stimme zu verbannen.
Stephen war sehr beschützerisch und vorsichtig, wenn sie mit ihrer Mutter allein unterwegs war. Nicht einmal ihre seltsame Schüchternheit konnte sie davon abhalten, sie zu beschützen, und auch Annas eigene Schüchternheit konnte sie nicht vor seiner Fürsorge bewahren. Sie musste sich einer stillen Aufsicht unterwerfen, die akribisch, sanft, aber äußerst beharrlich war. Und doch war das Liebe? fragte sich Anna oft. Es war sicher nicht die vertrauensvolle Hingabe, die Stephen immer für ihren Vater empfunden hatte; es war eher eine Art instinktive Bewunderung, gepaart mit einer großen, geduldigen Güte.
„Wenn sie nur mit mir so reden würde wie mit Philip, könnte ich sie vielleicht verstehen“, sinnierte Anna. „Es ist so gelegentlich, nicht zu wissen, was sie fühlt und denkt, zu vermuten, dass sie immer etwas im Hinterkopf hat.“
Die Heimfahrt von Malvern verlief meist schweigend, denn Stephen hatte das Gefühl, ihre Aufgabe sei erfüllt, ihre Mutter brauche ihren Schutz nicht mehr, jetzt, wo der Kutscher für sie beide sorgte – er und die arrogant aussehenden grauen Kutschpferde, die doch so gut erzogen und sanftmütig waren. Anna seufzte und lehnte sich in ihrer Ecke zurück, müde vom Versuch, ein Gespräch zu führen. Sie fragte sich, ob Stephen müde oder nur mürrisch war, oder ob das Kind vielleicht doch dumm war. Sollte sie vielleicht Mitleid mit dem Kind haben? Sie konnte sich nie ganz entscheiden.
Währenddessen genoss Stephen die bequeme Kutsche und begann, sich kaleidoskopischen Gedanken hinzugeben, solchen Gedanken, die zum Ende des Tages gehören und gelegentlich Kinder besuchen. Frau Thompsons gekrümmter Rücken sah aus wie ein Bogen – nicht wie ein Regenbogen, sondern wie ein Bogenschützenbogen; wenn man eine gespannte Sehne von ihren Füßen bis zu ihrem Kopf spannen würde, könnte man dann mit Frau Thompson gerade schießen? Porzellan-Hunde – bei Langley gab es schöne Porzellan-Hunde –, die erinnerten einen an jemanden; ach ja, natürlich, Collins – Collins und ein Cottage mit roten Porzellan-Hunden. Aber man versuchte, nicht an Collins zu denken! Es lag so ein seltsames Licht über den Hügeln, eine Art goldener Glanz, und man wurde ganz traurig – warum sollte man traurig werden, wenn ein goldener Glanz so auf die Hügel schien? Milchreis, fast so schlimm wie Tapioka – aber nicht ganz, denn er war nicht so schleimig – Tapioka entzog sich allen Bemühungen, ihn zu kauen, er schmeckte furchtbar, als würde man auf seinem eigenen Kaugummi herumkauen. Die Gassen rochen nach Feuchtigkeit, ein wunderbarer Geruch! Doch wenn Nanny die Wäsche wusch, roch sie nur nach Seife – aber natürlich wusch Gott die Welt ohne Seife; als Gott brauchte er vielleicht keine – du brauchst viel, besonders für die Hände – wusch Gott seine Hände ohne Seife? Mutter, die von Kälbern und Babys sprach und aussah wie die Jungfrau Maria in der Kirche, die mit Jesus im Buntglasfenster, die dich an die Church Street erinnerte, die doch gar nicht so schlecht war; die Church Street war eigentlich ziemlich aufregend – wie lustig musste es für Männer sein, Hüte zu haben, die sie abnehmen konnten, anstatt nur zu lächeln – ein Melone musste viel lustiger sein als ein Leghorn – den konnte man Mutter nicht abnehmen –