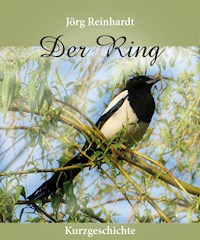Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Parlez Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DIE WEGE WISSEN MEHR ÜBER IHRE ZIELE ALS DIE MENSCHEN, DIE AUF IHNEN UNTERWEGS SIND. Die Verrückten sind los im Fontaneland und treiben dort, in der wunderschönen Landschaft zwischen Berlin, Kyritz, Lindow und Kremmen, ihr Unwesen. Die Berliner Freunde Eigenbrodt und Bentheim – recht schräge Vögel – geraten unversehens in den Strudel der abenteuerlichen Jagd nach der GOLDENEN TROMPETE DER PRIGNITZ. Und da jagen viele: allen voran der Verwandlungskünstler Querkenbeck, der seinen Widersachern aus dem Russenclan zuvorkommen möchte (woran ihn aber die Größe seiner Ohren hindert). Im Clan selbst kocht vor allem die rattenscharfe Natascha ihr eigenes Süppchen. Eher hilflos in diesem Strudel der Kyritzer Kommissar Nattermann und gänzlich hilflos der Kremmener "Journalist" Nick Nottenwald, Nataschas Lover. Ein irres Treiben – voller überraschender Wendungen, in augenzwinkernder Grundstimmung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÖRG REINHARDT UND FRANK MÜLLER
EIGENBRODT UND BENTHEIM
in:
QUERKENBECK UND DIE GOLDENE TROMPETE
Eine brandenburgische Kriminalgroteske
Impressum:
© Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© Parlez Verlag 2021
ein Projekt der Bluecat Publishing GbR
Gneisenaustraße 64
10961 Berlin
www.parlez-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Wort Union
Autoren: Frank Müller und Jörg Reinhardt, Berlin
Covergestaltung: Norma Vohland
Coverbilder: Наталья Дьячкова, ngupakarti und Elena (stock.adobe.com)
ISBN: 978-3-86327-071-1
Vorbemerkung
Dies ist wahrhaftig eine völlig verrückte Kriminalgeschichte. Oder vielleicht nur ein verkorkster Heimatroman? Egal:
Die Protagonisten, Eigenbrodt und Bentheim, scheinen nicht alle Tassen im Schrank (!) zu haben.
Den Stein ins Rollen bringt ein Riesenbaby mit Segelohren durch seine Weihnachtsansprache über das Trompetenrohr.
Die Prignitz sucht die goldene Trompete.
Und tötet dafür.
Absurde Russen mischen mit.
Der ermittelnde Kommissar war einst ein sprechender Scheibenwischer.
Alle Spuren führen ins Luch.
Natascha.
Der Schrank (!).
Klingt so, als müsste man anfangen zu lesen.
1
HAFENFÜHRUNG, BLÖDELZEIT,
WENN AM BODEN BENTHEIM SCHREIT.
Die Sache begann an einem Freitagabend in einer Kneipe irgendwo in Brandenburg, als Eigenbrodt und Bentheim alles von Belang gesagt hatten und zum Blödeln übergingen. Eigenbrodt hatte sich schon öfter mit der Vorstellung beschäftigt (und dabei halblaut in sich hineingelacht), man müsste sich einmal ohne jede Sachkenntnis als Pseudo-Fachmann unter Experten mischen und so tun, als ob man von einer komplexen Materie viel verstünde. Es gehe keinesfalls darum, begann er Bentheim seine Idee zu erläutern, tatsächlich vorhandene Fähigkeiten für eine Amtsanmaßung zu nutzen, sondern vielmehr darum, gutgläubige Menschen, die keinerlei Täuschung erwarteten, durch völlige Planlosigkeit und Inkompetenz, die im Gewand der Kennerschaft daherkamen, zu verwirren.
Bentheim horchte auf. Das gefiel ihm.
„Ich habe neulich im Fernsehen eine Doku über den Hamburger Containerhafen gesehen“, fuhr Eigenbrodt fort. „Ich stelle mir mit dem größten Vergnügen vor, wie wir zwei uns dort als Fachleute für Hafenführungen zur Verfügung stellen.“ Bentheims Augen begannen zu leuchten, während Eigenbrodt den Gedanken weiter ausspann. „Wir übernehmen eine Gruppe internationaler Containerhafencracks, die eigens nach Hamburg kommen, um sich über den neuesten Stand der Technologie zu informieren. Die müssen uns zunächst für absolut seriös halten und an unseren Lippen kleben. Etwaige Zweifel an unseren Ausführungen, so abwegig und mit wirren Haaren vorgetragen sie auch sein mögen, dürfen nur sehr langsam entstehen.“
Bentheim konnte sich für das Vorhaben immer mehr begeistern. „Ich könnte“, setzte er das Drehbuch fort, „ein paar Meter hinter der Gruppe, die dir aufmerksam lauscht, über ein gut markiertes Kabel stolpern und ganz fürchterlich zu schreien beginnen.“
„Ja“, sagte Eigenbrodt, „das ist gut, und ich werde sie gleich beruhigen mit der Feststellung, dass hier unten schon viele schwer gestürzt sind, aber anschließend in der Krankenstation Geesthacht gut versorgt wurden.“
Bentheim bestellte zwei Biere. „Auf mich.“
„Sie werden natürlich Fragen haben“, Eigenbrodt schien sich das Szenarium genau vorzustellen. „Ich werde dann unter ständigem Kopfnicken wahllos an Knöpfen drehen und dazu werbend anmerken: ‚Ja, die allerneueste Technik auf diesem Gebiet.‘ Es kommen sicher richtige Kollegen vorbei, die das Ganze für echt halten und kurz stehen bleiben. Sie werden beifällig nicken und alle Japaner in der Gruppe ebenso. Das Bemühen um sozialen Zusammenhalt wird stärker sein als die Sorge um das knirschende Geräusch hinter einer Wand.“
„Und um den nunmehr permanent stürzenden und schreienden anderen Gruppenleiter“, ergänzte Bentheim, vom Lachen bereits tränenüberströmt.
„Ja“, lachte auch Eigenbrodt, „so soll es sein.“
2
IST AUCH KLEBI SONDERBAR,
BENTHEIM MACHT DIE SACHE KLAR.
Hamburg schwirrte Bentheim in den nächsten Tagen im Kopf herum. Er hatte dort eine kurze, aber intensive Zeit verlebt und mit wachsender Begeisterung erinnerte er sich an die WG im Karolinenviertel, wo man eigentlich nur zwischen zwei Saufexzessen hinging, um gepflegt in Ohnmacht zu fallen. Und er erinnerte sich an Klebi, damals eine Größe auf dem Kiez, der sich auf Einbrüche in Villen spezialisiert hatte. Seinen Spitznamen verdankte er der Neigung, Bewohnern von Häusern, die er nachts besuchte und die sich dort zufällig und unerwünscht aufhielten, den Mund mit Sekundenkleber zu verschließen. Klebi war ein Mann mit vielen Talenten und vor allem mit Kontakten.
Das alles war gefühlte hundert Jahre her und er fand, dass es an der Zeit wäre, nach Hamburg zu fahren und Klebi zu besuchen. So einer bleibt seinem Metier treu. Er war entweder tot oder saß in seiner reichlich bemessenen Freizeit im ‚Froschauge‘.
„Mensch, das is’ doch der fiese Bentheim. Mann, siehst du scheiße aus.“
„Danke, Klebi, ich freue mich auch, dich zu sehen.“
Die Kneipe war noch an Ort und Stelle auf St. Pauli. Nur dass man jetzt gleich am Eingang auf eine klebrige, zentimeterhohe Dreckschicht trat. Früher war dieser Belag den Klos vorbehalten gewesen. Dafür war seit damals nicht gelüftet worden. Durch den Zigarettenqualm konnte man mit Mühe den Tresen sehen, der von einem Deckenstrahler matt ausgeleuchtet wurde. Klebi war der einzige Gast um 10 Uhr morgens. Er saß auf seinem alten Platz an der Ecke des Tresens. Nachdem sich Bentheims Augen an das trübe Licht und seine Nase an den Gestank gewöhnt hatten, stellte er sich neben die einstige Kiezgröße, die nichts mehr hatte, was an ihre glorreiche Vergangenheit erinnerte. ‚Abgeranzt‘ würde Eigenbrodt sagen, der für solche Erscheinungsbilder ein ganz besonderes Vokabular in petto hatte.
„Muss dich ja nicht fragen, wie’s dir geht, hast du ja am Telefon durchblicken lassen“, sagte Bentheim, der irgendjemanden suchte, von dem er einen Kaffee bekommen konnte. Klebi registrierte immer noch alles ganz genau und brüllte: „Emma, Schlampe, antreten, Kundschaft!“
Aus irgendeinem geheimen Winkel der Kneipe schleppte sich eine Frau heran, deren Alter zwischen 18 und 80 alle Wetten zuließ. Das Gesicht war unter einer Matte strähniger Haare versteckt und den Rest des Körpers, der sich mühsam hinter den Tresen zwängte, steckte in einem sackartigen Gebilde, das man nicht unbedingt als Kleidung bezeichnen konnte.
Bentheim murmelte etwas von Kaffee, was die Frau hinter dem Tresen auf einen Thermoturm drücken ließ, wodurch eine blassbraune Brühe in eine ehemals weiße Tasse befördert wurde. Bentheim nickte dankend, verzichtete aber auf eine Kostprobe.
„Nu’ aber mal Butter bei de Fische“, Klebi zündete sich eine Zigarette an und zog durch. „Hab’ das am Telefon nich’ ganz verstanden, wat wollt ihr da abzieh’n?“
Bentheim hatte vorgearbeitet. Logistik war sein Ding, Eigenbrodt war nur für den Wahnsinn zuständig. Also hatte er Klebi im Kiez ermittelt. Das war nicht schwer gewesen, sein Ruf war legendär. Denn so viele Villen in Blankenese hatten noch nicht mal die ältesten Pizzalieferanten von innen gesehen.
Die Telefonnummer war schon schwieriger zu bekommen gewesen. Da hatte ihm der Portier des kleinen Hotels geholfen, in dem er abgestiegen war. Der hatte einen Freund und dessen Bruder und so weiter und so weiter ... So kam es zu einer fernmündlichen Vorabinformation und zum Treffen mit Klebi, der die notwendigen Beziehungen hatte, um das Projekt ‚Hafengaudi‘, wie es Bentheim getauft hatte, nicht an Formalitäten scheitern zu lassen.
Er erklärte ihm das ganze Vorhaben noch einmal persönlich.
„Ihr habt doch einen an der Kerze! Ihr seid doch total durch die Leuchte. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das bringt Ärger und nich’ einen müden Cent. Geh ma’ zum Arzt, du Flachwichser.“ Dann begann ein Vortrag über Kontrollen, Sicherheitssysteme, Wachleute und die damit verbundenen Gefahren, den Bentheim erwartet hatte.
Nach etwa fünf Minuten unterbrach er: „Klebi, komm auf den Punkt.“
„Ihr braucht ’ne Plastikkarte. Mit euern Namen drauf. Am besten von ’ner großen Reederei, damit die Namen bei ’ner Kontrolle nich’ in irgend ’nem Schädel stecken bleiben. Obwohl, Eigenbrodt, weiß nich’, wie bescheuert is’ das denn? Wer heißt’n so?“
Bentheim fand den Namen seines Freundes auch ziemlich belastend, aber wer konnte etwas für dieses Elend? Er hatte Fantasienamen in Erwägung gezogen, aber bei einer Prüfung der Betriebsausweise wäre es nicht schlecht, echte Personalpapiere vorweisen zu können.
„Ist nun mal so“, erwiderte Bentheim, „müssen wir mit leben.“
Er hatte auch schon hundert Visitenkarten drucken lassen. Ganz knapp, dezentes Weinrot mit nüchternem weißem Schriftbild „Bentheim und Eigenbrodt“, darunter etwas größer „Discovery Agency“, und in der dritten Reihe seine Handynummer. Es hatte verhaltenen Protest von Eigenbrodt gegeben, der das nicht originell fand.
„Wäre dir ‚Bentbrodt‘ oder ‚Eigenheim‘ lieber gewesen?“ Damit war für ihn die Sache erledigt.
Klebi stürzte seinen letzten einstelligen Wodka des Morgens hinunter. „Wat is’ euch der Spaß denn wert?“, fragte er.
„Sag was“, forderte Bentheim ihn auf.
„200 sollten drin sein.“
„Klebi, Klebi, wo sind deine guten Manieren? Einem alten Kumpel die Kohle aus der Tasche ziehen. Für einen lausigen Kontakt.“
„Alter Kumpel, dass ich nich’ lache“, schnaubte Klebi. „Das warst du noch nich’ mal vor hunnert Jahren.“
„Hälfte“, schlug Bentheim vor.
„150! Letztes Angebot, is’ ’ne Menge Risiko.“
„Aber wohl nicht deins“, sagte Bentheim versöhnlich. „Gut, aber schnell muss das gehen.“
„Momang“. Klebi stand auf und verzog sich an die andere Ecke des Tresens, tippte ein paar Mal auf seinem Handy herum und wartete. Dann nahm er einen Anruf entgegen, deckte den Hörer kurz ab und brüllte durch die Kneipe:
„Hasse Passfotos dabei?“
„Klar!“, brüllte Bentheim zurück.
Nach knapp einer Minute saß Klebi wieder neben ihm und der erste zweistellige Wodka des Tages floss durch seine Kehle.
„Und?“, fragte Bentheim. „Wann, wer und wo?“
„Kohle!“, Klebi hielt die Hand auf.
„Hälfte jetzt, Hälfte nach Erhalt“, sagte Bentheim, zählte 75 Euro ab und legte die Passfotos obendrauf.
„Heute Abend, hier is’ die Adresse.“ Klebi schob ihm einen Zettel mit einem Namen und einer Anschrift hin.
„Mann, mitten im Superviertel, wer öffnet die Tür?“
„Paula. Und danach kommst du her und bringst den Rest der Kohle. Wenn nich’, dann hol ich den Kleber und besuch dich zuhause.“
Dass man diesen Bezirk im Osten Hamburgs nicht unbedingt als Favorit bei der Wohnungssuche auf der Liste hatte, konnte Bentheim nachvollziehen. Mehrmals taxierten ihn auf dem Weg zum Haus der geheimnisvollen Paula kräftige, junge Männer und durchleuchteten ihn mit Röntgenblicken. Dass es noch nicht vollständig dunkel war, schien hier keinen direkten Einfluss auf die Überlebenschancen eines Ortsfremden zu haben.
Er hatte sich die drei Stockwerke im Hinterhaus hochgearbeitet, wobei er ab und zu stehen bleiben musste, um den Brechreiz zu unterdrücken, den das Gemisch strenger Gerüche verursachte. An einer pink gestrichenen Tür klingelte er und was dann im Türrahmen erschien, war mit dem Wort ‚ausfüllend‘ nur unzulänglich beschrieben. Das Geschlecht des Wesens, das im Zwielicht der Funzeln im Treppenhaus und im Hausflur erschien, war nicht zu bestimmen. Ganz sicher war, dass sich der Körper weiter nach hinten in den Flur hinein ausdehnte. Aus der Gestalt piepste es plötzlich schrill: „Ah, der Bentheim. Komm rein, Schnucki.“ Dann drehte sich die Masse und Bentheim überlegte kurz, ob er wieder gehen sollte.
„Mach die Tür hinter dir zu, Schnucki, wir geh’n gleich mal ins Büro.“
Er hörte auf zu überlegen, schritt tapfer über die Schwelle, schloss die Wohnungstür und folgte dem Fleischberg, der in einer Art Bademantel steckte, durch einen langen Flur.
„Da hast du ja Glück gehabt“, zwitscherte es von vorne, „dass ich heute so einen Stapel Plastikkarten vorbereiten musste. Irgendeine Schwachmatentruppe aus Norwegen oder so. Da hat der Klebi gesagt, für den guten, alten Bentheim könnte ich ja zwei Stück abzwacken. Immer gut, wenn man Leute wie mich hat, was Schnucki? Der Klebi ist ja auch ’n ganz Lieber, der tut mir ja auch ab und zu einen Gefallen.“
Bentheim wollte nicht wissen, womit Klebi Paula gefällig war. Stattdessen konzentrierte er sich auf den Weg und darauf, nicht von Gegenständen getroffen zu werden, die sie im Vorbeigehen umwarf.
„So, Schnucki, da wären wir.“ Sie stieß die Tür zu einem Zimmer am Ende des Flurs auf, aus dem gedämpftes rotes Licht schien, welches von einem Halstuch erzeugt wurde, das jemand über eine Stehlampe geworfen hatte.
Paula walzte an einem überdimensionalen Bett vorbei ans Fenster, vor dem ein kleiner, mit Bergen von Papieren bedeckter Tisch stand. Sie beugte sich darüber und baggerte mit ihren Schaufelhänden durch den Wust, wodurch sie die Unordnung noch ein wenig mehr durcheinanderbrachte. Dann zog sie mit einer erstaunlichen Feinmotorik zwei laminierte Kärtchen hervor und hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. Bentheim hatte sich zwischen Bett und Schrank bis zu ihr herangekämpft, als sie sich umdrehte und er zum ersten Mal ihre Vorderseite sah. Das Gesicht hatte eindeutig hündische Züge, eine Mischung aus Bulldogge und Boxer, der Rest des Körpers blieb, dankenswerterweise, unter dem überdimensionierten Bademantel verborgen.
Sie schaute auf die Plastikkarten und entblößte mit einem Grinsen eine Reihe von Zähnen, die unregelmäßig und gelb waren und durchaus dem ersten Eindruck von ihrem Gesicht entsprachen.
„Das bist du“, piepste sie und tippte mit dem Daumen auf eine Karte. „Und der andere ist dann wohl“, sie sah konzentriert auf das eingestanzte Namensfeld, „ist dann wohl Eigenbrodt. Meine Fresse, was ein bescheuerter Name, ist der echt?“ Ohne seine Antwort abzuwarten, piepste es weiter: „Sag mal, sieht der wirklich so aus? Der Name passt. Hihihi, Bernd, das Eigenbrot, hihihi.“
Bevor sie sich nicht mehr halten konnte, wollte Bentheim den Rückzug antreten. „Tja, das wäre es dann, du hast ja alles mit Klebi besprochen.“
„Ja, der Klebi, is’n ganz Süßer, auf den kann man sich verlassen.“
„Ja“, Bentheim wurde nervös, „finde ich auch. Dann nehme ich mal die kleinen Kärtchen und mache mich vom Acker, ich habe noch einen Termin.“
„Klar, Schnucki, du hast da noch einen Termin“, sagte Paula, warf die Karten auf den Tisch zurück und versetzte ihm einen Stoß an die Schulter. Ein kleiner Schubser für Paula, ein großer Treffer für Bentheim. Er landete rücklings auf dem Bett.
„Du hast einen wichtigen Termin mit mir“, kam es gar nicht mehr so piepsig aus dem Mund, der jetzt eine rote, schlabbernde Schlange entließ. Mit einer nie erwarteten Behändigkeit riss sich Paula den sie umhüllenden Stoffballen vom Leib. Bentheim dachte mehrere Dinge gleichzeitig: ‚Ich werde blind‘, ‚Klebi, du alte Sau‘, ‚Eigenbrodt, das kannst du nie wieder gut machen‘, und bevor er auch nur eine Abwehrbewegung machen konnte, fiel ein Gebirge auf ihn und es wurde Nacht.
3
WAS BEI NACHT NOCH LUSTIG KLANG,
MACHT DAS HERZ BEI LICHTE BANG.
Eigenbrodt wusste zunächst von all diesen Vorgängen nichts. Er war ohnehin nicht allzu sehr auf der logistischen Schiene unterwegs. Außerdem ging er seiner bevorzugten Tätigkeit und gleichzeitig Belustigung nach: dem Ergänzen von Fernsehbildern und -tönen durch nicht begründbare Zutaten. Diese hatten rein gar nichts mit der dargebotenen Handlung zu tun, konterkarierten sie auch nicht in irgendeiner nur entfernt logischen Weise, sondern bildeten ein komplett eigenständiges Randgeschehen. So amüsierte er sich köstlich über die unsichtbare (für ihn aber nahezu greifbare) Vorstellung, dass in dem gerade eingeschalteten Krankenhausfilm, in dem sich zwei Ärzte ganz seriös über Behandlungsmethoden austauschten, am Rande des Bildausschnitts (wie zufällig eingefangen) jemand im Gang zusammengeschlagen wurde: grundlos, zusammenhanglos, von den Hauptakteuren unkommentiert. Auch geografische Dokus eigneten sich für diese Art fantasievoller Bearbeitung: im Vordergrund eine herzensgute Leiterin einer Tierklinik für bedrohte Arten, die ihrem Gesprächspartner mit leicht zitternder Oberlippe Rede und Antwort steht, im Hintergrund (unthematisiert) ein Passant, dem ein schwerer Gegenstand ins Genick fällt, vielleicht auch mehrere. Eigenbrodt kicherte vor sich hin, er fühlte sich wohl, und hätte stundenlang abartige Bilder in andere Bilder ‚hineinsehen‘ können. Köstlich! Das schönste Genre: der sinnlose Film. Wenn der Wirklichkeit schon nicht mit Vernunft beizukommen war, dann doch aber mit Unvernunft! Einmal, Eigenbrodt erinnerte sich mit Wohlwollen, hatte ein Spaßvogel im Fernsehen Ernst mit dieser Kunstform gemacht: Er hatte sich als Journalist ausgegeben und eine der damals wichtigsten SPD-Politikerinnen interviewt. Das Interview nahm einen durchaus geordneten und sinnhaften Verlauf, nur dass der Journalist zwischen seinen Fragen Tabletten einzunehmen begann. Das wirkte zunächst normal: eine Tablette oder auch zwei (die für die Gesundheit wichtig zu sein schienen), gerne sicher auch mal drei oder vier ... Es muss etwa die zehnte gewesen sein, als die Politikerin, die vorher konzentriert geantwortet hatte, unruhig zu werden begann. Sie bestritt noch zwei, drei Antworten etwas fahriger als zuvor, und als der Fragende dann wieder Tabletten einwarf, verlor sie völlig die Fassung, brach ab mit dem für Eigenbrodt unvergesslichen Ruf: „Was nehmen Sie denn hier ständig für Tabletten ein?“ Wunderbar.
Es klingelte an der Tür. Leicht genervt öffnete Eigenbrodt. Es war Bentheim, der von seiner Hamburger Mission zurückkehrte. Eigenbrodt, mit schief sitzender Brille und leicht wirren Haaren, sah ihn verblüfft an, als habe er ihn bei der Teilnahme an einer antiken Tragödie gestört: „Du?“ Bentheim trat unaufgefordert ein und sprach noch im Gehen über die Schulter zu Eigenbrodt, der wirkte, als habe er die Ankunft noch nicht realisiert: „Na sicher ich, oder dachtest du, die Eintrittskarten zu deiner Scheiß- Hafenbesichtigung fallen vom Himmel? Ich wäre fast unter 90-G-Glocken erstickt deswegen.“ Er setzte sich, Eigenbrodt wandte sich langsam um und begann, der Blick noch etwas starr, die neue Situation zu begreifen.
„Hafenbesichtigung“, sagte er leicht somnambul mehr ins Leere als zu Bentheim. Der reagierte zunehmend gereizt, schien doch sein voller Einsatz in Hamburgs Osten nicht die rechte Resonanz zu finden. Er fischte die zwei Zauberkarten aus seiner Jacke und wedelte damit herum: „Hier!“ Als Eigenbrodt nicht gleich reagierte, legte er nach: „Damit wird man vor uns auf die Knie fallen im Containerhafen, alle Türen öffnen und nun kommst du ...“ Eigenbrodt erwachte nur langsam aus seiner Lethargie. Er hatte die Szene der absurden Führung durch einen der modernsten Containerhäfen der Welt, von dem sein Freund und er nicht das Geringste verstanden, mehrfach in seiner Fantasie durchgespielt. Er hatte all das erzählt, mit Verve, mit großer Vorstellungskraft, und unter ansteckendem Gelächter – man hätte fast meinen können, man sei real mit einer verwunderten Expertengruppe im Containerhafen unterwegs. Aber nun schlug das Ganze in tatsächliches Handeln um und diese Erkenntnis irritierte Eigenbrodt. Er war nicht sicher, ob der absurde Humor der wahnwitzigen Führung vor der Wirklichkeit einer Aktion in Hamburg Bestand haben würde. „Du hast also tatsächlich -“, wandte er sich nun direkt an Bentheim, der ihn aber barsch unterbrach: „Ich habe mir tatsächlich den Allerwertesten aufgerissen, um diese Eintrittskarten zu organisieren.“ Er wedelte erneut damit herum. Eigenbrodt war unschlüssig, wie er reagieren sollte. Eigentlich hätte er am liebsten weiter ferngesehen und imaginäre Bilder produziert, aber die Entschlossenheit seines Freundes begann zu wirken. Vielleicht würde ja die Begegnung mit dem realen Ort des Geschehens ...
4
... SCHAUN UNS AN UND WISSEN DANN,
WO MAN PLANLOS BLÖDELN KANN.
Eigentlich hatte er unangemessen reagiert. Als Eigenbrodt in dieser unnachahmlichen und komplizierten Art anfing zu faseln, denn das tat er gerne zu solchen Anlässen, faseln, war Bentheim einfach gegangen. Die Hamburger Episode war gerade mal 48 Stunden her und er hatte in dieser Zeit versucht, psychische Folgeschäden erst gar nicht zuzulassen. Sein körperlicher Zustand würde sich normalisieren. An Geschlechtsverkehr wäre eine Zeit lang nicht mal zu denken, aber die Blutergüsse und eine leichte Rippenprellung würden sich von selbst regulieren. Schwieriger war es, den penetranten Geschmack im Mund zu bekämpfen. Starke Pfefferminzpastillen schienen sich langsam auf seine Darmflora auszuwirken, also saß er jetzt in einer Kneipe in der Nähe des Hauptbahnhofs und versuchte es mit einer Doppelkorntherapie.
Schon auf der Rückreise hatte er das Gefühl gehabt, dass das ganze Unternehmen zwar interessant, aber irgendwie doch sehr schwammig war. Sie hatten nun die Eintrittskarten zum Hafen, aber wie hatte sich Eigenbrodt das eigentlich vorgestellt? Wie sollte man an die Klienten kommen? Und wenn man so absurde Dinge machte, würde dann nicht doch irgendwann der Sicherheitsdienst kommen und die ‚Spezialisten‘ vom Hof jagen? Oder gleich die Bullen und dann ab in die Klapse?
Bentheim war klar, dass das ganze Projekt zu viel Planung erforderte. Selbst wenn Eigenbrodt Bereitschaft signalisiert hatte, nochmal auf das Thema einzugehen, fühlte es sich nicht gut an. Das ganze Ding war nicht seine Kragenweite. Eigenbrodt musste etwas aus dem Moment heraus machen. Seine Fantasien waren ohnehin meistens so grotesk, dass sie ihre volle Wirkung eigentlich nur in der Theorie und im Gespräch entfalteten. Wie oft hatten sie tage-, manchmal wochenlang über ein Thema gelacht, das sich einfach so im Wahnsinn einer Unterhaltung entwickelt hatte? Da war Eigenbrodt unschlagbar. Aber diese Situationen zu realisieren, schien unmöglich. Das spontane Element fehlte, wenn man die Voraussetzungen planen musste.
Bentheim dachte an das Geld, das er in die aktuelle Planung gesteckt hatte. Zwar hatte er 60 Euro gespart, als er nach dem Paula-Gemetzel noch mal ins ‚Froschauge‘ gegangen war, um Klebi sein restliches Honorar zu geben. Da hatte er Glück, denn der ehemalige Villenschreck schlief tief und fest in einer Kneipenecke und merkte nicht, dass in seiner Hand statt 75 Euro drei Fünfer eingerollt wurden. Trotzdem war das alles kostenintensiv und wurde auch nicht billiger, wenn sie zu zweit nach Hamburg fahren würden. Zudem wollte er bestimmten Personen kein nächstes Mal begegnen. Nein, das war gelaufen und Bentheim hob das Glas, um auf diese Feststellung mit allen Kneipengeistern anzustoßen.
Am liebsten hätte er Eigenbrodt angerufen und den Rest des Abends mit ihm gezecht, aber er fürchtete, sie würden nur einen neuen Unsinn aushecken und er war noch nicht bereit dafür.
Was für eine seltsame Beziehung sie doch pflegten. Seit über vierzig Jahren waren sie befreundet und tatsächlich war der Humor ein nicht unwesentliches Element dieser Freundschaft. Sie konnten über Dinge lachen, die kein anderer lustig fand. Es war ein Humor, der sich aus unerklärlichen Quellen speiste. Die intensivsten Momente entstanden, wenn sie sich im richtigen Moment, zum richtigen Anlass ansahen und dasselbe dachten. Sie saßen mal in einem Gitarrenkonzert, schauten sich im selben Moment an und dachten wohl beide dasselbe. Der Rest der Veranstaltung war eine einzige körperliche Tortur, im Versuch den seriösen Vortrag des Künstlers nicht durch irres Lachen zu unterbrechen. Dieser Humor resultierte aus einer Neigung zu einem speziellen Wahnsinn, der sich nicht ergründen ließ. Ein Psychologe würde sich wohl nach intensiver Beschäftigung damit selbst in Behandlung begeben müssen.
Beide hatten sie natürlich ganz eigene impulsive Momente, in denen der individuelle Wahnsinn ausbrach. Eigenbrodt konnte in einem öffentlichen Schwimmbad plötzlich von einer Wand zum Beckenrand laufen und dann wie zufällig ins Wasser fallen. Das ist an sich nichts Besonderes, aber er hatte das mal eine halbe Stunde hintereinander gemacht, mit immer dem gleichen irren Gesichtsausdruck und Bentheim stand daneben und hatte Schmerzen vor Lachen.
Bentheim selbst lebte seine Irrationalität nicht so spontan aus. Bei ihm mussten Voraussetzungen geschaffen sein, um Dinge zu tun, die wahrscheinlich nur Eigenbrodt in vollem Umfang nachvollziehen konnte. Vor ein paar Wochen hatte er auf einer Baustelle die Scheiben von Baugeräten eingeworfen und dabei darauf geachtet, dass die Steine mittig trafen und ein bestimmtes Muster erzeugten. Er hatte das keinesfalls ohne Anlass gemacht: Es war eine Art Protest gegen den Lärm, den die Maschinen auch an einem Feiertag machten. Die Aktion war spontan, aber Bentheim brauchte einen Anlass, um zu handeln. Dann erst machte er sich um die Konsequenzen keine Gedanken mehr.
Er merkte, wie ihm der Doppelkorn zusetzte, und beschloss nach Hause zu gehen. Er hatte einige Male still in sich hineingelächelt, als er an die Baufahrzeuge dachte. Niemand hatte ihn aufgehalten, im Gegenteil, die zuschauenden Passanten an diesem Samstagnachmittag hatten ihn sogar vor einer Polizeistreife abgeschirmt. Während die Reaktionen eines zufälligen Publikums in Eigenbrodts Vorstellungen meist aus Kopfschütteln und Fassungslosigkeit bestanden, hatte Bentheim stumme Sympathiekundgebungen erhalten.
Er legte einen Geldschein auf die Rechnung und verließ das Lokal. Langsam lief er die Straße zu seinem Kiez hinunter. Er grinste vor sich hin. Er hatte Lust, etwas mit Eigenbrodt zu machen. Dazu musste man nicht nach Hamburg. Aber mal raus aus der gewohnten Umgebung, ins Umland. Nach Mallorca würde er gerne mal und sich dann dort treiben lassen. In eine dieser Rentnerhochburgen. Da würde sich bestimmt etwas ergeben. Die Rentner dort in ihren abgeschotteten Enklaven waren leicht zu schocken. Was sich dort veranstalten ließe, ohne jede Vorbereitung, würde einen Heidenspaß machen. Es gab nur ein Problem: Eigenbrodt zu überreden, die Stadt mal für ein paar Tage zu verlassen, war so gut wie unmöglich. Schade. Bentheim spürte dieses Kribbeln im Bauch: Lust darauf, irgendeinen Blödsinn zu machen.
Er bemerkte, dass er leise vor sich hin brabbelte, ein paar Mal gekichert hatte und so die Aufmerksamkeit einiger Passanten im Vorbeigehen erregte. Jetzt kam ihm eine Mutter mit zwei kleinen Kindern entgegen. Bentheim grinste und murmelte einen mantraähnlichen Singsang: „Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid“, unterbrach dann den Sermon, um kurz laut aufzulachen. Zwei Meter vor ihm blieb eines der Kinder stehen und zog an der Hand der Mutter. Die schaute ihn fragend an. Bentheim blieb ebenfalls stehen. Dann verzog er den Mund, als wenn er anfangen würde zu sabbern und stieß hastig hervor: „Was guckst’n so, kannst aufs Maul kriegen.“ Dann ging er an der ungläubig blickenden Mutter vorbei, drehte sich noch einmal um, machte „Huh!“ und setzte seinen Weg fort. Jetzt brabbelte er fortlaufend, keine Sätze oder Worte, nur unverständliche Laute. Wenn er an Passanten vorbeiging, wurde er deutlich: „Kannst aufs Maul kriegen, kriegen alle auf die Fresse“ und „So geht’s nicht weiter, aufs Maul, alle in die Fresse hauen.“ Ja, das machte ihm Spaß, es war primitiv und einfach, es war noch nicht mal originell und er konnte sich steigern, bis er glaubte, er könnte wirklich jemandem aufs Maul hauen. Ja, das machte Spaß, er nannte das seinen „cholerischen Humor“, er dachte dabei genauso wenig nach wie Eigenbrodt. Das tat gut, musste ab und zu sein. Allerdings war ihm das subtil Wahnsinnige dann doch lieber. Es war nachhaltiger.
Man müsste Eigenbrodt mal wenigstens für einen Tag woanders hinkriegen. In eine der provinziellen Fußgängerzonen einer Kleinstadt. Kyritz an der Knatter zum Beispiel. Bentheim fing laut an zu lachen: Eigenbrodt und Bentheim in Kyritz an der Knatter ...
5
TROMPETENGOLD ZUR WEIHNACHTSZEIT:
DES EINEN FREUD’, DES AND’REN LEID.
Bentheim hatte seinen Besuch angekündigt und schien nicht weiter sauer wegen der Hamburg-Angelegenheit zu sein. Eigenbrodt freute sich auf ihn. Wenn bei ihnen beiden auch das Mischungsverhältnis zwischen Imaginieren und Handeln nicht immer übereinstimmte – am Ende gab es stets etwas zu erinnern aus dem Riesenvorrat der gemeinsamen Lebenserfahrungen.
Bentheim hatte gute Laune mitgebracht und es dauerte nicht lange, bis er mit dem halb scherzhaft hingeworfenen Vorschlag rausrückte, man müsse ja (auf der B5, die Eigenbrodt ja wohl liebe) nicht bis Hamburg fahren. Es reiche ja auch bis Kyritz.
„Kyritz?“, schien Eigenbrodt fragend zu sinnieren.
„Ja, an der Knatter.“
„Aus Kyritz kam der Querkenbeck.“
„Der Verrückte? Der Trompetenspezialist?“
„Ja, der. Ich hab dir doch von jenem legendären Weihnachten bei uns erzählt.“
„Na ja, ist schon ’ne Weile her. Weiß ich nicht mehr so genau. Hast du zu dem denn noch Kontakt?“
„Nein. Das Letzte, was ich über ihn hörte, waren Rufe aus unserem Korridor. Er läge wie tot in den Winterblumen. Und als ich nachsehen ging, war unser Vorgarten leer. Da war kein Querkenbeck, und keiner konnte sagen, wo er geblieben war.“
„Wie war das nochmal an dem Weihnachtsabend?“
„Es war einer meiner bösesten Scherze, aber einer der besten. Meine ganze Familie gezwungen, am Heiligen Abend stundenlang einem abartigen Vortrag zuzuhören.“
„Wahnsinn!“
„Allerdings! Machen wir eine kleine Zeitreise zurück!“
WEIHNACHTEN BEI EIGENBRODTS
Eigenbrodts Wohnzimmer zu Weihnachten: sehr sparsame weihnachtliche Dekoration, hier und da eine Kerze, vielleicht ein Tannenzweig. Drei Stuhlreihen mit je drei Stühlen, einem Kindertheater ähnlich, stehen für ein Publikum bereit. An einem einfachen Tisch davor hat bereits Platz genommen ein ungewöhnlich großer und ungewöhnlich hässlicher Mann (Querkenbeck) mit riesiger Nase und riesigen Segelohren. Alle anderen Weihnachtsgäste treten langsam ein, mit Verwunderung über den unerwarteten Besucher. Die Weihnachtsgäste sind Familienmitglieder: der Hausherr / Organisator / Sohn der Familie (S), seine betagte Mutter (M), seine ältere Schwester, also Tochter der Familie (T). Diese drei Akteure/-innen nehmen (M sichtlich irritiert) in der ersten Stuhlreihe Platz. Die weiteren sechs Familienmitglieder (WF) werden hier nicht näher unterschieden. Es obliegt der Regie, zwischen ihnen zu differenzieren bzw. Äußerungen bestimmten Individuen zuzuordnen. Sie verteilen sich auf die übrigen sechs Plätze. Wenn alle neun Gäste sitzen, erhebt sich S, tritt neben den Tisch, hinter dem sich (mit ungewöhnlich blödem Gesicht, das ab und an von einem Tick gleichzeitig nach oben wie nach unten bewegt wird) Q befindet, und richtet das Wort an die kleine Gesellschaft.
S (sehr salbungsvoll): Ja, ich wünsche uns allen nun ganz offiziell: Frohe Weihnachten! Ihr habt bereits gesehen: Wir haben heute unter uns einen lieben Gast (er wendet sich Q mit einladendem Lächeln zu), und ich habe die große Freude, die Weihnachtsfreude sozusagen, für den heutigen Nachmittag und Abend, ja, vielleicht auch bis in die Nacht hinein, eine besondere Attraktion ankündigen zu können.
M (zu der neben ihr sitzenden T in ungedämpfter Lautstärke): Nacht?!
(T bleibt demonstrativ ohne Reaktion, um uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu signalisieren.)
S: Es ist mir gelungen, Herrn Querkenbeck (Blickkontakt) zu gewinnen, der uns – ja, die große Freude machen wird, an diesem Heiligen Abend über ein Instrument – ja, was sage ich, über DAS Instrument der Heiligen Nacht zu sprechen: die (bedeutungsschwangere Pause) Trompete!
Das heißt, ich muss das präzisieren, nicht wahr, Herr Querkenbeck? Im engeren Sinne über das Trompetenrohr. Und dann, wir haben das im Vorfeld besprochen, möglicherweise noch, lieber Herr Querkenbeck, in einem kleinen, wie soll ich sagen, Encore ein paar – wirklich nur wenige – abschließende Bemerkungen über die Trompete als ein Ganzes.
M (zu T): Wie heißt der?
T: QUER – KEN – BECK, Mutti, Querkenbeck.
S: Dies soll heute einmal ein ganz anderes Weihnachten werden und deshalb bitte ich euch auch alle, vielleicht noch einmal die Toilette aufzusuchen, bevor Herr Querkenbeck beginnt. Denn wir wollen die Tür in gegenseitigem Einvernehmen nachher geschlossen halten, damit der Vortrag (Blickkontakt) nicht unnötig gestört wird.
WF: Wie sieht die Zeitplanung aus?
S: Der Vortrag (Blickkontakt) wird zwei Hauptteile haben. Für jeden Teil rechnen wir mit drei Stunden, also insgesamt sechs Stunden. Dazwischen eine kleine Pause, aber eine sehr kleine, denn der thematische Faden soll nicht abreißen. Im ersten Teil wird Herr Querkenbeck über das hintere Trompetenrohr sprechen, im zweiten Teil über das vordere. Und ich bin sicher, dass wir ihn zum Abschluss noch bitten werden und er diese Bitte auch (übertrieben unterwürfig) erhören wird, ein paar Worte über die Trompete als Ganzes zu verlieren. Vielleicht noch einmal im Umfang von (Blickkontakt) zwei Stunden? ... Etwa zwei Stunden, aber ohne Pause davor, schließlich verlassen die Konzertbesucher den Saal ja auch nicht vor der Zugabe. Na dann ... Frohe Weihnachten! Wir sehen uns in wenigen Augenblicken – und freuen uns!
(Unruhe und Gewirr unter den Gästen. Einige streben rasch der Toilette zu. Verbale Reaktionen: „Das ist doch keine Weihnachtsfeier!“ / „Ich kann doch hier nicht sechs Stunden sitzen!“ / „Acht!“ / „Was ist denn das hintere Trompetenrohr?“ / „Wie heißt der?“ / „Quakenbeck?“ / „Die Tür bleibt zu?“ / „Da mach ich mir in die Hose.“ / „Querkenbeck, Mutti.“ / „Geht weiter.“ / „Scheiße hier!“
S bemüht sich, den Beginn der Veranstaltung einzuleiten. Die Gäste begeben sich langsam, zum Teil unwillig, wieder auf ihre Plätze. Q hat sich noch nicht gerührt. Es herrscht das vor einem Ereignis übliche Gemurmel. Gedämpfte Wortwechsel im Auditorium. WF: „Der Gorilla bewegt sich überhaupt nicht.“ WF: „Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, als ich kam, hat der im Vorgarten gelegen, bei den Winterastern.“ WF: „Was?!“ WF: „Ja, der lag platt auf der Erde, wie tot.“ WF: „Und – hast du ihm geholfen?“ WF: „Nö – dachte, es wäre eine Falle.“ Im Auditorium kursiert ein Teller mit kleinen, festen Gebäckteilchen. S signalisiert, man möge beim Weitergeben des Tellers leise vorgehen.
M: „Und was ist das Schönes?“ T: „Das kannst du essen, Mutti.“ WF (aus der Stuhlreihe hinter M und T zu vernehmen): „Ist das der Hartkuchen, der auch für Hunde geeignet ist? Ja, lecker, ein Kombihundekuchen.“ M (zu T; beide sprechen nun mit Stimmen wie vom Kompressor gestaucht, leise, aber mit dem Nachdruck der Verärgerung): „Ich esse keinen Hundekuchen.“ T: „Den kannst du essen, Mutti. Der ist sehr lecker.“ Sie beißt selbst ein winziges Stück ab. M: „Ich esse diesen Hundekuchen nicht.“ T: „Der ist sehr gut.“ Sie starrt nach vorn. -
Q erhebt sich von seinem Stuhl, bleibt hinter dem Tisch in voller Größe stehen. Die übergroßen Ohrmuscheln sind von der Wintersonne angestrahlt und fast durchsichtig. Es tritt völlige Ruhe ein. Die Gäste sind, aus welchen Gründen auch immer, konsterniert.)
Q (der sich beim Sprechen häufig mit einem gedehnten „Ja-ja-Ja“ unterbricht und dessen gedrechselte Vortragsweise eher Verwunderung als Aufmerksamkeit hervorruft): Lieber Herr Eigenbrodt, verehrter, lieber Herr Eigenbrodt – ein Tag nun der Freude, der großen Freude – die Trompete, ja die Trompete, die Trompete und nichts als die Trompete – oder sollte ich sagen: das Trompetenrohr, das Trompetenrohr – und nichts als das Trompetenrohr – oder sollte ich sagen: das hintere Trompetenrohr, das hintere Trompetenrohr – und nichts als das hintere Trompetenrohr. Das hintere Trompetenrohr! (Er ist außer Atem geraten, pausiert, hat aber noch Kraft für die Ja-ja-ja-Einwürfe. In eben dieser Art und Weise fährt er etwa eine Stunde lang fort, wobei alles Gesagte den Charakter der unverbindlichen Vorbemerkung trägt, so als werde er noch lange brauchen, um zum eigentlichen Thema zu kommen.) ...
Ja, das Trompetenrohr – und nichts als das Trompetenrohr.
M (in mittlerer Lautstärke in den Raum sprechend): Scheiße im Trompetenrohr kommt zum Glück recht selten vor.
S (ermahnend zu M): Mutti, ist ja gut.
(Der „Vortrag“ geht in der beschriebenen Form noch eine Stunde weiter. Q will wohl zum Ausdruck bringen, dass der hintere Teil des Trompetenrohrs ein wichtiger für die Intonation sei und dass es hier auf handwerkliche Genauigkeit ankomme. Im Auditorium zeigen sich Ermüdungs- und Erschöpfungserscheinungen.)
WF (zum Sitznachbarn): Der ist doch nicht ganz dicht.
WF (antwortend): Ich meine, der hat vorhin im Vorgarten gelegen.
(In der dritten Stunde des ersten Vortragsteils wird das Durchhaltevermögen der Zuhörer aufs Äußerste strapaziert, vor allem durch Floskeln wie „Ich möchte mich nun dem Thema, das wir bislang nur umkreisten, ein wenig nähern“ und durch häufiges Aufstöhnen und Wiederholen des Wortes „Trompetenrohr“, welches T jeweils mit einem Rippenstoß gegen ihre Mutter begleitet.)
WF: Irgendwie riecht es hier komisch.
M (darauf reagierend): Es riecht hier multrig.
WF: Als hätte sich jemand in die Hosen gemacht.
M: Ganz multrig.
T: Ist ja gut, Mutti.
WF: Ich glaube fast, der hat sich bepinkelt. Aber man kann die Hose nicht richtig sehen. Und ich bin mir sicher, er hat vorhin im Vorgarten gelegen.
(Endlich, nach drei Stunden, Pause. Alle verlassen das Wohnzimmer. Man hört die Stimmen aus der Ferne: „Das ist eine ZU-MU-TUNG!“ / „Muss ich nötig!“ / „Wo ist denn der Querkenbeck?“ / „Wie lange ist Pause?“ / „Noch eine Minute.“ / „Ich kann nicht mehr.“ / „Ich geh da nicht mehr rein.“ / „Meine Mutter ist von der Toilette gestürzt.“ / „Der Querkenbeck liegt in den Winterastern.“)
S (wie ein Zeremonienmeister): Wir müssen das hier beenden.
„Meine Güte“, Bentheim verdrehte leicht die Augen, „wenn ich mir vorstelle, so ein Weihnachten. Da ist es doch kein Wunder, dass du manchmal so komisch tickst.“ „Ich ticke komisch? Wie meinst du das denn?“ Eigenbrodts Augenlider flatterten unruhig.
„Irrational, meine ich. Mit solchen Leuten in der Familie muss man sich doch diverse Psychosen einfangen. Habt ihr in der Geschlossenen gelebt?“
„Nun hör aber mal auf. Du tust ja so, als hätte ich einen Dachschaden.“
Bentheim sagte nichts mehr und dachte nach. Wenn das nur ein Beispiel aus dem intimen, ihm unbekannten Leben der Familie seines Freundes war, dann wollte er weitere nur in angemessenen Dosierungen erfahren. Da kennt man sich nun schon so lange und dann trifft man die Dämonen. Egal, der Spaßfaktor war jedenfalls ziemlich hoch. Bentheim köpfte die nächste Bierflasche.
6
QUERKENBECK AUS KYRITZ KAM
UND HIER FÄNGT DER WAHNSINN AN.
„Wollen wir uns ein Taxi nehmen?“ Eigenbrodt sah aus wie jemand, den man mit einem Zwanzig-Kilo-Tornister mittags durch die Wüste gejagt hatte.
„Taxi? Bist du krank? Für die paar Meter?“, Bentheim schüttelte energisch den Kopf. „Auf, auf, Kamerad, jetzt wird die Stadt der Städte erobert.“
Es war Kyritz. Nicht unbedingt das Juwel auf der Liste Brandenburger Ziele, doch nah genug an Eigenbrodts Alltagskosmos und doch weit genug entfernt, um in der erstbesten Kneipe mutlos hängenzubleiben.
Nach dem Abend mit der Weihnachtsgeschichte hatte Bentheim Nägel mit Köpfen gemacht und Eigenbrodt verpflichtet sich zwei Tage später mit ihm auf den Weg in die Provinz zu machen. Gerade hatten sie den unwirtlichen Bahnhof verlassen und schlugen den Weg zur Stadtmitte ein.
Eigenbrodt stapfte missmutig neben Bentheim her. Der wollte sich die gute Laune nicht verderben lassen und baute vor:
„Wir werden uns erst mal einen schönen Kaffee genehmigen.“
Eigenbrodt grummelte in sich hinein. Dann fragte er:
„Wo ist eigentlich die Knatter?“
„Häh?“, Bentheim war überrascht.
„Na ja, Kyritz an der Knatter. Wo ist die Knatter?“
„Mann“, antwortete Bentheim, „die gibt’s doch gar nicht. Ich dachte, das ist allgemein bekannt.“
Jetzt war Eigenbrodt sehr erstaunt. „Wie, die gibt’s nicht. Ist das kein Fluss?“
„Natürlich ist das ein Fluss, aber der heißt nicht Knatter, sondern Jäglitz“, klärte ihn Bentheim auf.
„Wieso heißt der Jäglitz, wenn das doch Kyritz an der Knatter ist?“, Eigenbrodt war zu einem trotzigen Quengeln übergegangen.
„Weiß ich nicht so genau“, antwortete Bentheim. „Das hat was mit Mühlrädern zu tun.“
„Mühlräder? In Kyritz an der Knatter, die gar nicht Knatter heißt, sondern Jagdmann?“
„Jäglitz“, verbesserte Bentheim genervt. „Und wenn du es genau wissen willst, dann frag doch einen Kyritzer.“ Er biss sich auf die Unterlippe, denn Eigenbrodt hatte sich sofort an einen entgegenkommenden Hooligan gewandt und sich ihm in den Weg gestellt.
„Warum heißt das hier Kyritz an der Knatter, wenn es die Knatter gar nicht gibt?“
Der stiernackige Einheimische, in dekorativem Schwarz gekleidet und in seinen Springerstiefeln etwa einen Meter größer als Eigenbrodt, blieb stehen, glotzte ihn aus friedensverweigernden Augen an und bellte: „Hass’n Problem, du Opfer?“
Bentheim zog Eigenbrodt zur Seite und beeilte sich, dem kampfbereiten Ureinwohner zu versichern: „Kein Problem, wir sind auf dem Weg ins Heim, er hat seine Tabletten nicht genommen“, und dann beschleunigte er, seinen Freund hinter sich herziehend, das Tempo, ohne sich noch einmal umzudrehen.
„Sag mal“, bemerkte er nach hundert Metern kurzatmig, „kannst du dir nicht einen anderen Touristenführer aussuchen?“
„Wieso? War doch eine einfache Frage.“
„Ja, für dich, aber nicht für den Ultraschwarzen. Übrigens“, Bentheim wollte das Ereignis keinesfalls weiter diskutieren, „hier ist das Zentrum“, und er beschrieb mit dem rechten Arm einen weiten Bogen, als wäre der ungemütlich gepflasterte Marktplatz die Plaça de Catalunya in Barcelona.
„Zentrum?“, Eigenbrodt rollte ungläubig mit den Augen. „Zentrum von was? Vorhölle?“
„Komm“, sagte Bentheim beschwichtigend, „so schlimm ist das auch nicht. Ist eben Provinz. Da vorne ist ein Café, da sind draußen noch Plätze frei, da gönnen wir uns was Schnuckeliges und machen looky looky.“
„Looky looky, du hast sie ja nicht alle“, sagte Eigenbrodt, schien aber nichts gegen eine Pause zu haben.
Fünf Minuten später saßen sie vor zwei Tassen Kaffee und zwei Cognacs.
Eigenbrodt schaute nach allen Seiten und resümierte nach kurzer Zeit: „Das ist hier ranzig. Die Häuser passen nicht zusammen. Da ist was restauriert, gegenüber verfällt was. Die Kirche sieht scheiße aus. Das Rathaus steht am falschen Platz.“
„Meine Güte“, stöhnte Bentheim, „hätte ich gewusst, dass du so eine Laune hast, wäre ich gar nicht erst losgefahren. Kannst du das nicht mal in Ruhe auf dich wirken lassen?“
„Was denn? Die ganzen Zombies? Hätt’ ich doch gleich zu Hause bleiben können“, maulte Eigenbrodt.
Wie von Geisterhand standen zwei frische, diesmal doppelte Cognacs auf dem Tisch. „Wenigstens das klappt.“ Eigenbrodts Stimme klang versöhnlich, er musste eine kleine Geste in Richtung der dicken, drallen Frau gemacht haben, die für den Nachschub zuständig war. „Scheint ja auch das Wichtigste zu sein“, fuhr er fort und zeigte auf eine Gruppe Alkoholiker, die gerade mitsamt zwei Kisten Bier die Bank vor dem Rathaus in Beschlag nahmen. „Donnerwetter“, Eigenbrodt hatte sich ganz gerade hingesetzt, „die haben ja alle denselben Haarschnitt. Wie vor dreißig Jahren. Vokuhila.“ Er klatschte sich mit plötzlicher Begeisterung auf die Oberschenkel. „Kyritz an der Knatter ist die Hauptstadt der Vokuhilas“, und er fing leise an zu lachen. Dann kippte er den Cognac auf ex, hielt das Glas hoch und machte mit der anderen Hand eine Bewegung, die wohl „zwei“ bedeuten sollte.
Bentheim blickte nicht ohne Wohlgefallen auf die dicke Frau, die nur ganz kurz den Kopf bewegte. Eine Minute später standen zwei Doppelte auf dem Tisch. „Wie machst du das?“, fragte er.