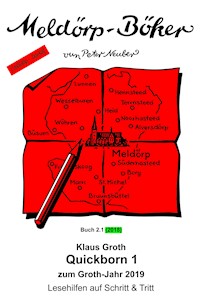
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Meldörp-Böker
- Sprache: Deutsch
Gedicht- und Erzählband, einer der allergrößten Klassiker der neueren niederdeutschen Literatur. Lesbar für jedermann durch phonetische, grammatikalische und lexikalische Hilfen auf Schritt und Tritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Neuber (Hg.), Meldörp-Bȫker 2.1
Klaus Groth
Quickborn 1
Ortsnamen in der Titelkarte
in SASS-ergänzender Schreibweise: Âlversdörp,
Friechskōōg, Hėnnsteed, Mârn, Nōōrhasteed, Wȫhren
›Klappentext 1‹
Peter Neuber, Burgstr. 18, 25704 Meldorffon: +49 (0) 179 680 45 39email: [email protected]öhmerwöör.de (download für das Wörterbuch ›Wȫhrner Wȫȫr‹)
(Textbõker tō de ›Wȫhrner Wȫȫr‹)
Bislang waren folgende Titel aus dem Internet kostenfrei, als ›Frie’ Woor‹, herunterladbar, jeweils in zweiter, geänderter Ausführung, 2015-11-15:
Nr. 1:
Verscheden Schrieverslüüd
Nr. 2.1:
Klaus Groth, Quickborn 1
Nr. 3.1:
Johann Hinrich Fehrs, Op Holsten-Eer
Gedruckt sind bislang erschienen, jeweils in zweiter, geänderter Auflage, 2015-11-15:
Nr. 3.2:
ISBN 978-3-9817316-6-8
Johann Hinrich Fehrs, Allerhand Slag Lüüd
Nr. 4.2:
ISBN 978-3-9817316-7-5
Theodor Piening, De Reis no’n Hamborger Doom
Nr. 5.1:
ISBN 978-3-9817316-8-2
Heinrich Johannes Dehning, Junge Schoolmeisterjohren in Dithmarschen vör 1900
Nr. 8.2:
ISBN 978-3-9817316-9-9
Georg Droste, Odde Alldag un sien Jungstöög
2018 erschienen bzw. erscheinen bei Tredition in jeweils 3. Auflage als Paperback und Hardcover und eBook:
Nr. 3.2: Johann Hinrich Fehrs, Allerhand Slag Lüüd
Paperback: 978-3-7469-6766-0 – Hardcover: 978-3-7469-6767-7 -eBook: 978-3-7469-6768-4
Nr. 4.2: Theodor Piening, De Reis no’n Hamborger Doom
Paperback: 978-3-7469-6812-4 - Hardcover: 978-3-7469-6813-1 -eBook: 978-3-7469-6814-8
Nr. 5.1: Heinrich Johannes Dehning, Junge Schoolmeisterjohren in Dithmarschen vör 1900
Paperback: 978-3-7469-3473-0 - Hardcover: 978-3-7469-3474-7 -eBook: 978-3-7469-3475-4
Nr. 8.2: Georg Droste, Odde Alldag un sien Jungstöög
Paperback: 978-3-7469-0882-3 - Hardcover: 978-3-7469-0883-0 -eBook: 978-3-7469-0884-7
Die Reihe wird bei Tredition fortgesetzt.
Peter Neuber (Hg.)
Meldörp-Bȫker
Nr. 2.1 (1. Oploog 2018)
Klaus Groth
Quickborn 1
Der zugrundeliegende Text erschien 1921 bei Lipsius und Tischer in Kiel und Leipzig als 9. und 10. Tausend. Das Vorwort zum ersten Tausend schrieb Groth im Herbst 1892:
Klaus Groth, Gesammelte Werke in vier Bänden,
1. Band: Quickborn 1(GrK1.1)
In der vorliegenden Ausgabe wurden die Groth-Texte sprachlich mit Vorsicht aktualisiert und zum Groth-Jahr 2019 um Aussprache- und Verständnishilfen auf Schritt und Tritt ergänzt. Es soll ein Buch für Jedermann sein. Jede Stelle des Quickborn 1 soll auch für diejenigen erschließbar sein, die dies nicht (mehr) für möglich hielten.
Vor allem sollen die Texte
in Dithmarschen lautlich leichter korrekt gelesen und vorgelesen werden können, sie sollen so leicht wie möglich über die heutige Zunge gehen!
Selbstverständlich geht es nicht darum, Groth zu korrigieren! Falls sich Text-Änderungen ergeben, fordern diese zum aufmerksameren Lesen des Originals auf! Die angekündigte Groth-Gesamtausgabe darf mit freudiger Spannung erwartet werden!
Es handelt sich hier um ein
Niederdeutsches Textbuch
zum Wörterbuch ›Wȫhrner Wȫȫr‹ in
SASS-ergänzender Schreibweise
Dat hēēt: in SASS-Schrievwies mit Opsetters. Vör âllen wârrt de Diphthongen kėnntli mookt — un dat is vun Vördēēl in hēēl Slēēswig-Holstēēn!
Datt ēēn würkli luut lesen un vörlesen kann!
Stand: 2018
Meldörp-Böker
(+ Kompetenztraining in Dithmarscher Platt)
Liebe ältere und jüngere und neuere Dithmarscher,liebe Urlauber in Dithmarschen,liebe Deutschlehrer und Schüler|innen der Sekundarstufen,liebe Deutschlehrer- und Germanistikstudenten aus Dithmarschen,liebe Freunde des Plattdeutschen überalldie ›Meldorf-Bücher‹ enthalten Dithmarscher Platt,die alte Dithmarscher Sprache, aber verständlichund in geeigneter ›SASS-ergänzender Schreibweise‹,un dōrmit luut leesbor un vörleesbor!
Ditschi-Platt, tru di wat!
Peter Neuber (Hg.), Meldörp-Bȫker 2.1
Klaus Groth
Quickborn 1
Copyright © 2018 by Peter Neuber, D25704 MeldorfGestaltung des Buchtitels: Manfred Schlüter, D25764 HillgrovenDigitale Einband-Umsetzung: DruckZentrum-Westkueste, D25746 Lohe-Rickelshof
Auflage 2018
Verlag und Druck: tredition GmbH
Paperback: ISBN 978-3-7469-8470-4Hardcover: ISBN 3978-3-7469-8471-1eBook: ISBN 978-3-7469-8472-8
Schwarzweiß-Kurzfassungder Aussprachehilfen für Dithmarschen!
Mit farblicher Unterstützung finden Sie die Tabelle auf der Buch-Rückseite!
—— Aussprache-Steckbrief für Dithmarschen ——
Sprich ō als [ou] (though), ē als [ei] (day), ȫ als [oi] (boy, moin, Heu, Häuser)!
Sprich â vor l+Konsonant & vor r+Konsonant als lang-a, [a:] (engl. half [ha: f], dark [da: k])!
Sprich ė als kurz-i (hin, Strich, Wirt); ġ|ġt als hart-g (Bug); ḃt als hart-b (lieb)!
Sprich -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) als -ben, -b’n bis hin zu -m [ölm, sülm]!
Sprich das r nach langem Vokal als nachklingendes a: [oua, eia, oia, …]:
Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!
Sprich sp, st wie ›spitzen Stēēn‹, sprich aber schr mit hochdeutsch-breiter Zunge!
Sprich das s in sl, sm, sn, sw möglichst als scharfes s oder als Zungenspitzen-sch!
Sprich j wie Journalist (jo, jüm, Jung); ä, ää, äh wie e, ee, eh (Jäger, nä, däägli, Fähr)!
Für die ch-Aussprache des g in mag, Slag, Steeg, Weeg, Steg, weg, Weg, leggt, seggt, krieg, lieg, kriggt, liggt, Loog, Moog, Tog, Mügg, Bârg, Dwârg, Borg usw. ist ǧ angedacht.
Bezüglich M3, M4a-d siehe unter Kennmarken M3, M4!Bezüglich X01, X09, X11 … siehe unter Regionale Besonderheiten!Bezüglich * siehe Grabbelkiste, Worterklärungen!Dies alles und weiteres finde vorn im Inhaltsverzeichnis!
Könner können
unter den Zusatzzeichen und über die Hilfen hinweglesen!
Weniger Versierte
folgen den hilfreichen Hinweisen ganz nach Bedarf!
Unter den Balken|Punkten findet sich die Sass’sche Schreibweise!
Warum(ab Herbst 2015)diese ›SASS-ergänzende Schreibweise‹?
Beide Schreibweisen, die zuvor verwendete wie die jetzige, stehen fest zu SASS (zum PLATT-DUDEN für NS, HH, SH seit 1956), ergänzen ihn aber und sind für Dithmarschen und ganz Schleswig-Holstein gleichermaßen tauglich. Traditionell werden hier die Diphthonge, die Zwielaute [ou, ei, oi|öü], nicht als Doppellaute (z. B. als ou, ej, oi|eu|äu) geschrieben, sondern als o, e und ö.
Meine ältere ›Dithmarscher Schreibweise‹ hielt sich an das Prinzip unserer Dithmarscher Altvorderen Groth und Müllenhoff, die die langen Monophthonge|Einlaute kennzeichneten, die problematischen Zwielaute aber nicht. Diese traditionelle Schreibweise erzeugte leider immer ein riesengroßes Problem: Die Monophthonge|Einlaute wurden unnötigerweise hervorgehoben; aber nur über sie konnte man sich die nicht markierten Diphthonge|Zwielaute logisch erschließen (indirekt, nach der Methode ›von hinten durch die Brust ins Auge‹). — Immerhin, man konnte! Behelfsmäßig unterstützte ich dies durch Anhebungen.
Meine neuere nun verwendete ›SASS-ergänzende Schreibweise‹ markiert direkt die Problem-Zwielautbuchstaben o, e und ö durch einen Balken (ō, ē und ȫ) und sagt: Dies ist höchstwahrscheinlich ein Doppellaut [ou, ei bzw. oi|öü], auch wenn er nicht so aussieht! Und die balkenlosen Buchstaben o, e und ö werden ganz normal als o, e und ö gelesen. — Schon Otto Mensing verwendete in seinen Lautschriftergänzungen die Zeichen ō, ē und ø, um auf Zwielaute bei Einlaut-Schreibweise hinzuweisen, für ganz Schleswig-Holstein!
Was im Buch (in den Groth-Texten) ist Platt, was ist Hoch?
Wȫȫr un Sätz in normoolgrōte un lōōtrechte Bōōkstoḃen:
Platt
Wörter und Textpassagen in normalgroßer und kursiver
Schreibweise:
Hochdeutsch, zumindest keinPlatt
Wȫȫr in lütte un lōōtrechte Bōōkstoḃen:
Platt(tōmeist Uttuusch- Wȫȫr)
Wörter, in kleiner und kursiver Schreibweise:
Hochdeutsch
(Übersetzungen oder i.d.R. hochdeutsche Erklärungen)
Zeilen-Trennzeichen ▪
In einigen Texten wurden die im Original einzeln stehenden Textzeilen in Textblöcke gezwängt, um die Hilfen platzmäßig unterbringen zu können. Der jeweilige Zeilenwechsel wurde m. H. des ▪-Zeichens kenntlich gemacht.
Ein Beispiel von Seite 59(GrK1.1.033):
Sunst gung hē mit tō Danz un tō Gelagg |Fest ▪ un smȫȫk |rauchte sien Piep sō brösig |wichtig as ėn Junker ▪ un sung un lach |lachte, doch ümmerX21 sunnerbor, ▪ un blēēv niX20 lang un hȫȫ’|hȫȫd sik |hütete sich vör dat Drinken. ▪ Ōōk hârr hē mit de Dēērns niX20 veel in’ Sinn, ▪ dē foken |veelmools sään, hē wēēr as ›holten Hinnerk‹ |steifer Mensch.
Über den Autor Klaus Groth
(teils in enger Anlehnung an das Internet-Portal der Klaus-Groth-Gesellschaft)
Groth wurde am 24. April 1819 in Heide (Lüttenheid) als Sohn eines Müllers geboren. — 2019 feiern wir 200 Jahre Klaus Groth!
Groth wurde nach seiner Schulzeit, also mit 14 Jahren, zunächst Schreiber beim Kirchspielsvogt in Heide. Mit 18 Jahren, 1837, ging er nach Tondern aufs Lehrerseminar. Nach vier Jahren brach er aus Geldmangel seine Ausbildung ab und wurde Lehrer an einer Mädchenschule in Heide. Schon nach wenigen Jahren, er war häufig krank, erlebte Groth 1847 einen körperlich-seelischen Zusammenbruch, der zum Ausscheiden aus dem Schuldienst führte. Bis ins Jahr 1853 wohnte er bei seinem Freund Leonhard Selle zur Genesung auf Fehmarn. Dort schrieb er seine plattdeutsche Gedichtsammlung ›Quickborn‹, die 1853 erschien. Dieser Gedichtband machte Groth mit einem Schlage berühmt.
Im gleichen Jahr holte ihn Karl Müllenhoff (Marne), Literatur-Professor, nach Kiel. Hier arbeiteten beide von Oktober 1854 bis April 1855 fast täglich für Erweiterungen und Neuauflagen des ›Quickborn‹ eng zusammen, namentlich an der Erstellung einer plattdeutschen Grammatik und einer leistungsfähigen Orthographie, die u.a. die langen Ein- und Zwielaute zu unterscheiden wusste. — Während des Winters 1854/55 entstand auch das Prosawerk ›Vertelln‹.
Auf ärztliche Empfehlung hin unternahm Groth im Frühling 1855 eine Reise, die ihn zuerst nach Bonn führte. Hier verlieh ihm die Philosophische Fakultät der Universität die Ehrendoktorwürde.
Im Jahre 1857 kehrte Groth nach Kiel zurück, wo er im Sept. 1858 an der Philosophischen Fakultät einen Habilitationsvortrag hielt. Über seine Bemühungen um eine Universitätslaufbahn in Kiel zerbrach die Freundschaft mit Müllenhoff. Erst 1866 erhielt er vom damaligen österreichischen Statthalter von Holstein den Professorentitel für deutsche Sprache und Literatur.
Klaus Groth ist einer der bekanntesten niederdeutschen Lyriker und Schriftsteller. Gemeinsam mit dem Mecklenburger Fritz Reuter gilt er als der Begründer der neueren niederdeutschen Literatur.
Klaus Groth verstarb am 1. Juni 1899 in Kiel.
Wat in dat Bōōk steiht (Rahmen)
Übersicht über erschienene Meldörp-Bȫker (Klappentext 1)
Titelblatt
Impressum
Aussprache-Steckbrief für Dithmarschen (wie auf Buchdeckel) – zur SASS-ergänzenden Aussprache
Warum der Schreibweisenwechsel ab Herbst 2015?
Was im Buch ist Platt, was Hoch? + Zeilen-Trennzeichen ▪
Über den Autor
Rahmen-Verzeichnis
Verwendete Literatur und Verweise auf diese im Buch
Verzeichnis der Groth-Texte
Beginn des Quickborn 1
Ansinnen der Meldörp-Bȫker
Schreibweise und Aussprache (ō, ē, ȫ; â; ė; ġ; ḃ; … )
Weitere Aussprache-Hinweise
Kennmarken (M3, M4, …, Information dazu)
Regionale Besonderheiten (X00, X01, …)
Grabbelkiste, Informationen zu*-Wörtern
Information über die Nutzung der Wȫhrner Wȫȫr
Werbung für die Meldörp-Bȫker und speziell für dieses
Verwendete Literaturund Verweise auf diese im Buch
In die Groth-Texte sind auch die Original-Seitenumbrüche in der Form (GrK1.1.063) eingelassen: Klaus Groth, Gesammelte Werke, Kiel und Leipzig bei Lipsius und Tischer, 1921, Band 1, Quickborn 1
Im Groth-Stückeverzeichnis und am jeweiligen Stückeanfang wird in der Form (GrK5.1.092) auch verwiesen auf: Klaus Groth, Quickborn, Heide bei Boyens,1998
Für die Erarbeitung dieser Ausgabe wurde auch Klaus Groth, Quickborn, Volksleben in plattdeutschen Gedichten ditmarscher Mundart, Hamburg, Perthes-Besser & Mauke, 5. Auflage (1. mit hochdeutscher Übersetzung), 1856, herangezogen und auf sie an den Stückeanfängen in der Form (GrK2.062) hingewiesen.
Verzeichnis der Groth-Stücke
Mien Mōdersprook
GrK1.1.001
GrK5.1.015
Mien Jehann
GrK1.1.002
GrK5.1.017
Dat Mōōr
GrK1.1.004
GrK5.1.021
Mien Annamedder
GrK1.1.003
GrK5.1.019
Orgeldreiher
GrK1.1.005
GrK5.1.023
As ik weggung
GrK1.1.006
GrK5.1.025
Ėn Brēēf
GrK1.1.007
GrK5.1.026
För de Gören
01 Still mien Hanne
GrK1.1.008
GrK5.1.028
02 Snēēwittjen
GrK1.1.009
GrK5.1.029
03 Utsichten
GrK1.1.009
GrK5.1.030
04 Hevelmann
GrK1.1.010
GrK5.1.030
05 Dor wohn ėn Mann
GrK1.1.010
GrK5.1.031
06 Wat ēēn wârrn kann, …
GrK1.1.011
GrK5.1.033
07 Prinzess
GrK1.1.014
GrK5.1.040
08 Kanēēljuud
GrK1.1.015
GrK5.1.041
09 Regenlēēd
GrK1.1.016
GrK5.1.038
10 Buussemann
GrK1.1.017
GrK5.1.042
De Fischer
GrK1.1.018
GrK5.1.051
De Möller
GrK1.1.019
GrK5.1.045
De Melkdēērn
GrK1.1.019
GrK5.1.047
De ōle Hârfenspelersch
GrK1.1.024
GrK5.1.044
De Krautfru
GrK1.1.022
GrK5.1.053
An dėn Moon
GrK1.1.025
GrK5.1.056
Grōōtmōder
GrK1.1.030
GrK5.1.061
Wiehnachtenoḃend
GrK1.1.028
GrK5.1.059
Pēter Plumm
GrK1.1.030
GrK5.1.062
Hanne ut Frankriek
GrK1.1.036
GrK5.1.069
Kedenriem
GrK1.1.057
GrK5.1.084
Priomeln
GrK1.1.058
GrK5.1.085
Bispeel
GrK1.1.060
GrK5.1.087
Oonten in’t Woter
GrK1.1.062
GrK5.1.090
Lünk
GrK1.1.063
GrK5.1.092
Matten Hoos
GrK1.1.061
GrK5.1.088,
Pēter Kunrod
GrK1.1.065
GrK5.1.094
Schietkrööt
GrK1.1.092
GrK5.1.125
Aftēker in’t Mōōr
GrK1.1.091
GrK5.1.123
Dagdēēf
GrK1.1.093
GrK5.1.127
Drēēs
GrK1.1.094
GrK5.1.129 S. 121
De Flōōt
GrK1.1.095
GrK5.1.131
Rumpelkomer
GrK1.1.101
GrK5.1.137
Wat sik dat Volk vertellt
1 Ōōl Büsum
GrK1.1.117
GrK5.1.155
2 Herr Jehannis
GrK1.1.118
GrK5.1.156
3 Hē wook
GrK1.1.120
GrK5.1.158
4 Dat stöhnt in’t Mōōr
GrK1.1.120
GrK5.1.159
5 Dat grulige Huus
GrK1.1.122
GrK5.1.161
6 De hillige Ēēk
GrK1.1.122
GrK5.1.162
7 De Pukerstock
GrK1.1.124
GrK5.1.164
8 Hans Iver
GrK1.1.126
GrK5.1.167
Ut de ōle Krönk
1 Groof Rudolf vun de Bȫkelnborg
GrK1.1.127
GrK5.1.169
2 Groof Gēērt in Ōlenwȫhren
GrK1.1.128
GrK5.1.171
3 De Holsten in’e Hamm
GrK1.1.129
GrK5.1.173
4 De Slacht bi Hemmingsteed
GrK1.1.130
GrK5.1.174
5 Heinrich von Zütphen
GrK1.1.133
GrK5.1.177
6 De letzte Fēhd
GrK1.1.135
GrK5.1.180
Unruh Hans
GrK1.1.136
GrK5.1.182
Oḃendgang
GrK1.1.143
GrK5.1.190
De Fischerkoot
GrK1.1.143
GrK5.1.191
De Schipperfru
GrK1.1.144
GrK5.1.192
De Kinner lârmt
GrK1.1.144
GrK5.1.193
Aflōhnt
GrK1.1.145
GrK5.1.195
De junge Weetfru
GrK1.1.145
GrK5.1.196
Sünndagsrōh
GrK1.1.146
GrK5.1.197
Famielnbiller
1 Dat Gewidder
GrK1.1.146
GrK5.1.198
2 De Sünndagmorgen
GrK1.1.154
GrK5.1.207
3 Heinri
GrK1.1.163
GrK5.1.218
4 De Welt
GrK1.1.167
GrK5.1.223
5 Voderhuus
GrK1.1.170
GrK5.1.227
6 Ut Lėnken wârrt ėn Keed
GrK1.1.172
GrK5.1.230
Dat Dörp in’ Snēē
GrK1.1.174
GrK5.1.233
Goldbârg
GrK1.1.174
GrK5.1.234
Mien Platz vör Döör
GrK1.1.175
GrK5.1.235
Ünner’n Kastanje
GrK1.1.176
GrK5.1.237
Oḃendfreden
GrK1.1.177
GrK5.1.238
De Möhl
GrK1.1.177
GrK5.1.240
Sē lėngt
GrK1.1.178
GrK5.1.242
Hattlēēd
GrK1.1.180
GrK5.1.244
Swienegel un Matten Hoos in’e Wett
GrK1.1.181
GrK5.1.246
Hans Schander (nach Burns)
GrK1.1.185
GrK5.1.251
De Fischtog no Fiel
GrK1.1.195
GrK5.1.262
Hell in’t Finster
GrK1.1.211
GrK5.1.280
Wėnn de Lurk treckt
GrK1.1.213
GrK5.1.283
In’t Holt
GrK1.1.212
GrK5.1.281
In’e Frėmm
GrK1.1.215
GrK5.1.286
Mien Voderland
GrK1.1.213
GrK5.1.284
Sō lach doch mool!
GrK1.1.213
GrK5.1.282
Ėn Vergeet-mi-ni
GrK1.1.215
GrK5.1.287
Ut dėn Swonenweg
Klockenlüden
GrK1.1.216
GrK5.1.365
Mien Pōōrt
GrK1.1.219
GrK5.1.367
Fief niede Lēder tō’n Singen
Dor wēēr ėn lüttje Buurdēērn
GrK1.1.220
GrK5.1.288
Dor geiht ėn Beek
GrK1.1.221
GrK5.1.367
Ōh, wullt’ mi ni mithėbben?
GrK1.1.223
GrK5.1.292
Hē sä mi sō veel
GrK1.1.223
GrK5.1.367
Mien Anna is ėn Rōōs sō rōōt
GrK1.1.224
GrK5.1.295
Dööntjes
GrK1.1.225
GrK5.1.296
Ōle Lēder
1. Kukuuk
GrK1.1.229
GrK5.1.310
2. De Jäger
GrK1.1.230
GrK5.1.309
3. De Lōōtsendochter
GrK1.1.231
GrK5.1.311
4. Schippers Bruut
GrK1.1.231
GrK5.1.312
5. Twēē Lēēfsten
GrK1.1.232
GrK5.1.314
6. Bi Nōōrwōōld
GrK1.1.233
GrK5.1.316
7. De Stēēn bi Schâlkholt
GrK1.1.234
GrK5.1.318
8. Dat kohle Graff
GrK1.1.235
GrK5.1.320
Ut de Masch
1. Dat Ünnermēēl
GrK1.1.236
GrK5.1.322
2. De Vullmacht
GrK1.1.240
GrK5.1.327
3. Dat Schicksol
GrK1.1.248
GrK5.1.336
Spröök
GrK1.1.253
GrK5.1.342
Ėn Lēderkranz
1. Dat Huus
GrK1.1.255
GrK5.1.344
2. De Goorn
GrK1.1.255
GrK5.1.345
3. De ōl’ Wichel
GrK1.1.256
GrK5.1.347
4. Vör Döör
GrK1.1.257
GrK5.1.349
5. Tō Bett
GrK1.1.257
GrK5.1.351
Drēē Vogeln
1. Goldhohn
GrK1.1.258
GrK5.1.353
2. De Duuv
GrK1.1.258
GrK5.1.354
3. Nachtrieder
GrK1.1.259
GrK5.1.355
Tō’t Ėnn
1. Vullmacht sien Tweeschens
GrK1.1.260
GrK5.1.356
2. Wohr di!
GrK1.1.260
GrK5.1.357
3. Wo hēēt sē doch?
GrK1.1.261
GrK5.1.359
4. Tȫȫv mool!
GrK1.1.262
GrK5.1.360
5. Verloren
GrK1.1.262
GrK5.1.361
För de Gören
|Für die Kleinen
1. Still mien Hanne
|Still, mein Hannchen
(GrK1.1.008 – Kiek ōōk GrK5.1.028 un ōōk GrK2.018!)
Still, mien Hanne, hȫȫr mi tō!
|Still, mein Hannchen (Hanna)
Lütte Müüs, dē piept in’t Strōh,
|Kleine Mäuse piepen im Stroh
lütte Vogeln sloopt in’ Bōōm,
|kleine Vögel schlafen im Baum
rȫhrt de Flünk un piept in’ Drōōm.
|bewegen die Flügel … Traum
Still, mien Hanne, hȫȫr mi an!
|Still, mein Hannchen, höre mich an!
Buten geiht de bȫse Mann,
|Draußen geht
boḃen geiht de stille Moon:
|oben geht der stille Mond:
„Kind, ’kēēnX29c hett dat Schriegen doon?“
|wer hat da geschrieen?
Över’n Bōōm sō still un blank,
över’t Huus an’ Heḃen lanġ
|über dem Haus am Himmel entlang
un wōX31 hē frome Kinner süht,
|und wo er artige Kinder sieht
kiek mool an, wo lacht hē blied!
|sieh … an, wie lacht er freundlich!
Dėnn seggt hē tō dėn bȫsen Mann,
|Dann sagt er zu dem
süm|seX04 wüllt ėn beten wiedergohn.
|sie wollen etwas weitergehen
Dėnn goht süm|seX04 beid’, dėnn stoht süm|seX04 beid’
|gehen
över’t Mōōr un över de Heid.
|über dem Moor und über der Heide
Still, mien Hanne, sloop mool roor!
|schlaf mal schön!
Morgen is hē wedderX41a dor,
|wieder da,
rein sō geel, rein sō blank,
|genauso gelb, ebenso blank,
över’n Bōōm an’ Heḃen lanġ!
(GrK1.1.009)
ÂllX26 in’t Gras de gelen Blȫȫm,
|All’ im Gras die gelben Blumen,
Vogeln piept in’e Appelbȫȫm!
|Vögel piepen in den Apfelbäumen!
Still, un mook de Ōgen tō,
|Still, und mache die Augen zu,
lütte Müüs, dē piept in’t Strōh.
2. Snēēwittjen
|Schneewittchen
(GrK1.1.009 – Kiek ōōk GrK5.1.029!)
Hârr mien Hanne Steveln an,
|Hätte meine Hanna Stiefel an,
sō lēēp sē in’e Stuuv,
|so liefe sie in der Stube,
un hârr mien Hanne Flünken an,
|Flügel
sō flōōg sē as ėn Duuv.
|so flöge sie wie eine Taube.
Un flōōg sē as ėn witte Duuv
un sett sik op ėn Pohl,
|und setzte sich auf einen Pfahl,
sō rēpen âllX26 de Kinner luut:
|so riefen alle Kinder laut
Snēēwittjen, koom hėndool!
|Schneewittchen, komm herab!
3. Utsichten
|Aussichten
(GrK1.1.009 – Kiek ōōk GrK5.1.030!)
Un wėnn mien Hanne lōpen kann,
|meine Hanna laufen kann,
sō goht wi beid’n spazēren.
|so gehen wir beide spazieren
Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:
|sagen die Kinder alle zusammen
Wat’s dat för ėn lüttje Dēērn?
|Was ist das für ein kleines Mädchen?
Un wėnn mien Hanne grötter wârrt,
|größer wird,
sō kriggt sē ėn smucken Hōōt.
|bekommt sie einen hübschen Hut.
Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:
WoX30 wârrt mien Hanne grōōt!
|Wie wird meine Hanna groß!
Un wėnn sē noch veel grötter wârrt,
sō kennt süm|seX04 ehr niX20 mēhr.
|so kennen sie sie nicht mehr.
Dėnn seġġt de Kinner âlltōhōōp:
Prinzess, dē kēēm dorher!
|Eine Prinzessin käme daher!
4. Hevelmann
|Kleiner Mann
(GrK1.1.010 – Kiek ōōk GrK5.1.030!)
Mien Hanne is ėn Hevelmann,
|Mein Hansi ist ein Hätschelmann,
hett splinterniede Steveln an,
|hat nagelneue Stiefel an,
un ridd de Jung ėn Hüttjepeerd,
|und reitet der Junge ein Hottepferd
sō is hē noch ėn Düttjen wēērt.
|Düttjen: Silbermünze von ca. 20 Pf
Mien Hanne wârrt ėn Knevel ut
|Aus Hansi wird ein Held
un kriggt ėn blanken Sovel ruut,
|kriegt ’nen blanken Säbel raus,
un ridd hē dėnn ėn Sodelpeerd,
|und reitet er dann ein Sattelpferd,
sō is hē hunnert Doler wēērt!
|so ist er 100 Taler wert!
5. Dor wohn ėn Mann
|Da wohnte ein Mann
(GrK1.1.010 – Kiek ōōk GrK5.1.031 un ōōk GrK2.020!)
Dor wohn ėn Mann in’t grȫne Gras,
|wohnte
dē hârr kēēn Schöttel, hârr kēēn Tass,
|hatte keine Schüssel
dē drunk dat Woter, wōX31 hē’t funn,
|trank das Wasser, wo er’s fand
dē plück de KassbeinX71, wō dē stunn’n.
|pflückte die Kirschen, wo
Wat wēēr’t ėn Mann! Wat wēēr’t ėn Mann!
|Was war’s ein Mann!
Dē hârr niX20 Putt, dē hârr niX20 Pann,
|hatte nicht Topf, nicht Pfanne,
dē ēēt de Appeln vun de Bȫȫm,
|aß die Äpfel von den Bäumen,
dē hârr ėn Bett vun luter Blȫȫm.
|hatte ein Bett von lauter Blumen.
De Sünn, dat wēēr sien Taschenuhr,
|Die Sonne
dat Holt, dat wēēr sien Vogelbuur,
|der Wald war sein Vogelbauer
dē sungen ėm oḃends över’n Kopp,
|sangen ihm … überm Kopf
dē woken ėm an’ Morgen op.
|die weckten ihn am Morgen auf.
De Mann, dat wēēr ėn nârrschen Mann,
|ein närrischer Mann,
de Mann, dē fung dat Gruveln an:
|der fing zu grübeln an:
Nu mööt|möö’X61 wi âll in Hüüs hier wohn’n. –
|Nun müssen wir alle
Koom mit, wi wüllt|wöötX63 in’t Grȫne gohn!
|Komm mit, wir wollen
6. Wat ēēnX29awârrn kann, wėnn ēēnX29ablōōts de Vogeln richtig verstohn deit
Ėn Märken
(GrK1.1.011 – Kiek ōōk GrK5.1.033 un ōōk GrK2.020!)
Dor wēēr ōōkX22 mool ėn Mann, un de Mann hârr ėn lütten Jung |Sohn. De Mann wohn |wohnte in’t Holt |Gehölz un fung Vogeln, un de Jung muss |musste ėm hölpen. Dat much |mochte hē wull. In’ Hârvst fungen süm|seX04 Kramsvogeln |Wachholderdrosseln un Drōōsseln |Amseln(?), dē wēērn âll |alle dōōt un hungen in’e Sneren |Dohnen (Schlingen), kopplangs |kopfüber an’e Bēēn, hēēlX29b trurig. In’ Winter fungen süm|seX04 Steilitschen |Stieglitze in ėn Slagbuur |Fangbauer; dē wēērn âllX26 lebennig un hârrn ėn bunten Kopp. Dē spelen |spielten in’t Buur |Vogelbauer un lēhren* |lernten Woter roptrecken |heraufziehen in ėn Fingerhōōt un Kanârjensoot |Kanarienfutter in ėn lütten Woog |Wagen. Over in’t Frȫhjohr, dėnn söchen |suchten süm|seX04 Lurkennesten |Lerchennester un Iritschen |Hänflinge. De Lurken buen |›buden‹X55 in’t Gras, dat wēēr grȫȫn un quutsch |quatschte ēēn |einem ünner de Fȫȫt; dėnn kēēm dor ėn drȫgen Rüüschenpull |Binsenbüschel, un dor wēēr dat wârme Nest ünner mit graubunte |graugesprenkelten Eier. De Iritschen buen |›buden‹X55 in’e Heilōh |Heide, dē wēēr bruun; ōōk manġ dėn Porst |dem Gagel=Wilden Rosmarin. Un wėnn ēēnX29a dor rumstēēg |herumstieg, bet an’e Knēēn, sō rüük |duftete dat krüderig |würzig, un de Nesten wēērn vull glatte swatte Peerhoor un hungen nüüdli manġ de Twiegen. Over dat Schȫȫnste wēēr in’t Holt |Gehölz, wėnn de Slötelblȫȫm |Primeln kēmen mit de Knuppens |Knospen ut dat drȫge Sprock |dem dürrenReisig, wōX31 de Sünndrang |Blindschleiche lēēg |lag un de Mierēēms |Ameisen krōpen as |umherzogen wie Suldoten. Dor wēērn de Nachtigolen un worrn |wurden fungen in ėn Nett. Dor sēēt de Jung tō luren |und lauerte, bet dor ēēn inkēēm |hineingeriet. Hē hȫȫrX65|hörte no de IeḃenX76|Bienen un dėn Woterbeek |Bach un hârr de Fȫȫt in’e Sünn. Ōōk hârr hē sien ēgen Gedanken. Over in’ Winter sēēt hē in’e Stuuv un richt |richtete de Steilitschen |Distelfinken af, un de Snēē lēēg buten op de Bȫȫm.
Dor hârr hē wēnig bi tō dōōn, man veel bi tō dėnken, un hē worr ümmerX21 grötter un klȫker. Dėnn hȫȫrX65 hē wull no de annern Vogeln in’t Buur. De Lüüd sään |sagten, süm|seX04 sungen |sängen, over hē mârk |merkte dat bâld, dat schien |lēēt man |nur sō, dat wēēr nix as Snacken un Vertellen. (GrK1.1.012) Hē kunn dor man ēērst |da nur zuerst gor niX20 achterkomen |hintersteigen, as wėnn ēēnX29a Däänsch hȫȫrt ōder de Oonten |Enten; over nȫȫssen |später lēhr* |lernte hē dat. DōX23 hȫȫrX65 hē, wo |wie süm|seX04 sik lange Geschichten vertellen |erzählten vun dėn Roov |dem Raben, dėn Spitzbōōv, un dėn Hööv |Habicht, dėn grōten Rȫverhȫȫftmann. Dėnn snacken |redeten süm|seX04 vun dat wunnerschȫne Holt |Gehölz un de Kanēēlblȫȫm |dem blauen Flieder, un dē reist |gereist wēērn, snacken vun Itooljen |Italien. Mėnnigmool |Oft fungen süm|seX04 âll an tō wēnen, over Tronen hârrn süm|seX04 niX20. Un sien VoderX11 sä |sagte dėnn: Nu sungen süm|seX04 mool |nochmal so nüüdli!
Mool |Einmal gung de Jung vör de Döör, as de Snēē wegdau |wegtaute. De Hȫhner sēten |saßen jüst ünner’n Tuun |Hecke un sünnen |sonnten sik. Süm|SeX04 hârrn jēēdēēn ėn Lock in dėn Sand kleit |gekratzt, dor lēgen |lagen süm|seX04 in un puken |pickten mit’n Snovel. De Hohn hârr dat gröttste Lock. – De Jung kēēm man eḃen ut’ Huus, dō flōgen süm|seX04 âll op, as wėnn de Hööv |Habicht kēēm, un hē hȫȫrX65|hörte dėn Hohn:
Küken neiht ut |reißt aus, Küken neiht ut, dat is kēēn Gō…dėnX50|kein Guter!
Un âll verstēken |versteckten sik achter’n Tuun |hinter der Hecke.
Dō gung de Jung langs dėn Hof, wō de Huuslünk |Spatz ümmerX21 Börgerverēēn |Versammlung hârr. Over nu wēērn annere Tieden, un de Lünken flōgen in dėn Busch, un süm|seX04 kēken listig achter de Twiegen ruut un rēpen âll mitėnanner:
Dat’s ėn Spiōōn, dat’s ėn Spiōōn!
Over an ēēkligsten wēēr, wat Geelgȫȫschen |Goldammer sä. Dē sēēt op ėn sōren |dürren Twieg boḃen in’e Spitz, trock |zog de FeddernX41e rein slurig |sehr bedrückt tōhōōp, sēhg |sah ėm sō duursoom |mitleidsvoll an un sä trurig:
Junġ, junġ, junġ verdor…ḃen!
Un sien Fru op de anner’ Spitz antwōōr |antwortete ut de Fēērn:
Junġ, junġ, junġ versōō…rt |verdorrt!
Dat kunn de Jung gor niX20 uthōlen |aushalten. Hē dach |dachte, wō schasstX62b|sollst du blōōts hėn, un lēēp no’t Holt rin. Dor sēēt over ėn Klunkroov |Kolkrabe boḃen |oben op ėn Bōōm un rēēp:
Du Nârr…r! Du Nârr…r!
(GrK1.1.013)
Dō worr de Jung dull |wütend un smēēt |warf ėm mit ėn Stēēn. Dat holp |half man |aber nix. De Swatte flōōg vör ėm her un rēēp, un de Jung lēēp achter ėm ran tō smieten |und warf. Sō kēēm hē ümmerX21 wieder no’t Holt rin |ins Gehölz. Tōletzt sēhg |sah hē ėn Bârg un ėn grōten Stēēn boḃenop. Dor flōōg de Vogel hėn un sett |setzte sik, un de Jung klatter |kletterte rop un wēēr noch hēēlX29b dull. As hē over achter dėn Stēēn kēēk, sēhg |sah hē ėn Nest, un in dat Nest wēērn allerhand blanke |glänzende Dinger. Un wat ėm an meisten gefull, dat wēēr ėn Rinġ mit ėn Stēēn in, dē blėnker |funkelte as de Oḃendstēērn. Dėn stēēk |steckte hē an sien Finger un kēēm wedderX41a in’e Hȫȫchd |nach oben. – Wat kunn hē dor wiet sēhn! Âll dat Holt |den Wald ünner de Fȫȫt, un ėn Weg lēēp dor langs, sō wiet de Ōgen man recken |nur reichten. Wō much |mochte dē hėngohn? Dat muss |musste hē doch weten |wissen, un sō gung hē ėm no |nach.
Hē gung un gung, tōletzt worr hē rein mȫȫd |sehr müde un hungerig. Dō drēēp |traf hē op ėn lüttM3 Huus. De Lüüd gēḃen |gaben ėm wat tō eten un sään |sagten, de Weg gung |führte no de Stadt, wōX31 de Kȫnig wohn |wohnte. As hē nu satt wēēr un utslopen hârr; dō gung hē wedderX41a lōōs, un tōletzt kēēm hē no de Stadt. Hē froog |fragte gliek, wō de Goldsmitt wohn |wohnte, un wies |zeigte ėm sien Rinġ un froog ėm, wat dē wēērt wēēr |wärei. De Goldsmitt sä, hē schull |sollte sik man doolsetten |hinsetzen, un lēēp dėnn gau no dėn Kȫnig un sä, nu wuss |wüsste hē, woneemX31|wo sien Rinġ wēēr |wäre, un de Dēēf |Dieb wēēr |wäre in sien Huus.
Dō gēēv de Kȫnig ėm Suldoten mit, dē kēmen un nēhmen dėn Jung sien Rinġ af un smēten |warfen ėm in ėn Tōōrn |Turm, wō niX20|weder Sünn ōder |noch Moon rinschien, dor muss |musste hē liggen |liegen. Hē wēēr rein trurig un dach |dachte an dat Holt un dėn Woterbeek un de Vogeln in’t Buur. Dat dä |tat dėn Tōōrnwächter lēēd |duur dėn Tōōrnwächter, un dē froog |fragte ėm, wattX25|ob hē ėm niX20 wat bringen kunn |könnte, dattX24 hē niX20 sō trurig wēēr |wäre. Dō sä |sagte de Jung: ›Ėn Vogel!‹ Dō broch |brachte de Wächter ėm ēēn, dat wēēr ėn Kanârjenvogel. Dē muss |musste ėm wat vertellen vun dat Eiland |von derInsel, wō hē her wēēr, wiet ut dat Woter, wō de Weg no Amēriko vörbigeiht, mit ėn grōten Bârg op, dē Füür spiegen |speien kann, un ėn ōlen grōten Bōōm. Dėnn wēnen |weinten süm|seX04 beid’ mitėnanner. Over de Tōōrnwächter mēēn, de Kanârjenvogel sung |sänge un de Jung duur doröver |un dėn Jung dä dat lēēd, un gung hėn un vertell |erzählte dat dėn Kȫnig.
De Kȫnig hârr |hatte ėn Dochter, dē wēēr hēēl|›heel‹ smuck |hübsch, over (GrK1.1.014) veelmools wēēr sē trurig. De Lüüd wussen |wussten gor niX20, wō dat vun kēēm, un sään, sē wēēr |wäre melanchōōlsch. De Kȫnig wuss |wusste dat wull, man hē kunn ehr gor niX20 hölpen.
As hē dat hȫȫrX65 vun dėn Jung, dō lēēt |ließ hē ėm holen un befroog |erfragte sik de hēleX29b Geschicht. Un de Jung vertell |erzählte ėm, wosückX30|wie de Lünken ėm utschollen |ausgescholten hârrn, un de Roov |Rabe hârr ėm nârrt |genasführt, un nu muss |müsse hē jammern as de Vogeln in’t Buur |Käfig; dėnn hē verstunn |verstünde âllns, wat süm|seX04 sään |sagten. Dō lēēt de Kȫnig ėm in de Stuuv |in die Stube, wō sien Dochter wēēr, un wies |zeigte ėm ėn Buur. Dor wēēr ėn lütten grauen Vogel in, dē sung rein wunnerschȫȫn, over sō trurig. Un jēēdēēn Mool, wėnn hē sung, sō wuss de Prinzess niX20, wo |wie ehr tōmōōt worr |zumute wurde. Un ōōk de Kȫnig mēēn, sē kunn noch mool melanchōōlsch wârrn. De Jung hȫȫrX65 dėn Vogel un sä, hē wuss |wisse wull, wat hē singen dä. Over hē dörs |dürfte dat niX20 sėggen, dėnn de Kȫnig worr |würde dull |ärgerlich wârrn. Dō sä de Kȫnig, hē schull |sollte dat man |nur sėggen. Un wėnn dat noch sō wat Slimms wēēr |wäre, sō schull |sollte ėm dor nix för doon wârrn. Dō sä de Jung: ›Dėnn will ik dat sėggen!‹. Un hē sä, datt de Vogel sung:
Kronen von Gold sind eitel Schein.Krone des Lebens ist Liebe allein.
As dat de Dochter hȫȫrX65, dō fung sē an tō wēnen. Over de Kȫnig sä, dat wēēr recht, nu schull |sollte de Vogel flēgen, un de Jung schull sien Dochter hėbben. – Un sō worr de Jung ōōk Minister, sō as alX26 frȫher mool ēēn |einer Kaiser worrn is, dē ōōk Vogeln grēēp |griff in’t Lauenborger Holt |Gehölz. Un dē hârr ōōk recht tōhȫȫrt un kunn mēhr as Brōōt eten: Dē verstunn dėn Wüppstēērt |Bachstelze un dėn Plōōgstēērt |Schafstelze un dėn Huuslünk ünner’n Ōken |unterm Dachbodenwinkel. Over de Vogeln, dē dor sungen, dē dä |tat hē niX20 in’t Buur. Un vun âll de Blööd |Blättern an de Bȫȫm klingt dat noch:
Hinnerk de GōdeX50
7. Prinzess
|Prinzessin
(GrK1.1.014 – Kiek ōōk GrK5.1.040 un ōōk GrK2.030!)
Sē wēēr as ėn Pöppen, sō smuck un sō klēēn,
|Püppchen
sēēt mi in’e Schummern tō drȫmen op’e Knēēn.
(GrK1.1.015)
Sē foot mi de Hand, un ik strook ehr Gesicht,
|fasste … streichelte
vertell ik ehr ümmerX21 de ōle Geschicht:
|erzählte
„Dor wēēr ėn Prinzess un dē sēēt in ėn Buur,
|in einem Käfig
hârr Hoor as vun Gold un sēēt ümmerX21 un luur:
|und wartete
DōX23 kēēm mool ėn Prinz, un dē hool ehr dor ruut
|holte sie
un hē worr de Kȫnig, un sē worr de Bruut.“
Un gau is sē wussen, un nu is sē grōōt!
|schnell … gewachsen
Sē sitt mi in’e Schummern noch still op’n Schōōt.
Sē höllt mi de Hand, un ik küss ehr Gesicht,
vertell ik ehr ümmerX21 de ōle Geschicht:
„Dor wēēr ėn Prinzess mool, dē sēēt bi ėn Buur,
hârr Hoor as vun Gold un sēēt ümmerX21 un luur.
Dō kēēm mool ėn Prinz, un dē hool ehr dor ruut,
un ik bün de Kȫnig, un du büst de Bruut!“
8. Kanēēljuud
|Zimtjude
(GrK1.1.015 – Kiek ōōk GrK5.1.041 un ōōk GrK2.034!)
Luurlütten Kanēēljuud,
|(Schmähname für jüdischen Kleinhändler)
wat süht hē verdwēēr ut!
|wie sieht er verquer=wunderlich aus
Hangt Band ut, hangt Trand ut,
|Hängt Band aus, hängt Tand aus
hannelt allerallerhand GrandgutX50.
|mit allerhand Kleinkram
„Isook, is dat Schipp komen,
|Isaak, ist das Schiff gekommen
is mien Sovel mitkomen?“
|ist mein Säbel mitgekommen
„Krieg ik ėn Woog nu, krieg ik ėn Popp,
|Bekomm’ ich … Wagen
krieg ik mien Hōōt mit FeddernX41e op?“
|Hut mit Federn drauf
„Kinner, noch nichtX20,
tōkomen Johr kummt dat vėllicht!
|nächstes Jahr vielleicht
Dat Woter wēēr dick worrn,
|war dick geworden
määt teben bet de Glicksoorn!“
|Glücksernte (GrK1.1.016)
Luurlütten Kanēēljuud!
Wat süht hē fidēēl ut!
|Wie sieht er doch lustig aus!
Sō afschoren, sō utfroren,
|So heruntergekommen … ausgepowert
snackt jimmer, jimmer vun de Glücksoorn.
Obraham, wōX31 büst du,
|Abraham
Voder Obram, sühst du?
|Abram
Truurbōōm vun Bobylon,
|Trauerbaum von Babylon
wō is de klōke Solomon?
|der weise Salomon
9. Regenlēēd
|Regenlied
(GrK1.1.016 – Kiek ōōk GrK5.1.038 un ōōk GrK2.032!)
Regen, Regen, druus,
|riesele
wi sitt hier wârm in’t Huus!
|wir sitzen hier warm im Haus
De Vogeln sitt in’ Bōōm tō kuren,
|sitzen kauernd im Baum
de Kȫh, dē stoht an’ Wâll tō schuren:
|Schutz suchend am Wall
Regen, Regen, druus,
wi sitt hier wârm in’t Huus!
Regen, Regen, ruusch,
|rausche
woX30 rüükt dat ut dėn Busch!
|wie duftet’s aus dem Busch
De Blȫȫm, dē hangt sō slooprig dool,
|Blumen hängen schläfrig
de Bȫȫm, dē rȫhrt de Blööd niX20 mool:
|die Bäume, die rühren
Regen, Regen, ruusch,
die Blätter nicht einmal
wo rüükt dat ut dėn Busch!
Regen, Regen, suus
|saus’
vun boḃen op uns Huus,
vun’t Dack hėndool in strieken Strōōm
|Dack (Reeteindeckung) … in Bindfäden
un liesen ut dėn Eschenbōōm:
|und leise aus der Esche
Regen, Regen, suus
vun boḃen op uns Huus.
Regen, Regen, rull,
|rolle
bet âllX26 de GrȫḃenX75 vull!
|bis alle Gräben voll (GrK1.1.017)
Dėnn loot de Wulken övergohn,
|lass die Wolken weiterziehen
un loot de Sünn man wedderkomenX41a:
|die Sonne wiederkommen
Regen, Regen, rull,
bet âll de Grȫḃen vull!
10. Buussemann
|Butzemann
(GrK1.1.017 – Kiek ōōk GrK5.1.042 un ōōk GrK2.036!)
De ōl’ Pēter Kruus,
dē hett ėn Kabuus,
|Kabüüs (alte Hütte, enge Stube, Kabuff; Kombüse!)
dē hett ėn Kabüüssel,
|Kabüffchen
dor sitt hē in’ Drüüssel,
|Halbschlaf=Schlummer
dor sitt hē un slummert, de Oḃend, dē schummert;
|dämmert
Dėnn huult de Wind,
|Dann heult
dėnn tuult|huult dat Kind,
|dann weint
dėnn wârrt Pēter Kruus
as ėn Muus sō geswind!
De ōl’ Pēter Kruus,
dē hett ėn Karduus,
|Kästchen (aus ›cartouche‹, daraus Kartusche)
dor hett hē ėn Pack in
|Päckchen
vun Petum-Tobak in.
|besonders gängiger europäischer Rauchtabak
Hē stoppt sik ėn Brösel,
|Er stopft sich ein Pfeifchen (kurze Pfeife)
hē pafft in sien Kösel,
|er qualmt in seinem Häuschen
hē sitt tō karmüüsseln,
|er sitzt und sinniert
hē löhnt sik tō drüüsseln:
|er lehnt sich an, um zu schlummern
Doch hȫȫrt hē dėn Wind
un rȫhrt sik dat Kind,
sō kummt Pēter Kruus
in ėn Suus geswind!
|in Fahrt=Saus geschwind
De ōl’ Pēter Kruus,
dē hett ėn Kapuuz,
|Kapuze (GrK1.1.018)
dē is ruug as ėn Pudel
|die ist rau wie ein Pudel
un spitz as ėn Buddel.
|und spitz wie eine Flasche
Un weiht dėnn de Wind
un schriggt dėnn dat Kind,
|schreit
sō kummt Pēter Kruus
ut’ Huus sō geswind!
De Fischer
|Der Fischer
(GrK1.1.018 – Kiek ōōk GrK5.1.051 un ōōk GrK2.040!)
Schȫn’ Anna stunn vör Strotendöör,
vör Strotendöör,
de Fischer gung vörbi:
„Schȫn’ Anna, knüttst du blaue Strümp,
|strickst du
dē blauen Strümp,
dē knüttst du wull för mi?“
„Dē Strümp, dē kriggt mien Brōder an,
mien Brōder an,
wull op de blaue Sēē.
Du mookst je sülḃen dien Nett sō grōōt,
dien Nett sō grōōt,
un Strümp bet an’e Knēē.“
„Mien Nett, dat mook ik grōōt un wiet,
sō grōōt un wiet
man för dėn dummen Stöör:
|nur für den dummen Stör
Du knüttst dien Strümp sō fien un dicht,
|so fein und engmaschig
sō fien un dicht,
dor geiht kēēn Sēēl hėndör.“
|da geht keine Seele hindurch
Schȫn’ Anna, knüttst du fiene Strümp,
sōōn fiene Strümp,
un knüttst du süm|ehrX05 sō blau:
Dor fangst du âllX26 de Fischers mit,
de Fischers mit,
un wēērn süm|seX04 noch sō slau.
De Möller
|Der Müller
(GrK1.1.019 – Kiek ōōk GrK5.1.045 un ōōk GrK2.042!)
Möllerbursch, sō flink un keit,
|flink und keck=kess
woX30 hē springt, sik dreiht:
|wie er
Sien Hoor is sō pluustig,
|struppig
sien Boort is sō duustig,
|stuffig=staubig
beten Kliester op de Backen
|etwas Kleister auf den Wangen
un dėn Spitzbōōv in’ Nacken,
|und den Schalk im Nacken
flüggt rum manġ dėn Mehlstuff
|fliegt herum im Mehlstaub
kriedenwitt as ėn Duuv.
|kreideweiß wie eine Taube
Sünnoḃends, mit mien Achtendēēl,
|Scheffel (Korn)
koom ik rop no Möhl.
|komme ich zur Mühle hinauf
Dėnn geiht sē un klappert,
|Mal läuft sie und klappert
dėnn steiht hē un plappert:
|mal steht er und plappert
Wo is hē bepudert,
|Wie ist er
wat spoost hē un sludert!
|wie spaßt er und tratscht
Un wėnn ik ėm dėn Schülgen geev,
|den Schilling gebe
wo kickt hē verlēēvt!
|wie guckt er verliebt
Over kēēm hē mi tō nēēg,
|Aber träte er mir zu nahe
sett ik ėm tōrecht!
|setzte ich ihn zurecht
Wo wull ik ėm pulen,
|Wie wollte=würde ich ihn zausen
wat wull ik ėm ulen!
|wie wollte ich ihn fegen (mit dem Staubfeger)
Ik klopp ėm de Jack ut,
|Ich klopfte ihm die Jacke aus,
as stȫȫv ik ėn Sack ut!
|als staubte ich einen Sack aus!
Sunst kunnen je âll Lüüd sēhn,
|Sonst könnten ja alle sehen,
no Möhl wēēr ik weenX83
|ich wäre zur Mühle gewesen
De Melkdēērn
|Die Melkerin
(GrK1.1.019 – Kiek ōōk GrK5.1.047 un ōōk GrK2.044!)
Bârfōōt in’ Sand, in raschen Schritt,
dėn glatten Ploten kriedenwitt,
|Schürze kreideweiß (GrK1.1.020)
stramm opschört dėn Linnwullenrock,
|aufgeschürzt … Leinwollen-
um’t Lief, sō kneepsch as ėn Pietschenstock,
|den Leib … schlank
– ĒēnX29a kann ehr licht sō mit de Hannen
|Man kann sie leicht mit
vun ēēn Hüft no de anner umspannen! –
Händen umspannen
dėn ēēn Ârm sō keit in’e Siet,
|den einen Arm so keck in der Seite
as wėnn ēēnX29a dat Ȫhr vun’e Tēēkann süht,
|Griff der Teekanne
um dėn witten Hâls de grȫne Dracht:
|das Tragholz (mit Ketten)
Ėn Dēērn, datt di de Ōgen lacht!
|Ein Mädchen, dass dir … lachen!
Ėn Strōhhōōt mit ėn brēden Rand,
um’t runne Kinn ėn blassrōōtM3 Band;
dat brune Hoor, in ėn dicke Tuut,
|in dicker Flechte (dickem Zopf)
kickt jüst as ünner’n Sünnenschēērm ruut.
|guckt just wie … heraus
De Ammers klappt bi jēēdēēn Schritt,
|Die Eimer klappern
de mischen Keden klötert mit,
|die Messingketten scheppern mit
un dėnn in’t Sēēl ėn lütten Ketel,
|im Bügeltau ein kleiner Kessel,
dē rasselt as ėn Bund vull Slötel.
|der rasselt wie ein Schlüsselbund
Sē’s frȫh tō Bēēn, dat’s Sünndagoḃend,
|früh auf den Beinen
ehrn Schatt will no de Koppel komen;
|ihr Schatz will zur Weide k.
dē nimmt ehr nȫȫss de Melkdracht af:
|dann die Milchtrage ab
Sē speelt de Doom un streevt vöraf. –
|spielt die Dame, schreitet
Hē sitt un smȫȫkt op’t Heck* bi’n Wâll,
|auf dem Weidetor am Wall
wō sē dėn Snittweg langskomen schâll.
|sie die Abkürzung … wird
Kiek dor! Dor lücht sē achter’n Knick
|blitzt auf sie hinterm Knick
un dreiht herop in’ Ōgenplink.
|und dreht herauf jeden Augenblick.
Sē driggt de Dracht sō steil un nett,
|trägt … so stolz und imposant
as ėn Leutnant niX20 sien Epaulett,
|wie … nicht sein Achselstück
un smitt dėn brunen Ârm sō keit,
|wirft den braunen Arm so keck
as kēēn Mamsell op’t PeermârktX77 deit.
|Heider Pf. (GrK1.1.021)
„Jo, dat mag ’k lieden, sō hest du’t dropen!“ –
|genau so
Hē hett alX26 Dōōr un Slēētbōōm open.
|Tor und Querholz offen
Ehr Dracht un Ammer sett sē dool,
|Trage und Eimer setzt sie ab
de Hōōt hangt op dėn Heckenpohl*.
|auf dem Hecktorpfosten
Nu stiggt sē dör dat lange Gras
|steigt
un schient sō witt un hett sōōn Hast
|strahlt so weiß … hat es eilig
un singt sō nüüdli ünner de Kōh;
|singt so lieblich
de Melk suust sacht dėn Takt dortō.
|saust sanft
Dėnn schüümt de Ammers vull un vuller,
|schäumen
un ›ratsch!‹ hett Hans süm|ehrX05 op’e Schuller,
un överglückli wâlzt süm|seX04 beid’
|tanzen sie beide
mit Snack un Lachen no de Heid.
|mit Plaudern und L. nach Heide
Koomt ehr ōōk vele Herrn tōmȫȫt
|Kommen ihr auch … entgegen
un kiekt ehr no de blōten Fȫȫt
|und blicken auf ihre nackten Füße
un gluupt ehr nööswies ünner’n Hōōt –
|und glotzen ihr frech
Wârrt sē ōōk ēērst ėn beten rōōt,
|Wird sie zuerst auch etwas rot
sō dėnkt sē doch: Loot süm|ehrX05 wat mēnen,
|Lass sie ’was
ik bün sō gōōtX50 as annersēēn!
|ich bin so gut wie andere Leute!
Un lustig hüppt sē över’n Weg,
kickt in ėn Koppel över’t Steg:
|blickt in eine Weide übern Steg:
„Wullt’ mit, mien Anna? Büst’ du al kloor?“
|Willst’ mit? … Bist’ fertig?
Un kiek, mien Anna is al dor!
|Und siehe, meine Anna ist schon da!
Un ėn beten wieder op’n Weg
stoht al poor annere tōrecht.
|stehen schon einige andere bereit
Un wat för ėn Grȫten, wat för ėn Pappeln,
|Grüßen … Plappern
as hȫȫrX65 ēēnX29a ėn Koppel Oonten snabbeln!
|Schar E. schnattern
Un noch mēhr Frische koomt dortō,
|mehr Neue kommen dazu
bet no de Heid hėn geiht dat sō:
|bis hin nach Heide geht es so
Jē kötter wârrt de lange Weg,
|Je kürzer der lange Weg wird
jē länger wârrt de kotte Rēēg.
|desto länger wird die Mädchenreihe
Bi de RōhsteedX52 is dat gor ėn Jagd,
|Pausenstelle |gar eine Sause
as wėnn in’t Mōōr de Kukuuks lacht.
|lachen (GrK1.1.022)
Ėn jēde smitt ehr Dracht dor af,
|wirft dort ihr Schulterjoch ab
un pett dėnn ēērst ėn Hopser af.
|tanzt erst einmal einen Hopser
Orchester hebbt süm|seX04 ümmerX21 gliek:
|haben sie … sofort
Dē sitten geiht, dē mookt Musik,
|Wer sich setzt, der macht Musik
Polkas un Dänz vun Strauß un Lanner
|und Wiener Walzer von
un Truurlēder manġėnanner.
|und Trauerlieder durcheinander
Herrjēminē! Kummt jüst ėn Snieder
|Kommt zufällig ein Schneider
in ėn feine Büx, mit dünne Glieder:
|in feiner Hose, mit dünnen
Dē kriggt dėnn noch ėn Jackvull mit,
|noch Hohn und Spott mit
wō hē noch acht Doog nōōg an hett. –
|noch 8 Tage gut von hat
De Klock sleit söḃen, un mit dėn Slag
löppt jēēdēēn no ehr ēgen Dracht,
|läuft jede zur eigenen Trage
hangt sik ehr um, hookt in, böört op –
|hängt … um, hakt ein, hebt an
un fârdig is de hēleX29b Tropp.
|und fertig ist die ganze Schar
Ēēn Keed dėn hēlenX29b Stieg dor lanġ,
|den ganzen Weg entlang
un vörwârts geiht dat mit Gesanġ:
„Der Sultan ist ein armer Mann …“,
dē wiss sēhg sik sōōn Blōmenkeed an!
|der gewiss sähe sich
In ėn Kottijōōn un Rēgendanz
|Cotillon (frz. Gesellschaftstanz)
mookt unse Dooms niX20 sō ēēn Kranz!
Doch in’e Heid ritt hē vunēēn,
|Doch in Heide reißt er auseinander
un bâld geiht âllns ēēn bi ēēn,
|und bald laufen alle einzeln
dē dör dėn Hoff, dē um de Eck,
|die durch den Hof, die um die Ecke
dor twēē tōhōōp noch ėn lütte Streck,
|dort zwei zusammen noch
nu dē in’t Huus un dē in’ Stâll,
|nun diese ins Haus und die in den
du steihst allēēn – un dō is’t âll!
|du stehst allein – und da ist’s aus!
De ōle Hârfenspelersch
|Die alte Harfenistin
(GrK1.1.024 – Kiek ōōk GrK5.1.044 un ōōk GrK2.054!)
Ik wēēr mool junġ un schȫȫn,
|Ich war mal
dat ’s nu niX20 mēhr tō sēhn.
|das ist nun nicht mehr zu sehen.
Ik hârr de Rōsen op de Back,
|Ich hatte die Rosen auf der Wange
ik hârr de Lucken um de Nack.
|hatte die Locken um den Nacken
Wo wēēr ik junġ un schȫȫn!
|Wie war ich jung und schön!
Wat wēēr ik junġ un schȫȫn!
(GrK1.1.025)
Ik sung vör Lust un Mōōt,
|Ich sang vor Lust und Freude,
ik sung för Lütt un Grōōt.
|ich sang für Klein und Groß.
Un âll, dē mi hȫrenX65 un sēhgen,
|die mich hörten und sahen
dē sään, ik wēēr sō junġ un schȫȫn.
|die sagten, ich sei so jung un
Wat hârr ik Lust un Mōōt!
|Wie hatte ich Lust und Mut!
Wo hârr ik Lust un Mōōt!
Ik dach niX20 an de Nōōt,
ik dach niX20 an dėn Dōōd.
Vun MârktX77 tō Mârkt, vun Huus tō Huus,
un wōX31 ik kēēm, dor wēēr’t ėn Lust:
WokēēnX29c dach wull an Nōōt?
|Wer dachte wohl an Not?
’kēēnX29c dach wull an dėn Dōōd?
|Wer dachte wohl an den Tod?
Ik sing noch ümmerX21 fōōrt,
|Ich singe noch immer weiter
un kruup vun Ōōrt tō Ōōrt.
|und krieche von Ort zu Ort
Un wėnn ik sing vun Lust un Lēēv,
|singe von Lust und Liebe
’kēēnX29c froogt mi nu, worum ik beev?
|wer fragt, warum ich zittere?
Ik sing man ümmerX21 fōōrt,
|Ich singe nur immer fort





























