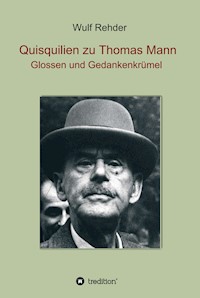
2,99 €
Mehr erfahren.
Quisquilien und Krümel-Abfälle - so hat Thomas Mann ironisch tiefstapelnd die "aberhundert Einzelinspirationen" genannt, aus denen er, wie sein Protagonist Gustav von Aschenbach, seine Werke in täglicher Arbeit "zur Größe emporgeschichtet" hat. Das Mosaik aus 150 Quisquilien in diesem Buch fügt sich zusammen aus Reflexionen über Thomas Manns Leben und Werk, aus Gedankenkrümeln zu häufigen Fragen und seltenen Zitaten, und aus Glossen zu einschlägigen Themen wie dem "kleinen Humor" und der "höheren Heiterkeit". Diese Teile verbinden sich zu einem reliefartigen Porträt Thomas Manns. Vielleicht findet sich sogar, trotz ihrer Petitesse, hier und da eine bisher unbekannte Kleinigkeit. Insbesondere für Schüler, Lehrer und Studierende gibt es Wissenswerte und Kurzweiliges zu finden. Sogar der kritische Literaturprofessor, der sicherlich ein gescheiteres Buch als dieses geschrieben hätte, soll mit Beispielen von Gelehrsamkeit angelockt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Quisquilien zu Thomas Mann
Wulf Rehder
Quisquilien zu Thomas Mann
Glossen und Gedankenkrümel
© 2017
Wulf Rehder
Kontakt:
Titelbild:
Thomas Mann 1955
Bild Copyright:
© S. Fischer Verlag GmbH
(Mit freundlicher Genehmigung)
Verlag:
tredition GmbH, Hamburg
ISBN Taschenbuch:
978-3-7345-9171-6
ISBN Hardcover:
978-3-7345-9172-3
ISBN e-Book:
978-3-7345-9173-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Carol
Inhalt
Quisquilien?
1 Leben
Zur Orientierung
Liebe, Ehe, Herzenserfahrung
Liebestrottel
Katia
Agnes E. Meyer
Paul Ehrenberg
Möbel
Das Pölchen
Der Herr und sein Hund
Bauschan und seine Freunde
Ehrendoktor
Verleihung – wofür?
Aberkennung – warum?
Wiederverleihung – wie?
Exil
Zeitplan
Quellen und Kommentare zum Exil
Politik
Links oder rechts?
Biographien
Zwei Unvollendete
Kunstwerk und Passion
Gelehrter und Professor
Das schwierige Kind
Opulent vs. Nüchtern
Auf Englisch
Kleinere biographische Arbeiten
Sonstiges
Thomas Manns Figurenkabinett
Abkonterfeit
Krankheit, Tod, Trauerrede
Nacht der Ewigkeit
2 Romane
Zur Orientierung
Buddenbrooks
Die Augen der Buddenbrooks
Bei Fontane gefunden
Königliche Hoheit
Mathematischer Hokuspokus
Der Zauberberg
Analytisches Kabinett
Der Anfang und das Ganze
Sterben eine Angelegenheit der Weiterlebenden
Schwieriger Unsinn
Fasching auf dem Zauberberg
Nachklänge der Walpurgisnacht auf dem Zauberberg
Der russische Kuss
Joseph und seine Brüder
Eine „spielerische Wissenschaft”
Doktor Faustus
Schönberg oder Wagner?
Mann und Wagner
Adrian Leverkühn und Kollegen
Professor Kumpfs „vorgebäumte“ Unterlippe
Der Erwählte
Die eigentümliche Sprache
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
Versuchte Fortsetzungen
Ein nachgelassenes Kapitel über die Twentymans
3 Erzählungen
Zur Orientierung
Der kleine Herr Friedemann
Heimsuchung
Zur Entstehung
Die Hungernden
Künstler sein oder Mensch
Das Wunderkind
Das Künstlerproblem
Tonio Kröger
Kunst und Leben
Künstlertum und Krankheit
Der Tod in Venedig
Schönheit und Eros
Liebe und Erkenntnis
Logik und dionysische Heimsuchung
Gustav von Aschenbach und Thomas Mann
Der Tod in Rom und „Der Tod in Venedig“
Liebestod auf Long Island
Mario und der Zauberer
Brief an einen Kritiker
Die Betrogene
„Sehr kritisierbar“
Quellen
Fiorenza
Die „Gladius Dei“ Epoche
4 Essays
Zur Orientierung
Polemik
Gut geschriebene Niederträchtigkeiten
Giftiges Gejökel
Ein politischer Schriftsteller?
Vom kommenden Sieg der Demokratie
Brief nach Deutschland
Deutschland und die Deutschen
Deutsche Hörer
Vier weitere politische Aufsätze
Einschätzungen Für und Wider
Ein neues Genre?
Ein Erzähler, der sich spiegelt
Beim Lesen von Hermann Kurzkes Essay zu den Betrachtungen eines Unpolitischen
Neuorientierung oder Freispruch aus Mangel an Haftbarkeit?
Skorpion oder harmloses Biest?
Worum es geht
Kurzkes eindrucksvolle Synthese
Fatale Geistesverwandtschaft?
Die Chinesen haben Recht!
Vaterländerei und Zivilisation
Hass – auf Demokratie und Parlament
Lediglich ästhetizistisches Theater?
Haben Dichterworte Konsequenzen?
Zum Weiterlesen
Wer ist der „zeitgenössische Denker“ in den Betrachtungen eines Unpolitischen?
Das Zitat
Drei Kandidaten
Auf der Fährte
Der Denker: Thomas Mann, frei nach Emil Hammacher
5 Nicht buchgerecht
Zur Orientierung
Der „kleine Humor“
Witz als Inkongruenz
Komischer Kitsch
Auslachen, Verhöhnen, Schadenfreude
Das Lachen
Das nicht geheuere Lachen
Triumphgelächter der Hölle
Zähne bleckendes Lachen in „Der Tod in Venedig“
Das Lachen auf dem Zauberberg
Das Lachen in Weimar
Erinnern und Vergessen
Der raunende Beschwörer des Imperfekts
Tony erinnert sich und Hanno vergisst
Nostalgischer Besuch in Weimar
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit
Selbstvergessenheit I
Selbstvergessenheit II
Selbstvergessenheit III
Buchgerechtes über Erinnern, Vergessen, Selbstvergessen
Nackte Arme und schöne Beine
Gefallen
Der kleine Herr Friedemann
Königliche Hoheit
Doktor Faustus
Ein Glück
Wälsungenblut
Die vertauschten Köpfe
Die Betrogene
Der Zauberberg
Felix Krull
Liebe und Geschlechtliches
Szenen der Liebe
Das Sinnlichste
Hunde im Souterrain
Eine Freudsche Fehlleistung?
Glück
Thomas im Glück
Zu Tisch
Bei Buddenbrooks zu Tisch
Sport
Turnspiele
Vokabular
Lieblingswörter
Dr. phil. Serenus Zeitblom
Biograph Zeitblom und Dr. Watson
Kritiker Zeitblom und Sancho Panza
Kollege Zeitblom und Frau Teste
Der kurze Satz
„In dieser Art. Gar nicht ungeschickt.“
„Ich liebe dich!“
„Goethe starb schreibend.“
Kitsch
„Anna, arme kleine Baronin Anna”
Siegmund und Sieglinde
6 Zitatenkrümel
Zur Orientierung
Bildung, die einem im Schlafe anfliegt
Kostbare Zeit
Moral: non dans la vertu ...
Moral: Wille zum Werk
Über Freude – ein Zitat Thomas Manns?
Kunst
Zitat von ... Horace Mann
Phantasie
Literatur und Schein
Tschechow als Spiegel
Kapitalismus und Dekadenz
Buddenbrook als Kapitalismuskritik?
Krötenküsser, Kammerer und Kuckuck
Sterben, Leben, Gegenwärtigkeit
Bild und Wortmalerei
Ton und Stil
Stil und Inkongruenz
Sein und Seele
Weihnachtsgedicht
Okkultes
Lebenszittern
Heinrich, nicht Thomas
Wissenschaftliche Arbeiten, die zu schreiben wären
7 Erben
Zur Orientierung
Anreger und Nachfolger
Uwe Tellkamp
Pawel Huelle
Jonathan Franzen
Philip Roth
Richard Powers
Walter Kempowski
Thorsten Becker
Andrej Dmitriew
Geoff Dyer
Michael Cunningham
Daniel Kehlmann
Notiz über den Autor
Quisquilien?
Thomas Mann hat das Wort selbst mehrmals gebraucht: Quisquilien. Er hat diese lateinische Vokabel zur Bezeichnung geringfügiger Nebensachen passenderweise dem promovierten Philologen Serenus Zeitblom in die Feder diktiert, der sich beim Leser dafür entschuldigt, in den Erinnerungen an seinen Freund Adrian Leverkühn, den Doktor Faustus, so viele „Quisquilien und Krümel-Abfälle” aufgenommen zu haben. Diese Einzelheiten seien „nicht buchgerecht,” fährt Zeitblom fort, „sie mögen in den Augen des Lesers etwas Läppisches haben.” In dieser ironischen Tiefstapelei versteckt ist jedoch Thomas Manns Überzeugung, dass – ganz im Gegenteil – der Künstler erst durch die Komposition all der vermeintlichen Nichtigkeiten das Gesamtwerk hervorbringt. So wie Gustav von Aschenbach, alias Thomas Mann, seine berühmten Bücher „in kleinen Tagewerken aus aberhundert Einzelinspirationen zur Größe emporgeschichtet“ hat.
In diesem Buch erwartet den Leser ein Mosaik von Quisquilien verschiedenster Art: Reflexionen zu Passagen und Figuren aus Thomas Manns Werk, Nachrichten aus seinem Leben, Diskussionen versteckter Zitate, essayistische Kommentare zu einschlägigen Themen wie dem „kleinen Humor“, und Glossen zu denBetrachtungen eines Unpolitischen. Die Quisquilien bürsten Altgewohntes gegen den Strich. Das Ergebnis? Zwar nicht völlig buchgerecht, aber hoffentlich auch nicht läppisch, sondern – mit etwas Wohlwollen auf Seiten des Lesers – ein bisschen unterhaltsam. Vielleicht findet sich sogar, trotz ihrer Petitesse, hier und dort eine bisher unbekannte Kleinigkeit.
Wer also sind die geeigneten, die idealen Leser der Quisquilien? Schüler, die ein oder zwei Werke von Thomas Mann lesen müssen? Lehrer, die damals, als sie noch Zeit zum Lesen hatten, von Thomas Mann begeistert waren und nun von ihren Schülern Gleiches erhoffen? Oder Studierende, die, im dritten Semester bereits lesemüde, sich anregen lassen wollen zu einer Hausarbeit? Für alle drei: Schüler, Lehrer, Studierende, gibt es hier hoffentlich Wissenswertes und Kurzweiliges zu finden. Sogar der kritische Literaturprofessor, der sicherlich ein gescheiteres Buch als dieses geschrieben hätte, soll durch einschlägige Literaturhinweise und gelehrte Gedankenkrümel angelockt werden.
Der Stil der Quisquilien wird an feuilletonistische Kabinettstücke und Streiflichter in Literaturbeilagen erinnern, oder an eine bekannte Melodie, die mit überraschenden Harmonien, oder Dissonanzen, wieder neu aufersteht. Diese Textstücke wollen überzeugen, aber auch zum Widerspruch einladen. Man darf keine Hofberichtserstattung erwarten. Stattdessen soll, wie Thomas Mann es selbst einmal ausgedrückt hat, auch die „nachhinkende Kritik” zu Wort kommen.
Die meisten Glossen und Gedankenkrümel sind überarbeitete Beiträge, die ich im Thomas Mann Forum thomasmann.de des S. Fischer Verlags beigetragen habe. Die 150 hier versammelten Quisquilien werden sich zwar nicht „zur Größe“ emporschichten, wollen sich aber doch am Ende zu einem reliefartigen Porträt Thomas Manns zusammenfügen.
Ohne den Zuspruch von Roland Spahr, Lektor beim S. Fischer Verlag und unermüdlich treibende Kraft bei der Fertigstellung derGroßen Kommentierten Frankfurter Ausgabe, hätte die für diese Quisquilien nötige, oft umständliche Detektivarbeit viel weniger Spaß gemacht, und ohne seine freundschaftliche Hilfe wären sie nie über die ersten Krümel-Abfälle hinausgekommen.
1
Leben
Zur Orientierung:Thomas Mann lebte von 1875 bis 1955. Der RomanBuddenbrooks, für den er 1929 den Nobelpreis erhielt, wurde bereits 1901 publiziert. 1905 heiratete er Katia Pringsheim, mit der er sechs Kinder hatte. Lebenslang im Bann anarchischer homoerotischer Gefühle, oft genug in Worten ausgedrückt aber nie in der Tat ausgelebt, war er dankbar, dass Katia ihm durch die Ehe eine bürgerliche „Verfassung“ gab. Während er sich mit eiserner Disziplin seinem Lebenswerk widmete, war sie für Haus und Kinder verantwortlich und agierte, mit Tochter Erika, als geschäftige Vermittlerin zwischen ihrem Mann und der Welt jenseits des Schreibtisches. 1919 wurde Thomas Mann von der Bonner Universität der Ehrendoktor verliehen, der ihm 1936 aberkannt und 1946 wieder zuerkannt wurde. Seit 1933 im Schweizer Exil, wanderte Thomas Mann 1938 mit Katia und den Kindern nach Amerika aus. Er äußerte sich zu politischen Themen und sprach im britischen Rundfunk zu deutschen Hörern. Seine Zeit im amerikanischen Exil, erst in Princeton, dann in Pacific Palisades nahe Santa Monica in Kalifornien, dauerte bis 1952. Er kehrte nicht nach Deutschland zurück, sondern verbrachte an der Seite Katias seinen Lebensabend in der Schweiz. Dort, in Kilchberg, liegt er begraben.
Liebe, Ehe, Herzenserfahrung
Liebestrottel
Frage:Wo steht: „Wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel.“
Antwort:Dies ist ein Zitat aus einem Liebesbrief Thomas Manns an Katia aus dem Jahr 1904, vermutlich Anfang Juni, als Thomas Manns sogenannte Wartezeit begann und Katia sich nicht recht entschließen konnte, seine Werbung anzunehmen. Das volle Zitat lautet: „Wer niemals Zweifel, niemals Befremden, niemals, sit venia verbo, ein wenig Grauen erregt, wer einfach immer nur geliebt wird, ist ein Trottel, eine Lichtgestalt, eine ironische Figur. Ich habe keinen Ehrgeiz in dieser Richtung.“ (Briefe I, 1899-1936, hg. Erika Mann, S. 43/4). Einiges aus diesen Briefen und vieles andere aus Thomas Manns ehelicher Erfahrung und außerehelicher Phantasiefindet sich bekanntlich im RomanKönigliche Hoheitwieder, in dem Prinz Klaus Heinrich den Autor Thomas spielt und Imma Spoelmann seine junge Frau Katia.
Thomas’ Liebe zu Katia zeigte sich im Laufe der Ehe mehr und mehr in Äußerungen der Dankbarkeit, aber auch dann in eigensinniger Art, wie seine Rede zu ihrem siebzigsten Geburtstag zeigt: „Katia Mann zum siebzigsten Geburtstag“ inEssays 1945-1955: Meine Zeit(hg. Kurzke/Stachorski und in anderen Ausgaben). In der Rede stehen Sätze, die mehr über Thomas Mann, den „Eheherrn“, sein von ihr behütetes Leben und seinen von ihr verwalteten Ruhm sagen als über das Geburtstagskind Katia. Zum Beispiel lesen wir: „Wenn irgend ein Nachleben mir, der Essenz meines Seins, meinem Werk beschieden ist, so wird sie mit mir leben, mir zur Seite. So lange Menschen meiner gedenken, wird ihrer gedacht sein.“
Katias Liebe und seine Dankbarkeit für ihre Fürsorge stellt Thomas Mann schon 1918 einander gegenüber, wie die Widmung verrät, die er in Katias Exemplar derBetrachtungen eines Unpolitischenschrieb. (Zu dieser Zeit war ihr fünftes Kind, Elisabeth, ein halbes Jahr alt. Katia war schwanger mit dem sechsten, Michael, der im April 1919 geboren wurde):
„Wir haben es zusammen getragen, liebes Herz, und wer weiß, wer schwerer daran zu tragen hatte, denn zuletzt hat der immerhin Thätige es leichter, als der nur Duldende. Auch trug ich es nur aus Not und Trotz, Du aber trugst es aus Liebe. Schmeichler sagen Dir wohl, es sei nichts Geringes und Leichtes, meine Gefährtin zu sein. Aber mich schmerzt das Gewissen dabei, und ich weiß wohl, daß dieser Schmerz nur durch immerwährende Dankbarkeit zu beruhigen ist.“
Katia
Frage: Gibt es ein Buch über die Ehe von Thomas und Katia Mann?
Antwort:Es gibt kein Buch mit dem TitelThomas und Katia Mann – Alles über ihre Ehe. Aber wer neugierig ist, findet genug in den folgenden Quellen:
1. Thomas Manns Aufsatz „Über die Ehe“. Der offizielle Titel lautet „Die Ehe im Übergang. Brief an den Grafen Hermann Keyserling.“ InEssays IIderGroßen Kommentierten Frankfurter Ausgabe.
Einerseits gilt für Thomas Mann, pragmatisch und nach Kant (der ein lebenslanger Junggeselle war und „viel lieber frei“ blieb): „Nach Kant wäre die Ehe dazu da, den Geschlechtsverkehr zu ermöglichen, und es gibt ja Fälle, wo dies zutrifft, wo die Leidenschaft für eine Frau, welche anders nicht zu haben ist, den Mann, der eigentlich viel lieber frei bliebe, bestimmt, sie zu heiraten.“
Oder ist die Ehe doch mehr? Er schreibt: „Die Ehe ist »gründende Liebe«, das heißt: die geschlechtliche Verbindung wird zur sakramentalen Grundlage einer dauernden, sie überlebenden Lebens- und Schicksalsgemeinschaft.“
Oder doch nicht? Vielleicht ist doch das „Geschlechtliche“ fundamentaler als die Ehe: „Die geschlechtliche Gemeinschaft, zu der die Ehe führt und die ihre sakramentale Grundlage bildet, ist etwas wesentlich anderes, Vergeistigungsfähigeres als jene, zu deren Erlangung man nicht notwendig zu heiraten brauchte.“
2. Hermann Kurzke:Thomas Mann: Das Leben als Kunstwerk. Kapitel V, X, XIII. Solide, einfühlsam, anregend, nicht übermäßig psychologisierend.
3. Nichtsine ira et studiogeschrieben sind die leicht zu findenden Autobiographien der Mann-Kinder und Katia MannsMeine ungeschriebenen Memoiren.
Mit genauso kritischem Auge sollten die folgenden vier Bücher aus zweiter Hand gelesen werden, egal, ob schmeichelhaft und bewundernd oder kritisch:
4. Inge und Walter Jens:Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim.
5. Manfred Kappeler:»Wir wurden in ein Landerziehungsheim geschickt« – Klaus Mann und seine Geschwister in Internatsschulen.
6. Andrea Wüstner:»Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam«: Die Eltern Katia und Thomas Mann.
7. Marianne Krüll:Im Netz der Zauberer. Eine andere Geschichte der Familie Mann.
Ganz ausgezeichnet ist Tilmann Lahmes BuchDie Manns – Geschichte einer Familie. Es zeichnet ein intimes Bild der Familie anhand von teilweise erst kürzlich aufgefundenen Briefen, die sich die Familienmitglieder geschrieben haben. Dabei bleibt der Autor Lahme angenehm distanziert und äußert sich, wo es angebracht ist, auch einmal ironisch oder kritisch. Die zugehörigen Briefe, darunter mehr als 100 bisher nicht bekannte, sind im BegleitbandDie Briefe der Mannsherausgegeben worden von Tilmann Lahme, Holger Pils und Kerstin Klein.
Agnes E. Meyer
Katia ehrte und beschützte ihren berühmten Gatten. Im Vergleich zu dieser eher nüchternen ehelichen Pflichtliebe erscheinen die Liebesbezeugungen von Thomas Manns amerikanischer Gönnerin, Agnes E. Meyer, geradezu überschwänglich. Thomas zeigt sich offiziell dankbar ob ihrer Hilfe, ihrer Geschenke, ihrer Bewunderung, war aber privat und in seinen Tagebüchern ablehnend und manchmal sogar grob. Ihre Annäherung an ihn oder sein Werk empfand er oft als aufdringlich.
Frage: In Breloers Film und in dem zugehörigen BuchDie Manns. Ein Jahrhundertromanzitiert Thomas Manns Sekretärin Hilde Kahn aus einem Brief, den Agnes E. Meyer an Thomas Mann geschrieben haben soll. Der Inhalt lautet in etwa: „Sie zu lieben, ist ein Solotanz, den nicht jeder hinbekommt...“
Antwort:Häufig, z.B. bei Breloer und in Zeitungsartikeln über den Film, findet man das Zitat in dieser Form: „Sie zu lieben, mein Freund, ist eine hohe Kunst, ein komplizierter Solotanz, den nicht jeder fertig bringt.“
In der Ausgabe des Briefwechsels zwischen Thomas Mann und Agnes E. Meyer, 1992 von Hans Rudolf Vaget im S. Fischer Verlag herausgegeben und kommentiert, wird der Ausspruch auf Seite 264 etwas anders zitiert:
„Sie zu lieben, mein Freund, ist eine hohe Kunst, die nicht jeder fertig bringt – ein komplizierter Solo-Tanz – Leben Sie wohl.
Ever Yours – Agnes E. Meyer“
Paul Ehrenberg
Der junge Thomas Mann war mit Paul Ehrenberg „befreundet“, doch in seinem Tagebuch nennt er Paul seine „zentrale Herzenserfahrung.“ Paul war das Modell für die Figur Rudi Schwerdtfeger imDoktor Faustus.
Frage:Wer war älter, Paul oder Carl Ehrenberg? Hat Thomas Mann sich in seinem „Lebensabriss“ (1930) geirrt? Dort schreibt er:
„Herzlich befreundet war ich zu jener Zeit mit zwei Jungen Leuten, (...) Söhnen eines Dresdener Malers und Akademieprofessors E. Meine Neigung galt dem Jüngeren, Paul, der ebenfalls Maler war, Akademiker damals und Schüler des berühmten Tiermalers Zügel, außerdem vorzüglich Violine spielte, war etwas wie die Auferstehung meiner Empfindungen für jenen zugrunde gegangenen blonden Schulkameraden [Armin Martens] aber dank größerer geistiger Nähe sehr viel glücklicher. Carl [Ehrenberg], der Ältere, Musiker von Beruf und Komponist, ist heute Akademieprofessor in Köln.“
Nach dieser Passage ist also Paul der jüngere und Carl der ältere Bruder. Dagegen liest man auf mehreren Webseiten:
Carl Ehrenberg: 1878-1962
Paul Ehrenberg: 1876-1949
Ist also doch Paul der ältere?
Antwort:Thomas Mann hat sich in seinem Lebensabriss von 1930 geirrt. Es gibt keinen Zweifel, dass Carl Ehrenberg im Jahr 1878 geboren wurde. Mehrere Lexika und Archive (zum Beispiel das Deutsche Musikarchiv) geben als Lebensdaten für Carl an: geboren 6. April, 1878, in Dresden, gestorben 26. Februar, 1962, in München. Eine unabhängige Bestätigung ist die Würdigung Carl Ehrenbergs zu seinem 60. Geburtstag von Wilhelm Zentner in der Deutschen Sängerbundeszeitung DSBZ vom 2. April 1938, Seite 192.
Dass Paul der ältere Bruder war und 1876 geboren wurde, liest man in Enzyklopädien (zum Beispiel artnet) und bei Auktionshäusern nach, die seine Pferdebilder anbieten (s. z.B. bei artprice.com). Auch zuverlässige Autoren und Thomas Mann Kenner wie H. R. Vaget in “Confessions and Camouflage” geben als Daten 1876 – 1949 an. (Allerdings hat Hans Wysling in “Letters of Heinrich und Thomas Mann” auf S. 314 die falschen Daten 1878 – 1949, dann aber wieder 1876-1949 in “Quellenkritische Studien zum Werk Thomas Manns.”) Die GKFA vonDoktor Faustushat ebenfalls 1876-1949. In Peter de Mendelssohns Biographie liest man: „Paul Ehrenberg wurde 1876 geboren, sein Bruder Carl war zwei Jahre jünger als er.”
Eine weitere Quelle ist diese: Die Akademie der bildenden Künste, München, hat Paul Ehrenberg unter der Matrikelnummer 01719 registriert mit dem Eintritt im Jahr 1897 und dem Alter 21, was das Geburtsjahr 1876 ergibt.
Zusatz von Dr. Evgueni Berkovitch: Die Recherche in den Urkundenbüchern des Standesamtes Dresden I von 1876 erbrachte unter der Nr. 1165 den gesuchten Eintrag zu Paul Ehrenberg unter dem Tag 08.08.1876. Die Überprüfung im Urkundenbuch vom Standesamt Dresden I von 1878 ergab den als Geburtstag von Emil Theodor Carl Ehrenberg den 06.04.1878.
Seitdem finden wir auf den Webseiten und Biographien meist die korrekten Lebensdaten:
Paul Ehrenberg: 8.8.1876-14.10. 1949
Carl Ehrenberg: 6.4.1878-26.2. 1962
Möbel
Das Pölchen
Frage:„Eine Art Pölchen“ - was ist das?
In einem Brief an Peter Pringsheim vom 06.11.1917 beschreibt Thomas Mann einen Teil der Einrichtung des Hauses in der Poschingerstraße: „[U]nser Haus inwendig kompletiert. Die obere Diele ist mit den Tölzer Eßzimmer-Möbeln eingerichtet und das als Fremdenzimmer Gedachte im II. Stock wollen wir mit Katjas Ahorn-Sachen zu einer Art Pölchen gestalten.“
Antwort:Hier erlaubt sich Thomas Mann einen privaten Sprachscherz mit dem Namen Na-pol-eon. Die Nachsilbe –chen wird ja oft zur Verkleinerung oder bei Kosenamen gebraucht: Lottchen ist die kleine Lieselotte. Und beim langen o tritt dann oft der Umlaut ö auf: der kleine Mond ist das Möndchen und der kleine Sohn das Söhnchen. Wenn man die erste Silbe Na- und die letzten drei Buchstaben –eon auslässt, dann meint also Pölchen den „kleinen Napoleon“. Einem (kleinen) Zimmer einen Personennamen wie Pölchen zu geben, ist vielleicht nicht sonderbarer als einen barocken Prunkstuhl aus dem 17. Jahrhundert einen „Louis XIV“ zu nennen.
Ebenso die Erklärung von Peter de Mendelssohn im zweiten Band seiner BiographieDer Zauberer, S. Fischer, 1996, Seite 1808. Dort heißt es lapidar: „Die ‚Ahorn-Sachen’ waren die Möbel des Tölzer Salons; ‚Pölchen’ hingegen bedeutete Frau Hedwig Pringsheims ‚Napoleon’ und bezog sich auf ihren Privatsalon in der Arcis-Straße“.
Vom Pölchen ein Ausflug zu Kosenamen: Eine weitere gebräuchliche Form der Verkleinerung ist bekanntlich –lein, wie in Kindlein oder beim Kosenamen Mielein, wie Katia Mann im Familienkreis und in Briefen oft hieß. Vor allem bei Klaus, der Eissi oder Aissi genannt wurde. Thomas war Pielein, meist aber der Zauberer oder einfach Z. Erika (Eri oder Erikind) war besonders begabt dafür, kuriose Spitznamen auszuteilen, zum Beispiel „Kuzimuzi“ für Bruno und Elsa Walter, s. „Erika Mann – Einblicke in ihr Leben“, Dissertation von Anja Maria Dohrmann.
Der Herr und sein Hund
Außer den Eltern und den Kindern der Manns gehörten fast immer mehrere Hausangestellte, ein Auto und ein Hund zur Familie. Bauschan aus der Novelle „Herr und Hund“ ist der bekannteste.
Bauschan und seine Freunde
Frage:Wie sah Bauschan aus?
Die Erstausgabe von „Herr und Hund“, München 1919, zeigt auf dem Titelblatt einen eleganten Scherenschnitt vom „Hund“ von Emil Preetorius. H.-P. Haack zeigt davon eine Abbildung auf seiner ausgezeichneten Wikiversity Seite.
Es gibt Bauschan auch als Statue (mit seinem Herrn) am Tegernsee, zu bewundern bei Google Bilder. Walter Kempowski, der 2005 den Thomas-Mann-Preis erhielt, hatte seinen Collie-Rüden ebenfalls Bauschan getauft.
Ein Hundekollege Bauschans ist Perceval ausKönigliche Hoheit, den Thomas Mann wie folgt einführt: „Den Hund angehend, der Perceval hieß (was englisch auszusprechen war) und meistens Percy gerufen wurde, so war dieses Tier von einer Erregbarkeit, einer Leidenschaft des Wesens, die jeder Beschreibung spottet ...“ Perceval ist eine der von Robert Gernhardt gezeichneten 24 Randfiguren in seiner Ausstellung „Das Randfigurenkabinett des Doktor Thomas Mann“ im Buddenbrookhaus (2005). Zwölf dieser Zeichnungen sind abgebildet im gleichnamigen Buch (mit Barbara Hoffmeister) im S. Fischer Verlag. Die Randfiguren sind:
Huij und Tuij (Joseph in Ägypten); Bendix Grünlich, Sesemi Weichbrodt (Buddenbrooks); Lobgott Piepsam („Der Weg zum Friedhof“); Tobias Mindernickel; Rose Cuzzle (Lotte in Weimar); Dr. Christian Jacobi alias „Luischen“; Dr. Edhin Krokowski, Ellen Brand (Zauberberg); Detlef Spinell, Baby Klöterjahn („Tristan“); Lord Kilmarnock, Felix Schimmelpreester (Felix Krull); Sextus Anicius Probus (Der Erwählte); Greiser Geck („Tod in Venedig“); Perceval (Königliche Hoheit); Hieronymus („Gladius Dei“); Saul Fitelberg, Der Teufel, Ines Institoris (Doktor Faustus); Anna von Tümmler („Die Betrogene“); Ein Jäger („Herr und Hund“); Ein Reisender („Tonio Kröger“); Die Kinder von Torre di Venere („Mario und der Zauberer“).
Ehrendoktor
Verleihung – wofür?
Frage: Thomas Mann hat 1919 von der Universität Bonn den Ehrendoktor erhalten. Wofür hat er diesen Ehrentitel bekommen?
Antwort:Nach Meinung aller Experten ist die Originalurkunde von Thomas Manns Ehrenpromotion verloren gegangen. Aber es existiert ein „amtliches Belegexemplar“ der Promotionsurkunde, deren Wortlaut mit dem der Originalurkunde übereinstimmen dürfte. Dieses Belegexemplar ist Teil eines vor ein paar Jahren gefundenen Bündels von Dokumenten, die erstmals vom 5. Februar bis 31. März 2006 in einer Sonderausstellung des Buddenbrookhauses in Lübeck gezeigt wurden. Die Urkunde ist nach Worten der Archivleiterin Britta Dittmann im Besitz des Buddenbrookhauses. Ein Scan des Dokuments, den sie mir freundlicherweise zugeschickt hat, hat folgenden Text:
DIE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
DER RHEINISCHEN
FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BONN
Verleiht
THOMAS MANN IN MÜNCHEN
dem Dichter von großen Gaben der in strenger Selbstzucht und beseelt von einem starken Verantwortungsgefühl aus innerstem Erleben das Bild unserer Zeit für Mit- und Nachwelt zum Kunstwerk gestaltet die Würde und die Rechte eines Ehrendoktors der Philosophie gegeben am Tage der Jahrhundertfeier der Universität den 3. August 1919
unter dem Rektorat des Professors der Rechte Dr. Ernst Zitelmann
unter dem Dekanat des Professors der Botanik Dr. Johannes Fitting
In der Laudatio wird Thomas Mann überdies als „Dichter und Schriftsteller“ bezeichnet, „der vor allem in seinem RomanBuddenbrooksein Werk geschaffen hat, das nach seinem kulturgeschichtlichen Gehalt wie nach seiner dichterischen Form in Anschauung, Aufbau und Sprache von den besten Kräften deutscher Art und Kunst [...] den kommenden Geschlechtern Kunde gibt.“
Aberkennung – warum?
Am 2. Dezember 1936 wird Thomas Mann, der inzwischen zu Weltruhm gelangt und in die Schweiz emigrierten war, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Als Konsequenz dieser Ausbürgerung teilt am 19.12.1936 Karl Justus Obenauer, Dekan der Philosophischen Fakultät, dem Nobelpreisträger schriftlich mit, dass ihm die 1919 verliehene Ehrendoktorwürde wieder aberkannt sei. Das kurze Schreiben lautet wie folgt:
„Im Einverständnis mit dem Herrn Rektor der Universität Bonn muß ich Ihnen mitteilen, daß die Philosophische Fakultät sich nach Ihrer Ausbürgerung genötigt gesehen hat, Sie aus der Liste der Ehrendoktoren zu streichen. Ihr Recht, diesen Titel zu führen, ist gemäß § VIII unserer Promotionsordnung erloschen.“
Obenauer war ein Leipziger SS-Mann, der für den abgesetzten Dekan Friedrich Örtel 1936 das Dekanat übernommen hatte.
Am Neujahrstag 1937 antwortete ihm Thomas Mann: „Die schwere Mitschuld an allem gegenwärtigen Unglück, welche die deutschen Universitäten auf sich geladen haben, haben mir die Freude an der mir einst verliehenen akademischen Würde längst verleidet und mich gehindert, noch irgendwelchen Gebrauch davon zu machen.“ Im übrigen führe er weiterhin den Ehrentitel eines Doktors der Philosophie, den ihm die Harvard-Universität verliehen habe, nämlich dafür, dass er „zusammen mit ganz wenigen Zeitgenossen die hohe Würde der deutschen Kultur bewahrt habe“.
Danach folgen diese oft zitierten Sätze:
„Ich habe es mir nicht träumen lassen, es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, daß ich meine höheren Tage als Emigrant, zu Hause enteignet und verfemt, in tief notwendigem politischen Protest verbringen würde. Seit ich ins geistige Leben eintrat, habe ich mich in glücklichem Einvernehmen mit seelischen Anlagen meiner Nation, in ihren geistigen Traditionen sicher geborgen gefühlt. Ich bin weit eher zum Repräsentanten geboren als zum Märtyrer, weit eher dazu, ein wenig höhere Heiterkeit in die Welt zu tragen, als den Kampf, den Haß zu nähren. Höchst Falsches mußte geschehen, damit sich mein Leben so falsch, so unnatürlich gestaltete. Der einfache Gedanke daran, wer die Menschen sind, denen die erbärmlich-äußerliche Zufallsmacht gegeben ist, mir mein Deutschtum abzusprechen, reicht hin, diesen Akt in seiner ganzen Lächerlichkeit erscheinen zu lassen ... Deutschland soll ich beschimpft haben, indem ich mich gegen sie bekannte! Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln!“
Wiederverleihung – wie?
Damit ist die Geschichte aber noch nicht beendet. Thomas Mann erhielt seinen Titel zurück. Brigitte Linden vom Bonner General-Anzeiger schreibt dazu:
„Gleich nach Kriegsende 1945 erklärte die Philosophische Fakultät der Universität Bonn die Aberkennung des Ehrendoktors von Thomas Mann fürnull und nichtig. Es dauerte freilich noch über ein Jahr, bis man es wagte, dem Schriftsteller, der in Pacific Palisades in Kalifornien residierte, den Titel wieder anzutragen. Der inzwischen wieder eingesetzte Dekan Örtel bediente sich schließlich der Vermittlung durch den jüdischen Historiker Wilhelm Levison - mit Erfolg: „Ich bin nicht der Mann, ein solches Anerbieten mit der Miene der Unversöhnlichkeit zurückzuweisen,“ schreibt Thomas Mann. Mit Briefen des Rektors, Professor Heinrich Konen, des Dekans und des University Control Officers wurde ihm Weihnachten 1946 die neue Doktor-Urkunde übersandt, für die er sich sogleich »herzlich und feierlich« bedankt.“
Der hier erwähnte Aufschub von einem Jahr ist nicht auf ein Zögern Thomas Manns zurückzuführen, sondern auf die Unsicherheit der Philosophischen Fakultät, ob Thomas Mann den Titel wieder annehmen würde. Eine Ablehnung hätte die Universität düpiert. Andererseits wollte von seiner Warte aus Thomas Mann sicherstellen, dass nicht die Besatzungsmächte die Wiederverleihung befohlen hatten, sondern dass die Professoren und Studenten „einhellig“ für die Wiederverleihung votierten. Die Professoren waren sich schnell einig. Wie die taz Köln am 17.1.2002 rückblickend schrieb:
„Schwierigkeiten aber gab es mit den Studenten. Der Allgemeine Studenten Ausschuss (AStA) konnte sich nicht zu einem eindeutigen positiven Votum durchringen. Am 15. November 1946 schließlich gab er eine lauwarme Erklärung ab: „Da wir überzeugt sind, dass Herrn Th. Mann die Verleihung der Dr.-Würde rechtmäßig erhalten hat, und uns der Grund der Aberkennung dieser verliehenen Würde nicht genügend bekannt ist, stehen wir einer Herbeiführung des alten Rechtszustandes nicht im Wege.“ Das war zwar nicht gerade die von Mann gewünschte einhellige Haltung zu seiner Wiedereinsetzung als Bonner Ehrendoktor, aber er gab sich damit zufrieden.“
Exil
Zeitplan
Eineinhalb Jahre nach der Entziehung der Doktorwürde wurde am 5. Mai 1938 offiziell die Einwanderung Thomas Manns in die USA vollzogen, und zwar über den Umweg nach Kanada, mit Hilfe seiner Gönnerin Agnes E. Meyer.
Dieser entscheidende Schritt Thomas Manns geschah erst nach langem Zögern und auf Drängen seiner Kinder, vor allem Erikas, die bei Nichthandeln sogar mit Liebesentzug drohte. Viele Ereignisse liegen zwischen Hitlers Aufstieg und Thomas Manns Ankunft in New York. Hier ist eine Liste der wichtigsten Daten:
30. Januar, 1933: Hitler wird Reichskanzler;
11. Februar, 1933: Thomas Mann Vortragsreise nach Holland – faktisch der Beginn des Exils – siehe auch Brief Thomas Manns an das Reichsministerium des Innern, vom April 1934;
27. September, 1934: Thomas Mann bezieht Haus in Küssnacht in der Schweiz;
19. November, 1936: Thomas Mann erhält tschechische Staatsbürgerschaft;
2. Dezember, 1936: Thomas Mann verliert deutsche Staatsbürgerschaft;
11. März, 1938: Einmarsch deutscher Truppen in Österreich;
15. Februar bis 6. Juli, 1938: Besuch Thomas Manns in den USA;
5. Mai, 1938: Einwanderung in die USA via Kanada;
7. Juli, 1938: Thomas Mann zurück in Küssnacht;
17. September 1938: Einschiffung nach USA in Boulogne;
24. September, 1938: Ankunft in New York;
28. September, 1938: Einzug in das Gästehaus (The Mitford House) in Princeton;
1. Oktober, 1938: Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei;
1. September, 1939: Einmarsch in Polen;
17. März, 1941: Auflösung des Haushalts in Princeton;
8. April, 1941: Wohnung in Pacific Palisades, Kalifornien;
7. Dezember, 1941: Japanischer Angriff auf Pearl Harbour;
8. Dezember, 1941: Amerikanische Kriegserklärung an Japan;
11. Dezember, 1941: Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die USA.
Diese Daten werden hier zitiert nach dem BandDichter über ihre Dichtungen, Teil II, Hrsg. Hans Wysling, Marianne Fischer. Siehe auch Hans R. Vaget:Thomas Mann, der Amerikaner. S. Fischer Verlag, Mai 2011.
Quellen und Kommentare
zum Thema „Thomas Mann und sein Exil“ sind unter anderem:
1. Zur persönliche Geschichte s. Kurzkes BiographieThomas Mann – Das Leben als Kunstwerk, Kapitel XIV bis XVII, und ein Teil von Kapitel VXX, dort e.g., „Warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe.“
2. DerThomas-Mann-StudienBand 41 (2010) hat den TitelThomas Mann und das ‚Herzasthma des Exils’.
3. Über seine Rückkehr, mit Rückblick, siehe die Seiten 466 bis 486 in Thomas Manns Aufsatz „Über mich selbst“.
4. Mit Fokus auf die Schweiz, s. den Artikel „Thomas Mann und die Schweiz“ von Thomas Sprecher, imThomas Mann Handbuch(2005) und sein Buch über Thomas Manns Exil in der Schweiz 1933-1938:Thomas Mann in Zürich. Für einen indirekten Standpunkt, das Exil gesehen durch die Linse von Journalisten, Kritikern usw., siehe „Im Schweizer Exil“ in Klaus Schröters SammlungThomas Mann im Urteil seiner Zeit.
5. Über Thomas Manns politische Essayistik, siehe den Artikelvon Hermann Kurzke imThomas Mann Handbuch(2005)
Politik
Links oder rechts?
Frage:Thomas Manns politischer Standort: Stand erlinksoderrechts?
Darüber haben sich die Gelehrten gestritten. Die Antwort, wenn man denn eine einsilbige geben will, hängt vor allen Dingen von der Zeit ab: Der Thomas Mann derBetrachtungen eines Unpolitischenstand woanders als Thomas Mann in Santa Monica oder der Thomas Mann, der 1949 nach Frankfurtund





























