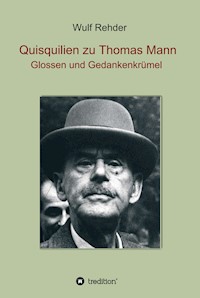2,99 €
Mehr erfahren.
"Sie können nicht glauben", schrieb Goethe an seinen Vater, "was es eine schöne Sache um einen Professor ist. Ich bin ganz entzückt gewesen, da ich einige von diesen Leuten in ihrer Herrlichkeit sah." Jene Herrlichkeit des deutschen Professors, aber auch seine tägliche Arbeit in Forschung und Lehre, seine Weltanschauung und sein Liebesleben, dazu Beschreibungen abendfüllender Professorenspiele, ein Verzeichnis noch ungeschriebener Doktorarbeiten und ein unverzichtbares Lexikon professoraler Grundbegriffe - das sind die spannenden Themen des hier in dritter Auflage vorgelegten Klassikers. Dieses Standardwerk ist das Ergebnis eigener Erfahrungen und langjähriger Beobachtungen des Autors im Kollegenkreis, ergänzt durch die genaue Lektüre deutscher Professoren von Schlegel bis Wilhelm von Humboldt, von Hegel bis Heidegger. Das Handbuch ist ein Muss für alle, die die Professorenlaufbahn einschlagen wollen, aber auch für die, die bereits nach dem Motto "Publizier oder krepier" leben und arbeiten. Und endlich auch für diejenigen, die gerne wissen möchten, warum sie die Herrlichkeit doch lieber meiden sollten. "Köstlich, sublim, lächerlich. Noch ist es Zeit, dem schwer zu beschenkenden Professor im Bekanntenkreis dieses passende Präsent auf den Gabentisch zu legen." Thomas von Randow, in DIE ZEIT vom 13.12.1985
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der deutsche Professor
Dritte
ergänzte und verbesserte
Auflage
Wulf Rehder
Der deutsche Professor
Handbuch für Studierende, Lehrer, Professoren und solche, die es werden wollen
© 2017
Wulf Rehder
Kontakt:
Titelbild:
„Brillenapostel“ von Conrad von Soest
Bild Copyright:
Gemeinfrei
Verlag:
tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback:
978-3-7439-0064-6
ISBN Hardcover:
978-3-7439-0065-3
ISBN e-Book:
978-3-7439-0066-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Carol
„Köstlich, sublim, lächerlich. Noch ist es Zeit, dem schwer zu beschenkenden Professor im Bekanntenkreis dieses passende Präsent auf den Gabentisch zu legen.“
Thomas von Randow
DIE ZEIT vom 13.12.1985
Inhalt
Einladung zur dritten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Proömium oder Einleitung in den Gegenstand
I. Der deutsche Professor bei der Arbeit
1. Die Rezension
2. Die wissenschaftliche Arbeit
3. Die Vorlesung
4. Nänie auf einen verstorbenen Kollegen
5. Allgemeine Antworten auf spezifische Fragen
6. Ungeschriebene Doktorarbeiten
II. Die Weltanschauung des deutschen Professors
1. Der C1 Professor oder die Wollust
2. Der C2/C3 Professor – ein Golz
3. Das Wesen des Zephir (C4)
4. Spezielle Wesen
Der Professor der Medizin
Der Professor der Mathematik
Der Professor der Philologe
5. Wesentliche Schwächen
III. Der Gymnasialprofessor
1. Professor am Gymnasium
2. Das Abenteuer des Gymnasiallehrers
IV. Der deutsche Professor privat & privatissime
1. Die Professorenfrau
2. Der Professor und die Frauen
3. Professorenspiele
V. Die Geschichte des deutschen Professors: Eine Heldensymphonie
Erste Satz: Allegro con brio
Zweiter Satz: Adagio assai
Dritter Satz: Allegro vivace
Vierter Satz: Allegro molto
VI. Professorenlexikon
Notiz über den Autor
Einladung zur 3. Auflage
Die letzte Seite der ersten Auflage dieses Buches wurde 1984 in einer 2-Zimmer Wohnung in der Cowper Street in Palo Alto, Kalifornien, auf einer geliehenen Smith-Corona Schreibmaschine getippt, zweifingrig und sehr langsam. Die Umlaute und das ß mussten per Hand eingefügt werden – das Wörtchen dass wurde damals noch daß geschrieben.
Hans-Helmut Röhring, ein unternehmender und temperamentvoller Mann, veröffentlichte denDeutschen Professorin seinem gerade gegründeten Rasch und Röhring Verlag. Klein aber fein war sein erster Katalog, mit populären Autoren so verschieden wie Otto Waalke und Hoimar von Ditfurth. Als Belohnung, aber doch überraschend, folgte noch im selben Jahr 1985 das PrädikatVerlag des Jahres. AuchDer deutsche Professor, hübsch aufgemacht mit dem Schattenriss eines steif dozierenden Gelehrten auf dem Cover, profitierte von der Aufmerksamkeit, wurde im Rundfunk vorgestellt und in der ZEIT von Thomas v. Randow besprochen.
Einige Professoren waren pikiert. Dabei ist das Buch kein wirklichkeitsnahes Porträt, sondern eine Karikatur eines historisch entstandenen, manchmal der Welt entrückten geistigen Wesens, dessen beste Exemplare auch heute noch jedermann bewundern muss. Immerhin wurden Kopien der zweite Auflage von 1996 gerne neu berufenen Professoren geschenkt und Privatdozenten nach ihrer Antrittsvorlesung überreicht.
Seitdem haben sich Herr und Frau Professor verändert. Statt der alten C1 bis C4 Titelierung werden sie jetzt anders nummeriert. Auch müssen sie jetzt den Bachelor und den Magister hervorbringen. Die Habilitation, damals aus der Mode gekommen, ist längst wieder gefordert in Form dicker Monographien, die mit einem Druckkostenzuschuss oder in Selbstverlagen publiziert, aber immer noch selten gelesen werden. Fachhochschulen, die Professoren beschäftigen aber nicht Universitäten heißen dürfen, rächen sich mit Pseudonymen wie „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ oder gar „University of Applied Sciences“.
Studenten sind jetzt Studierende. Wer noch ein bisschen Latein kann, weiß den Unterschied zu schätzen. In der Tradition des klassischen Verbsstuderein der e-Konjugation musste der Student nach etwas streben, trachten und sich bemühen, und zwar mit dem Dativ, wie in „virtuti studere“ – nach Tapferkeit streben (Cicero,De Oratore). Heute ist die lateinische Klassik vergessen und Studierende leihen sich das mittellateinischestudiareaus der a-Konjugation aus, durch das sie wie im Italienischen mit einem direktem Objekt, dem Akkusativ, ein Fachgebiet einfach erlernen, wie in „vorrei studiare fisica quantistica“ – ich möchte Quantenphysik lernen.
Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung,1986, verkaufte ich meine professorale Seele im Silicon Valley. Es lag ein teuflisches Angebot vor, dass ich nicht ablehnen konnte. Die näheren Beweggründe sind im Vorwort zur zweiten Auflage genannt. Der Erlös reichte für ein kleines Haus und Zahnspangen für die Kinder. Fünf Jahre später, als Manager nach Pisa transferiert, schnupperten wir, Frau und Kinder inklusive, wieder europäische Luft. Doch waren wir mit Amerika noch nicht am Ende. Aufregende und schwierige Jobs folgten. Unvergesslich bleibt für immer die Nacht Anfang November 2008, als Obama Präsident wurde.
Endlich, fünfundzwanzig Jahre nach unserer Auswanderung von Berlin nach San Francisco, auf einer Reise nach Deutschland, fand ich sie wieder, die Seele. Es dauerte noch sieben weitere kalifornische Jahre, bis Haus und Hof und bis auf das Nötigste und Liebste aller Besitz verkauft oder weggegeben war und die Rückkehr nach Deutschland glückte. Großzügige, gastfreundliche Freunde, allen voran Professor Dr. habil. Holger van den Boom und Professorin Dr. Felicidad Romero-Tejedor, arrangierten Lehraufträge für Ästhetik und Mathematik in Lübeck. Heute, nur eine Stunde entfernt von der Adresse in der Berliner Fregestraße, von der aus 1981 das amerikanische Abenteuer begann, gibt es genug Muße, denDeutschen Professornoch einmal mit neuem Titelbild und neuen Illustrationen aufzufrischen und zum vergnüglichen Wiederlesen einzuladen.
Den Inhalt habe ich kaum verändert und die alte Professorenhierarchie von C1 bis C4 nicht durch die W-Besoldungsleiter ersetzt. Grob gesagt, wurde aus dem damals meistens nicht habilitierten C1-Assistenzprofessor der jetzt meist bereits habilitierte Juniorprofessor W1. Der W2 Professor löste den außerordentlichen Professor, den Extraordinarius der C3-Kategorie ab, wobei der Stand der ehemaligen C2-er in W1 oder W2 aufgegangen ist. Der ordentliche Professor der Zephir-Klasse C4 trägt jetzt die Nummer W3.
Eine erfreuliche Veränderung muss noch erwähnt werden. Der Fraueneanteil in der deutschen Professorenschaft, der zur Zeit der zweiten Auflage 1998 nur bei etwa 8% lag, ist inzwischen – zu langsam, aber immerhin - auf über 23% gewachsen. Deshalb sollte der Frau Professorin eigentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, wodurch das Bild des herkömmlichen deutschen Professorentums dramatisch korrigiert werden dürfte. Eine solche Revision muss aber bis zur 4. Auflage warten. Empirische Felduntersuchungen und theoretische Anstrengungen, die einem möglichen Paradigmenwechsel gelten, sind im Gange.
Trotz innerer Abneigung meinerseits gehorcht der Text jetzt weitgehend der reformierten Rechtschreibung, so dass aus dem Stengel ein Stängel, aus dem Quentchen ein Quäntchen, und aus dem schnippischen daß ein zischendes dass wurde. Zitate blieben jedoch meist in der Schreibweise beibehalten, in der ich sie ursprünglich vorgefunden habe.
Vorwort zur 2. Auflage
Indem ich die Feder ergreife, um in der völligen Muße und Zurückgezogenheit, die nur ein kulturneutrales Silicon Valley bietet, ein Bekenntnis niederzuschreiben, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob meine Freunde in Deutschland dieses mein geistiges Unternehmen nach Temperament und Schule denn auch zu lesen gewillt sind, ja die Einbildungskraft aufbringen, mich zu verstehen und, im Idealfall, mir meine Apostasie zu verzeihen. Mein Bekenntnis: Ich bin kein deutscher Professor mehr.
Den Doktorhut abzulegen und auf Titel und Talar zu verzichten, ist nicht eine Tat, die sich auf das einfache Bedürfnis, einevita contemplativanun gegen dievita activaeinzutauschen, zurückführen ließe. Nein; wie es sich für einen deutschen Akademiker gehört, habe ich für meine Entscheidung tiefschürfende Beweggründe. Einer dieser Gründe ist der, dem viele deutsche Geheimräte und Professoren seit Goethe und Kissinger gerne gefolgt sind: Geld. Der zweite Grund (insgesamt will ich hier vier Gründe anführen und näher diskutieren) wird vor allem in geschäftlichen Kreisen von Industrie und Wirtschaft gerne mit „Geld“ kopuliert: Zeit ist Geld. Zeit also. Mit dem Eintreten in das reifere Alter wurde mir nämlich bewusst, dass ich zur Erreichung meiner persönlichen Ziele mehr Zeit benötigen würde, als mir nach den Vorlesungen an der Universität und dem stundenlangen Ringen mit dem schnöden Axiom „Publizier oder krepier“ noch zur Verfügung stand. Den dritten Grund gebe ich nur mit Zögern preis, und nur weil mich mein deutscher Verleger wiederholt gedrängt hat, im Interesse einer größeren Auflage ja nur die volle Wahrheit zu sagen. Nun gut denn: drittens also entschied ich mich eines schönen Tages, aus Deutschland in die USA auszuwandern und mich für immer in Kalifornien niederzulassen. Das Quartett der Gründe, wird letztendlich vollendet durch die Erwähnung eines Gefühls, das eher ein Beweggrund, ein Motiv, ist denn ein kühler, logischer und zureichender Handlungsgrund: der vierte Grund war pure Abenteuerlust.
In der systematischen Redeweise des großen Immanuel Kant bestimmen somit die folgenden klassischen vier Beweggründe mein Handeln: 1. Geld, sicherlich ein objektiver Bestimmungsgrund, der nach Kant nur „von reinen Vernunftbegriffen abhängt“; 2. Zeit, ein transzendentaler Grund der „notwendigen Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen“, vor allem des empirischen Gesetzes von der Endlichkeit unseres Erdendaseins; 3. die Emigration, eine Handlungseinheit, die dem notwendigen und zureichenden praktischen Bedürfnis Rechnung trägt, während meines Erdendaseins im selben Land, Kreis und Haus wohnen zu wollen wie meine amerikanische Frau und Kinder; und schließlich 4. Abenteuerlust, ein ästhetischer und subjektiver Bewegungsgrund (kurz auch Triebfeder genannt), in dem die Urquelle meines Wollens in gewissen sinnlichen Gefühlen angetroffen wird, die nicht immer leicht zu analysieren sind.
Bezüglich des Geldes, um den ersten der Bestimmungsgründe für meinen Sinneswandel in größerer Tiefe hier wieder aufzunehmen, herrschen in den USA und Deutschland unterschiedliche, und ich möchte sagen: komplementäre, Ansichten. Zunächst die Sprache. Auf Deutsch sprechen wir davon, „Geld zuverdienen“. Im Amerikanischen heißt es „tomakemoney“, sich Geld besorgen. Vom Verdienen ist dabei nicht die Rede. Kant, den ich hier zum wiederholten Mal zitiere, macht in seiner Rechtslehre den Unterschied auf noch andere Weise klar. Für den Deutschen gilt im Wesentlichen die „Realerklärung“ des Geldes, die da besagt, dass Geld das allgemeine Mittel sei, „den Fleiß der Menschen gegeneinander zu verkehren“, will sagen: die Arbeit der Menschen zu bewerten und belohnen. Dagegen ist für den Amerikaner die Nominalerklärung gültig, nach der Geld eine Sache sei, „deren Gebrauch nur dadurch möglich ist, dass man sie veräußert“. Deutscher Wertschätzung vom Verdienst und Fleiß steht demnach ein amerikanischer Pragmatismus gegenüber, der darauf zielt, Geld anzuschaffen und zum Erwerb einer nutzbaren Ware schnell wiederauszugeben. Da jeder ernsthafte Gedanke an Geld mir im allgemeinen peinlich und manchmal geradezu widerwärtig ist, sagt mir die demokratische, abstrakte, nachlässige Nominaldefinition vom Geld als Tauschmittel – auch in der extremen Form der Kreditkarte – mehr zu als die reale Definition von Geld als Viehersatz (pecunia, abgeleitet vonpecus, lateinisch für das Vieh), und mehr auch als die moralisch-etymologische Deutung eines Thomas von Aquin, der in seiner SchriftDe regimine principum ad regem Cypribehauptet: „Moneta heißt das Geld, weil es uns »moniert«, dass kein Betrug unter Menschen vorkomme, da es das geschuldete Wertmaß ist“. Soviel also zum Geld.
Was Zeit denn in ihrem Wesen sei, lernt der deutsche Gebildete vorzugsweise anhand der Vorbilder Kant (für Philosophen), Einstein (für Physiker), und Thomas Mann (für Humanisten). Bei Kant ist Zeit, wie wir oben gesehen haben, eine notwendige, objektive Bedingung, Erscheinungen überhaupt beobachten zu können; der Newtonsche Apfel fällt für Kant „in der Zeit“. Weit gefehlt, sagt Albert Einstein. Zeit ist dem Raumkörper angewachsen wie ein zusätzlicher siamesischer Arm, ihr Maß ist abhängig von der Art der Bewegung des Beobachters. Der Wurm im fallenden Newtonschen Apfel misst die Zeit anders als die Schlange, die im Apfelbaum ruht. Schließlich: Thomas Manns Ingenieur Hans Castorp nun empfindet, wie seine persönliche Zeit, will sagen: sein unebener Zeitsinn, mit der chronologisch-linearen und der historisch zirkularen auf Ewigkeit in einem unendlichen Zopfe verflochten ist.
Keine dieser drei Zeitvorstellungen war geeignet, meinen Zeitdurst zu beschreiben. Besser geeignet schien mir Borges‘ Coda in seinem Essay „Eine neue Widerlegung der Zeit“, wo er sagt: „Zeit ist die Substanz, aus der ich bestehe, Zeit ist der Fluss, der mich fortträgt, aber ich selbst bin der Fluss; sie ist der Tiger, der mich verschlingt, aber ich selbst bin der Tiger; sie ist das Feuer, das mich verzehrt, aber ich selbst bin das Feuer“. Nahe verwandt ist Vladimir Nabokovs zukunftslose Zeit in seinem RomanAda, wo sie das körperlose Bewusstsein beschreibt, das der Geist von den Leiden und Freuden des Körpers hat – die Freuden, die Walt Whitman in seinem Poem „Leaves of Grass“ besingt, die Leiden, wie sie Herman Melville und Edgar Allan Poe erfahren haben. Dies sollte meine Zeit werden, eine vollmundige, gegenwärtige und daher nie endende Zeit.
Freiwillige Emigration und Abenteuerlust sind verwandt. Du kannst nicht auswandern, wenn dich nicht Neugier und das Verlangen nach dem Unbekannten antreiben. Der erste Kulturschock, der einen deutschen Professor in den USA erwartet, kommt von dem völlig verschiedenen Sozialprestige. In Amerika ist der Professor kaum zu unterscheiden von demidiot savant, jemandem also, dem ein normaler Bürger mit argwöhnischer Ehrfurcht begegnet, dem aber kein Bankbeamter eine Kredit bewilligt. Erfolg kommt erst, wenn du das akademische Gegenstück von dem geworden bist, was Robert Musil den Großschriftsteller nennt: wenn der Gelehrte ein hochbezahlter Manager seiner eigenen Forschungsaufträge, seiner Beraterverträge und seines Image geworden ist. Ein wohlhabender und wohlbeleibter Clown zu werden, der Forschung für das Pentagon betreibt, war mein Ehrgeiz nicht. Meine Wissbegier und mein Spieltrieb galten der englischen Sprache mit ihrem gewaltigen Wortschatz aus einsilbigen Substantiven, zweisilbigen Adjektiven, und beweglichen Verben, die durch Präpositionen zusätzliche Bedeutung und Farbe gewinnen. Ich gestehe: Shakespeare und John Donne haben für mich mehr Witz und Leidenschaft als Goethe und Schiller. Romane von Ralph Ellison, Richard Powers, Paul West, Robert Stone, Thomas Pynchon finden unmittelbar Resonanz in meinem altmodischen Herzen. Melville und Joyce gehören zu den wenigen Auserwählten, die mit Adverbien umgehen können. Und amerikanische Literatur-Gazetten wie der New Yorker, Mother Jones und The New York Review of Books, wenn man sie erst einmal entdeckt hat, öffnen mehr neue Welten, als selbst Kolumbus erhoffte. Die amerikanisch-unkomplizierte Offenheit der akademischen und literarischen Szene würde mir erlauben, so hoffte ich, aus dem raupenartigen Professorendasein aufzusteigen in die Schmetterlingsexistenz des journalistischen Privatgelehrten mit Latein- und Griechischkenntnissen.
Nachdem ich so in meinem Gemüte alle Gründe, den Stand eines Mathematikprofessors zu verlassen, zusammengefasst hatte, blieb immer noch die Entscheidung zu fällen, welchen neuen Berufsweg ich denn nun einzuschlagen gedächte. Aus den Gründen wuchsen Vergleiche und Kriterien, und aus ihnen resultierte endlich eine Reihe von Prioritäten. Mein Salär sollte in keiner Weise ein Wertmesser meiner Arbeit sein, sondern ein (weitgehend unsichtbares) Mittel zum Zwecke des Lebensmitteleinkaufes. Zweitens, der neue Beruf sollte mir jene vollmundige Zeit belassen, in der ich dann die Intensität Poes und die Vitalität Whitmans erfahren könnte. Drittens: Kalifornien versus Schleswig-Holstein. Der blaue Himmel über Silicon Valley, die vielen verschiedenen Gesichtsfarben und Sprachen, die öffentlichen Büchereien und großzügigen Universitätsbibliotheken, frisches Obst und exotisches Gemüse, anderseits aber auch die hektische Atmosphäre einer künstlichen Computer-Landschaft mit achtspurigen Autobahnen und gelegentlichen Erdbeben – dies alles musste die liebgewonnene Ansicht von Elbdeichen und regnerischer Marsch aufwiegen und die behäbige Stimmung strohgedeckter Bauernhöfe vergessen machen. Und schließlich, viertens: der deutsche Geist in meinem Kopf, jenes unbegreifliche Vermögen, das sich einerseits selbst denken und andererseits das schnell vorübergehende Spiel der Wirklichkeit auf den Begriff bringen kann, jene flüchtige Substanz also, verlangte immer weniger danach, vertikale Löcher (Theoreme genannt) in den Laib der Mathematik zu bohren und diese dann mit Beweisen wieder aufzufüllen. Nein; die genannte Abenteuerlust ist eine horizontale, breitgefächerte Begierde, die auf die Intensivierung, Vervielfältigung und Verinnerlichung neuer Erfahrungen gerichtet ist.
Wie Wallace Stevens und T. S. Eliot teilte ich seitdem meine Welt fein säuberlich in zwei Hälften. In der einen trage ich einen Anzug mit dezenter Krawatte, kommuniziere in der verarmt-armseligen Sprache des Big Business und sitze meine Zeit in Strategie-Meetings ab, was mir aber immerhin meine Miete bezahlt. In der anderen Hälfte spiele ich den Amateur-Literaten, schreibe Buchbesprechungen, Essays, kulturkritische Kommentare, die mit dem Vokabular der späten sechziger Jahre gewürzt sind. Im Unterschied jedoch zu Wallace und Eliot führe ich das Leben eines Hochstaplers. Ich meine das so: Wenn ich meine Arbeit als Manager tu, weiß ich tief in meinem Innersten, dass ich recht eigentlich ein Schreiberling bin, Privatgelehrter in Sachen Melville, Poe und Nabokov, ein dilettierender Künstler also, der mit Poeten parliert und mit Herausgebern und Verlagsherren korrespondiert. Und andererseits, während ich dicke Bücher lese und gegen ein Almosen einen Essay schreibe, der mich sechs Wochenenden kostet, sage ich mir insgeheim: Es ist doch gut, dass ich das Geld nicht nötig habe, denn ich bin ja recht eigentlich ein tüchtiger Manager mit gutem Gehalt.
Meine deutschen Freunde haben inzwischen den Nabokovschen Werdegang vom unordentlichen Assistenten zum ordentlichen Professor durchlaufen – Nabokov sagt wörtlich; „… from lean lecturer to full professor“. Aus Wirbelwinden sind Zephire geworden. Und wie diese mir mit verlegenem Lächeln mitteilen, haben etliche Fakultätskollegen die „ungeschriebenen Doktorarbeiten“ (siehe Kapitel I, Abschnitt 6) längst an ehrgeizige Studenten vergeben, die in der Mehrzahl von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert werden. Der Geist deutscher Gelehrsamkeit ist also auch ohne mich lebendig wie eh und je. Und so hoffe ich, verehrte Leserin, geneigter Leser, dass Sie dieses Buch nicht ernster nehmen als den bekannten Ausruf jenes törichten Kindes in Hans Christian Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern.
Mountain View, Kalifornien
Am Weihnachtstag des Jahres 1996
ProömiumoderEinleitung in den Gegenstand
Ich habe mir den deutschen Professor und die Einrichtungen der heutigen Universität zum Gegenstand eines Studiums gemacht. Wenn mein Bild aber auch im allgemeinen nicht günstiger ausgefallen ist, so bitte ich besonders die zahlreichen Professoren um Entschuldigung, welche ich während dieser Zeit lieben und als Menschen, wie Gelehrte, hochschätzen, ja verehren gelernt habe. (…) In jedem Fall bin ich bestrebt gewesen, ohne die geringste persönliche Polemik nur streng historisch und objektiv vorzugehen, und man wird diesem Bestreben seine Anerkennung nicht versagen können.
Prof. Dr. Johannes Flach,Der deutsche Professor der Gegenwart,Leipzig 1886. Seit 2009 wieder vollständig im Internet bei wikisource verfügbar.
Grundsätzlich ist der deutsche Professor einIndividuum ineffabile, unteilbar wie die akademische Freiheit und unaussprechlich wie die deutsche Seele. Andererseits zerfällt der Professor als Spezies in vier Arten, die bequemer Weise mit C1, C2, C3 und C4 (sprich Zephir) bezeichnet werden. In die unterste Gruppe C1 fallen die Assistenzprofessoren oder Hochschulassistenten; aus ihren Reihen rekrutiert sich der akademische Nachwuchs. Sie sind die jungen Fähnriche der Wissenschaft, noch nicht Beamte auf Lebenszeit, aber flott und ehrgeizig und auf dem besten Weg dorthin. Lebenslänglich dienen dagegen meist schon die Vertreter der beiden Mittelgruppen C2 und C3, früher Dozenten und außerordentliche Professoren geheißen.
Der ureigentliche deutsche Professor ist aber der Ordinarius, Prof. ord. oder o. Prof., der Zephir-Professor, der Gottähnliche. Er ist es denn auch vorzüglich, auf den seine geringeren Mitbürger das respektvolle Attribut „zerstreut“ anwenden wie das „hochkarätig“ auf eine Gemme. Seine sprichwörtliche Zerstreutheit ist seit Jahrhunderten als Markenzeichenmade in Germanyin viele Länder exportiert und dann bisweilen als Tiefe und Genialität, als genuin Faustisches, oder doch zumindest als etwas liebenswürdig Altmodisches interpretiert worden.
Theodor Mommsen, selbst o. Professor, deutete die persönlichverspielte Zerstreutheit weniger harmlos als Weltfremdheit, aus der sich so manche Unterlassungssünde desZoon politicum professoraleerklären lasse. Sitzen doch schon bei Homer (Ilias, 3. Gesang, Verse 149 ff.) die vornehmen Professoren der Universität Troja fern vom Schlachtgetümmel lieber auf dem skaiischen Tore, tüchtig im Reden und stimmgewandt wie die Zikaden, aber zu schwach, mit den gut geschienten Achäern eine Lanze zu brechen.
Hin und wieder sind sie wohl auch auf die Barrikaden gegangen, die deutsche Professoren seit Luther, meist vereinzelt wie die Göttinger Sieben um die Brüder Grimm 1837 und im Appell der achtzehn Wissenschaftler vom April 1957. Oft jedoch folgten den Reden, Lehren und Appellen die Taten nicht nach. Auch einige Rektoratsreden und eilige Bekenntnisse von vor mehr als fünfzig Jahren stecken dem Professor noch immer wie ein schuldiges Sodbrennen hinter dem synthetisch-feschen Rollkragen.
Dabei kommt das Wort „Professor“ bekanntlich von dem lateinischen Verbumprofiteri, teilt mit dem anderen lateinischen Wort „Profit“ überraschenderweise jedoch nur die gemeinsame Vorsilbe.Profiteriist ein sogenanntes Deponens, ein Verb mit aktiver Bedeutung, aber passiver Konjugationsendung, und heißt verdeutscht „öffentlich und frei seine Lehrmeinung verkünden“. Nun sind Worte und Verben nichts als Schall und Rauch, und sie schließen nicht aus, dass ein Professor bisweilen die gelehrte Aktivität ganz hinter die passive Form zurücktreten lässt, auch womöglich des Profits wegen. Zum Beispiel ist die Tatsache bezeichnend, dass imSchmidschenWörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriftender Eintrag „Geld“ eindeutig vor dem Eintrag „Gelehrigkeit“ erscheint.
Doch wollen wir nicht voreilig und einseitig urteilen. In Wirklichkeit ist nämlich die Professorenzunft flexibel und weitgespannt zwischen Geld und geistigem Gut, zwischen Avantgarde und flauer Passivität – mit allen möglichen Mischformen.
Von diesem Formenreichtum will dieses Buch berichten. Allein, umsonst wird der geneigte Leser eine pünktliche Aufgliederung in Statistiken und Tabellen suchen. Dies wäre zwar eine artige Leistung gewesen und aller Mühe sicherlich wert. Helge Pross, Helmuth Plessner, das Infratest-Institut und DER SPIEGEL haben sich hier verdient gemacht. Uns steht der Sinn nach Höherem, danach nämlich, die einzigartige Einheit des Phänomens „deutscher Professor“ herauszustellen, nicht aber, ihn zu zergliedern wie einen schönen Schmetterling.
Dem kapriziösen Gegenstand dieser Studie entsprechend, wechselt der Blickpunkt mehrmals zwischen dem Sublimen und dem Lächerlichen, mit etlichen Aufenthalten an lohnenden und einfachen amönen Zwischenstationen, dort, wo, in einer Variante zu Christian Morgenstern, „Geist und Torheit so recht sich gatten“. Methodisch ist es deshalb unvermeidlich, hier einen neuen Stil von Wissenschaftlichkeit aufzuführen, der einen wohlwollenden Leser vielleicht an Flauberts unvollendete Komposition (oder ist es Kompilation?) aus Banalität und Bêtise, anBouvard et Pécuchetalso, denken lässt, während ein Kenner des Absurden Spuren des Jarryschen Dr. Faustroll zu sehen glaubt. Sie haben beide recht. Die Hypothese übrigens, dass in jedem gelehrten Dr. Faustus ein Stückchen vom Faustroll lebt, ist genauso gut bestätigt wie die Vermutung, dass jeder Assistenzprofessor ein (heimlicher) Don Juan ist, dessen Lust an der Logik in der Logik seiner Lust begründet liegt.
Im Verlauf der Geschichte saßen der Hofrat und der Hofnarr oft genug am selben Fürstentisch, ja im Fall des wittenbergischen Professors Taubmann trafen sich der wissenschaftliche und der kurzweilige Rat sogar in einer Person.
Dieses Handbüchlein soll in ähnlichem Sinne die Überzeugung stützen, dass Sinn und Unsinn nicht nur sehr nahe beieinanderliegen und miteinander interferieren, sondern dass sie einen nichtleeren Durchschnitt haben. In dieses gemeinsame Terrain haben sich immer wieder einige der besten Vertreter aus Wissenschaft, Philosophie, Sport, Theologie u. a. m. begeben, um Atem zu schöpfen, befreit von Kalkül und Methode sich dem freien anarchistischen Spintisieren überlassend, bevor am nächsten Arbeitsmorgen der Wecker klingelt und der Garten der Wissenschaft aufs neue sorgfältig bestellt werden muss.
Im Ton, der ja auch im Buch die Musike macht, verraten sich von selbst die Einflüsse der Herren Mencken, Thomasius, Rabener, Heine, Tucholsky, ohne sie allerdings zu erreichen – und des alten Simplicissimus. Aber auch trotz der vielzitierten Stimme eines Lichtenberg ist dies nicht ein aufklärerisches Buch, geschweige denn ein besserwisserisches. Ebenso wenig gebe ich hier eine leichtgewichtige Antwort auf die schwierige Frage „Was darf die Satire?“, deren Antwort „Alles!“ ohnehin nur dann schlagend ist, wenn die Satire bedroht ist. Heute ist sie aber nicht nur nicht bedroht, sie ist nicht einmal gefragt, und es ist gar nicht einfach, dem Leser einen Scherz so ins Gemüt einzupflanzen, dass er meint, dort sei nun ein Problem verborgen.
Wenn also nicht beißende Satire, scharf wie die Dogge des Simplicissimus, ist dies hier ein Exerzitium in feiner Ironie, ein „Kleintun“ des hochstehenden Professors, oder gar eine philosophische „wirklich transzendentale Buffonerie“, wie Friedrich Schlegel in dem Fragment „Philosophie – Heimat der Ironie“ schreibt? Ich fürchte, nicht einmal ein Schlegelsches Ironiefragment können wir für uns beanspruchen, geschweige denn die Hegelsche Bestimmung der Ironie als „unendliche absolute Negativität“ oder Kierkegaards „Ironie ist eine Existenzbestimmung“. Schweren Herzens sei eingestanden, dass wir mit leichterer Hand ans Werk gegangen sind.
„Schweren Herzens“, weil wir meinten, uns wie bei jedem anspruchsvollen deutschen Buch methodologisch legitimieren zu müssen. Diese Reflexion ist uns nicht gelungen, mag nun der Gegenstand zu flatterhaft gewesen sein – oder ob es die theoretische Unlust war? Von Ausnahmen abgesehen, schien der deutsche Professor in seinem Wesen problemloser als etwa ein Arbeiter oder Künstler, vielleicht weil seine Ideologie so fugenlos in seine Wirklichkeit passt und sein Selbstbewusstsein infolgedessen „bereits reflexiv gefedert“ (Sloterdijk) ist? Die Malaise liegt aber noch tiefer.
Erstens und oberflächlich, weil die spitznasige Satire zusammen mit ihrer hochstirnigeren Schwester Ironie aus der Sprache in die Zeitung abgewandert sind. Wie sehr beide bei diesem Umzug gelitten haben, zeigen täglich journalistische Glossen durch ihre nörglerische Schnodderigkeit und durch billigen Hohn, ja ehemals glänzende Nachrichtenmagazine in all ihrer jugendlich-täppischen Hämischkeit.
Der aufrechte Martin Walser hat noch etwas retten wollen für Sprache und Stil: siehe seine Frankfurter Vorlesungen „Selbstbewusstsein und Ironie“ (1981). Er musste aber bis auf Kafka zurückgehen, um fündig zu werden. Damit geht er weit über die traditionellen Mittel der Ironie hinaus, die doch lediglich den Zwiespalt von Anspruch und Wirklichkeit bloßstellen will ohne auslegende Worte der Erklärung, worin dieser Zwiespalt bestehe. Insofern ähnelt die Wirkungsweise der Ironie den Witzen ohne Worte.
Zweitens und weniger oberflächlich glaube ich, dass Ironie und Satire heute einfach unmöglich sind. „Schwer, eine Satire zu schreiben“, sagt Adorno im 134. Abschnitt seinerMinima Moralia. Ich möchte nicht widersprechen, sondern hinzufügen: „Schwer, keine Satire zu schreiben.“ Denn der Leser, ob er nun „Schneewittchen“ oder das Börsenblatt liest, kann gar nicht umhin, seine ironische Optik jedem Textverständnis vorzublenden. Naivität und Bewusstsein waren in Deutschland immer schon schwer zu trennen, wo mehr Menschen als irgendwo anders jüdische Witze lesen, wo in weniger Arbeitsstunden mehr Unzufriedenheit produziert wird als anderswo und wo die gesamte Spitze der APO Professoren werden wollte.
Das ist das Dilemma und daher die Unlust.
Angesichts dieser Misere hat sich der Autor unvermutet in einer methodischen Klemme befunden, indem er nämlich nicht mehr die angelernten Tropen und rhetorischen Tricks beibringen zu dürfen glaubte, und aus dieser Not dann ein tugendhaftes Handbuch gemacht, das konsequenterweise poetologisch neutral ist.
Wenn daher einerseits auf jedwede Heranziehung von Scherz, Satire, Ironie verzichtet wurde, so wird dies doch durch die tiefere Bedeutung der Nützlichkeit, die auch diesem Handbuch eignet, mehr als wettgemacht.
Frühere Gelehrte schon haben sich den Professor zum Gegenstand ihrer Dissertationen gemacht. Professor Dr. Johannes Flach, der oben zitiert wurde, veröffentlichte bereits1886 seine kritische WürdigungDer deutsche Professor der Gegenwart, ein zu Unrecht vergessener Klassiker. Bekannter geworden sind skurrile Prototypen wie Thomas Carlyles Professor Diogenes Teufelsdröckh, Heinrich Manns Professor Unrat und (wiewohl nicht deutsch) der liebenswerte Assistenzprofessor Timofey Pnin aus Vladimir Nabokovs eleganter Feder.
Um kurz jenseits deutscher Sprachgrenzen zu bleiben: Zweiundzwanzig Jahre nach besagtem Dr. Flach hat ein eminenter englischer Gelehrter, Francis M. Cornford, ein mehrfach nachgedrucktes, kleines Buch geschrieben, das einige gut gewürzte Passagen zum Cambridger Hochschulleben enthält:Microcosmographia Academica: Being a Guide for the Young Academic Politician. Die den amerikanischen Akademikerhainen angepasste VersionUp the Ivy. Being Microcosmographia Academica Revisitedvon Ashley Montagu, der sich zuerst anonym Academicus Mentor genannt hatte, wurde bei Hawthorn Books, New York 1966, veröffentlicht, worin aber leider das Kleintun eher in ein witzloses Niedermachen und flaches Breittreten ausartet.
Wie ein stiller Nachmittag in der Rara-Abteilung einer großen Universität ergab, haben beide, Cornford und Academicus Mentor, ihren Titel von John Earle entliehen, einem angesehenen Bischof und Oxforder Scholaren, der seine Charakterstudien „Microcosmography“ (z. B. über den „Down-Right Scholar“) nach Theophrasts klassischem Vorbild modelliert hat – doch hiervon später mehr.
Professoren aus Fleisch und Blut standen ihren literarischen Kollegen um nichts nach. Der Professor der Professoren Hegel, der deutsche Plato Schelling, deutsche Professoren von Kant bis von Weizsäcker, sie alle vereinen in Kopf und Brust das Teutonische mit dem Sokratischen und halten sich rechtens, wie Fichte erkannt hat, für die feinste Spezies neben den Göttern, in der sich endlich die Bestimmung des Menschen an sich erfüllt hat.
Was Wunder, wenn Du, lieber Leser, vielleicht auch gerne Professor werden möchtest!
Um Dir ein klares und ehrliches Bild der Pflichten wie auch der Ehren, die einen deutschen Professor anfallen, zu vermitteln, sollen in diesem Buch nur beispielhafte Gelehrte, berühmte Magister und geprüfte Doktoren zu Wort kommen. Besonders dankbar bin ich für die unschätzbaren Beiträge, hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt, die mir großzügiger Weise von der Witwe meines großen Lehrers, des Prof. Dr. habil. Dr. h. c. mult. Berthold Dietrich Bummelböhm, überlassen worden sind.
Auf ihn traf zu, was Shakespeare in „Henry VIII.“, iv, ii, 51, sagt:
He was a scholar, and a ripe and good one;
Exceeding wise, fair spoken, and persuading;
Lofty and sour to them that loved him not;
But, to those men that sought him sweet as summer.
Doch nun: lector intende, laetaberis, wie Apuleius in seiner Einleitung zum „Goldenen Esel“ schreibt: Folge, lieber Leser, mit Aufmerksamkeit unserer Geschichte, und Du wirst deinen Spaß haben!
I DER DEUTSCHE PROFESSOR BEI DER ARBEIT
Arbeit[mhd. Arebeit, „Mühe“, „Not“] zielbewußte Kraftbetätigung, bes. die auf Schaffung von Werten gerichtete körperliche oder geistige Tätigkeit des Menschen.
dtv-Lexikon, A-Bam (1979), S. 187
Der deutsche Professor definiert und legitimiert sich wie jeder Deutsche durch seinen Beruf und die Arbeit, die er in diesem Beruf ausübt. Dabei sollte hier Hans Magnus Enzensbergers Bemerkung beachtet werden: „Jeder Beruf hat seine eigenen Risiken, seine spezifischen Pathologien, seinedeformation professionelle. Bergleute leiden unter ihrer Staublunge, Schriftsteller an narzißtischen Störungen, Regisseure an Größenwahn. Alle diese Defekte lassen sich auf die Produktionsbedingungen zurückführen, unter denen die Patienten arbeiten.“ (Siehe seinBuch Elixiere der Wissenschaft, (2004). S. 13).
Um also die Freuden und Leiden des Patienten „deutscher Professor“ erfolgreich diagnostizieren zu können, müssen wir ihn bei der Arbeit beobachten. Als Produktionen seines Berufslebens sollen nun kurz die folgenden skizziert werden: Die Rezension, die wissenschaftliche Arbeit, die Vorlesung, die Nänie (Trauerrede) auf einen verstorbenen Kollegen, allgemeine Antworten auf allerlei spezielle Fragen von Studenten u.a., und die Vergabe und Betreuung von Doktorarbeiten.
1. Die Rezension
Ich meinesteils würde ebenso gern einer Spielbank oder einem Bordell vorstehn als so einer anonymen Rezensionshöhle.
A. Schopenhauer; Paralipomena. Über Schriftstellerei und Stil. Sämtliche Werke, § 281, Bd. 5, Darmstadt 1976, S. 605
Wiewohl Professor Georg Christoph Lichtenberg im Sudelheft D schriftlich behauptet: „Wenn er eine Rezension verfertigt, habe ich mir sagen lassen, soll er allemal die heftigsten Erektionen haben“, so will ich dem aus eigener negativer Erfahrung und nach Einholen von Meinungen rezensierender Kollegen, die alle (bis auf einen klassischen Philologen) mit mir übereinstimmen, auf das allerentschiedenste widersprechen. Wahr und wichtig ist vielmehr nicht die erogene, sondern die rein eristische Komponente der Rezension, die streitbare Lust am Besserwissen. Jedes Buch, kaum hat es das Neonlicht im Buchladen erblickt, wird zuerst einmal von der allgemeinen Kinderkrankheit aller Bücher, der Rezension, angefallen. Mit Recht haben sich Lichtenberg und vor allem auch Schopenhauer gegen die anonyme Rezension gewehrt, deren Vertreter Schurken und Schufte, Hundsfötte und Blindschleichen betitelt werden. „Tout honnête homme doit avouer les livres qu’il publie“, wie Rousseau in der Vorrede zu seinerNeuen Hêloïseschreibt.
Wenn du dem oft verleumdeten Club der Rezensenten ernsthaft beitreten willst, wirst du einige Regeln zu deinem eigenen Vorteil beachten müssen. Wie im Leben allgemein, gilt es auch hier, den Unterschied zwischen dem Besserwissen und dem Bessermachen durch eine möglichst fehlerfreie Grammatik zu überbrücken. Um Emil Staiger zu rezensieren, musst du, ja darfst du nicht Emil Staiger sein; ein gut aufgelegter Max Frisch ist da besser. Generell wird die genannte Überbrückung desto reibungsloser gelingen, je inkommensurabler Autor und Rezensent sind. Verschiedenheit schafft Distanz, mithin Objektivität und klare Sätze.
Hast du selber über den zu rezensierenden Gegenstand, wie wir gerne sagen, „gearbeitet“, und bist dabei zu entgegengesetzten oder auch gar keinen Ergebnissen gekommen, so wirst du geschickter Weise deine ablehnende Argumentation durch Hinweise auf die sogenannte „vorhandene Literatur“ beträchtlich abkürzen können. Geht es in einer Rezension doch nicht so sehr darum, recht zuhabenoder zubekommen, als recht zubehalten. Auch ist es sehr gefährlich, sagt Voltaire irgendwo, in Dingen Recht zu haben, wo große Leute unrecht gehabt haben. Die Verfasser eben dieser vorhandenen Literatur werden dir übrigens darin beistimmen, dass die Wahrung des geistigen Besitzstandes allemal wichtiger ist als der schnöde Erwerb neuen Besitzes.
Der Besprechungsteil eines Journals ist nicht der Ort, sich wissenschaftlich zu verausgaben. Dagegen bietet die Rezension eine billige Gelegenheit zu feinem Lob und gerechtem Tadel. Lob vermag besonders wohlfeil auf den Rezensenten zurückzuwirken nach der horazischen Maxime „Acedas socius, laudes, lauderis ut absens“ (Sat. II, 5/72) – „Werde Kumpan und lobe, damit man dich wieder lobt, in deiner Abwesenheit“. In der Tat, es ist ja möglich, dass jemanddichrezensiert. Wenn er deine Werke lobt und preist, gut; dann hat er sich an die Clubregeln gehalten.