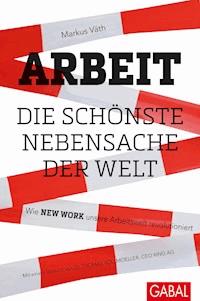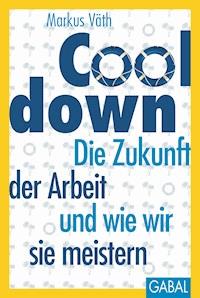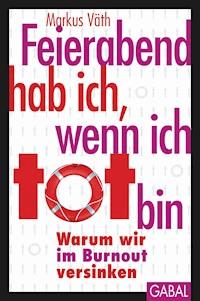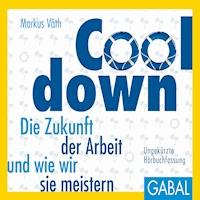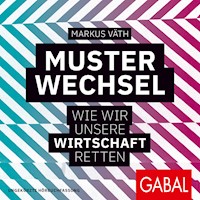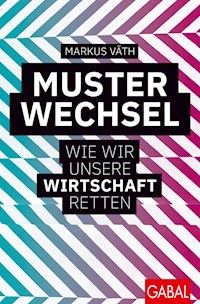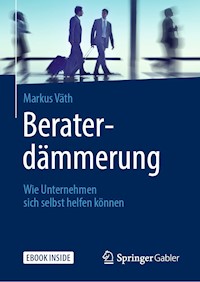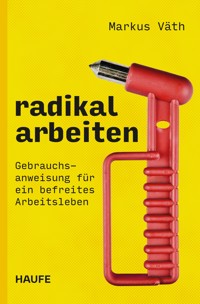
24,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Arbeitswelt, wie die meisten von uns sie kennen, ist oft frustrierend: zu viele Meetings und E-Mails, zu viel Bullshit und Bürokratie, zu wenig Aufbruch und Dynamik, zu wenig Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Wir haben eine Arbeitswelt gebaut, in der die Arbeit uns beherrscht – und nicht wir die Arbeit. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hier setzt Markus Väth an. "Radikal Arbeiten" ist die Antwort auf genau diese unbefriedigende Arbeitssituation. Er zeigt in seinem Buch, wie wir zum Wesentlichen zurückkehren und nicht im täglichen Chaos des Arbeitsalltags versinken. Ihm geht es um Arbeit ohne Bullshit, Arbeit ohne Angst, lebendige Organisationen und Arbeit, in der wir unsere Stärken tatsächlich verwirklichen können. Markus Väth macht klar, wie wir Menschen ticken, was uns produktiv und glücklich macht, wie wir Sinn in unserer Arbeit finden und konstruktiv zusammenarbeiten – unterstützt von mehr als dreißig kleinen und großen Werkzeugen für den beruflichen Alltag. Eindringlich legt er uns fünf Prinzipien ans Herz, von denen wir uns leiten lassen sollten: - Pragmatismus: "Mach das, was funktioniert und lass alles andere weg" - Entfaltung: "Bring das Beste in dir und anderen hervor" - Abgrenzung: "Schütze dein Privatleben vor deiner Arbeit" - Respekt: "Begegne anderen mit Hilfsbereitschaft und Wertschätzung" - Lernen: "Erweitere täglich dein Wissen und Können" "Menschen wollen mit ihrer Arbeit einen Unterschied machen, sie wollen etwas bewirken." Markus Väth ist Arbeitspsychologe und Initiator des Radikalen Arbeitens. Er gilt als einer der führenden Vertreter für Neues Arbeiten und zählte 2023 zu den Top 99 HR-Influencern in Deutschland. Er ist Co-Host des Podcasts "Der Radikale Salon", Kolumnist bei CAPITAL und mit Interviews und Artikeln unter anderem bei ARD, RTL, WiWo und diversen Fachmagazinen vertreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[5]Inhaltsverzeichnis
Der missverständliche Begriff: Was »radikal« wirklich bedeutetDestruktive vs. konstruktive RadikalitätVier Merkmale radikaler IdeenDer Mensch und sein Verhältnis zur ArbeitTeil 1: Krise, Knappheit, Kollaps: Die Arbeitswelt ist längst radikalFlexibler Kapitalismus und seine FolgenDer psychologische ArbeitsvertragDer soziale KapitalismusDer flexible KapitalismusFolgen der Schwächung des psychologischen ArbeitsvertragsWie Organisationen aus den Fugen geratenZweckrationalität und WertrationalitätOrganisationen im permanent betaUnreflektierte Struktur- und ProzessanpassungenDer unreflektierte Einsatz von Management-MethodenDie humanzentrierte OrganisationDer Mensch als ArbeitskraftunternehmerDas Mach-es-selbst-PrinzipDie Entgrenzung der ArbeitsweltDer Mensch als Unternehmer in eigener SacheTeil 2: Die Vision des Radikalen ArbeitensArbeit als FortschrittWertschöpfung neu denkenDer Zusammenhang von Fortschritt, Wertschöpfung und Radikalem ArbeitenArbeit ohne Bullshit Hauptformen von Bullshit Raus aus dem Bullshit Arbeit ohne AngstDie drei Grundmotive menschlichen LebensDie andere Seite der Medaille: AngstRadikal gegen die AngstArbeit mit DynamikGibt es ein ideales Tempo der Veränderung?Der dynamische PulsArbeit, die man wirklich, wirklich willBerufliche Stärken erkennenBerufliche Stärken entwickeln»Arbeit, die man wirklich, wirklich will« innerhalb der derzeitigen ArbeitsweltTeil 3: Die Prinzipien des Radikalen ArbeitensPragmatismus: Mach das, was funktioniert – und lass alles andere wegWerkzeuge für dich, dein Team und deine OrganisationEntfaltung: Bring das Beste in dir und anderen hervorWerkzeuge für dich, dein Team und deine OrganisationAbgrenzung: Schütze dein Privatleben vor deiner ArbeitWerkzeuge für dich, dein Team und deine OrganisationRespekt: Begegne anderen mit Hilfsbereitschaft und WertschätzungWerkzeuge für dich, dein Team und deine OrganisationLernen: Erweitere täglich dein Wissen und KönnenWerkzeuge für dich, dein Team und deine OrganisationAusblickWeiterführende InfosDanksagung AnmerkungenImpressum[9]Der missverständliche Begriff: Was »radikal« wirklich bedeutet
[10]»Wer es könnte: Die Welt hochwerfen – dass der Wind hindurchfährt.«
Hilde Domin, Dichterin
Wann hast du das letzte Mal etwas Radikales gedacht, gesagt, getan? Wann hattest du das Gefühl des persönlichen Sprungs, des Aufatmens, vielleicht der Befreiung aus Situationen, Beziehungen, Verhältnissen? Diesen persönlichen Moment, den der Schriftsteller Hermann Hesse mit dem Satz unsterblich gemacht hat: »Einem jeden Anfang wohnt ein Zauber inne«?1
Radikal denken, fühlen, handeln setzt das Bisherige in eine neue Perspektive. Man tritt in den Raum des Übergangs, wagt etwas und schlägt eine neue Richtung ein. Oft sind es Handlungen, die wir ersehnen, deren Konsequenzen wir aber oft nicht überblicken können: der berufliche Neuanfang in einer anderen Stadt, die Trennung nach einer langen Beziehung, das Übernehmen von Führungsverantwortung, die Entscheidung für oder gegen eine wichtige Operation, Mutter oder Vater werden. In allen diesen Situationen wagen wir etwas. Radikale Lösungen verändern nicht nur die Welt, sondern auch uns selbst.
Radikale Ereignisse haben spürbare Konsequenzen für alle Beteiligten. Der Begriff »radikal« kommt vom lateinischen radix (»Wurzel«); im Duden steht an erster Stelle der Begriffsklärung nicht, wie man meinen könnte, »mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend«, sondern »von Grund aus erfolgend, ganz und gar; vollständig, gründlich«. Radikal denken, fühlen und handeln bedeutet vor allem, dem Wesen einer Sache näherkommen. Persönliche Meilensteine in der Arbeit oder im Leben allgemein können dann radikal sein, wenn sie uns etwas über uns selbst erzählen: über unsere Wünsche und Ziele, über unsere wahren Werte und darüber, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen.
Selbstverständlich gibt es auch eine dunkle Seite der Radikalität. Manchmal lesen wir von Personen oder Gruppen, die sich religiös oder [11]politisch »radikalisiert haben«. Auf offener gesellschaftlicher Bühne oder im stillen Kämmerlein werden Pläne für eine radikale Abkehr von bisherigen Verhältnissen geschmiedet. Eine Abkehr, ja Abscheu für bisherige Verhältnisse paart sich mit einer Zukunft, die man nicht nur für sich, sondern für einen möglichst großen Personenkreis herstellen will: die eigene Familie, den Staat, eine religiöse Gesellschaft oder gleich die ganze Welt.
Destruktive vs. konstruktive Radikalität
Man könnte deshalb zwischen »destruktiver Radikalität« und »konstruktiver Radikalität« unterscheiden. Radikalität kann destruktiv werden, wenn sie sich nicht mehr an offenen, rationalen Diskursen orientiert, sondern alternative Meinungen ausschließt oder wenn sie gewaltsam durchgesetzt wird. Radikale Ideen und Bewegungen, die ins Destruktive kippen, erkennt man unter anderem daran, dass man sich gegenüber Andersdenkenden abschließt oder sie sogar aktiv bekämpft. Destruktive Radikalität ist dogmatisch – sie hinterfragt sich selbst nicht mehr, sondern wird zur unhintergehbaren, absoluten Wahrheit. So werden auch keine Kompromisse mehr möglich und Veränderungen verwirklichen sich nur durch Zwang oder Gewalt. Demokratische Prozesse, die vielleicht am Anfang einer radikalen Idee standen, werden mehr und mehr zurückgedrängt oder ausgehebelt.
Im Gegensatz zur destruktiven Radikalität kann konstruktive Radikalität als notwendiger Motor gesellschaftlichen Fortschritts gelten. Für diese Form der Radikalität braucht man Haltung und schützende Mechanismen der Selbstreflexion. Sobald eine radikale Bewegung aufhört, über sich selbst nachzudenken oder sich infrage zu stellen, ist der Weg zu Zwang und Unterdrückung nicht mehr fern. Genauso wichtig [12]ist die mögliche Veränderung der Idee durch Argumente, Diskussion und den offenen Austausch mit anderen Perspektiven.
Destruktive Radikalität geht immer zulasten der Umgebung – bis hin zur psychischen oder physischen Vernichtung. Amokläufer, welche die eigene Familie oder eine Schulklasse auslöschen; Selbstmordattentäter, die sich auf einem Basar in die Luft sprengen, oder politische Parteien, die mit fremdenfeindlichen Ressentiments oder mit der Angst der Menschen auf Stimmenfang gehen. Das sind Beispiele einer destruktiven Radikalität, die letztlich Schaden auf allen Seiten anrichtet. Der ursprüngliche Impuls des Radikalen, die Veränderung der persönlichen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, der Aufbruch, die Befreiung wird sofort im Keim erstickt durch Zerstörung und Leid.
Konstruktive Radikalität hingegen geht in Resonanz mit ihrer Umwelt. Alle historisch radikalen Bewegungen mit langfristigem Erfolg waren konstruktiv radikal: die indische Bewegung des gewaltlosen Widerstands unter Mahatma Gandhi gegen die britische Kolonialherrschaft; die amerikanische Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, aber auch die friedliche ostdeutsche Revolution von 1989. Alle diese Bewegungen eint das Humanistische, das Konstruktive. Sobald Gewalt, Zerstörung und Unterdrückung ins Spiel kommen, bricht die Resonanz mit der Umwelt zusammen und man muss die Radikalität durch Zwangsmaßnahmen und totalitäre Methoden aufrechterhalten und rechtfertigen. So wandelt sich konstruktive Radikalität in destruktive.
Radikalität zeigt sich in vielen Ausdrucksformen, sei es in politischen oder sozialen Bewegungen, in der Form privater Initiativen – und in Organisationen. Auch dort muss Radikalität positiv besetzt werden, um Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Gewerkschaften streiken für höhere Löhne und damit für »soziale Gerechtigkeit«, Unternehmensleitungen appellieren an »Werte« oder propagieren »Nachhaltigkeit« bzw. andere ethische Konstrukte, um radikale Schritte zu rechtfertigen. Es geht dann beispielsweise bei Standortschließungen »um [13]das Überleben des Unternehmens«. Dass solche Aussagen in der Regel keinen positiven Widerhall, sondern eher unmittelbares Misstrauen erzeugen, zeigt, wie störanfällig die Resonanz zwischen Organisationsleitung und Belegschaft sein kann. Oft werden radikale Lösungen im Organisationskontext – von denen wir später einige kennenlernen werden – als destruktive Radikalität wahrgenommen. Anders als bei sozialen oder politischen Bewegungen entsteht in den seltensten Fällen eine Atmosphäre der Solidarität und der Übereinstimmung. Radikalität wird dann nicht miteinander, sondern gegeneinander gelebt. In Organisationen kämpft man dann nicht nur gegen die äußeren widrigen Umstände oder um Marktanteile, sondern auch gegeneinander: um Vorteile innerhalb der radikalen Dynamik und um die Deutungshoheit der Geschehnisse.
Solche destruktiven Varianten der Radikalität sollen allerdings nicht Thema dieses Buches sein. Radikales Arbeiten ist, wie wir sehen werden, weit davon entfernt, destruktiv zu sein, Menschen oder Dinge zu zerstören bzw. Leid zu verursachen. Im Gegenteil ist Radikales Arbeiten ein Entwicklungsprogramm für Menschen, eine »Gebrauchsanweisung für ein befreites Arbeitsleben«. Es stellt die positive Resonanz wieder her – zwischen dem Menschen und seiner Arbeit, zwischen den arbeitenden Menschen untereinander und auch zwischen der Organisation und der Gesellschaft. Es ist in den später dargestellten Prinzipien kein »Mind-Set«, sondern ein »Action-Set«, ein flexibles Programm zur Verbesserung der eigenen Arbeit: einfach, verständlich, wirksam. Radikales Arbeiten ist humanistisch in dem Sinne, dass es die Grundlage bildet für menschliche Arbeit an sich. Wo immer Menschen allein oder in Gruppen arbeiten, können sie von Radikalem Arbeiten profitieren.
Woran erkennt man nun radikale Ideen? Erinnern wir uns an die obige Herleitung und die Definition des Begriffs »radikal«: »von Grund aus erfolgend, ganz und gar; vollständig, gründlich«. Was bedeutet das im politischen, kulturellen oder organisationalen Kontext? Was kennzeichnet die »Gründlichkeit« positiver Radikalität? [14]Betrachtet man historische Bewegungen wie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King in den 1960ern, den Kampf der polnischen Gewerkschaft Solidarność unter Lech Wałęsa in den 1980ern, ökonomische Initiativen wie das von Muhammad Yunus in den 1990ern forcierte Mikrokreditwesen in Bangladesch oder die Gemeinwohlökonomie des Österreichers Christian Felber in den 2010ern, fallen vier Merkmale in der Entwicklung dieser radikalen Ideen auf: der Paradigmenwechsel, die Risikobereitschaft, der visionäre Impuls und die Beschleunigung.
Vier Merkmale radikaler Ideen
1 | Paradigmenwechsel
Der Paradigmenwechsel ist, wie schon angedeutet, Merkmal jeder radikalen Idee. Von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes her (»Wurzel«) über den Anspruch des Großformatigen bis hin zur Reaktion der Umwelt geht es bei radikalen Ideen um das Grundsätzliche. Kein Fortschritt in kleinen Schritten wird angestrebt, sondern »der große Wurf« oder der »Befreiungsschlag«.
Radikale Ideen entstehen oft in einer Phase des individuellen, organisationalen oder gesellschaftlichen Übergangs, der anthropologischen liminal spaces. So gab sich beispielsweise die Französische Revolution im späten 18. Jahrhundert nicht mit kleinen Verbesserungsschritten zufrieden, sondern stürzte die Monarchie und begann, die Grundzüge einer Republik zu verwirklichen.
Allerdings ist ebendiese Französische Revolution auch ein Beispiel einer radikalen Idee, die von der konstruktiven auf die destruktive Seite gekippt ist. Die Jakobiner um Danton und Robespierre errichteten ein Terrorregime und ertränkten die Revolution schließlich im Blut der Bürgerinnen und Bürger, woraufhin sich Napoleon wieder zum [15]Kaiser aufschwingen konnte. Dennoch: Mit dem Ende des Gottesgnadentums und der Installation eines souveränen Volkswillens, mit der Abschaffung des Ständesystems zugunsten einer Gleichheit vor dem Gesetz und mit der Trennung von Kirche und Staat gelang der Französischen Revolution ein Quantensprung hin zu einer modernen Gesellschaft.
2 | Risikobereitschaft
Außerdem kann bei der Verwirklichung einer radikalen Idee von einer enormen Risikobereitschaft aller Beteiligten ausgegangen werden. Während der Entwicklung seines Raumfahrtunternehmens Space X zum Beispiel setzte CEO Elon Musk alles auf eine Karte (man kann Elon Musk für vieles kritisieren, aber seine industriellen Revolutionen mindestens im Automobil- und Raumfahrtsektor sind unbestritten). Nach drei gescheiterten Startversuchen investierte Musk sein gesamtes Kapital in einen erneuten, vierten Raketenstart; er gab damals selbst zu Protokoll, dass er bei einem Fehlschlag pleite gewesen wäre. Musk gelang es darüber hinaus, seine Mannschaft zu ungewöhnlichem Engagement und unglaublicher Leistung zu motivieren – mit dem Ergebnis, dass die Belegschaft bereit war, sein Risiko zu teilen und nicht abzuwandern. Im Endeffekt wurde das Risiko belohnt: Der vierte Raketenstart gelang und Space X entwickelte sich zu einem der führenden privaten Raumfahrtunternehmen.
Risikobereitschaft hängt unmittelbar mit dem Willen zur Investition zusammen: persönlich, zeitlich, technologisch, finanziell. Der Volksmund sagt: »Von nichts kommt nichts.« Und das gilt insbesondere bei der Umsetzung einer radikalen Idee, die mitunter ganz enorme Anstrengungen von den Beteiligten verlangt. Jeder Testflug, jede Himalaja-Besteigung, jeder Firmenkauf birgt Risiken, die man bewusst eingeht, um seine Vorstellung von der Zukunft zu verwirklichen. Ohne Risikobereitschaft gibt es keine Verwirklichung des Wesentlichen, der großformatigen Idee.
[16]3 | Kraftvolle Vision
Parallel zur grundsätzlichen Veränderung (»Lasst es uns tun!«) muss eine radikale Idee eine kraftvolle Vision entwickeln, welche die Menschen überzeugt, ja mitreißt und die Frage beantwortet: »Wofür tun wir es?« Auch zu Beginn der Französischen Revolution gelang es den Anführern, die Massen zu begeistern und sie auf ihre Seite zu ziehen. Armut, Hunger und Unterdrückung waren schon immer kraftvolle Treiber von Veränderung. Die Denker der Französischen Revolution verknüpften dies mit der Aussicht auf Mitsprache, auf ein besseres Leben und die Würdigung der bislang verachteten Stände und Klassen. Bis heute kommt keine gesellschaftliche oder organisationale Veränderung ohne »Vision« aus, ohne »Mission« oder »Purpose«. Alle diese Werkzeuge sind im Grunde zahme Versionen einer radikalen Idee.
Das Paradebeispiel einer positiven radikalen Idee stammt erneut aus der Raumfahrt: die Mondlandung von 1969. US-Präsident John F. Kennedy gab 1961 die Vision vor, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen – ein bis dahin wenn nicht undenkbares, so doch höchst ambitioniertes Vorhaben. Die Russen hatten 1957 zum ersten Mal einen Satelliten erfolgreich ins All geschossen. Dieses als »Sputnik-Schock« bekannt gewordene Ereignis führte schließlich zur amerikanischen Mondlandung und zum »race to space« zwischen Amerikanern und Russen.
Die Vision einer radikalen Idee überführt die Unruhe, den Handlungsimpuls, in ein konkretes, äußerst anspruchsvolles Ziel. Radikale Ideen sehen sich daher oft selbst als Werkzeuge des Fortschritts, als überfällige Korrekturen einer Gegenwart, die viel zu lang auf ausgetretenen Pfaden unterwegs ist.
4 | Beschleunigung
Schließlich bestechen radikale Ideen oft durch die Schnelligkeit ihrer Umsetzung, ihre Beschleunigung. Eine Art institutionalisierte Ungeduld erfasst die Anhängerinnen und Anhänger einer radikalen Idee. Sie möchten veränderte Verhältnisse lieber heute als morgen. Im [17]Gegensatz zur Umwelt haben sie die verbesserte Zukunft bereits vor Augen und wollen – im Guten wie im Schlechten – ihre Version der Zukunft möglichst schnell umsetzen. So gut wie alle politischen, religiösen oder kulturellen Strömungen, von der Roten Armee Fraktion (RAF) bis zu christlichen bzw. muslimischen Fundamentalisten, sehen die Gegenwart als etwas, das möglichst schnell in ihrem Sinn überwunden werden soll.
Von allen Merkmalen radikaler Ideen ist die Beschleunigung die problematischste. Wenn es um radikal neue Technologien geht, sorgt deren Brauchbarkeit für eine möglichst schnelle Marktdurchdringung, egal ob es um neue Impfstoffe, Smartphones oder die breite Anwendung künstlicher Intelligenz geht. Dabei verhalten sich diese Technologien zunächst ethisch neutral; sie können für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Die Spaltung des Atoms führte zu einer neuen Form der Energieversorgung genauso wie zur Vernichtung von Hunderttausenden in den Flammenhöllen von Hiroshima und Nagasaki. Künstliche Intelligenz kann zur Entwicklung personalisierter Medizin genauso genutzt werden wie zum Design biologischer Waffen. Der etwas platte Spruch »Es ist nicht das Gewehr, das tötet, sondern der Mensch, der den Abzug betätigt« hat in der Hinsicht seine Berechtigung, als die Technologie im Dienst einer menschlichen Ethik steht – oder eben nicht. Gerade die rasende Entwicklung der künstlichen Intelligenz macht deutlich, wie sehr die Diskussion ethischer Bedenken der technologischen Schnelligkeit hinterherhinkt.
Die soziale Beschleunigung unserer Entscheidungsfindung hält nicht Schritt mit der technologischen Beschleunigung. Menschen brauchen Zeit für das Erklären, Diskutieren und Testen neuer Ideen. Das kann radikale Ideen scheitern lassen: Da sie nicht auf den Faktor Beschleunigung verzichten wollen, diskreditieren sich manch radikale Ideen durch Ungeduld und destruktive Handlungen wie Anschläge oder die Verurteilung Andersgläubiger (um in den oben genannten Beispielen zu bleiben).
[18]Im Kontext von Organisationen realisiert sich Beschleunigung durch Entscheidungsgewalt und die Macht der hierarchischen Umsetzung. Natürlich erzeugt die Schließung eines Werks in der Industrie einen gewissen Gegenwind, doch letztendlich kann die Beschleunigung durch eine exekutiv getroffene Entscheidung nicht aufgehalten, sondern deren Konsequenzen können nur abgemildert werden.
Der Mensch und sein Verhältnis zur Arbeit
Wofür setzt sich Radikales Arbeiten ein?
Radikales Arbeiten, um es kurz zu machen, beschäftigt sich mit menschlicher Arbeit. Überall dort, wo menschliche Arbeit verrichtet wird, sei es im Fegen von Straßen, im Erstellen von Projektberichten oder im Überwachen von Maschinen, sollte radikal gearbeitet werden.
Radikal Arbeiten möchte, dass
möglichst jede Arbeit in irgendeiner Form einen Beitrag zum Fortschritt der Gesellschaft leistet, zu Wohlstand, Sicherheit, Innovation, Bildung und Gesundheit,wir in unserer Arbeit Anerkennung, Respekt, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit erfahren,wir unsere Arbeitszeit nicht mit Bullshit vergeuden, sondern in unserer Arbeit zum Wesentlichen, zur echten Arbeit kommen,wir eine Arbeitswelt ohne Angst bauen; dass wir Menschen befähigen, sich selbst und ihre sozialen Beziehungen so zu steuern, dass Konflikte konstruktiv sind,wir Organisationen bauen, die wo immer möglich nach Prinzipien und nicht nach Regeln funktionieren und dem Gedanken einer »Autonomie von unten« folgen,[19]wir unsere Talente und Überzeugungen ausleben können; nicht egoistisch zulasten anderer, sondern am »richtigen Platz« für ein gelingendes Leben.Bevor wir jedoch in den weiteren Kapiteln zur momentanen Situation der Arbeitswelt, zur Vision des Radikalen Arbeitens und seiner Anwendung kommen, müssen wir uns kurz mit dem Menschen und seinem Verhältnis zur Arbeit beschäftigen.
Spätestens seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert durchzieht die Arbeitswelt und damit auch jede moderne Tätigkeit, die wir verrichten, ein unauflösbarer Konflikt: So gut wie jede menschenbezogene wissenschaftliche Disziplin, sei es Medizin, Psychologie, Soziologie oder Philosophie, geht vom arbeitenden Menschen als Subjekt aus. Das bedeutet, der Mensch sollte mit seinem Denken, Fühlen und Handeln im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Mit anderen Worten: Die Arbeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Arbeit.
Eine solche Sichtweise bedeutet ausdrücklich nicht, dass Arbeit immer mit Spaß und Leichtigkeit verbunden sein sollte. Das wäre eine oberflächliche, hedonistische Sicht auf die Dinge. Jeder arbeitende Mensch weiß, dass Arbeit auch Mühsal und Frust bedeuten kann. Den Menschen als Subjekt seiner Arbeit zu sehen, bedeutet vielmehr anzuerkennen, dass menschliche Arbeit mit Merkmalen wie Respekt, Anerkennung, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit angefüllt sein sollte.
Dem gegenüber steht die Objektivierung des Menschen im Arbeitsprozess, die Reduzierung auf seine Funktionalität als Arbeitskraft. Es ist eine Art »ewiger Kampf« zwischen den philosophischen und psychologischen Ansprüchen der menschlichen Existenz und den Realitäten der Arbeitswelt, ein Kampf, der mitunter zuungunsten des Menschen ausgeht. Die Wahrnehmung dieses Kampfes reicht weit über die Arbeitssphäre hinaus. So warnte selbst Papst Johannes Paul II. bereits Anfang der 1980er-Jahre davor, Menschen als bloße Werkzeuge im Arbeitsprozess zu behandeln. Dies wäre eine Verwirrung, eine glatte »Umkehrung der Ordnung«. Auch im Kapitalismus müsste der Ein[20]zelne als »wahrer Gestalter und Schöpfer« gerade in der Arbeit verstanden werden.2
Dabei ist eine teilweise Reduzierung auf die funktionale Arbeitskraft eine Grundbedingung für Arbeitsteilung und damit der modernen Arbeitswelt. »Funktional« bedeutet, dass man sich zunächst auf bestimmte Fähigkeiten und Aufgaben konzentriert, um spezialisierte Tätigkeiten effizient zu organisieren. An einem Software-Programmierer interessiert vor allem, ob er »funktional« ist in dem Sinne, dass er die nötigen Programmierkenntnisse für seinen Job mitbringt. Diese Funktionalität kann man »objektivieren«: Man betrachtet den Programmierer als »Objekt«, als Mittel zum Zweck, mit dem die Organisation ihr Ziel (das Herstellen von Software) besser erreicht. Der Mensch wird buchstäblich zur »Arbeitskraft«, die nur im Hinblick auf ihren Lösungsbeitrag interessiert. Kein Krankenhaus könnte ohne die Arbeitsteilung zwischen Ärztinnen bzw. Ärzten, Pflegepersonal und Verwaltung existieren. Kein Unternehmen könnte Waren herstellen oder Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen anbieten, wenn nicht höchst unterschiedliche Menschen für einen gemeinsamen Zweck arbeitsteilig zusammenarbeiten würden. Eine gewisse Objektivierung des Menschen und die damit verbundene Funktionalisierung ist kapitalistischen Arbeitsprozessen somit eingeschrieben.
Dennoch versucht man in der Arbeitswelt, diese Spannung, dieses Tauziehen zwischen Subjekt und Objektivierung, zwischen einem »arbeitenden Souverän« (Axel Honneth) und seinem funktionellen Arbeitsplatz zu reduzieren, zum Beispiel durch Slogans wie »der Mensch im Mittelpunkt« oder durch Initiativen zu Werten und Kultur bzw. durch arbeitspolitische Maßnahmen.
Wir spüren instinktiv, dass es in der menschlichen Arbeit um mehr als das Einreihen in eine Prozesskette, um das Empfangen von Befehlen oder das Funktionieren als »menschliche Ressource« (»Human Resources«) geht. Dass diese Abmilderung, diese Wiederherstellung des Subjekts jedoch oft schiefgeht, erkennt man an steigenden Krankheitszahlen, am epidemischen Motivationsverlust der Beschäftigten [21]und an sinkender Produktivität. Der Mensch erkennt den Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Arbeitswelt, zwischen den hehren Worten und der Realität in Bürofluren und Fabrikhallen. Allzu oft bleiben Respekt, Anerkennung, Sinn und Wirksamkeit auf der Strecke.
Das Ziel des Radikalen Arbeitens ist es nicht, den Widerspruch zwischen dem Subjektanspruch des arbeitenden Menschen und der Reduzierung auf seine Funktion als Arbeitskraft aufzulösen. Dieser Widerspruch ist dem kapitalistischen System der Arbeitsteilung eingeschrieben. Das Konzept des Radikalen Arbeitens kämpft vielmehr dafür, dass die Funktionalisierung des Menschen, seine Reduzierung auf eine »Ressource« des arbeitsteiligen Systems nicht die Oberhand gewinnt. Es kämpft dafür, dass Arbeit für den Menschen da ist – und nicht umgekehrt. Das Ziel muss sein, in der Gesellschaft, in der Politik, in Organisationen und in den arbeitsbezogenen Wissenschaften ein Bewusstsein für die Subjektstellung des Menschen zu erzeugen und gemeinsam an einer Arbeitswelt zu bauen, die geprägt ist von Anerkennung und Respekt, von sinnvoller und gleichzeitig wirksamer Arbeit. Von allen Definitionen und Ableitungen Radikaler Arbeit ist diese mit die wichtigste: dass diese Funktionalisierung des Menschen nicht überhandnimmt und der Einzelne nicht darauf reduziert wird – das ist der Arbeitsauftrag des Radikalen Arbeitens.
In Teil 1 des Buches erläutere ich daher wichtige Aspekte ebendieser Arbeitswelt, die eine Rolle für unsere Betrachtung des Radikalen Arbeitens spielen. Danach erarbeite ich in Teil 2 eine Vision des Radikalen Arbeitens, die sich aus dem Grundauftrag für Anerkennung, Respekt, Sinn und Wirksamkeit ableitet, und schließe in Teil 3 mit den praxisbezogenen Prinzipien des Radikalen Arbeitens, die es uns allen ermöglichen sollen, radikal zu arbeiten – für uns, für die eigene Organisation und für eine zukunftsfähige Arbeitsgesellschaft.
[23]Teil 1: Krise, Knappheit, Kollaps: Die Arbeitswelt ist längst radikal
[24]Flexibler Kapitalismus und seine Folgen
»Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.«
Albert Einstein
Wenn wir uns mit dem Radikalen Arbeiten befassen wollen, müssen wir uns einem Begriff nähern, der zunächst mindestens ebenso schillernd scheint: Kapitalismus. Genau wie der Begriff »Radikalität« ist auch der Begriff »Kapitalismus« stark vorgeprägt. Er wird nicht nur in ökonomischen Debatten gebraucht, sondern dient mindestens ebenso oft als ideologisches Kanonenfutter von politisch links bis rechts.
»Kapitalismus« kennzeichnet in öffentlichen Debatten weniger ein Gesellschaftssystem als einen Kampfbegriff ohne nähere Definition. Man verwendet den Begriff eher unkritisch, auch in seinen populär verzerrenden Darstellungen. »Raubtierkapitalismus«, »Neoliberalismus« und weitere Schattierungen werden in die Diskursmanege geworfen – letztlich, ohne dass man sich wirklich mit dem Phänomen auseinandersetzt. Wie auch? Der Kapitalismus als Gesellschaftssystem ist komplex und seine Definition lässt sich eben nicht in drei Zeilen pressen oder erschöpfend in nur einem Fachartikel behandeln. Von Denkern wie Adam Smith über Karl Marx bis zu John Maynard Keynes und Ralf Dahrendorf haben sich so viele kluge Köpfe mit dem Thema Kapitalismus befasst, dass es im Rahmen dieses Buches nicht einmal eine ansatzweise erschöpfende Würdigung geben kann.
Trotzdem muss Radikales Arbeiten auf den Kapitalismus Bezug nehmen, schon deshalb, weil unsere gesamte menschliche Arbeit in diesem Gesellschaftssystem stattfindet. Dazu muss man nicht in der Wirtschaft [25]tätig sein. Auch verbeamtete Lehrkräfte, die Heilsarmee oder ehrenamtliche Vereine sind Beteiligte am kapitalistischen Gesellschaftssystem. Auch wenn es in der menschlichen Geschichte Alternativen zum westlich geprägten Kapitalismus gab und gibt (zum Beispiel den ehemaligen Sozialismus der Sowjetunion oder den aktuellen Staatskapitalismus chinesischer Prägung), bewegen wir uns innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftslogik meist wie ein Fisch im Wasser. Dieser nimmt das Wasser nicht bewusst wahr, denn es ist sein natürlicher Lebensraum. Er lebt und schwimmt dort, jeden Tag und ganz selbstverständlich.
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich nicht unterschiedliche Varianten von Kapitalismus bzw. dessen moralische Rechtfertigung diskutieren; das ist nicht das Ziel dieses Buches und wäre auch zu umfangreich. Aber es gibt einen Aspekt des Kapitalismus, der entscheidend ist für unser Verständnis von Radikaler Arbeit und den wir daher klären sollten: das Versprechen, das der Kapitalismus, vor allem in der konkreten Ausgestaltung der Arbeitswelt, den Menschen gibt, die in und für ihn arbeiten. Dieses zentrale Versprechen, das der Kapitalismus den Menschen in der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gab – Wohlstand und Jobsicherheit im Gegenzug für die eigene Arbeitsleistung, für die langfristige Perspektive, dass »die Kinder es einmal besser haben« –, wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend infrage gestellt, ja gebrochen. Die Grundthese dieses Buches lautet daher, dass Radikales Arbeiten die einzig mögliche Antwort auf den Bruch dieses zentralen kapitalistischen Versprechens ist.
Der psychologische Arbeitsvertrag
Worin bestand nun dieses zentrale Versprechen, der »Deal« zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden, der eine wichtige Grundlage war für den Aufstieg des Kapitalismus von einer frühen Industrialisierung bis zu den Weltkonzernen der 1970er-Jahre? Um das zu erklären, möchte ich kurz den Begriff des »psychologischen Arbeitsvertrags« erläutern. Das gebrochene Versprechen und die Logik des heutigen Kapitalismus sind nicht darstellbar ohne diesen Begriff.
[26]Man stelle sich die Alltagssituation einer Bewerbung vor: Der Bewerber sitzt einem oder auch mehreren Vertreterinnen und Vertretern der Organisation gegenüber. Man spricht über Aufgaben, bisherige Erfahrungen des Bewerbers und natürlich darüber, warum er gerade hier arbeiten will. In weiten Teilen des Gesprächs geht es um den offiziellen Arbeitsvertrag, um Arbeitsort, Arbeitszeit, den Verantwortungsbereich, mit wem er zusammenarbeiten wird und so weiter.
Sehr viel seltener spricht man über die gegenseitigen Erwartungen, den psychologischen Arbeitsvertrag: Was für eine Arbeitskultur herrscht in der Organisation? Was erwartet die Führungskraft an Arbeitsstil oder Initiative? Schon diese Frage erfordert aufseiten der Führungskraft Erfahrung und eine ausgeprägte Selbstreflexion. Auf der anderen Seite schweigt der Bewerber unter Umständen aus taktischen Erwägungen. Lieber nicht sagen, was man an Führung, Kultur oder den Umgang mit Verantwortung erwartet, sonst schadet man sich womöglich selbst!
So entwickeln sich manche Bewerbungsgespräche zu einer »Arena des Ungesagten«; das allerdings sät den Samen der Unzufriedenheit und des Missverständnisses. Nicht selten sind Arbeitgeber von der Kündigung eines Arbeitnehmers überrascht. Es sah doch »auf dem Papier« alles gut aus. Genauso kann eine Arbeitnehmerin ihre Kündigung als völlig unvermittelt erleben, wähnte sie sich doch in gutem Glauben, alle ihre Aufgaben »nach Vorschrift« erledigt zu haben.
Das Beispiel der Bewerbung soll uns zeigen, dass in vielen Situationen der Arbeitswelt der psychologische Arbeitsvertrag, das Klären gegenseitiger Erwartungen, eher unter den Tisch fällt. Dabei sind diese gegenseitigen Erwartungen oft entscheidend für die konstruktive Zusammenarbeit und gute Ergebnisse.
Der soziale Kapitalismus
Betrachtet man nun die Entwicklung der Arbeitswelt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, kann man, was den sogenannten psychologischen Arbeitsvertrag [27]zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgeber angeht, von einem »sozialen Kapitalismus« sprechen.3 Der soziale Kapitalismus betrachtet menschliche Arbeit als Tauschobjekt: Während Arbeitnehmende ihre Arbeitskraft investieren, sorgt der Arbeitgeber für Jobsicherheit, eine möglichst langfristige Jobperspektive und berechenbare Aufstiegsmöglichkeiten. Die organisatorische Leitstruktur des sozialen Kapitalismus ist deshalb bis heute die Pyramide: Diese ist »rationalisiert«, das heißt, jedes Amt, jeder Teil hat an einer bestimmten Stelle der Hierarchie eine genau definierte Funktion.
Die Vorteile des sozialen Kapitalismus für den Einzelnen liegen unter anderem in der Berechenbarkeit der eigenen Biografie. Der soziale Kapitalismus konnte es sich leisten, Arbeitnehmenden eine langfristige Beschäftigungsperspektive zu bieten. So war es zumindest bis zu den ökonomischen Krisen des frühen 21. Jahrhunderts durchaus üblich, das ganze Berufsleben »beim Daimler« oder »beim Bosch« zu verbringen. Eine solche langfristige Anstellung sorgt für ein berechenbares Einkommen, was wiederum die Grundlage ist für (teure) Investitionen wie eine eigene Immobilie und einen gewissen Lebensstandard.
Die pyramidalen Organisationen des sozialen Kapitalismus konnten historisch gesehen nur deshalb so lang durchhalten, da sie nicht nur nach innen hinsichtlich ihrer Wertversprechen für die arbeitenden Menschen berechenbar waren, sondern ebenso nach außen. Dafür sorgten beispielsweise eher träge technologische Innovationszyklen sowie eine starke Stellung von Gewerkschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen. Es herrschte eine Kombination aus hoher Binnennachfrage (bedingt durch den Nachholbedarf an Konsumgütern in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg) und einer aktiven Steuerpolitik mit günstigen Abschreibungssätzen. Gerade die Gewerkschaften sorgten auf Arbeitnehmerseite mit ihrem Kampf für Jobsicherheit und höhere Löhne für das Funktionieren der pyramidalen Struktur. Es ging den Gewerkschaften nicht darum, die Struktur und Funktionsweise des sozialen Kapitalismus infrage zu stellen, sondern darum, die Arbeitgeber dazu zu bringen, ihren Teil des psychologischen Arbeitsvertrags einzuhalten.
[28]Der flexible Kapitalismus
In den 1970er-Jahren begann sich der Wind allerdings zu drehen. Nur noch geringe Produktivitätssteigerungen, ein gesättigtes Konsumklima, die zunehmende Globalisierung und die aufkommende digitale Revolution setzten die klassischen, pyramidalen Organisationen des sozialen Kapitalismus unter Druck. In der Folge entwickelte sich der flexible Kapitalismus als natürliche Evolution des sozialen Kapitalismus.
Das Verhältnis der Organisation zu den in ihr arbeitenden Menschen veränderte sich, weil sich das Verhältnis der Organisation zu ihrer Außenwelt veränderte. Die Globalisierung und die Liberalisierung des internationalen Handels führten zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck auf vielen Märkten. Dadurch sanken die Preise, was die Gewinne etablierter Unternehmen schmälerte.
Insgesamt kehrte sich das bisherige Primat der Produktion über den Markt um: Stattdessen bestimmten nun Marktmechanismen die Struktur wirtschaftlicher Prozesse. Die neue Mechanik des flexiblen Kapitalismus bietet einzelnen Beschäftigten zwar oft größere Handlungsspielräume, überträgt ihnen jedoch gleichzeitig immer mehr Marktrisiken – beispielsweise durch eine direkte Kopplung der Bezahlung an den Erfolg ihrer Abteilungen.
Seit den 1970er-Jahren schwindet daher die Dominanz der pyramidalen Organisationsstruktur (außer in der Verwaltung) und gibt Raum für neue organisationale »Daseinsformen« – inklusive ganz neuer Entwicklungen wie reinen Plattform-Unternehmen (zum Beispiel in Gestalt des »Ride Hailing«-Dienstes Uber oder des Wohnraumvermieters Airbnb). Auch hier können die Gewerkschaften als Vertreter einer organisierten Arbeitnehmerschaft als Gradmesser dienen. Waren 1960 in Deutschland fast 35 Prozent der Arbeitnehmenden gewerkschaftlich organisiert, waren es 2013 nur noch 18 Prozent: ein Rückgang um fast die Hälfte.4
Insgesamt gerät der private Sektor in den letzten Jahrzehnten immer mehr unter Druck. Vom kleinen Mittelständler bis zum Weltkonzern sieht man sich globaler Konkurrenz ausgesetzt, dem Zwang [29]zur Digitalisierung, einem veränderten Wertekanon hin zu Nachhaltigkeit und Kapitalismuskritik, gerade unter jungen Menschen, einer hohen Bürokratie und (geo)politischen Verwerfungen. Darauf müssen Unternehmen reagieren, und eine solche Reaktion betrifft auch das gesamte Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmenden, eben den psychologischen Arbeitsvertrag.
Im Grunde wird der psychologische Arbeitsvertrag im flexiblen Kapitalismus zwischen diesen beiden Parteien vielleicht nicht komplett aufgekündigt, aber doch geschwächt. Waren früher Karrieren von langfristiger Sicherheit, Routine und Loyalität geprägt, kamen seit den 1990er-Jahren beispielsweise immer mehr befristete Arbeitsverhältnisse, Projektarbeit und häufige Arbeitsplatzwechsel ins Spiel. So haben sich die befristeten Arbeitsverträge in den letzten 30 Jahren in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen auf etwa 12 Prozent fast verdoppelt.5 2022 war die Hälfte aller befristet Beschäftigten jünger als 35 Jahre. Immer mehr junge Menschen erleben den Eintritt in die Arbeitswelt und mindestens die erste Arbeitsstelle als unsicher; von einem langfristigen Angebot als Gegenleistung für ihre Arbeit kann in diesen Fällen eher keine Rede sein. Dabei hat eine befristete Stelle auch handfeste soziale Folgen: Befristet Beschäftigte sind statistisch häufiger von Armut betroffen als unbefristet Beschäftigte. Sie verdienen außerdem etwa 8 Prozent weniger als unbefristet Beschäftigte und können diesen Rückstand mit den Jahren auch schlechter aufholen. Junge, befristet Beschäftigte sind auch seltener verheiratet und haben weniger Kinder als Gleichaltrige mit unbefristetem Arbeitsvertrag.6
Organisation und Individuum stehen sich im flexiblen Kapitalismus häufiger ohne feste Verbindungen oder Verpflichtungen gegenüber. Das gegenseitige Versprechen »Arbeitskraft gegen Sicherheit« hat sich weitgehend aufgelöst; es erscheinen vermehrt unsichere Arbeitsverhältnisse auf der Bildfläche, die von Stellenabbau, dem Ersatz durch künstliche Intelligenz und dem Lohndruck durch die Konkurrenz einer globalen Workforce bedroht sind. Dafür gesorgt haben nicht [30]nur die Wesensmerkmale des flexiblen Kapitalismus, sondern ebenso die erheblichen geopolitischen und wirtschaftlichen Krisen des frühen 21. Jahrhunderts: die Bankenkrise von 2008, die Flüchtlingskrise 2015, die Coronapandemie, der Ukrainekrieg oder die zweite Amtszeit Donald Trumps als US-Präsident (um nur die wichtigsten zu nennen). Alle diese Krisen verstärken die Notwendigkeit der organisationalen Anpassung an neue Gegebenheiten.
Folgen der Schwächung des psychologischen Arbeitsvertrags
Die nun schon mehrmals erwähnte Schwächung des psychologischen Arbeitsvertrags, des Versprechens »Arbeitskraft gegen Sicherheit und Berechenbarkeit« hat bemerkenswerte Folgen. Von diesen Folgen möchte ich einige wenige kurz skizzieren, die für das Verständnis des Radikalen Arbeitens wichtig sind:
den Ersatz der klassischen pyramidalen Organisation durch alternative Strukturen;die Entwertung fachlicher Tiefe zugunsten eines breiteren, dafür oberflächlicheren Qualitätsanspruchs;einen zunehmenden Mismatch zwischen geforderten und verfügbaren Qualifikationsprofilen und eine damit drohende Potenzialverschwendung;eine »soziale Kurzatmigkeit« durch das Aufbrechen langfristiger Arbeitskonstellationen und deren Ersatz durch »Projektarbeit«;einen praktisch überall spürbaren »Kooperationsinfarkt« durch misslingendes Management von Terminen, Meetings, Mails und Aufgaben.1 | Neue Organisationsformen