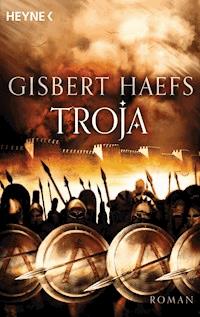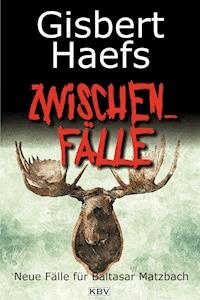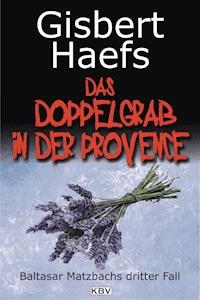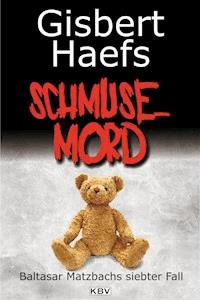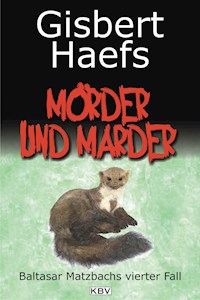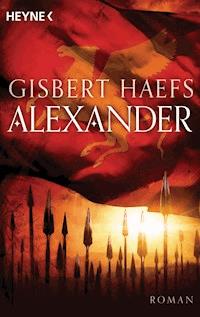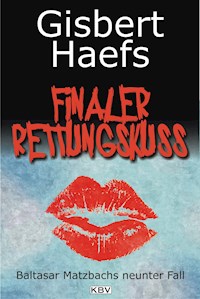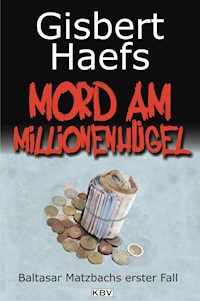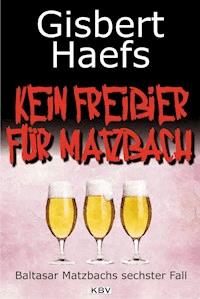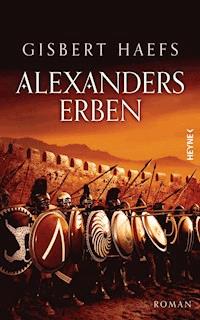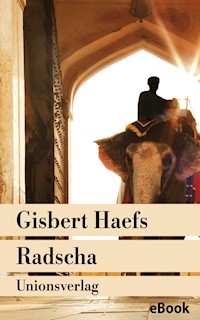
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Indien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: eine Zeit mächtiger Fürsten und großer Kriegsherren, Schauplatz dramatischer Kämpfe und ein Land für Abenteurer aus aller Herren Länder. Als der irische Bauernsohn George Thomas – eine historische Figur – 1781 an Bord eines englischen Kriegsschiffs nach Madras gelangt, erliegt er sofort der geheimnisvollen Faszination dieses farbenprächtigen und betörenden Ortes. Verführt von der Schönheit des Landes und dessen Versprechen von Reichtum und Ruhm, beschließt George zu desertieren. Denn einst prophezeite ihm eine geheimnisvolle Frau in seiner Heimat unermesslichen Reichtum. Doch dann lernt er die gefährliche Seite der Macht kennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Indien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: eine Zeit mächtiger Fürsten und großer Kriegsherren, Schauplatz dramatischer Kämpfe und ein Land für Abenteurer aus aller Herren Länder. Ein irischer Bauernsohn steigt auf zum Radscha – und lernt die gefährliche Seite der Macht kennen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Gisbert Haefs (*1950) ist Autor und Übersetzer. Er hat u. a. die Erfolgsromane Alexander und Hannibal verfasst und ist Übersetzer der Werke von Rudyard Kipling, Ambrose Bierce, Jorge Luis Borges, Sir Arthur Conan Doyle u. a. Zudem ist er Autor von Funkfeatures, Hörspielen und Kriminalromanen.
Zur Webseite von Gisbert Haefs.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Gisbert Haefs
Radscha
Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel Raja im Goldmann Verlag, München.
© by Gisbert Haefs
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Alex Nikada
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30837-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 07:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
RADSCHA
1 — Von Tipperary nach Madras2 — Saldanha und die Inquisition3 — Lucky Lukes Lektionen4 — Begegnungen in Kalkutta5 — Im Dienst der Kompanie6 — Der Weg nach Lakhnau7 — Die grünen Jahre8 — Von Lakhnau nach Lalsot9 — Samru Begum10 — Das Buch der Niedertracht11 — Jehazi Sahib und die Begum12 — Zuflucht13 — Im Strudel14 — Rundreise nach Hause15 — Radscha von Hariana16 — Die Teile und die Götter17 — Das Ende in BengalenZu Transkription und Aussprache indischer Begriffe/NamenWorterklärungenEinige Daten zum historischen HintergrundEuropäische Handelskompanien in IndienDas Mogul-ReichDie MarathasDie EuropäerMehr über dieses Buch
Über Gisbert Haefs
Gisbert Haefs: »Mehr als ein plausibles Bild ist nicht möglich, weder für Historiker noch für Autoren historischer Romane.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Gisbert Haefs
Zum Thema Indien
Zum Thema Abenteuer
Zum Thema Asien
Thomas war ein Mann von großer Kraft und Kühnheit und bemerkenswertem militärischen Genie. Im Chaos untergehender Königreiche des damaligen Indien war sein Schwert immer dem verfügbar, der am meisten bot; aber er besaß die Tugenden seines Berufsstands – niemals verriet er einen Herrn, war seinen Soldaten gegenüber gütig und großzügig und jederzeit bereit, einer Frau zu helfen.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (1911)
1
Von Tipperary nach Madras
Besser drei Tage Mann sein als ewig Geist,
besser Tiger hetzen als Hühner hüten.
Lieber Kobras walken als Würmer kneten,
lieber Stahl für Stunden als jahrelang Leder,
lieber einmal Einer als immer Jeder.
Nicht gebissen – der sein, der beißt.
Lieber einmal schlüpfen als lange brüten.
Nicht zertrampelt werden, nein, selber treten.
So viel besser das Schwert als die Feder.
NAWAZ SHAH
Er war noch nicht fünfundzwanzig, hatte nach Indien gewollt und in Bristol keine Versuche unternommen, den Presskommandos der Flotte zu entgehen. Zuletzt jedenfalls, als die Schiffe, die auf der Reede lagen, nach zuverlässigen Gerüchten nicht Nordamerika anlaufen, sondern Frachter der Ostindien-Kompanie geleiten sollten. Amerika, wo aufmüpfige Kolonisten Tee in ein Hafenbecken geschüttet und einen eigenen Staat ausgerufen hatten, mochte andere locken, aber nicht ihn. George Thomas wollte nicht für einen wahnsinnigen König kämpfen, sondern reich werden, selber König sein: ein Radscha.
Radscha: Dieses Wort war für ihn ähnlich magisch wie der sagenhafte Pagoda-Baum, der in Indien wuchs und an dem ein kluger und starker Mann nur rütteln musste, wenn er die pagoda genannten Goldmünzen haben wollte. Klug musste der Mann sein, um den richtigen Baum zu finden und von Geisterbäumen zu unterscheiden, die ähnlich aussahen, aber Schlangen regnen ließen; stark musste er sein, um kräftig genug rütteln und andere Rüttler niederhalten zu können. Glück brauchte er auch, um nicht vom goldenen Regen erschlagen zu werden.
Aber das Risiko wollte er gern eingehen; gäbe es denn einen köstlicheren Tod als diesen? In den Armen einer schönen fremden Frau liegend, unter Palmen, gekühlt vom Fächer, den ein Elefant mit dem Rüssel schwenkt, als ruhmreicher Krieger und König von Goldmünzen erschlagen zu werden? Den Tod gewissermaßen als endlosen Feiertag zu verbringen? Blut, Schweiß, Schnaps, Ruhm und Reichtum zuvor, statt elender Plackerei?
Er wusste, dass indische Fürsten viel Geld für europäische Offiziere ausgaben. Geld und die Möglichkeit, es mit dem Schwert oder mit Kanonen zu mehren. Seeleute und Händler hatten es ihm erzählt, schon im Hafen von Youghal, wenn einmal schlechte Winde einen von Gold und Gewürzen stinkenden East Indiaman an die irische Südküste verschlugen. Aber ein einfacher Ire konnte nicht Offizier werden, nicht in England. Soldat, ja, und dann vielleicht, mit der Zeit, Sergeant; und die Sultane und Radschas und Mirs brauchten europäische Sergeanten. Aber die Ostindien-Kompanie konnte in diesen Jahren kaum Soldaten anwerben, da die Krone Männer brauchte, um die Kolonisten in Amerika zu bekämpfen und die Franzosen, die ihnen halfen.
Der beste Weg zu Ruhm und Reichtum schied also aus, und wenn der einzige andere Weg bei den Presskommandos der Flotte begann, bitte sehr. So angenehm war die Arbeit als Stauer nicht, und viel schlimmer konnte es an Bord der Kriegsschiffe auch nicht sein.
Hatte er gedacht. Aber er war Ire, also Dreck, sobald sie auf See waren; und bei den zahlreichen Übungen, bei denen jene, die irgendetwas konnten, aus der Masse der Dumpfen herausgesucht wurden, hatte er ein paar Tage zu einer Geschützbesatzung gehört, seine Liebe zu Kanonen und sein Talent für sie entdeckt, bis jemand sich daran erinnerte, dass seit den Tagen von Guy Fawkes Katholiken nicht in die Nähe von Schießpulver kommen durften.
Was auch immer dort drüben, an Land, in der wilden Fremdheit warten mochte, konnte kaum schlimmer sein als die Zeit an Bord, und ohne jeden Zweifel wäre es aufregender. Natürlich hatten sie in den Mannschaftspferchen darüber geredet – wenn nicht gerade einer der Unteroffiziere an den Hängematten entlangstrich und »Bein zeigen« brüllte, um Frauen zu begrapschen und Männer mit einem Tauende zur Arbeit zu treiben. Alle wollten desertieren, vielleicht würden zwei oder drei es tatsächlich wagen. Sobald sie an Land waren, unbeobachtet von Offizieren, nicht bewacht von den steifbeinigen Seesoldaten.
Die Landbrise war heiß und schwer von Gerüchen. Irgendwo unter Deck krakeelten ein paar Frauen, die auch nach oben wollten, um etwas zu sehen. Die Männer, sofern nicht zu Arbeiten eingeteilt, lehnten an der Bordwand und starrten hinüber zu den blendend weißen Gebäuden des Orts und den dunklen Wällen der Festung. Monate auf See, eingepfercht in einem Schiff der Flotte; Monate mit madigem Hartbrot, Pökelfleisch, wimmelndem Wasser und der täglichen Schnapsration. Hängematten in stinkenden Zwischendecks, die neunschwänzige Katze als einziges Schoßtier, Drill und Plackerei an glühenden Tagen und in eisigen Nächten.
Und dort drüben gab es Dinge, die nach Wildheit dufteten, nach Hitze, schäumenden Pflanzen, Üppigkeit und Lust – Gerüche, die keiner beschreiben konnte; Düfte wie ein betäubender Hieb und auch wie ein sengendes Bohren. Die älteren Seeleute, die früher schon einmal hier oder weiter nordöstlich gewesen waren, am Hugli, wo die Kompanie einen Ort namens Kalkutta besaß, hatten immer wieder davon erzählt, aber da es nicht zu vermitteln war, war es auch nicht zu glauben. Gold und Juwelen, Elefanten und Schlangen, weise Männer, die sich nur in ihren Bart und schmierige Tücher wickelten, und schwellende Frauen, die dies nicht taten, wie man hörte. Goldene und silberne Münzen für die Tapferen, die Rückfahrt im Schiff für die Feigen, für alle einen anderen und letztlich gleichen Tod, und vielleicht vorher etwas Besseres als Hartbrot und Peitsche.
Noch jetzt, einundzwanzig Jahre später, erinnerte er sich an diese Stunden, das Fieber: warten auf die Entscheidung des Kapitäns, wie viele Seeleute an Land würden gehen dürfen. Alle wussten: Sobald der Erste verschwand, war das Spiel für die anderen beendet. Oder hatte sich die Lage entspannt? Waren vielleicht gar keine französischen Schiffe in der Nähe, sodass bis auf eine Bordwache alle zum Landgang verschwinden konnten?
Warten, warten, warten. Flaggsignale wurden gewechselt zwischen dem Schiff und dem Fort Saint George. Die Gig des Kapitäns wurde bereitgemacht, abgelassen; es sah nach noch mehr Warten aus. Dann, endlich, die erlösende Mitteilung: keine französischen Schiffe in der Nähe, drei Tage und Nächte Landgang. Der Kapitän stieg in die Gig, um sich zum Kommandanten der Festung zu begeben. Und musste umsteigen in eines der von einheimischen bemannten Boote, die aussahen wie geflochtene Hobel und als Einzige die gefährliche Brandung vor Madras überwinden konnten.
Der Zahlmeister hatte die erwartete Anweisung erhalten: keinem Matrosen mehr als ein Viertel der Löhnung auszuhändigen. Angeblich war nicht genug Geld an Bord; angeblich werde der Kapitän vom Fort mehr Münzen mitbringen. Einige Männer murrten, einige lachten, die meisten nahmen es gleichmütig hin. Man wusste Bescheid; die Kapitäne wollten verhindern, dass die Männer auf dumme oder kluge Gedanken kamen. Ein Viertel des Solds war mehr als genug, um drei Tage lang zu saufen und zu huren, bis der restliche Verstand nicht einmal in den Beutel zwischen den Beinen passte. Der ganze Sold – karg, aber über Monate sammelt sich dennoch einiges an – hätte den einen oder anderen dazu bringen können, im Land zu verschwinden, in der nächsten Stadt ein Geschäft aufzumachen. Es hieß, so etwas sei schon versucht worden und bis jetzt habe niemand überlebt. Es sei denn als Söldner eines indischen Fürsten. Aber der nächste Fürst war weit, und bis man ihn gefunden hatte, musste man von etwas leben. Ein Viertel war dafür zu wenig.
George Thomas hatte all dies nicht gekümmert. Und der Entschluss des vierundzwanzigjährigen Seemanns anno 1781 erschien dem General anno 1802 immer noch als beste und wichtigste Entscheidung seines Lebens. Seltsam, die Zufälligkeiten, dachte er. Nun ritt er in den Sonnenaufgang, mit einem britischen Offizier namens Francklin, der ihn ein paar Tage bewirtet und tausend Fragen gestellt hatte, der ihn nach Bengalen begleiten würde; damals hatte ein Franklin, zweiter Offizier des Schiffs, die Wache gehabt, und die Biografie des verrückten Iren wäre ihm keine Kauri-Muschel wert gewesen.
Er brauchte nur die Augen zu schließen, um wieder mitten im damaligen Gedränge zu sein. Die überfüllten Flechtboote mit johlenden Männern. Die Hitze, die zuzunehmen schien, als sie sich dem Strand näherten. Die Gerüche, die dichter wurden, unterfüttert vom Dunst der schwitzenden, ungewaschenen Körper. Die Stadt, von den Briten Fort Saint George genannt … Er wusste, dass sie Madras hieß und dass der Name vielleicht daher kam, dass hier einmal eine bedeutende madrasa der Mogulherrscher gestanden hatte, Schule oder vielleicht sogar Universität. Und er wusste, dass es einen alten Iren gab, aus Tipperary, der eine Schänke betrieb und Landsleuten half. Vor allem, wenn sie ebenfalls aus der Nähe von Tipperary kamen. Und wie eine Woge schlugen die Eindrücke über ihm zusammen, damals: die nackten Kinder, Frauen mit erregendem Gang – aber welche Gangart welcher Frau wäre nach den Monaten an Bord nicht erregend gewesen; den Monaten schmierigen flüchtigen Kopulierens unter Deck, wo ein paar Frauen tatsächlich mit irgendwem verheiratet und die anderen für alle waren? –, helle Häuser, darunter viele Schänken und Bordelle, Kaufläden, die Gerüche, ein Käfig, an dessen Holzstäben ein Affe rüttelte, Schwärme kreischender bunter Vögel. Er erinnerte sich an seinen ersten Gedanken, der aus dem Getümmel der Eindrücke aufragte wie die Hand eines Ertrinkenden, der von unterhalb, mit brennenden Augen, das rettende Floß gesehen hat: Und selbst wenn dieses Paradies sich als Hölle herausstellt, nur weg aus dem Fegefeuer der Navy.
Was er nicht mehr genau wusste: wie er den ersten Tag zugebracht hatte. Rudel gegensätzlicher Erinnerungen kläfften in seinem Kopf gegeneinander an. Die Zehen einer Dirne; Zinnbecher mit unverdünntem Rum; das Stöhnen der Frau und seines beim Erguss; Palmen, an denen Kinder hinaufkletterten; der Sonnenuntergang wie Blut auf dem Bajonett eines Postens am Fort; der anglikanische Priester, der in der Dämmerung einige Männer beschwor, nach den ersten Wallungen nun des Herrn zu gedenken; und der gleißende Mond dieser ersten schlaflosen Nacht. Ein fetter gelber Mond, tief über der staubigen Ebene, die keine Ebene war, sondern niedriger Busch, Dschungel, in den er nicht gehen sollte und dem er nicht fernbleiben konnte. Er musste getorkelt sein, mit Schlieren vor den Augen und, wahrscheinlich, einer Flasche in der Hand. Vielleicht hatte er gesungen oder wenigstens gelallt, als er in die tausend Geräusche und Gerüche der Nacht ging. Das Schrappen schuppiger Haut an einem verkrüppelten Stamm; Gezischel und Gekecker über ihm und weiter weg; ein stechender Ruch wie blutige Dornen, ein feister Duft wie Erbrechen nach unendlichem Gelage, ein Hauch wie Seide, die mit frischem Muskat zusammen gemahlen und dann in Zitronenwasser verrührt wird …
Plötzlich, auf einer Lichtung, suppig vom gelben Mondschleim, der halbverfallene Tempel und die Meute dürrer Hunde – gelb, sagte er sich, oder eher vergilbt –, vor denen er auf der Ruine Zuflucht suchte, ohne zu bedenken, dass dort Schlangen hausen mochten. Oben, auf der brüchigen, von Steinbrocken übersäten Plattform ein Mann, der kauernd pisste und ihn mit makellosen Zähnen angrinste, den Kopf schief, fast auf die rechte Schulter gelegt. Ein Europäer.
»Was machst du da?«
Der Mann richtete sich auf. »Ich schaffe Platz für Nachschub aus deiner Flasche, Bruder.« Eine Stimme wie Rahm und Räude, schmeichelnd und abstoßend zugleich, durchschossen vom Knarren einer kaum geölten Karrenachse. Flüssiges Englisch mit leichtem Akzent – Portugiese? Holländer? Jedenfalls kein Franzose; Thomas wusste, wie Franzosen klangen, wenn sie Englisch sprachen.
Er gab ihm die Flasche; der Mann trank, rülpste, wischte sich den Mund und hielt ihm das Gefäß wieder hin; erst dann nestelte er an seiner knielangen, längst nicht mehr weißen Hose, um das Glied zu verstauen. »Und du?«, sagte er schließlich.
»Ich? Ich … weiß nicht.«
»Frisch angekommen, mit der Fregatte, was?«
»Ja.«
»Und jetzt? Drei Tage saufen, dann zurück an Bord, dem edlen George weiterhin zu dienen?«
»Nein.«
»Ah.« Der Fremde nickte, als habe man ihm eben etwas bestätigt, was er ohnehin wusste. »Setz dich, Bruder; das will bedacht sein.«
Irgendwie kam es George Thomas ganz natürlich vor, auf der Spitze eines verwüsteten Tempels in einem wilden Land in fremdartiger Nacht mit einem Fremden die Vergangenheit, die Zukunft und die winzige Spanne dazwischen zu bereden. Sie saßen auf den Steinen, tranken abwechselnd, bis die Flasche leer war, und redeten die Sonne herauf. Der Mann hieß João Saldanha, war Portugiese aus Goa und auf der Suche.
»Ich suche Gott«, sagte er, »und hoffe, dass er nicht zuerst mich findet. Bis ich ihn gefunden habe, wie immer er aussehen mag, will ich alle Götter lästern; vielleicht bringt ihn das dazu, sich eher blicken zu lassen.«
»Heißt das, du pisst in jeden Tempel?«
Saldanha gluckste. »Geht nicht immer. Manchmal muss man gerade nicht, und manchmal sind zu viele Priester in der Nähe, die das übel nehmen würden. Dann muss man etwas anderes versuchen.«
Und das hatte auch Thomas getan, jahrelang, in einem weiten Land, in dem es dafür unendliche Gelegenheiten gab. Immer wieder waren sie einander begegnet, verabredet oder zufällig wie in jener Nacht, in der Saldanha ihm Rat und Rätsel gab. Bruder, Freund, manchmal fast Vater … aber als Vater mochte Thomas nicht an den Pilger denken. Und während er in den grellen Morgen ritt, mit dem britischen Offizier, den er für das Geleit durch die britischen Territorien mit Auskunft über sein Leben bezahlen sollte, stellte er fest, dass er an viele Dinge nicht denken mochte. Und dass es reichlich Einzelheiten gab, die er diesem Francklin nicht erzählen würde.
Als George Thomas zwölf Jahre alt war, brach sich sein Vater das Genick. Das Pferd, in vollem Galopp in ein Kaninchenloch getreten, hatte ein Bein gebrochen und musste erschossen werden. Man sagte, dies sei ein guter Tod für den alten Thomas, der Pferde geliebt und gepflegt, geheilt, zugeritten und besprochen hatte; dass er lieber unter einem Pferd als auf seiner Frau gestorben wäre, war eine der Tuscheleien – außer Hörweite der Priester. Ein Jammer nur um das Pferd; eine Frau hätte man ja nicht erschießen müssen. George fand derlei Äußerungen nur mäßig komisch, und wenn ihn niemand sah, weinte er viel, denn er hatte seinen Vater geliebt.
Später sagte er gelegentlich, zwölf sei zu früh gewesen – dreizehn sei ein gutes Alter, um festzustellen, dass es ein schlechtes Alter sei, und wenn man dies einmal festgestellt habe, bemerke man auch bald, dass jeder Punkt, auf dem man stehe, schlechter sei als die Punkte rechts und links. Gestern und morgen sind besser als heute, rechts und links sind besser als hier – einer der zahllosen Gründe, in Bewegung zu bleiben und lieber zu suchen als zu haben. Dann grinste er und sagte, den Verehrern erwachsener Sesshaftigkeit könne er noch eine Begründung seiner Jugendlichkeit geben: »Wenn es mich mit dreizehn erwischt hätte, wäre ich wahrscheinlich gereift, und wenn ich elf gewesen wäre, als es geschah, hätte ich sicherlich eine Phase oder zwei übersprungen. Stattdessen bin ich irgendwie zwölf geblieben.« Er widersprach aber denen nicht, die – das waren vor allem Briten – derlei Überlegungen verwarfen und alles durch ein Wort erklärten: Ire.
Vielleicht widersprach er ihnen deshalb nicht, weil das Wort viele andere Dinge erklärte. Vater Thomas – Patrick, der sich nach dem Willen der britischen Herren nicht Pádraig schreiben durfte – hatte als Pächter eine kleine Farm bearbeitet: magere Böden, saure Erde, verkrüppelte Bäume, ein wenig Torf. Der englische Grundherr war angeblich umgänglicher als andere seiner Art, was nichts an den Abgaben und an der Dürftigkeit des Bodens änderte. Sie hatten ein paar Schweine, drei Kühe, die sich hinter Wäschepfosten hätten verstecken können; und die Pferde. Die Pferde, die George schon als kleiner Junge ritt, ohne Sattel. Sie machten den Unterschied aus, den wichtigen Unterschied zwischen Armut und Hunger.
»Man muss etwas haben, das man besser kann als die Nachbarn«, hatte der Vater gesagt. »Viel besser … sagen wir: je besser, desto gut.«
Struppige störrische Fohlen, eingetauscht gegen eine Karrenladung Torf und eine alte Wäschetruhe; aufgepäppelt, gestriegelt, zugeritten und für goldene Guineas an englische Herren verkauft. Edle Tiere, gedacht für eine Lady, aber zu ungebärdig für ruhigen Sitz auf dem Damensattel, nach vier Tagen des Raunens und Zuredens durch Patrick Thomas lammfromm. Jagdpferde, lahm von einem Fehltritt im Galopp, nach einer Woche des Reibens und Redens und stinkender Packungen aus Schlamm und Kräutern wieder feurig und geschmeidig wie zuvor. Schwere Ackergäule, befallen von rätselhaften Krankheiten – wofür eigentlich nur pookas, mindere Dämonen, Hexen oder ähnliches Volk verantwortlich und folglich heilungsbefugt sein konnten –, zogen nach Patricks Handreichungen den Pflug so hurtig, dass es eine Lust war, zuzuschauen und nicht selbst Pferd zu sein.
Die Pferde machten den Unterschied aus: zwischen der kargen Kate aus kaum behauenen und nur sporadisch mit Moos oder Mörtel verfugten Steinen, mit zwei Räumen, Holzboden, einem eisernen Herd, dem Elternbett in einem Raum, den Betten der Kinder im anderen, und den kärgeren Katen der Nachbarn, die fast alle nur über einen Raum mit offenem Feuer verfügten und ein Bett für die ganze Sippe, falls es überhaupt ein Bett gab statt Strohmatten, die auf dem feuchten Erdboden des Inneren lagen, nicht auf üppigen Bohlen.
Der Unterschied hätte durchaus größer sein können; es gab, wie George früh überlegte, verschiedene Unterschiede, und der Abstand zwischen dem vorhandenen Unterschied und dem lediglich möglichen Unterschied hieß poteen: Schnaps, gebrannt aus allem, was man ansonsten hätte essen können. Schnaps, von dem Patrick Thomas reichlich genossen hatte, als er seinen letzten Ritt begann, und ohne den er vielleicht den Sturz überlebt hätte.
Aber eigentlich waren es ja nicht die Pferde, sondern deren Beine, die den Unterschied ausmachten. Die Beine, zu denen die Hufe gehörten, trugen alles. Ein Pferdekopf mochte als Aalreuse dienen; aus der Haut des Tiers ließen sich Decken und Stiefel anfertigen; die Mähne und der Schweif konnten als Bürsten und Matratzenfüllung enden; aber was war der schönste, stärkste und essbarste Rumpf ohne die Beine?
George hatte schon als Kind einen Witz gehört und als Wahrheit verstanden: abgründige Wahrheit, die alle Rätsel des Universums barg. Es ging um einen Mann, wahrscheinlich – hatte er beim Grübeln gedacht oder sich ausgemalt – einen Schäfer, mit langem Mantel und bodenlosen Taschen; dieser Mann kam – woher? – ins Dorf, ging in den Kramladen mit Ausschank, verlangte einen Tontopf mit Bier und stellte daneben einen Napf, den er aus einer der Taschen zog. Auch diesen Napf ließ er mit Bier füllen; dann holte er aus einer anderen Tasche einen kleinen Hund, ein wurstförmiges Ding ohne Beine, legte das Vieh neben den Napf und sah zu, wie es das Bier aufschlabberte.
»Aber«, sagte der Kaufmann und Wirt verblüfft, »der hat ja keine Beine!«
»Stimmt, hat er nicht«, sagte der Mann und trank einen tiefen Schluck aus dem Tontopf.
»Und wie heißt er?«, sagte der Wirt.
»Der hat keinen Namen«, sagte der Mann.
»Wie, keinen Namen? Ein Hund ohne Namen?«
»Der braucht keinen Namen; der kommt ja doch nicht, wenn ich ihn rufe.«
Jahrelang dachte George über die Geschichte nach, und über die Geschichten hinter der Geschichte. Woher kam der Mann mit dem gewaltigen Mantel? Er musste fremd in dem Dorf sein, denn andernfalls hätte der Wirt ihn und den Hund gekannt und wäre nicht überrascht gewesen. Wenn er aber von weit her kam, wie war er gereist? Gewandert? Mit dem Hund in der Tasche? Und ohne einen Beutel oder ein Bündel, von denen in der Geschichte nichts gesagt wurde? Eher besaß er wohl ein Pferd, vielleicht sogar einen Wagen. Dann musste er von noch weiter her kommen, denn George kannte in der Umgebung von Roscrea alle Leute, die reich genug waren, um mit Pferd oder Wagen weite Reisen zu machen.
Wozu schleppte er den nutzlosen Hund mit sich herum? Und wer hatte genug Geld, um nicht nur selbst richtiges Bier zu trinken, sondern auch noch den Hund damit zu verwöhnen? Richtiges Bier, von Braumeistern hergestellt und im Laden vom Fass gezapft, war teuer, zu teuer für die meisten Leute und bestimmt zu teuer für einen nutzlosen Hund ohne Beine und ohne Namen.
Aber vielleicht war der Hund ja nur scheinbar nutzlos; es musste sich um irgendein sagenhaftes Tier handeln, einen Zauberhund vielleicht oder jedenfalls ein Tier, das früher einmal Beine besessen und seinem Herrn das Leben gerettet hatte. Aber wieso war der Hund dann namenlos? Wieso hieß er nicht, zum Beispiel, Großer Verstümmelter Lebensretter, Held ohne Bein und Tadel oder, warum nicht, Cuchullain Sweeney?
Und wenn sich das alles gar nicht in oder bei Roscrea abspielte? Ob es irgendwo weit weg noch eine andere Stadt gab, andere Dörfer? Vielleicht endete die Welt doch nicht hinter den Hügeln, wo die Kobolde hausten und kleine Jungen fraßen, die zu weit herumstreunten. Der Mann im Herrenhaus, den alle Sir Charles nannten oder Mylord oder, wenn er nicht in der Nähe war, bloody Saxon – Mylord Sir Charles kam angeblich von jenseits eines Wassers, das viel breiter war als die Bäche der Gegend. George hatte das immer für eine Art Märchen gehalten; er wusste, dass es den Teufel gab und die Heilige Jungfrau und fairies und leprechauns und pookas und Bäche und gar nicht weit entfernt den großen, stillen See mit der heiligen Insel, aber ein Wasser, so breit, dass man nicht hinüberschauen konnte?
Und wenn es all das wirklich gäbe, sagte er sich, dann wäre es sogar vorstellbar, dass Besitzer bein- und namenloser Hunde sich dort richtiges Bier leisten konnten. Dass es dort Häuser gab, durch deren Dach es nicht regnete; vielleicht sogar Dörfer, in denen nicht alle Leute immer vor der Wahl standen, die Abgaben ans Herrenhaus oder an den Steuereinnehmer zu entrichten und zu hungern oder sich einmal satt zu essen und dafür bestraft zu werden.
Gegenden, anders gesagt, in denen man besser leben konnte. Ein alter Bettler erzählte ihm von Ländern hinter den Bergen und großen Gewässern (er nannte sie Meere), wo die Sonne nicht immer von Regen behindert wurde, wo die Leute bunte Gewänder trugen und einander mit Gesang die Leiber durchbohrten.
»Haben sie sonst nichts zu tun?«
»Es macht ihnen Spaß.« Der Bettler fuhr sich mit der rechten Hand über die Augen. »Sie kriegen dafür viel Geld – silberne Münzen, manchmal auch goldene, und genug zu essen und zu trinken.« Er gähnte. »Und Betten zum Schlafen.«
»Hast du das selbst gesehen?«
»Mitgemacht, Junge.« Diesmal nahm er die linke Hand, um sich die müden Augen zu wischen. George sah, dass es die Hand nicht gab, dass man sich aber auch mit einem vernarbten Gelenk die Augen wischen konnte.
Der Bettler hockte auf einem Brett, neben den Stufen, die zum Haupteingang der Kirche führten. Der umgedrehte rötliche Hut hatte mehrere Spitzen und enthielt ein paar kleine Münzen, im Lauf der letzten Stunden von Mitleidigen hineingeworfen.
»Und dabei hast du die Hand verloren?«
»Im Krieg, ja. Und nicht nur die Hand.« Mit zwei Fingern der Rechten zupfte er an dem schmutzigen Tuch, das er um den Kopf gewickelt hatte. Über der Stirn wucherte wie Ried an einem Teich ein Haargürtel; dahinter glitzerte blaurot, wie giftiges Wasser, eine grässliche Narbe.
»Ein Schwerthieb – sagen die Ärzte.« Der Bettler verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die George nicht deuten konnte. Die tausend Falten und Fältchen schienen zu tanzen und neue Muster zu bilden. »Deshalb weiß ich viele Dinge nicht mehr.«
»Was weißt du nicht mehr? Wo es genau war?«
Der Mann seufzte. »Indien«, sagte er dumpf. »Weißt du, wo das ist?«
»Nein.«
»Weit weg, hinter vielen anderen Ländern. Man muss über ein paar Meere fahren.«
Es war kurz vor Sonnenuntergang; ein kalter Wind strich über den verlassenen Kirchplatz. Der Bettler bewegte sich unruhig, als ob er den Rücken an etwas reiben wolle. Das Brett, auf dem er hockte, machte die Bewegung mit.
»Was …«, sagte George; er riss die Augen auf.
Unter dem Brett waren kleine Räder; er sah sie, als der Mann an seinem langen, mantelartigen Umhang zupfte.
»Ja, das auch. Ich glaube, ich hab meinem Hauptmann das Leben gerettet; deshalb haben sie mich heimgebracht, statt mich in Indien sterben zu lassen.« Er hob den verdreckten Saum.
Und George sah, dass der Bettler keine Beine hatte, nicht einmal Stümpfe. Mit dem Rumpf saß oder hockte oder ruhte er auf dem rollenden Brett.
Ein furchtbarer Verdacht stieg in George auf. Mit fadendünner Stimme sagte er: »Und … wie heißt du?«
Der Bettler hob die Schultern. »Weiß ich nicht. Vielleicht hab ich nie einen Namen gehabt. Nenn mich Joseph. Joe. Oder Teddy, Tommy, Toby, oder Jeroboam oder Jethro. Ishmael. Oder Paddy. Oder« – er grinste schräg – »Mirza Ali Khan. Es ist alles gleich. Aber ich erinnere mich an andere Dinge, die wichtiger sind.«
»Woran denn?«
Der Bettler nestelte an dem schmierigen Kopftuch, bis es die Narbe wieder bedeckte. Er verdrehte die Augen, als wolle er nach innen schauen, und George sah nur noch das Weiße, durchsetzt mit gelblichen und roten Verästelungen.
»Frauen«, sagte der Mann. »Paläste mit tausend Räumen und dreitausend Fenstern. Den Pagoda-Baum, auf dem Goldmünzen wachsen, und wenn man ihn findet und schüttelt, braucht man nie mehr zu hungern.« Die Pupillen wurden wieder sichtbar, richteten sich auf den Jungen. »Weißt du, was das Größte ist, was ein Mann werden kann?«
»König?«, sagte George zögernd; er hatte gehört, dass es ein mächtiges Land namens England gab, in dem selbst der allmächtige Grundherr Sir Charles unbedeutend wäre, und an der Spitze von England – er stellte es sich als eine ungeheuer breite Kirche vor, mit dem Fürsten oben auf dem Turm – gab es den König, der über alles bestimmte.
»Baah, König.« Der Bettler spuckte aus. »Es gibt viele Könige, und der, an den du denkst, ist ein schwachsinniger Deutscher, der nicht mal anständig Englisch kann. Nein, es gibt Größeres.«
George riss die Augen auf. »Papst?« Er flüsterte beinahe; über dem Papst gab es nur Gott, und der Papst musste also das Allergrößte sein.
»Baah.« Wieder spuckte der Bettler, diesmal mit mehr Schleim als beim ersten Mal. »Der Papst ist gar nicht so mächtig, und vor allem hat er keine Frauen. Nein. Wenn du wissen willst, was das Größte ist – ein Radscha.«
»Was ist das?«
»Auch eine Art König, in Indien, Kleiner; aber viel reicher und mächtiger als alle Könige in Europa. Er trägt nur kostbare Kleider und hat tausend Frauen und zehntausend Diener und hunderttausend Soldaten, und er isst aus goldenen Schüsseln und hat zehn Ringe an jedem Finger, und für jeden einzelnen Ring könntest du ganz Roscrea kaufen …«
»Auch das Haus von Sir Charles?«
»Baah. Das Haus von Sir Charles? Darin würde ein richtiger Radscha allenfalls seine Hunde unterbringen. Schon die Ställe, die er für seine Elefanten bauen lässt, sind größer und schöner.«
»Was ist das, Elefanten?«
Der Bettler erzählte, bis die Sonne untergegangen war: von Elefanten und Kamelen und Kobras und Tigern, von Schwertern, deren Griffe mit Edelsteinen besetzt waren, von Seen und Wüsten und Bergen, und immer wieder von einem Palast mit dreitausend Fenstern, den er nie selbst gesehen hatte. Irgendwo, weit im Norden Indiens, sagte er, stehe dieser Palast, und in ihm wohnten die Windgeister, und die hätten mehr Schätze als alle Radschas, und vielleicht besäßen sie auch eine geheime Kammer, hinter der eine noch geheimere Kammer lag und dahinter noch eine und noch eine, und in der allerletzten bewahrten sie die Namen und die Schatten aller Menschen auf, vielleicht auch seinen Namen, den er verloren hatte.
Damals war George vielleicht sechs, und er ging wie im Fieber heim, betrunken von Wörtern und Geschichten und voll von Sehnsucht nach den fernen fremden Gegenden. Und überzeugt davon, dass Menschen wie Hunde mit den Beinen auch den Namen und Teile des Gedächtnisses verlieren, und dass kein Teil des Körpers wichtiger ist als die Beine, samt den Füßen und Zehen.
Aber es gab namenlose Schafe, die vier Beine hatten, und von seiner Mutter erfuhr er, dass Gott die Welt erschaffen und den Menschen eine Seele gegeben habe, und diese Seele sei das, was mit dem Namen gemeint sei, und sie sitze nicht in den Beinen oder Füßen, sondern irgendwo tief im Brustkorb. Ferner hörte er, dass Gott auf die Welt gekommen sei, um die Menschen zu erlösen, bis auf die Engländer, welche von der Mutter Gottes zweifellos in die tiefste Hölle geschickt würden, wenn man nur innig genug zu ihr bete. Ein bisschen Hölle hätten sie ja schon, in Indien, wo es fast so heiß wie in Satans Reich sei; in Indien stürben zwar viele Engländer und seltsamerweise auch Iren, die dort für englisches Geld kämpften, das eigentlich indisches Geld sei, aber die richtige Hölle sei es noch nicht. In der säßen nämlich die Engländer und ein paar andere böse Menschen, sogar zwei oder drei Leute aus Tipperary und Roscrea, bis zum Hals in Jauche, und hin und wieder kämen ein paar Unterteufel mit Sensen an und schrien »Kopf weg!«. Besondere pookas dürften immer die Spieße drehen, auf die Satan persönlich die Lords gesteckt habe, während andere mit Blasebälgen die Feuerchen zum Lodern brächten.
»Es gibt auch Ziegen in der Hölle«, sagte die Mutter, »und die haben ganz rauhe Zungen. Besonders kleine Unterteufel streuen den Engländern Salz auf die Fußsohlen, und die Ziegen, die Salz lieben, lecken mit ihren rauhen Zungen das Salz ab, und das kitzelt furchtbar, und dann lachen sich die Geleckten beinahe tot, und am Schluss steckt man sie in die Jauche, damit sie wieder zu sich kommen.«
Also kümmerte man sich auch in der Hölle um die Füße; sie mussten wohl wichtig sein, selbst wenn sie nicht die Seele und den Namen enthielten. George begann, die Füße aller Menschen zu betrachten, die er barfuß zu Gesicht bekam, und bald entdeckte er, dass es eine Beziehung zwischen den Zehen und dem Wesen gab.
Liebenswürdige Menschen hatten schöne Zehen. Es gab natürlich auch freundliche Leute mit absonderlichen Zehen – Zehen wie Hämmer, oder so gespreizt, dass sie einen Stock oder eine Peitsche hätten halten können, oder die übereinandergewachsenen Zehen einer Tante; aber allgemein stellte George fest, dass Menschen, die er mochte, erträgliche, interessante oder schöne Zehen hatten. Am schönsten waren die seiner Mutter: ein Fünfer-Wurf wohlgeratener rosa Ferkel, an den zitzenlosen Fußbauch geschmiegt. Bestimmt hatte die Mutter Gottes, grünäugig und rothaarig wie Mrs Thomas, auch wunderschöne Zehen.
Im Lauf der Jahre erfuhr er mehr über die Welt, von der die Mutter sagte, sie sei eine Kugel. Hingen die Menschen auf der anderen Seite mit dem Kopf nach unten? Der Pfarrer hingegen behauptete, es handle sich um eine Scheibe, wenn sie auch den Wissenschaftlern als Kugel erscheinen möge. George versuchte, das Beste daraus zu machen; er stellte sich eine Scheibe vor, die Gott, ein pooka oder beide um eine Kugel gewickelt hatten, und hielt die Welt lange Zeit für irgendwie würstchenförmig. Im Innern der Wurst, klar, war die Hölle – wenn man eine Wurst aus der Pfanne nimmt, kühlt sie ja außen schneller ab und bleibt innen heiß. Indien musste ziemlich in der Mitte liegen, wo es besonders schnell glühend wurde. Und ganz gleich, was der Pfarrer sagte: Es gab pookas und leprechauns und fairies und alles mögliche Kleine Volk, und einige dieser merkwürdigen Geschöpfe, die George oft in der Dämmerung von Weitem sah, lebten auf der Insel in dem flachen See, nicht weit vom Herrenhaus des Engländers. Warum sie allerdings ausgerechnet in der Nähe von Sir Charles blieben, der ebenso wenig an sie glaubte wie der Pfarrer, war ihm unerfindlich. Vielleicht hätten sie wegziehen oder den See samt Insel verlegen oder Sir Charles verscheuchen sollen. Die Mutter sagte, es gebe diese Geschöpfe, die sie auch »Die Alten Leute« nannte; also gab es sie, fertig. Und der See mit der Insel der Lebenden … Offenbar kamen nicht alle, die starben, in den Himmel oder in die Hölle; aber wer kam auf die Insel? Nur die, die an all das glaubten, wovon der Pfarrer nichts wissen wollte?
Die hässlichsten und abstoßendsten Zehen hatte der Mann, den die Mutter ins Haus holte, als der Vater sich den Hals gebrochen hatte. Wie eines der Muttertiere draußen ließ sie sich nachts von ihm stoßen, tags beschimpfen und in beiden Dämmerungen gelegentlich prügeln. Es gab eine zweite Heirat, das schon, aber für George galt sie nicht. Der Vater war tot, der Neue war der Bursche mit den scheußlichen Füßen: Die Vorderglieder der großen Zehen wiesen fast rechtwinklig zu den anderen, die kleinen waren heimtückisch winzig, fast in den Fuß zurückgezogen, wo sie zu lauern schienen: Ungeziefer, das jederzeit herausschießen und beißen könnte.
George wusste nicht genau, ob der Vater auf der Insel oder woanders weilte; der, von dem es hieß, Er sei im Himmel, bekümmerte ihn weniger. Wenn der Pfarrer recht hatte und Der Da Oben nichts von pookas und leprechauns hielt, dann wollte George nichts mit Ihm zu tun haben. Die Mutter Gottes und ein paar Heilige wie Patrick, gut und schön, aber auf den Rest konnte er verzichten, solange die Kleinen Leute sich überall bemerkbar machten. Da gab es die Fee, die bei den Reichen Federn aus den Kissen rupfte und diese »Rüpfchen« immer dort hinterließ, wo Georges kleine Schwester Deirdre sie finden konnte; beim Einschlafen rieb sie sich damit die Nase. Und es gab einen pooka – bei sich nannte er ihn Murphy, weil er ihn sich vorstellte wie den alten Bauern mit dem zerknitterten Gesicht und den Lachfalten, drei Katen weiter links –, der war zuständig dafür, Dinge schiefgehen zu lassen oder Gegenstände unauffindbar zu verstecken. Wesen, die streunende Kinder unter die Erde lockten – verschwanden denn nicht immer wieder Kinder? Wesen, die für Wind und Regen sorgten – und regnete es vielleicht nicht jeden Tag, mal mit, mal ohne Wind? Sicher gab es auch einen Gott, der fürs Sterben zuständig war. Nicht zu reden von Zehen.
Über die meisten Erinnerungen legte sich nach und nach ein Schleier; wenn er später in Indien die eine Sorte Erinnerungen seiner Frau und den Kindern, die andere seinen Offizieren und die dritte den Tanzmädchen erzählte, damit sie ihn gründlicher liebten, kam ihm der Schleier so dick vor, dass dadurch nicht auszumachen war, ob die verschleierten Bilder echt oder eingebildet waren. Man müsse seine Erinnerungen erfinden, um sie wirklich zu besitzen, sagte Saldanha einmal; aber George Thomas war nicht sicher, ob es wirklich Saldanha war, an den er sich da erinnerte. Die Zehntausende von Gesichtern … An die Zehen seiner Mutter erinnerte er sich, und an die des Stiefvaters. Auch das Gesicht der Mutter war nicht verschwunden, ebenso wie das des richtigen Vaters. Wie der Stiefvater ausgesehen hatte, wusste er nicht mehr. Die Schwestern, deren Gesichter immer weiter verschwammen, hatten kleine Bilder malen lassen, auf denen er sie nicht erkannte.
Eine der lebhaftesten Erinnerungen war noch immer die an das Herrenhaus, den Wohnsitz von Sir Charles. Als der richtige Vater noch lebte, war George oft mit ihm dorthin geritten, um geheilte Pferde abzugeben oder Tiere zu beschauen, die vielleicht der Pflege bedurften. Sir Charles … Aber wozu dachte er jetzt an den alten Adligen? Auch der war längst tot; das hatte eine der Schwestern geschrieben, denen Thomas manchmal Gold, Silbermünzen und kostbare Steine schicken ließ, von Hansí nach Agra, nach Lakhnau, nach Kalkutta, nach London, nach Bristol, nach Youghal, nach Tipperary. Vorbei; nun ritt er den Weg, den seine Geschenke getragen oder gefahren worden waren.
Drei Dutzend Krieger – seine treuen Pindaris – begleiteten und schützten ihn. Spätestens in Kalkutta würde er sie entlassen müssen; was sollten diese Männer, seine getreuen Brüder und Mitkämpfer, in Irland? Und schon hier, auf dem Territorium der Ehrenwerten Englischen Ostindien-Kompanie, brauchte er sie nicht mehr als Geleitschutz.
Einen Vorzug hatten die britischen Krämer, das musste man ihnen lassen: Was sie einmal in Besitz nahmen, gaben sie nicht wieder her, und für Räuber war von allen Landen Indiens Bengalen zweifellos das mit der schnellsten Sterblichkeit. Die Briten mochten seine Pindaris als Räuber ansehen, aber sie hatten ihm freies Geleit gewährt; er und seine Kostbarkeiten waren auch ohne große Bedeckung sicher.
Danach? Er grinste in den heißer werdenden Vormittag, zog die verbeulte Zinnflasche aus der Brusttasche und trank einen langen Schluck. Guter Whiskey bis an sein Lebensende; ein Herrenhaus wie das von Sir Charles, vielleicht nicht in der Grafschaft Tipperary, sondern näher bei Cork, zum Beispiel in Kinsale oder Youghal; etwas mit Blick aufs Meer, mit einem Hafen und Schiffen, deren Besatzungen in den Schänken wunderliche Geschichten erzählten. Wie damals …
Er steckte die Flasche wieder ein und tastete nach dem Talisman, der alten, abgegriffenen Schachfigur. Ob Sir Charles je geahnt hatte, wer der Dieb war?
Einmal nur war es George Thomas gelungen, einen Blick in den prächtigen Saal des Herrenhauses zu werfen. Es stand einige Meilen außerhalb von Roscrea auf einem Hügel, im Herzen eines Parks. Es war mehr als ein Blick, denn er stieg durch das offene Fenster von der Terrasse ein, mit angehaltenem Atem, und sah sich um. Die Bücher, die schweren Sitzmöbel, die prunkvollen Gobelins waren ihm kaum einen Blick wert. Was ihn anzog, war der kleine Schachtisch, dessen geschwungene Beine aus schwarzem Holz in Löwenfüßen endeten. Auf den Spielfeldern des Tischs war eine Partie unvollendet abgebrochen; einige Figuren standen nicht mehr auf den schwarzen und weißen Vierecken, sondern am Rand. Aber anders als die Felder waren sie nicht schwarz und weiß, sondern rot und gelb; ein Gelb, das vielleicht einmal weiß gewesen war. Am Rand, geschlagen und ausgeschieden, stand neben einem roten Reiter auf rotem Pferd und mehreren roten Fußsoldaten mit Speer und Schild ein winziger, feinstens geschnitzter Kriegselefant mit haudah – aber das Wort kannte er damals noch nicht –, und dieses vermutlich kostbare Tier eines alten, in Indien oder China gefertigten Spiels schien George anzusehen, zu mustern, zu prüfen und dann für tauglich zu befinden, denn es flüsterte in seinem Kopf: Nimm mich mit.
Seither hatte der Elefant nie wieder geflüstert, oder Thomas hatte nie mehr genau hingehört. Bei wichtigen Entscheidungen fasste er aber immer noch nach dem Tier in der Tasche; zuletzt hatte er dies getan, als die Frage »ehrenvoller Abgang oder ruhmreicher Tod« sich stellte. Er lächelte; nach all den Jahren wusste er, wie Menschen sich entscheiden, aber es war trotzdem gut, die Figur zu berühren und nichts zu spüren, wenn man sich für das entschied, was das Sinnvollste war. Ehrenhafte Aufgabe, mit keineswegs überwältigenden, aber doch ausreichenden Schätzen. Mit nicht ganz fünfundzwanzig war er mittellos von einer Fregatte des Admirals Hughes geflohen, der die Linienschiffe des Franzosen de Suffrein nicht finden konnte. Mittellos, dumm, ein in der Welt verlorener Ire. Nun boten ihm – einem Iren! – die Briten Gastfreundschaft und ehrendes Geleit an: Es wird uns eine Ehre und ein Vergnügen sein, den ruhmreichen General George Thomas … und so weiter.
Ein Haus wie das von Sir Charles. Eine Irin, rothaarig, mit grünen Augen und schönen Zehen … Marie hatte dunkle Augen und wunderbare Zehen, aber sie wollte Indien nicht verlassen, blieb mit den Kindern in Sardhana. Was hatte ihm die Alte auf der Insel der Lebendigen versprochen? »Frauen mit hübschen Füßen« – woher wusste sie, dass ihm so viel an Zehen lag? – »und Ruhm und Reichtum, solange du die Frauen ehrst. Du wirst nicht fliehen, Georgie, ganz gleich, wie sehr du deinen Stiefvater hasst. Geh, wenn deine Mutter dich nicht mehr braucht. Ehre die Frauen, vor allem die, die es nicht verdienen. Achte die Götter; auch jene, an die du nicht glaubst. Und ihre Priester. Wenn du eine Frau siehst, die ohne Füße geht, und einen Affen, der ein Buch liest, einen Dreizack in falschen Händen und einen rosa Elefanten, dann hast du noch einen Tag.«
Es war ein Sonnentag gewesen, trotzdem in der Erinnerung grau und unheimlich. Sir Charles und seine Gesellschaft waren auf der Jagd, die Dienerschaft unsichtbar, und er lief, so schnell er konnte, weg vom Haus, geduckt, den Elefanten in der Tasche der löchrigen Hose. Einen Bogen schlagen, sich nicht vor dem Haus blicken lassen, die Zufahrt meiden; er rannte, bis er den seichten See erreichte, in dem die Insel der Lebendigen lag. Es hieß, dorthin seien früher die besonders edlen und frommen Ritter gegangen, die dank ihrer vielen Tugenden nicht sterben mussten. Wer dort lebte, starb nicht; und man erzählte, eine alte Frau hüte den Platz. Natürlich wollte der Priester nichts davon wissen, und vermutlich hielten auch die Engländer alles für Unsinn. Sir Charles, sagte man, sei mit einem Boot zur Insel gerudert und habe dort niemanden gesehen.
Aber an diesem Tag winkte eine graue Gestalt George von der Insel zu; und als ob nichts dabei wäre, als ob der Ort keine Furcht oder Ehrfurcht einflößte, watete George in den seichten See, bis das Wasser zu tief wurde, schwamm ein paar Züge, erreichte die Insel und sah –
Kein Gesicht. Die Stimme einer alten Frau kam aus einem unsichtbaren Mund, im Schatten der schwarzen Kapuze eines schwarzen Umhangs. George fröstelte. Woher wusste sie seinen Namen und das mit den Zehen? Wie konnte sie wissen, dass er den Vater vermisste, den Stiefvater hasste und kurz zuvor, auf dem Weg zum Haus von Sir Charles, beschlossen hatte, noch an diesem Abend fortzulaufen?
In all den Jahren in Indien hatte er immer wieder Frauen ohne Füße gesehen, Aussätzige, Krüppel, aber sie gingen nicht – sie krochen, humpelten, manche wurden getragen. Lesende Affen gab es nicht, nicht einmal ein Bild des als Affe dargestellten Gottes Hanuman mit Buch hatte er gefunden. Der Dreizack des Gottes Shiva – was hatte die Alte daheim, auf der winzigen Insel in einem winzigen See in der Grafschaft Tipperary, von Shivas Dreizack gewusst? Aber nie war ein Dreizack in den falschen Händen gewesen, immer nur in denen des Gottes, auf Bildern oder als Statue. Und rosa Elefanten gab es nicht. Grau, weißlich, von Schlamm schwärzlich überkrustet, aber rosa?
Er blieb zu Hause, bis seine Mutter 1776 starb. Da war er neunzehn, und aus dem Hass gegen den Stiefvater gab es nur den einen Ausweg: Flucht. Er sagte den Schwestern Lebwohl und verließ an einem regnerischen Abend das Haus außerhalb von Roscrea.
Thomas wanderte zum Hafen Youghal in der Grafschaft Cork; dort arbeitete er auf dem Kai, wo er Getreidefrachter be- und entlud. Youghal war recht wohlhabend, die Docks gesäumt von Speichern, in denen das Getreide des Hinterlands aufbewahrt wurde. Diese »Läden«, aus Bruchstein gebaut, hatten bis zu fünf Stockwerke. Getreide die Steinstiegen hinauftragen und später wieder hinunterschleppen, damit es in die Schiffe geschaufelt werden konnte, war ermüdend und trostlos, aber Thomas war dank der Plackerei daheim ans Arbeiten gewöhnt. Zwei Familien – die Farrells und die Flemings – beherrschten den Handel, und er fragte sich, ob die Farrells wohl die alten Kladden noch aufbewahrten, in denen er als Arbeiter verzeichnet gewesen war.
Schiffe aller Nationen kamen in den Hafen, brachten wilde Geschichten aus anderen Ländern mit, die seine Ohren füllten, während er half, die Schoner und Schaluppen zu beladen. Der Marktplatz, zwischen dem alten Uhrentor und den Docks, war Treffpunkt vieler Seeleute aus der halben Welt.
Fast zwei Jahre arbeitete er dort. Er hörte Abenteuergeschichten über des weißen Mannes Grab an der afrikanischen Westküste und über Reichtümer, die Söldner in Indien erringen konnten. Anfang 1779 segelte er als Matrose von Youghal nach Bristol, wo es ihm später gelang, sich von einem Presskommando schnappen zu lassen.
Aber dazu hatte er warten müssen. Eigentlich wollte er weder für noch gegen England, sondern für sich kämpfen, und er verließ sich darauf, dass die Flotte ihn irgendwo hinbringen würde, wo er dies besser konnte als in Europa. Schiffe segelten nach Nordamerika, um den dortigen Truppen Verstärkungen für den Kampf gegen die Rebellen zu bringen; andere wurden lediglich im Kanal eingesetzt, weil die nächste Auseinandersetzung mit Frankreich begann.
Aber die fand auch im fernen Indien statt, wo die Ostindien-Kompanie Gold und Gewürze auftürmte, Steuern an die Krone zahlte und, von den Franzosen bedrängt, um Hilfe bat. Und um Geleitschutz für die schweren Frachtsegler. Die Steuergelder der Kompanie waren ein Grund, die Flotte zu schicken; der andere, wichtigere war das Kapital so vieler Lords und Abgeordneter, das in Aktien der Kompanie steckte.
Er gluckste. Der Franzose Claude Martin, wichtigster Mann in Lakhnau, hatte ihm zu Aktien der Ostindien-Kompanie geraten. Er wusste nicht, wie viel er davon besaß – in London; die Dividenden wurden über eine Bank in Cork an seine Schwestern gezahlt. War es nicht eine nette Überlegung: nach Indien zu kommen, um die Gesellschaft zu stützen, deren Aktien er mit Geld bezahlte, das in Kämpfen teils gegen die Interessen der Kompanie und der Krone erworben und durch Dividenden gemehrt wurde? Schräge Welt, wenn man nicht an die Abfolge der Dinge in der Zeit dachte.
Aber all das würde er dem Offizier nicht erzählen. Was ging es einen Engländer an, wie die Dinge in Irland standen, wo sie besser stünden, wenn es die Engländer nichts anginge? Im Zweifelsfall würde dieser Francklin derlei entweder nicht verstehen oder höflich lächelnd unterschlagen. Die Zeit an Bord des Schiffs und die Lehrzeit bei den Paligars wollte Thomas ebenfalls für sich behalten. Die Zeit beim Nizam von Haidarabad? Wichtig, aber ohne Ruhm. Nein, er würde in Delhi beginnen, 1787, mit der Fürstin – ein Teufelsweib, die Begum, aber hinreißende Füße! – und ihrer Suche nach europäischen Offizieren für die kleine Armee.
Rauch am Horizont; oder eine Spiegelung? Mussten sie sich noch immer vorsehen, waren sie noch nicht ganz unter dem Dach britischen Friedens? Britischer Ausbeutung … Vielleicht brannte da vorn ein Dorf, vielleicht lagen Leichen auf den Gassen und in den Trümmern. Seit mehr als einem halben Jahrhundert, seit den Mogulherrschern die Macht zu entgleiten begann, zogen Heere durchs Land, jeder kämpfte gegen jeden, Perser und Afghanen beteiligten sich an Massakern und Plünderungen, und vermutlich würde Mister Francklin vorschlagen, den ganzen Halbkontinent unter britische Herrschaft zu nehmen, um des Friedens willen. Vielleicht; Thomas dachte an Irland, wo die Briten den Frieden gründlich zerstört hatten. Und daran, dass alles mehrere Seiten hat.
Die Zeit der Abschiede. Ob endlich irgendein Gott Saldanha eingeholt hatte? Wieder dachte er an jene unglaubwürdige Nacht, damals, außerhalb von Madras, wo so viele Dinge begonnen hatten. Saldanhas zynische Beichte, wenn man den bizarren Monolog denn so nennen wollte. Auch davon nichts für Francklin. Manche Dinge muss man vor tollen Hunden und Engländern verbergen.
2
Saldanha und die Inquisition
Sie höret die Priester, die Totengesänge,
Sie raset und rennet und teilet die Menge.
Wer bist du? Was drängt zu der Grube dich hin?
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Nicht Sandalia und auch nicht Saldaynia. Saldanha, durch die Nase, eh? Ja, besser.
Irland, sagst du? Alle Iren sind wahnsinnig. Alle, die ich kenne. Verrückt wahnsinnig, verstehst du? Die Briten … die Briten sind vernünftig wahnsinnig. Die Franzosen sind methodisch wahnsinnig. Alle sind wahnsinnig. Ich auch. Portugiese. Lieber tot als Araber, aber viel lieber Araber als Spanier. Die Spanier … ah, reden wir von was anderem.
Ich? Ich war mal Arzt. Ein guter Arzt, hat man gesagt. Weißt du, was Diagnose ist? Therapie? Nein? Also gut … Krankheiten erkennen, ja, ist das eine; sie behandeln etwas anderes. Manche Ärzte sind in der einen Sache gut, in der anderen eine Katastrophe. Ich war in beidem gut. Studiert habe ich in Portugal und Frankreich, dann war ich von Goa aus einige Zeit in Persien, wo es gute Medizinschulen gibt. Aber.
Weißt du, wer die schlimmsten sind? Ich meine, wahnsinnig sind wir alle, mehr oder weniger, aber am schlimmsten sind die, die ein Gott behaust. Unser Gott, der Moslemgott, irgendein Gott. Nichts ist grässlicher als das, was die Leute sich und einander im Namen der Götter antun. Ich hatte einmal eine Frau, einen Sohn, eine Tochter, Freunde; jetzt hab ich …
Du, als guter Ire, bist ein Bekenner des einen wahren Glaubens, nicht wahr? Goa ist voll von solchen, sage ich dir; mit und ohne Kutte. Die heilige Inquisition hat in Goa ihr mächtigstes Bollwerk in ganz Asien. Ich bin mit den Zehen an dieses Bollwerk gestoßen.
Zehen? Ah, du liebst Zehen? Ich nicht; ich mache mir nichts aus Zehen. Meine tun nicht mehr weh, aber damals … Wie lange das her ist? Es war gestern, vor zehn Jahren, übermorgen, ich weiß es nicht. Lass mich an einer anderen Stelle beginnen.
Der Heilige Francisco Javier … Francis Xavier, sagst du? Nun gut; wir wissen, wer gemeint ist. Vor mehr als zweihundert Jahren kam er nach Indien, ein Mann voll von Inbrunst und brennendem Glauben. Die anderen Jesuiten haben schnell begriffen, dass Indien anders ist als Europa. Dass hier die Erbärmlichen nichts gelten, denn sie sind deshalb erbärmlich, weil sie in einem früheren Leben schlechtes karma angehäuft haben.
Karma? Das ist … wie soll ich sagen? Die Gesamtheit deines Lebens, alle Sünden und guten Taten, dein Wesen, deine Frömmigkeit, deine Lust; es fließt alles zusammen und wird zu einer bunten Pfütze, die ist dein karma. Wenn dein karma gut ist, wirst du im nächsten Leben ein Fürst, ein großer Krieger, ein reicher Händler. Wenn dein karma schlecht ist, wirst du vielleicht eine Laus, ein Käfer, eine Schlange, ein Bettler. Wenn …
Nein, nicht alle. Die Hindus denken so. Falls ich sie richtig verstehe. Die Herrscher des zerfallenen Reichs, die Moguln, bekennen sich zum Islam; und dann gibt es noch andere, aber bleiben wir bei den Hindus, da sie in der Umgebung von Goa die Wichtigsten sind.
Wenn du also ein Bettler bist, aussätzig, was auch immer, dann hat dich nicht ein schlimmer Schicksalsschlag getroffen, sondern es ist dies das Ergebnis deiner früheren Leben. Du bist jetzt, was deinem vorigen Leben entspricht. Es ist nicht gut, einem zu helfen, der nichts anderes verdient hat als das, was ihn plagt. Die Letzten müssen sich sehr anstrengen, um im nächsten Leben die Ersten zu sein, und …
Ah, du wirst schon sehen, wenn du wirklich nicht zurück aufs Schiff gehst. Bleiben wir bei den Jesuiten. Die klugen Männer haben sehr schnell begriffen, dass in Indien die Bekehrung der Heiden oben beginnen muss, an der Spitze, bei den Brahmanen und Kshatriyas. Fürsten, Priester, Krieger, ja? Wenn sie bekehrt werden, könnte es sein, dass jemand ihrem Beispiel folgt. Es ist sinnlos, den Armen die Füße zu waschen; erstens werden sie gleich wieder schmutzig, und zweitens bekümmert es keinen, wie die Füße oder Gedanken eines Armen beschaffen sind.
Aber Francisco Javier war anders. Wahnsinnig, wie alle Basken. Er kam an Land, in der Kleidung eines armen Bettelmönchs, und betete und missachtete die Einladungen des Bischofs und des Gouverneurs, und vielleicht hat er sich sogar gegeißelt. Zuzutrauen wäre es ihm. Dieser Trottel ging hin und wusch den Armen die Füße, predigte für die Aussätzigen, wollte nichts von den Mächtigen wissen. Die auch nicht von ihm. Er hat ein paar Leute bekehrt, aber nur Leute, die so, wie in Indien die Dinge sind, überhaupt nicht zählen. Dann ist er weitergereist; ich glaube, nach China. Oder zuerst Japan? Ich weiß es nicht. In China hat er das auch so gemacht, und dann ist er gestorben. Völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Als er tot war, hat sein Begleiter eine Handvoll kalkiger Erde auf den Leichnam geschmissen und den Sarg verschlossen. Irgendwann später, ein paar Jahre danach, fingen dann die Geschichten an – von wegen er war ein Heiliger, hat Wunder gewirkt, was ebendie erzählen, die sich davon etwas versprechen.
Etwas Besonderes hat sich der damalige Vizekönig von Goa versprochen. Nämlich, dass viele Menschen in die Stadt kommen und ihr Geld ausgeben, wenn in der Stadt dieser wichtige Heilige zu besuchen ist, dieser inbrünstige Trottel. Also hat er ihn aus – ah nein, nicht aus China; inzwischen war die Leiche, das heißt, der Sarg in Malakka. Der Vizekönig hat ihn herbringen lassen, nach Goa, und als man den Sarg öffnete, hat man festgestellt, dass die Leiche nicht verwest war, sondern bestens erhalten. Ein Wunder, haben sie geschrien; ich nehme an, es lag an irgendwelchen Dingen, die in dieser kalkhaltigen Erde waren, die man über die Leiche gestreut hat.
Man hat ihm eine eigene Kirche gebaut. Nicht, dass es in Goa nicht schon genug Kirchen gegeben hätte, o nein. Aber bitte sehr, noch eine. Und da hat man ihn aufgebahrt, und die Gläubigen kamen von nah und fern und haben ihn um ein Wunder gebeten, eine Heilung, was auch immer, und ihm zum Zeichen der Verehrung die Füße geküsst. Eine fromme Frau – man kennt sogar den Namen; sie hieß Isabel de Carom – hat ihm dabei einen Zeh abgebissen und ihn im Mund mit heimgenommen, als wundertätige Reliquie. Sie hat aber den Mund zu voll genommen, schätze ich, oder nicht gründlich genug gekaut; irgendwer hat es beobachtet, und sie musste den Zeh wieder ausspucken.
Man hat den Heiligen jedes Jahr ein paar Tage lang ausgestellt, und das war immer ein Anlass für gewaltige Pilgerreisen und ein großes Fest. Ich glaube, noch im ersten Jahrhundert nach seinem Tod, sagen wir, gegen 1590, ist ein zweiter Zeh verschwunden, aber diesmal wurde niemand beim Beißen und Kauen beobachtet. Im Jahre 1614 wurde der Papst befragt, ob denn nicht der vom Volk längst als heilig verehrte Mann heiliggesprochen werden kann. Um die Wundertätigkeit zu prüfen, hat der Papst den rechten Arm des Toten erbeten; man hat ihn gehorsam abgesägt, und ein paar Jahre später wurde Francisco Javier amtlich heiliggesprochen.
Merk dir dies, Ire: ein Arm im Vatikan, ein Zeh wer weiß wo. Ich sagte, ich hätte mir die Zehen gestoßen. Nicht meine, nein. Es waren die Zehen eines Dominikaners, des zweiten Mannes in der Führung der Hunde Gottes. Führung in Goa, natürlich, und das heißt Indien für sie. Die Hunde Gottes … nicht besser als die gelben Köter da unten. Sie kläffen und beißen und schlagen ihr Weihwasser dort ab, wo es für andere am unangenehmsten ist … Der edle Ordensherr hatte einen wunden Zeh, und weil er ihn nicht früh genug hat behandeln lassen, wurde ein wunder Fuß daraus. Ein dicker, stinkender, schwärender Fuß. Ein Dorn vielleicht am Anfang, oder ein Insektenbiss, wer weiß. Ich wurde erst gerufen, als der Fuß schon nicht mehr zu retten war. Früh genug, um das Bein zu retten – der Fuß konnte am Knöchel abgeschnitten werden, und dann durfte man hoffen, dass die Vergiftung nicht weiterbrennen würde.
Habe ich gesagt, dass ich in Persien gewesen bin? Dort hat man noch ein paar alte Kenntnisse, die in Europa vergessen sind. Oder nicht ganz vergessen, aber aus guten Gründen nicht mehr benutzt. Pilzgifte, zum Beispiel, oder gewisse Sorten Kräutersud, die das Bewusstsein und den Schmerz nehmen. Der Kirchenmann hat geweint und geknirscht und gesagt, ich solle es möglichst wenig schmerzhaft machen, und ich hatte Mitleid mit ihm. Ich habe einen Kräutersud angefertigt, dazu ein wenig von einem bestimmten getrockneten Pilz als Pulver hinein, und ihn davon trinken lassen. Er hat selig geschlafen und nichts von dem Schneiden gespürt.
Aber es gibt Gründe, weshalb die Ärzte in Europa so etwas nicht mehr benutzen. Es ist ein Rauschmittel, ähnlich wie andere, die es in Indien gibt. Besser als Schnaps. Vielleicht sogar besser als bhang … Kennst du nicht? Du wirst es kennenlernen; man kann es rauchen oder trinken. Wird aus einer Art Hanf gemacht, wie die Krawatte, die sie dir um den Hals binden, wenn sie dich erwischen. Willst du wirklich nicht zurück?
Nun ja. Rauschmittel, sagte ich. Der Sud und die Pilze. Man träumt, und im Traum kann man fliegen, oder man liegt schönen Frauen bei und ergießt sich. Kannst du mir folgen? Gut.
Ich habe ihm den Fuß abgenommen, ohne Schmerzen; und ich war dumm genug, dies ohne Zeugen zu tun. Als er wieder zu sich kam, dieser Hund von einem Dominikaner, hat er mich lange angesehen und gefragt, welche heidnischen Hexen mir geholfen hätten. Wobei?, sage ich. Beim Schneiden und den Dingen, die sonst geschehen sind, sagt er. Es ist sonst nichts geschehen, sage ich. O doch, sagt er; mit deinen teuflischen Kräutern und den heidnischen Hexen hast du mich dazu gebracht, den heiligen Eid der Keuschheit zu brechen.
Das hat er geträumt, im Rausch, und ich hatte keine Zeugen, die hätten beschwören können, dass keiner außer mir bei ihm war, als der Fuß fiel.