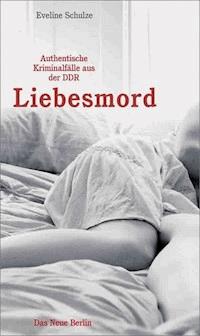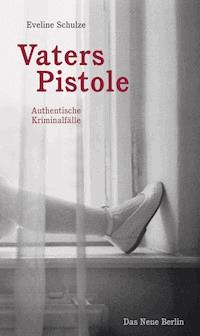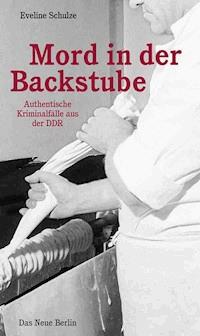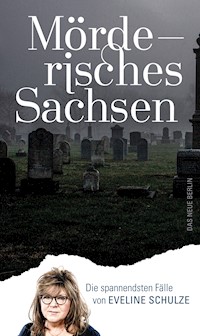Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannende Fälle der Miss Marple aus Görlitz »Die Autorin schildert die Fälle in einer eindringlichen Sprache...« Richter ohne Robe In den sechziger Jahren ist das Görlitzer Geschäft für Kinderwagen eine gute Adresse für werdende Eltern. Der freundliche Inhaber gibt sich große Mühe, die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Dass er noch ein anderes Geschäft betreibt, ahnt niemand. Als er auffliegt, sind die Bürger schockiert: Über Jahre hat er einen Kinderporno-Ring am Laufen gehalten und war unter Pädophilen über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wegen »kupplerischer Zuhälterei, Unzucht mit Kindern, Verstoß gegen das Devisengesetz und die Zollverordnung« wird er zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. – Ein erstaunlich mildes Urteil hingegen erhält eine Frau aus Olbersdorf, die ihren Mann getötet hat. Der Fall führt zurück in die Nachkriegsjahre: Auch in Olbersdorf gibt es mehr Frauen als Männer, viele sind gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Und jene, die bereits zurückgekommen sind, wissen diesen Mangel durchaus zu nutzen; eine dauernde Demütigung, die bei Ehefrauen irgendwann in Wut umschlagen kann. Das Gericht gesteht der Täterin mildernde Umstände zu. – Ein weiteres Tötungsdelikt ereignet sich in makaberer Kulisse. Auf dem Friedhof von Eibau kommt es zum Streit zweier Männer – am Ende liegt der eine tot auf dem Boden. Die Spuren weisen ins »Homosexuellen-Milieu«. Eveline Schulze rekonstruiert drei Kriminalfälle aus DDR-Zeiten, stellt Täterprofile und die Ermittlungsarbeit dar und geht auf die gesetzlichen Regelungen, etwa die Aufhebung des »Schwulenparagrafen 175«, und die Rechtsprechung ein. Vor allem aber erzählt sie diese Fälle als spannende Geschichten mit viel Zeitkolorit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Das Neue Berlin –
eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage
ISBN E-Book 978-3-360-50187-5
ISBN Print 978-3-360-01380-4
1. Auflage 2022
© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
Bildnachweis: Archiv Schulze, Ralph Schermann (3), Ch. Rißler (5)
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin, unter Verwendung eines Motivs von picturealliance /UnitedArchives | Werner Otto
www.eulenspiegel.com
Über dieses Buch
Kindesmissbrauch und Pornografie in den sechziger Jahren in Görlitz, ein Eifersuchtsdrama unter Homosexuellen, das auf dem Friedhof in Eibau endet, die Rachetat einer betrogenen Ehefrau in Zittau: Verbrechen, die sich tatsächlich zutrugen, von der Autorin spannend in Szene gesetzt. Und nebenbei entsteht ein Bild der Zeit und ihrer Menschen, wie sie damals ganz normal lebten.
Über die Autorin
Eveline Schulze, erfolgreiche Autorin aus Görlitz, legt ihren mittlerweile neunten Band mit Kriminalfällen aus der Region vor. Die studierte Journalistin arbeitete in den achtziger Jahren bei der Kriminalpolizei ihrer Heimatstadt und kennt nicht nur aus den Polizeiakten, sondern auch aus eigenem Erleben die Kriminalfälle, über die sie berichtet.
Inhalt
Rasende Eifersucht
Der Tote auf dem Friedhof
Geschlossene Gesellschaft
Rasende Eifersucht
Der Schlag klingt dumpf. Der Oberkörper fällt zurück ins Kissen. Und noch einmal schlägt sie zu. Wieder und wieder. Wie im Rausch. Erst als das Gesicht nur noch blutende Masse ist, hält sie keuchend inne. Das Beil entgleitet der Hand und poltert auf die Dielen. Dann kehrt Ruhe ein. Sie atmet heftig und schaut nach unten. Mit einer Mischung aus Verzweiflung und Verachtung sieht sie auf den Mann, aus dessen Bart Blut in das Kopfkissen sickert. Lautlos. Die Turmuhr der Klosterkirche schlägt, das dunkle Bongbong hallt nach. Erneut senkt sich Stille über die Stadt. Wölkchen stehen vor ihrem Gesicht. Es ist so kalt im Zimmer. Eisblumen machen das Fensterglas undurchsichtig.
Ist er nun endlich hin?
Sie lauscht in die Todesstille. War da ein Geräusch? Doch, der röchelt, der atmet noch. Ihr Blick geht zum Beil zu ihren Füßen. Die stumpfe Seite ist klebrig rot, Haare haften daran. Sie zögert, überlegt. Schließlich dreht sie sich abrupt um und geht in den Korridor. Dort setzt sie die Füße voreinander, ihre Schritte sind weder schleppend noch weit ausgreifend. Sie geht einfach, als wäre nichts geschehen. In der Küche steuert sie zielgerichtet den Vorratsraum an. Von der Tür blättert die Farbe. Wie überall. Seit Jahren hätte gestrichen werden müssen. Erst fehlte die Zeit, später die Farbe. Sie drückt die Klinke und öffnet die aus Brettern grob zusammengefügte Tür. Der Raum dahinter gleicht mehr einem Verschlag denn einer Speisekammer. Seine Regale sind so gut wie leer. Die wenigen Lebensmittel, die man auf Marken oder auf dem Schwarzmarkt bekommt, bleiben hier nie lange. Die Menge ist zu gering, und der Hunger zu groß.
Sie geht in die Knie und zieht aus dem untersten Regalfach eine Wäscheleine hervor. Greift das Bündel und richtet sich wieder auf. Die Leine wirft sie auf den Küchentisch, öffnet das Schubfach. Mit dem Küchenmesser trennt sie ein Stück ab, vielleicht einen Meter. Das Messer ist stumpf, oder der Hanf zu hart. Es dauert, bis der letzte Faden der verdrillten Leine durchtrennt ist. Ruhig legt sie das Messer wieder in den Schubkasten und schiebt diesen zurück. Dann nimmt sie das abgetrennte Seil und geht ins Schlafzimmer. Ohne Erregung greift sie nach dem blutigen Schädel, hebt diesen mit ihrer Linken an und schiebt mit der Rechten das Meterstück unter dem Nacken hindurch. Sie verknotet gelassen die beiden Enden und zieht zu. Fest. Fester.
Die Leine gräbt sich tief in den Hals. Die Frau verharrt geraume Zeit in dieser Haltung, bis sie sicher ist, dass der Mann nicht mehr röchelt. Erst als sie sich überzeugt hat, dass der letzte Funken Leben wirklich aus dem Körper gewichen ist, lässt sie die Enden los. Sie verweilt noch einen Moment in ihrer Haltung, mustert ungerührt den Leichnam. Ohne jeden Anflug von Betroffenheit oder gar Reue. Sie hat getan, was getan werden musste. Der Entschluss war lange gereift. Nicht mal eben so über Nacht. Allerdings wusste sie am Silvesterabend und auch am Neujahrstage noch nicht, dass es nun ausgerechnet an diesem 3. Januar geschehen würde. Heute Morgen hatte ein letzter Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht.
Ohne sich noch einmal umzuschauen, verlässt sie die Wohnung. Die Tür zieht sie nur ran. Hier schließt ein Kapitel. Wozu noch die Wohnung?
Es geht bereits auf Mittag zu, als Viola Schmidtke das Mietshaus in der Zittauer Innenstadt betritt. Der Himmel ist trübe, die Temperatur im Keller. Sie friert in ihrem dünnen Mäntelchen, doch die Aussicht auf das Bett wärmt ihr Herz. Erst am Abend muss sie wieder arbeiten. Vor wenigen Monaten war sie am Grenzlandtheater engagiert worden, was sie sehr glücklich machte, denn lange hatte sie ohne Engagement leben müssen. Kriegsbedingt waren 1944 alle Theater im Reich geschlossen, auch die Bühne in Breslau, an der sie ihre Schauspielerlaufbahn begonnen hatte. Sie ist jung, lebenshungrig und ohne Anhang, der Freund fiel an der Ostfront. Seither sucht sie Anschluss in der ihr noch immer fremden Stadt. Der Krieg hatte sie nach Zittau getrieben. Schlesien ist nun polnisch, an der Stadt fließt die Lausitzer Neiße vorüber. Die bildet jetzt die Grenze. Und in die Neiße mündet die Mandau, die aus Tschechien kommt. Zittau ist eine Dreiländerstadt, in der auch Menschen aus drei Ländern leben. Nicht alle freiwillig. Viele sind gestrandet wie die Schauspielerin aus Breslau und noch immer von der Vorstellung beherrscht, irgendwann dorthin zurückkehren zu können, woher man kam. Jetzt aber hat Viola Schmidtke wieder eine Anstellung, eine winzige Bodenkammer und einen Kerl, was gegenwärtig dreifaches Glück bedeutet. In dieser schrecklichen Zeit herrscht an allem großer Mangel, vor allem an Männern. Millionen liegen in Einzel- oder Massengräbern überall auf dem Kontinent, und weitere Millionen befinden sich noch in Kriegsgefangenschaft.
Erwin ist zwar um einiges älter als sie, aber das stört sie nicht. Störend ist allenfalls die Tatsache, dass sie sich ihn mit einer Frau, vermutlich sogar mit mehreren Frauen teilen muss. Er arbeitet als Hausmeister am Theater, als Faktotum. Zuständig für alles, wo Not am Mann ist. Was manche Frau wörtlich nimmt. Viola hat damit kein Problem. Es ist, wie es ist. Nicht schön, aber hinnehmbar.
Sie will es doch auch.
Erwins Frau ist immer mal wieder aushäusig, weshalb sie es manches Mal im Ehebett treiben und nicht nur auf der Matratze unter ihrem Dach. Zittau war in den letzten Kriegstagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden, erst am 8. Mai hatten sich die hier kämpfenden deutschen Einheiten ergeben. Da schwiegen in Berlin und anderswo schon längst die Waffen. Die Wohnungsnot aufgrund der Kriegsschäden war noch zusätzlich gewachsen wegen der Umsiedler aus dem Osten, zu denen auch Viola gehört.
Doch sie ist eine Frohnatur, die das alles wenig anficht. Sie ist mit der Welt, auch wenn diese kaputt ist, im Reinen. Selbstbewusst und energiegeladen schaut sie in die ungewisse Zukunft. Vor der hat sie keine Furcht. Das wird schon, sagt sie sich.
Die Haustür fällt schwer ins Schloss. Viola tastet nach dem Lichtschalter, und obgleich es beim Drehen des Knopfes knackt, bleibt es dunkel. Vor einer Stunde gab es noch Strom. Sie schüttelt den Kopf, so ist das eben. Die Stromsperren kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt und friert.
Im diffusen Schein, der durch das zugefrorene Oberlicht in den Hausflur fällt, geht sie vorsichtig zum Treppenaufgang. Sie greift nach dem Handlauf, der auch in die Jahre gekommen ist. Das Geländer wackelt wie ein Lämmerschwanz. Lehnte sie sich dagegen, würde es gewiss abbrechen.
Es riecht nach Bohnerwachs, und Viola fragt sich, woher der stamme, denn verkauft wird er nicht, weil gegenwärtig niemand Bohnerwachs produziert: Es fehlen die Zutaten. Werden wahrscheinlich noch alte Wehrmachtbestände sein, die jemand zur Seite geschafft hat, denkt sie und steigt tastend die Stufen hinauf.
Im zweiten Geschoss sucht sie die Klingel, doch ehe sie den Knopf über dem Schild mit dem Namen »Konrad« drückt, zieht sie kopfschüttelnd die Hand zurück. Wenn das Flurlicht nicht brennt, läutet auch drinnen keine Klingel. Sie klopft kräftig an die Wohnungstür. Doch die scheint nur angelehnt. Viola drückt dagegen, die Tür gibt nach.
Vorsichtig öffnet Viola einen Spalt und ruft ins Dunkel der Diele: »Hallo?« Und noch einmal: »Hallo, Erwin!«
Niemand antwortet. Sie weiß: Rechts geht es ins Schlafzimmer, links zu Küche und Bad, geradeaus in die Wohnstube. Die kleine Wohnung ist gut geschnitten, jeder Raum hat Fenster, selbst das Klo. Allerdings sorgen die Außenwände insbesondere an Tagen wie diesen dafür, dass es überall saukalt ist. Erwin hat ihr mal die Eiskristalle gezeigt, die die Wand mit Glitzer überzogen. Da blieb man, wenn man nicht rausmusste, den lieben langen Tag besser im Bett.
»Erwin?«
Viola tastet sich zur Wohnzimmertür, die natürlich wie alle anderen Türen geschlossen ist. Das ist so üblich, um die wenige Wärme im Raum zu halten und nicht sinnlos in der ganzen Wohnung zu verteilen. »Erwin?«
Sie drückt die Klinke nach unten und öffnet, doch in der Stube ist niemand außer dem Frost. Vielleicht in der Küche? Aber auch dort müsste sie doch gehört worden sein. Gewiss liegt er im Bett und schläft noch, denkt die junge Frau und kehrt zum Schlafzimmer zurück. Sie lässt die Wohnzimmertür offen, damit ein wenig Licht in den Flur fällt und sie nicht wie ein blindes Huhn dahintorkeln muss. »Erwin!«
Viola öffnet die Schlafzimmertür. Als erstes nimmt sie einen süßlichen Geruch wahr. Und als zweites dessen Quelle: das zertrümmerte, blutige Gesicht eines im Bett liegenden Mannes. »Erwin?« ruft sie und weiß nicht, ob sie den Namen immer noch in den Raum hineinruft oder den da liegenden, unkenntlichen Körper meint. Ist das der Mann, mit dem sie sich verabredet hat?
Wer aber sonst sollte in Erwins Bett liegen?
Viola steht starr, unfähig oder unwillig, sich zu bewegen oder überhaupt zu reagieren. Sie verharrt im Türrahmen. Keine Frage, in den Kissen liegt ein Toter. Denn dass dieser so zugerichtete Mensch noch lebt, ist auszuschließen.
Sie schweigt und schaut scheinbar ungerührt. Viola hat im Krieg viele Tote gesehen. Von Granaten zerrissene, in Luftschutzräumen verschüttete und ausgegrabene, von Kugeln getroffene Menschen, Soldaten und Zivilisten, Kinder mit zerschmetterten Gliedmaßen … Die Gewöhnung lässt auch Gefühle sterben. Bilder stumpfen ab, je häufiger man sie wahrnimmt. Militärs verrohen bei der Ausübung ihres Kriegshandwerks, Zivilisten nicht minder bei der Besichtigung soldatischer »Arbeitsergebnisse«. Zweieinhalb Jahre nach Kriegsende bewegen und erschüttern die Schrecken der zivilen Zeit nur wenig. Als der Krieg 1939 begann, sang Heinz Rühmann, dass einen Seemann nichts umhauen könne. »Denn wenn der letzte Mast auch bricht, wir fürchten uns nicht.« Und programmatisch ging es im Refrain weiter: »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, / Keine Angst, keine Angst, Rosmarie! / Wir lassen uns das Leben nicht verbittern, / Keine Angst, keine Angst, Rosmarie! / Und wenn die ganze Erde bebt / Und die Welt sich aus den Angeln hebt: / Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, / Keine Angst, keine Angst, Rosmarie!« Die Welt geriet aus Angeln und Fugen, und »Rosmarie« bekam es schließlich doch mit der Angst zu tun. Das hallte nach.
Ein wenig überrascht von der eigenen Gefasstheit ist Viola trotzdem. Vielleicht spürt sie nur im ersten Moment keinen Schmerz, und er kommt noch? Oder ist sie Erwin doch nicht so verbunden gewesen, wie sie annahm? Es war einfach nur schön, begehrt zu werden. Sie hat es geliebt, wenn er in sie drang, wild und ungezügelt. Da spürte sie Leben: in sich und überhaupt. Aber mehr scheint es nicht gewesen zu sein. Alt hätte sie mit ihm nicht werden wollen, das war ihr schon vom ersten Tag an klar. Etwas älter mit ihm – vielleicht, aber nicht alt. Irgendwann wäre Schluss gewesen.
Aber doch nicht so.
Viola Schmidtke tritt nicht mehr näher ans Bett, sondern hinaus. Aus dem Zimmer, aus der Wohnung, aus dem Haus.
Das Polizeirevier befindet sich unweit von hier. Sie kam vorhin daran vorbei. Es ist zwar Samstag, aber die Wache wird wohl auch am Wochenende besetzt sein. Die Polizei, die seit Juni 1945 »Deutsche Volkspolizei« heißt, schläft so wenig wie das Verbrechen. Viola Schmidtke schreitet durchs Portal, das Dienstgebäude ist mehr Villa denn Kaserne. An der Wache sitzt einer in blauer Uniformjacke. Er blickt erst auf, als die junge Frau vor ihm steht und sich kokett die Haare aus der Stirn wischt. »Guten Tag«, sagt sie und streift sich verlegen die Schneeflocken vom Mantel.
»Guten Tag«, sagt der Uniformierte. »Wie kann ich Ihnen helfen?« Sein Gesicht scheint Verschlusssache, kein Muskel bewegt sich. Er ist im Dienst.
»Ich muss eine Anzeige machen.«
»Hat das nicht Zeit bis Montag?« Der junge Mann reagiert wie ein alter Behördenmensch, der Dienst nach Vorschrift macht und ansonsten in Ruhe gelassen werden möchte. Eben so, wie es Tucholsky einst pointiert formulierte: »Das deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzen.«
»Nein, hat es nicht. Glaube ich jedenfalls.« Sie lässt sich nicht abwimmeln.
Die Blaujacke beugt sich nach vorn. »Um was geht es denn?«
»Ich habe einen Toten gefunden.«
Keine Reaktion.
»Einen toten Mann, der wahrscheinlich erschlagen wurde. In seinem Bett.«
»Soso«, sagt der Volkspolizist hinterm Schalter. »Und da sind Sie sich ganz sicher?«
»Was? Dass es sich um einen Mann handelt?« Viola Schmidtke lacht kurz auf, obwohl ihr alles andere als zum Lachen ist. »Hören Sie: Ich habe den Mann tot in seinem Bett liegen sehen. Sein Gesicht war völlig zerschlagen, sodass ich ihn nicht erkennen konnte. Aber ich bin überzeugt, dass es mein Bekannter Erwin Konrad ist. Wir hatten uns verabredet. Und nun ist er tot.«
Der Uniformierte greift zum Telefonhörer. Ohne den Blick von der Frau zu nehmen, steckt er den Finger in ein Loch der Wählscheibe und dreht sie bis zum Anschlag. Die Scheibe rattert zurück. Er wiederholt die Übung.
Nach einer Weile sagt er: »Kamerad Oberkommissar. Hier ist eine Frau an der Wache, die meldet einen Toten.«
Offenkundig sagt am anderen Ende der Leitung jemand etwas. Der Polizist sagt »Jawoll« und legt den Hörer zurück in die Gabel. »Es kommt jemand, der Sie abholt.«
Dann wendet er sich wieder der Zeitung zu, die vor ihm auf dem Tisch liegt.
Viola Schmidtke hält nach einer Sitzgelegenheit Ausschau, denn wie lange es dauert, bis sie »abgeholt« wird, weiß sie nicht. Allerdings ist das Haus augenscheinlich nicht besonders gastfreundlich. Weit und breit kein Stuhl. Sie versucht ein paar Schritte zu machen, doch es bleibt beim Versuch.
»Wo wollen Sie hin?«, dringt es an ihr Ohr. »Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass man Sie abholen wird!«
»Ich weiß.« Sie reagiert gelassen.
»Na, warum warten Sie dann nicht?«
»Ich mache nichts anderes: Ich warte.«
»Aber Sie haben sich bewegt!«
»Heißt ›warten‹ bei Ihnen, dass man sich nicht von der Stelle rühren darf und Wurzeln schlagen muss? Ich will nur ein paar Schritte tun, um nicht zu erfrieren und um den Hunger zu unterdrücken. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und gestern hatte ich auch nur geröstete Kartoffelschalen.«
Viola Schmidtke setzt ihre Unschuldsmiene auf. Immerhin ist sie Schauspielerin. Das ist jedoch unnötig. Erstens hatte sie nichts Sittenwidriges vor, zweitens eilt jemand die Treppe hinunter. Am Koppel des Mannes baumelt vor dem Bauch in Blinddarmhöhe eine gewaltige Ledertasche, darin eine erkennbar schwere Pistole.
Der Mann steuert auf sie zu, streckt ihr noch im Laufen die Hand zum Gruß entgegen: »Oberkommissar Tuchowski.« Er vertrete die Kriminalpolizei in Zittau, sagt er hüstelnd. Vermutlich gibt es wohl nicht so viele Kriminalisten in der Stadt, die er »vertritt«.
»Kamerad Anwärter«, wendet er sich an den Zerberus, »ich nehme die Dame mit hinauf ins Dienstzimmer.«
Die Ausrüstung der Kriminalpolizei 1948: Handschellen und eine Luger, Modell 08, Standardwaffe der Volkspolizei bis Ende der sechziger Jahre
»Kamerad?«, fragt sie beim Treppenaufstieg. »Ist das die neue Anrede?«
»So ist es«, sagt der Kriminalist. »Wir sind jetzt Volkspolizei, da gibt es keine Herren mehr.«
Viola Schmidtke schüttelt leicht indigniert den Kopf. »Ich kenne ganz andere Kameraden.«
»Ich auch. Aber das kam von oben, von der Landesbehörde in Dresden. Ich vermute, dass es tatsächlich eine Anweisung der Russen ist.« Er schaut sich um, als habe er etwas Unbotmäßiges gesagt und fürchte nun, von einem unbemerkten Zuhörer dafür zur Rede gestellt oder zur Rechenschaft gezogen zu werden. »Dafür habe ich nicht bei den Nazis als ›Kameradenschwein‹ gesessen.«
Viola mustert den etwa Vierzigjährigen von der Seite.
»Ich soll in meiner Kompanie den Kameraden in den Rücken gefallen sein, weil ich mit defätistischen Äußerungen die Wehrkraft untergraben habe, hat der Militärrichter behauptet.« Er winkt ab. »Wie auch immer. Jetzt haben wir eine neue Zeit. Kameraden von damals und Kameraden von heute sind zwei verschiedene Paar Schuhe.« Der Oberkommissar lächelt gewinnend. »Ich denke, irgendwann kommt man da« – er reckt den Zeigefinger zur Decke – »noch selber drauf, dass eine solche Anrede an gestern erinnert. – So, wir sind da.«
Er öffnet eine Tür und lässt seiner Begleiterin den Vortritt. Die schreitet über die Schwelle eines karg möblierten Raumes. Ein Schreibtisch mit einem Stuhl davor und einem dahinter, dazu ein breiter Rollladenschrank, die Regalbretter, soweit erkennbar, nur mäßig mit Aktenordnern gefüllt, mehr nicht. An der Wand vor grauer Tapete ein gerahmter Kopf, den Viola nicht kennt. Sie ist sich aber sicher, dass bis vor kurzen dort das Konterfei eines Mannes mit Bärtchen unter der dicken Nase hing.
»Nehmen Sie bitte Platz«, sagt der Kriminalist und weist auf den Stuhl vorm Schreibtisch mit dem verschlissenen Bezug. »Den Mantel behalten Sie besser an, es ist nicht geheizt.«
Dann pflanzt er sich hinter den Schreibtisch, langt nach einem Blatt Papier, greift sich einen Bleistift und hält ihn gegen das Licht, vermutlich um zu prüfen, ob er angespitzt ist. Als spreche er mit sich selbst, entfährt es ihm: »So, dann wollen wir mal.« Dann wird er förmlich.
»Wie ist Ihr Name?«
Nachdem er die Personalien aufgenommen hat, kommt er zur Befragung.
So und so.
Der Bleistift gleitet rasch übers Papier.
Sie habe also ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann gehabt, stellt der hohlwangige Mann fest, der noch immer sichtbar von seiner Haft im Militärgefängnis gezeichnet ist. Die aber, da ist sich Viola Schmidtke sicher, wird ihm zu seiner heutigen Anstellung bei der Polizei verholfen haben. Nazi-Aktivisten und Mitläufer waren nach dem Ende des Hitlerreichs systematisch aus Behörden und Verwaltungen vertrieben wurden. Wer heute dort saß, hatte in der Regel eine saubere Weste.
»Ja«, antwortet sie ein wenig unwirsch auf diese Frage. Was habe das mit ihrer Anzeige zu tun?
Der Kriminalist antwortet keineswegs unfreundlich. Er müsse bei einer Tat immer auch nach dem möglichen Motiv forschen. Hat man das Motiv, findet man auch den Täter.
»Was sollte ich für ein Motiv haben, den Mann zu töten, mit dem ich schlafe? Jetzt, wo Männer rar sind.« Viola Schmidtke gibt sich entrüstet.
»Die meisten Morde sind Beziehungstaten.«
Sie schlägt die Beine übereinander. »Und Sie glauben, weil ich eine Beziehung zum Opfer hatte, könnte ich auch die Täterin sein. Und laufe zur Polizei, um den Mord zu melden, um von mir abzulenken.« Sie lacht kurz auf. Denn dass es sich um einen Mord handelt, scheint unstreitig: Der Mann dürfte sich seine Verletzungen wohl kaum selbst zugefügt haben.
Ein Lächeln stiehlt sich in das blasse Gesicht des Oberkommissars. »Nun mal langsam, junge Frau. Ich versuche nur zu ermitteln. Was ist mit der Ehefrau? Wusste sie von dem Verhältnis?«
Achselzucken. »Darüber haben wir nie gesprochen. Aber sie wird schon gewusst oder geahnt haben, dass Erwin nie was anbrennen ließ.«
»Wie meinen?«
»Na, ihr Mann legte alles flach, was nicht bei drei auf den Bäumen war.«
Der Kommissar nimmt den Blick vom Blatt und schaut sie belustigt an. »Mit Verlaub: Sie also auch?«
»Ach, Herr Kommissar, sehnen wir uns nicht alle nach etwas Nähe und Zuwendung?«
»Aber doch nicht so!« Er unterdrückt seine Missbilligung nur mäßig.
»Wie dann?«
Er räuspert sich. Er möchte einen Fall aufnehmen und keinen Dialog über Moral und Liebe führen. Als habe er die Frage überhört, erkundigt er sich: »Der Tote unterhielt also zu mehreren Frauen Beziehungen. Also ich meine, als er noch lebte«, korrigiert er sich.
»Kann man so sagen.«
»Und er war verheiratet.«
»Das sagte ich bereits.«
»Was waren das für Frauen, mit denen Erwin Konrad, nun«, und wieder hüstelt der Kommissar, »verkehrte?«
»Kamerad Oberkommissar«, Viola Schmidtke beugt sich nach vorn und verzieht ihr hübsches Gesicht zu einem Grinsen, »ich lag nie unterm Bett oder hielt die Lampe.«
»Aber Sie werden doch vielleicht bemerkt haben, auf welchen Frauentyp er stand, wer in sein Beuteschema passte?«
Sie lacht hell auf. »Hat ein Hecht im Karpfenteich ein Beuteschema? Wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, will ich auch direkt antworten: Erwin nahm jede, die er kriegen konnte. Und er bekam fast jede: von der ersten Garderobiere bis zur letzten Tänzerin. Praktisch alle. Dicke wie dünne, ganz junge und schon etwas ältere. Es gibt ja kaum Männer gerade, und er war einfach gut …«
Sie brach ab. Jetzt hatte sie vielleicht doch das Geheimnis von Erwins Erfolg verraten. »Kurz und gut, wenn Sie so fragen, es gibt nicht wenige Menschen, die zu einer …«, sie machte eine Betonungspause, »die ein Motiv für eine ›Beziehungstat‹ haben könnten. Aber sollte man sich nicht erst einmal den Tatort anschauen und die Leiche abholen? Und vielleicht könnte man auch nach Erwins Frau suchen.«
Der Oberkommissar nickt. Natürlich, das habe er auch vor. Er wisse schon, was zu tun sei. Habe das Opfer, also der Erwin Konrad, gesagt, wo seine Frau sei? Sie hätten sich ja gewiss nicht verabredet, wenn seine Lebenspartnerin in der Wohnung gewesen wäre, nicht wahr.
»Sie wollte gestern Abend zu einer Freundin oder Verwandten nach Görlitz fahren, hat er gesagt. Dann hätten wir heute sturmfreie Bude.«
Der Kriminalist vermerkt auch das auf dem Blatt. Dann ist er fertig. Ihre Personalien habe er ja notiert, er wisse, wo er sie erreiche. Vermutlich werde er im Laufe der Ermittlungen ohnehin ins Grenzlandtheater kommen. »In dieses Sündenbabel.«
Er lacht unsicher und erhebt sich. »Ich bringe Sie noch nach unten.«
Keine Stunde später beugt sich Oberkommissar Tuchowski über die Leiche. Das Gesicht sieht wahrlich nicht gut aus. Ob jedoch die Schläge mit Beil oder der Strick an seinem Hals zum Tode geführt haben, ist auf den ersten Blick nicht festzustellen. Das sollen sie in der Pathologie im Stadtkrankenhaus untersuchen. Er hat kurz zuvor dort angerufen und darum gebeten, ein Auto zu schicken, um den Leichnam abzuholen. Sofern sie genügend »Treibstoff« für ihren Holzgasgenerator haben, wird der Wagen bald eintreffen.
Tuchowski umrundet das Ehebett. Es ist zerwühlt. Nicht nur auf der Seite, wo der Tote liegt. Er wirft das Federbett zurück. Das Laken weist reichlich Flecken auf, deren Ursprung unzweideutig ist. Auch Blutspuren sind dabei. Der Oberkommissar lässt angewidert die Zudecke fallen.
Die Lage ist überschaubar. Dort liegt die Leiche, da die Tatwaffe. Nichts deutet auf einen Kampf. Die Wohnungstür weist keine Einbruchsspuren auf. Der Täter oder die Täterin muss in der Wohnung gewesen sein. Allerdings irritiert Tuchowski die Tatsache, dass das Gewaltverbrechen mit Gewalt verübt worden ist. Seit seiner Ausbildung zu Beginn der dreißiger Jahre hat er schon viele Leichen gesehen – Frauen, Männer, Kinder. Doch Mörderinnen, ohnehin eine verschwindende Minderheit, haben ihr Opfer nie derart zugerichtet. Frauen massakrieren nicht, sie nutzen subtile Methoden. Tabletten, Gift, auch mal eine Schusswaffe. Und ein so stark zertrümmerter Schädel ist ihm noch nie vor Augen gekommen. Vielleicht hat hier ein Mann Hand angelegt? Ein Gehörnter, der seine Frau in flagranti mit dem Nebenbuhler erwischt haben könnte. Wo aber ist dann die Frau, die im Bett lag? Hat er sie mitgenommen? Ging das alles ohne Geräusch und Geschrei ab?
Er wird nachfragen, ob die Nachbarn etwas gehört oder gesehen haben.
Oberkommissar Tuchowski geht durch alle Räume. Aufmerksam mustert er jedes Zimmer. Nichts Auffälliges. Die Wohnung wirkt aufgeräumt. Im Wohnzimmer lässt er sich in einen schweren Sessel fallen. Ah, Friedensware, geht es ihm durch den Kopf. Er schickt seine Augen auf Wanderschaft. Vertiko mit tickender Buffetuhr, geschwungen das Holz, das Schlagwerk nicht aufgezogen. Die Glockenschläge, die dieser Zeitmesser stündlich erzeugt, sind martialisch. Er kennt das, er hat selbst eine zu Hause. Und steckt den Schlüssel zum Aufziehen nur in das eine Loch. Das zweite meidet er. Tuchowski grinst. Es geht den Menschen wie den Leuten.
Sein Blick wandert zum kreisrunden Couchtisch. Ein weißes Tuch mit Lochstickerei bedeckt die Platte, in der Mitte eine Kristallschale. In der Schale liegt etwas. Er erhebt sich und fischt das Papier aus der Schüssel. Tuchowski faltet das Blatt auseinander. Es steht nur eine Görlitzer Adresse darauf. Wer ist diese Frau, deren Anschrift hier vermerkt wurde, in welchem Verhältnis steht sie zum Opfer und dessen Frau? Der Oberkommissar versenkt das Blatt in der Brusttasche seines Mantels, den er nicht abgelegt hat. Es ist hundekalt in der Wohnung. Die Kachelöfen in Wohn- und Schlafzimmer waren seit mindestens 24 Stunden nicht geheizt, wie er beim Handauflegen feststellt. Sie erklären aber auch das Beil, das heutzutage zur Wohnungsausstattung gehört. Damit besorgt man sich Heizmaterial.
Tuchowski ist überzeugt, alles gesehen zu haben. Bis der Krankenwagen eintrifft, kann er ja noch die Nachbarn befragen, sagt er sich.
Inzwischen ist auch der Strom wieder da. Das Flurlicht geht plötzlich an, ohne dass er den Schalter berührt hat. Die Glühbirne an der Decke muss bei der Stromsperre erloschen sein. So vernimmt er denn im Innern der Nachbarwohnung das Schrillen einer Klingel, als er auf den Knopf drückt. Drinnen hört er schlurfende Schritte, im Schloss dreht sich vernehmbar ein Schlüssel, dann öffnet sich die Tür ein wenig.
»Ja bitte?« Eine grauhaarige Frau mit spitzer Nase und eingefallenen Wangen lugt durch den Spalt. Über ihrer Schulter trägt sie eine Wolldecke. Augenscheinlich ist es in ihrer Wohnung so kalt wie nebenan.
»Kriminalpolizei«, hebt Tuchowski an, doch die alte Dame fällt ihm sofort ins Wort.
»Können Sie sich ausweisen?«
»Selbstverständlich«, sagt der Oberkommissar und kramt eine grüne Klappkarte aus seiner Brusttasche und mit ihr das gefaltete Blatt, das er aus der Kristallschale gefischt hat. Inzwischen hat die Dame die Tür um ein paar Zentimeter geöffnet.
Tuchowski hält ihr das Dokument vor die Nase, damit sie es studieren kann. Links das Passbild mit Personalangaben und Dienstsiegel, rechts das Ganze in kyrillischen Lettern, versehen mit dem roten Stempel der sowjetischen Militäradministration.
Zweisprachiger Dienstausweis eines Volkspolizisten, ausgestellt vom Leiter des Kreispolizeiamtes Hoyerswerda am 25. August 1947
Die Frau lässt sich Zeit. Tuchowski ist geduldig. Erst als sie das Studium beendet hat, erkundigt er sich, ob sie gestern oder heute etwas Auffälliges gehört habe.
»Warum?«, fragt sie. »Und was soll ich gehört haben?« Sie rückt die Decke auf der Schulter zurecht und schaut den Kriminalisten von unten neugierig an.
»Nun«, sagt Tuchowski, »Ihrem Nachbarn geht es nicht so gut.« Er räuspert sich, weil er diesen Satz selber dämlich findet. »Er ist tot. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Darauf zielt meine Frage, ob Sie etwas gehört haben.«
Die Grauhaarige verzieht keine Miene. Tod und Vergehen gehören auch bei ihr seit Jahren zum Alltag.
»Wie?«
»Erschlagen mit einem Beil. Deshalb denke ich, dass Sie Geräusche gehört haben könnten. Diskussionen oder Schreie, vielleicht haben Sie auch jemanden aus der Wohnung kommen sehen?«
»Wann?«
»Heute in der Früh oder vormittags. Wir vermuten«, Tuchowski korrigiert sich, »ich vermute, dass es in der Nacht oder auch am Morgen passiert sein könnte.«
»Nein, ich habe nichts gehört und auch nichts gesehen.«
»Hing bei Konrads der Haussegen schief?«
Die Nachbarin macht eine wegwerfende Bewegung.
»Heißt das ja oder nein?«
Sie wiederholt die Geste und sagt: »Weibergeschichten.« Sie spricht das Wort so aus, dass Tuchowski die Tiefe der Verachtung spürt, die die Frau gegenüber ihrem nunmehr dahingegangenen Nachbarn empfindet.
»Weibergeschichten?«
Plötzlich bricht es aus der alten Dame heraus. Dass oft fremde Frauen zu diesem geilen Bock gekommen seien. Sie gebraucht tatsächlich diese Formulierung, die seinerzeit noch mit dem Reichspropagandaminister verbunden war. Goebbels hatte oft die Ufa-Studios besucht und immer wieder gutaussehende Nachwuchssternchen abgeschleppt. Dafür nannte man ihn den »Bock von Babelsberg«. (Seines Problems war er sich durchaus bewusst. »Mein Eros ist krank«, schrieb er in sein Tagebuch. »Jedes Weib reizt mich bis aufs Blut. Wie ein hungriger Wolf rase ich umher.«)
»Die arme Frau Konrad …«
»War sie etwa dabei?«
»Natürlich nicht. Immer wenn sie nicht daheim war, trieb er es im Ehebett mit einer anderen.«
»Auch mit der hier?« Oberkommissar Tuchowski faltet das Blatt auseinander und hält es der Frau vors Gesicht.