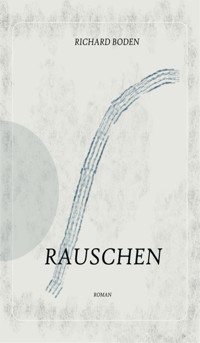
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur kurz raus. Nur kurz fliehen. Nur eben alles umwerfen, den Job kündigen und dann entflieht Jonas Berlin endlich in Richtung Einsamkeit der Nordsee. So der Plan, aber Pläne sind ja auch immer zum Verwerfen da, gerade dann, wenn Europa dazwischen geworfen wird. Oder ein kaputtes Auto. Oder die Liebe. Der Rausch oder das Meer. Es rauscht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Richard Boden
Rauschen
© 2020 Richard Boden
Verlag und Druck:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-18549-4
Hardcover:
978-3-347-18550-0
e-Book:
978-3-347-18551-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
RAUSCHEN
TEIL I – DAS ENDE
KAPITEL 1
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich im Augenblick vor allem eines: Wasser. Das gehört da nicht hin. Geh weg! Bitte. Danke.
Wasser. Fällt einfach so vom Himmel, als hätte es eine Einladung nicht nötig. Offensichtlich kann jetzt alles einfach kommen. Nur das Gehen fällt den meisten Menschen noch schwer. Und den Dingen erst. Wenn Dinge gingen, wären sie nicht weiter da, oder? Dabei ist das doch gar nicht so schwierig. Ein Schritt, dann noch einer. Also gut, zugegeben, gehen fällt dem Wasser jetzt schon schwer. Aber fallen ist, nun, so viel Behauptung darf wohl angebracht sein, auch nicht gerade die innovativste Form der Existenz. Es regnet also. Schon wieder.
Die dicken Holzbalken unter und über mir knarzen verdächtig. Bei jedem Schritt, den ich gehe, den ich aufführe, muss man wohl konkretisieren. Es drängt sich mir der Gedanke auf, dass das Knarzen, welches aller Offensichtlichkeit nach nicht von mir verursacht sein kann – kommt es doch von oben, aus der Decke sozusagen – mit dem Knarzen der Dielen unter meinen Füßen brachial genau übereinstimmt. Als führten wir einen gemeinsamen und doch still getrennten Tanz auf, der Verursacher des Knarzens über meinem Kopf und ich. In Ermangelung ausreichender Informationen benenne ich ihn oder sie hiermit als Knarzer. Ich denke, es ist ein Mann. Die Schritte sind schwer. Das muss ein Mann sein. Vorurteile, hallo! Herzlich willkommen. Bitte eintreten.
Der Mann tanzt nicht nur, er trampelt. Laut. Unachtsam. Während ich in aufkeimender Verzweiflung weiter nach meinem Regenschirm tanze – in der erbitterten Hoffnung, mir damit wenigstens einen Teil der zukünftigen Nässe vom Leib zu halten – komme ich nicht umhin, ein gewisses Unbehagen ob des trampelnden Ungetüms da oben zu entwickeln. Es liegt mir fern, die klanglichen Qualitäten der Natur oder ihrer weitsichtigen Schöpfung in irgendeiner Form zu kritisieren. Doch wäre es, vom Standpunkt eines einfachen Komponisten aus betrachtet, schon schöner, wenn die Natur sich bei der Erschaffung der Rhythmik trampelnder Männer ein wenig mehr Mühe gegeben hätte. Stille als Lautstärke wäre ja auch mal was gewesen. Neu. Ungewohnt. Etwas ganz Verrücktes eben.
Willkommen im Kopf meiner Schachtel. Oder im Kopf meiner Schachtelsätze. Oder im Tal der Sätze. Ich weiß es doch auch nicht. Mich zu konzentrieren, fällt mir schwer. Ich sollte mich beeilen, habe aber keinen Regenschirm. So sind sie, die Kausalketten unserer Zeit. Und oben wird immer noch getrampelt. Frechheit.
Endlich kann ich das Objekt meiner Begierde entdecken. Lässt ja tief blicken, wenn man das über einen Regenschirm sagt. Er, es, das Objekt liegt ungezogen und ungewohnt auf der Kommode neben der Tür. Da gehört er nicht hin, es nicht hin. Ich greife nach dem Regenschirm, kralle meine Tasche aus Echtleder – für die mich nicht nur meine direkten Nachbarn, sondern vermutlich der gesamte Stadtteil, den ich mein Zuhause nenne, wohl am liebsten zurechtweisen würden – klemme mir beides unter den Arm und eile nach draußen. Ich bin spät dran. Auch wenn das wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Ich arbeite mit Künstlern, mit Musikern und Kreativen oder dem, was sie glauben, darzustellen. Manchmal wird dabei nicht einmal etwas von ihnen dargestellt. Meistens sogar. Ich organisiere und koordiniere das Orchester der ehrwürdigen Philharmonie zu Berlin. Ob ich damit selbst noch Künstler oder schon ein Leidender bin, weiß ich oft selbst nicht genau. So ist das wohl mit implizitem Wissen – es transformiert sich, arrangiert sich, komponiert sich um und dichtet sich dieses und jenes zusätzlich an. Gewiss bleibt dabei jedoch der Umstand, dass noch keine Probe der vergangenen Wochen in vollständiger Anzahl teilnehmender Individuen, Individualitäten zur angesetzten Zeit begonnen hat. Gewiss bleibt auch, dass sich die drei Minuten Fußweg zum nächstgelegenen städtischen Nahverkehrsmittel, welches normalerweise unterirdisch verkehrt, aus einem mir jedoch unerfindlichen Grund in meinem Bezirk überirdisch fährt, mit Kinderwagen gesäumt sein wird. Mütter und Kinderwagen. Ein klischeebeladenes Abbild ihrer selbst geben sie da ab, wenn sie sich in den Biobäckerladen drängen. Oder aus ihm herauskommen. Manchmal beides. Gleichzeitig. Bestimmt.
Sofern Sie glauben, eine gewisse Abneigung – ich möchte nicht sagen, Unzufriedenheit – herauszulesen, so bleibt mir zu antworten: Gewiss!
Wenn ich schon bei Gewissheit bin, könnte ich mitteilen, dass mein Gewissen sich jeden Tag mit neuen Gereimtheiten herumschlägt. Könnte. Mitteilen. Mach ich aber nicht. Das weckt wieder nur Unzufriedenheit. Die wird heute vermieden. Das gehört sich so. Andererseits, wie kann man zufrieden sein? Ich setze kein Wenn dazu. Meine Gedanken werden von Zeit zu Zeit regiert von Wenns. Aber hierbei nicht. Ich lasse die Frage so stehen. Sie tanzt mir häufig genug durch den Kopf. Wie der von der Natur vernachlässigte Knarzer, der ein Stockwerk über mir wohnt.
Als ich die Straße betrete, ist das Wasser weg. Natürlich ist es nicht einfach verschwunden, wie es ab und an mit der Intelligenz der Menschen passiert. Pardon. Nein. Es ist noch da. Aus großen Pfützen lacht es mir entgegen. Aber es fällt nicht mehr. Es ist gegangen. Vielleicht kann Wasser also doch gehen. Immerhin habe ich jetzt meinen Regenschirm. Als Schutz. Vor dem gehenden Wasser oder vor trampelnden Knarzern oder vor Müttern mit Kinderwagen. Aber ich lasse ihn besser eingepackt. Die Leute halten mich doch für bescheuert, wenn ich jetzt mit geöffnetem Schirm durch die Stadt laufe.
Es ist voll um mich herum. Ich befinde mich im beschriebenen Mobilitätsmittel der Wahl und muss feststellen: Es ist voll. U-Bahn. Zu voll. Feststellungsgabe – was sicherlich nicht so heißt – wie ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Schön. Voll, aber jeder darf natürlich noch mit. Und ja, natürlich mache ich Ihnen gerne auch noch etwas Platz. Platz aus allen Nähten, wie es wohl heißt. Nur, dass es hier keine Nähte gibt. Nicht einmal Platz für einen Regenschirm gibt es hier noch. Ich überlege, mich von meinem zu trennen und ihn einfach auf den Bahnsteig zu werfen, in der Hoffnung, damit die verfügbare Luft im Wagen erhöhen und die Atmung wieder einsetzen lassen zu können. Zu spät. Ich habe zu lange Schachtelsätze in meinem Kopf gebildet. Die Tür ist zu. Aber das hätte ich dem Regenschirm eh nicht antun können. Thema Gewissen und so. Und überhaupt.
Dreißig schweißnasse und unangenehm riechende Minuten später befinde ich mich am Erfüllungsort meines Seins. Ich befinde mich gern hier. Ich bin Komponist, Musiker, Organisator, Unzufriedener. Woher dieser Unfrieden kommt, ist mittlerweile Teil einer inneren Offenbarung, die zu äußern ich jedoch auf später verschieben muss.
Die Bratsche kommt. Die Bratsche ist natürlich nicht sein richtiger Name. Aber ich habe irgendwann angefangen, meine Kollegen nach ihren Instrumenten zu benennen. Ich muss feststellen, dass sich hieraus eine gewisse Komik ergibt. Der Humor der Realität ist oft nur schwer einzufangen, auf Seiten oder Saiten zu pressen und zum Klingen zu bringen. Die Bratsche trägt Brille. Eine Hornbrille. Eine wirklich gigantische Brille. Meine Augen sind zwar auch auf die echtholzummantelte Unterstützung zweier geschliffener Gläser angewiesen, doch das Monstrum im Gesicht der Bratsche ist in Kombination mit der Vergrößerung der Augenpartie, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe zweifelsohne benötigt, einfach nur einnehmend. Die Bratsche trägt Glatze – nennt man das so, auch wenn keine Frisur vorhanden ist? - und einen blauen Schal, der zu wollig und zu groß ist, um noch als dezentes Tuch durchgehen zu können. Der Mund der Bratsche begrüßt mich mit einem zu lauten und zu gespielten Unterton von Freundlichkeit in der Stimme. Kurzum, alles wie immer.
»Jonas. Da bist du ja. Mensch, wie geht’s dir denn? Bist du gestern Abend noch gut nach Hause gekommen?«
Die Fragen der Bratsche kommen schnell, ohne Reaktionsmöglichkeiten zuzulassen. Fragen stellen, ohne Antworten abzuwarten, war schon immer eine faszinierende Variante von Kommunikation. Besonders in Berlin. Besonders hier. Ich begrüße mein Gegenüber mit seinem richtigen Namen, noch immer verwirrt von der Kombination aus Brille, Schal und glänzender Kopfhaut.
Nach Minuten des künstlerisch hochtrabenden Gesprächs der Nichtigkeit dränge ich mich an ihm vorbei in den Kern des Gebäudes. Der Konzertsaal ist schön und erfüllt mich immer mit Ehrfurcht, besonders dann, wenn er nicht durch Menschen gestört wird. Ich frage mich oft, wie man ein von außen so hässliches Gebäude innen doch mit solcher Ruhe strahlen lassen kann. Ich bin schon lange hier. Vielleicht zu lange. Gewissheit. Sie wissen ja. Ich habe zahllose Konzerte hier gegeben, organisiert, orchestriert und komponiert. Doch in meinem Kopf türmt sich immer mehr die Frage auf: Für wen eigentlich? Unser Publikum ist die Elite. Unser Publikum ist Macht, Geld, Schönheit und in einigen wenigen Ausnahmefällen auch künstlerisches oder musikalisches Verständnis. Manchmal Interesse. Es reizt mich nicht. Unser Publikum lähmt mich. Die Bratsche könnte das nicht verstehen. Für sie ist das Publikum der Nabel der Welt. Ihre Existenz im Mitmachen von Vorgaben füllt die Bratsche mehr aus, als es mich ausfüllen könnte. Ich spüre die Leere. Und die Suche. Wir suchen alle, denke ich. Ich suche nach der Melodie, die bleibt. Nach der Zeit, die Melodie hören, verstehen und aufschreiben zu können. Es ist ein abgedroschenes, kindisches und albernes Klischee. Kritiker meiner selbst, der ich selbst nicht zuletzt am häufigsten bin, würden mich auslachen für das Faktum, die perfekte Melodie finden zu wollen. So ist das mit Sehnsüchten. Früchte unserer Gedanken. So ist das auch mit mir. Die Bratsche würde es nicht verstehen. Der Knarzer wohl noch weniger.
Heute ist mein letzter Tag hier. Heute ist mein letzter Tag als Komponist Jonas an der Philharmonie Berlin. Morgen beginnt etwas Neues. Was es ist, weiß ich noch nicht.
Da kommt die zweite Querflöte. Die Pünktliche. Die Schüchterne. Die Schöne. Sie ist immer die Erste (nach mir) im Saal und immer die Letzte (vor mir), die ihn wieder verlässt. Die zweite Querflöte ist klein, blond, hat eine Stupsnase und ist immer fleißig. Ich mag sie.
»Hallo, Jonas.«
»Hallo.« Zweite Querflöte, hätte ich fast laut dazugesetzt. Ich kann mich jedoch drosseln und stottere ihren Namen hinterher. Na toll. Der letzte Tag hier, und er stottert die zweite Querflöte an. Was soll sie jetzt nur denken? Vielleicht denkt sie, dass er wohl besser zur Triangel als zu einem Klavier gegriffen hätte. Nicht, dass ich etwas gegen Triangler hätte – oh nein, schöne Instrumente waren einfach ausverkauft. Ja, ich beuge mich nur dem allgemeinen Spott des Orchesters. Lasse mich integrieren. Mission erfolgreich. Immerhin.
Jetzt ist es still. Die zweite Querflöte und ich schweigen. Wir starren auf unsere Noten und tun so, als würden wir sie noch einmal durchgehen, auch wenn wir beide wissen, dass wir das Stück bereits perfekt verinnerlicht haben. Dann kommt die Bratsche mit zwei anderen zur Tür herein, und vorbei ist es mit der Ruhe. Die Bratsche hat meinen Stellvertreter dabei, der hoffentlich noch nicht gesagt hat, dass er mein Stellvertreter sein wird. Das würde ja nur Fragen aufwerfen, und die gilt es zu vermeiden. Fragen habe ich schon genug, danke.
Ruhe kehrt erst wieder ein, als die Probe ihr Ende gefunden hat und die zweite Querflöte und ich wieder die Letzten im Saal sind.
»Ich höre hier auf. Heute war mein letzter Tag«, bricht es aus mir heraus. Was ist los mit mir? Contenance? Hat offensichtlich schon gekündigt. Na ja.
Ich muss gestehen, dass ich nicht so leicht etwas gestehe. Schon gar nicht gestehe ich Gedanken oder Themen, die normalerweise meine Privatsphäre beinhalten.
»Oh. Das kommt überraschend. Schade. Warum?« Die zweite Querflöte scheint mit sich zu kämpfen. Gespräche mit Menschen zu führen, die sie erst seit ein paar Jahren kennt, scheint ihr genauso unangenehm zu sein wie mir. Wir starren uns an. Stille. Immer noch. Ich rekapituliere die Enttäuschung, die ich meine, aus ihrer Stimme herausgehört zu haben und verpasse so den richtigen Moment für eine Antwort. Wie so oft.
»Nun. Ich – privater Kram. Du weißt schon. Ich muss einfach etwas Neues ausprobieren.«
Ja, gut. So kann man ein Gespräch nun auch völlig gegen die Wand fahren. Danke für deinen Beitrag, Jonas. Die zweite Querflöte starrt mich dennoch verständnisvoll mit ihren großen grünen Augen von unten an.
»Du musst ja auch nicht drüber reden. Manchmal möchte man das nicht. Das verstehe ich. Alles Gute, Jonas. Pass auf dich auf.«
Dann ist sie verschwunden. Ich merke erst, dass sie weg ist, als ich anfange, in den leeren Saal zu stottern. Was war das denn? Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Worte mit der Querflöte gewechselt zu haben. Zweite Querflöte, erinnere ich mich. Nicht die erste. Die erste ist eine unausstehliche Furie. Ich schaue mich um. Der Saal ist verlassen und still. Verrückte Zeiten müssen das sein.
Ich greife nach meinem Mantel, packe meine Sachen zusammen und verlasse den Saal. Ich stelle mir vor, wie der Vorhang hinter mir fällt. Ich weiß, dass es hier im Moment keinen Vorhang gibt, der fallen könnte und auch keinen Grund, einen Vorhang fallen zu lassen. Aber der Gedanke ist schön. Das einzige, was fällt, ist mein Regenschirm. Ich zucke zusammen. Offensichtlich war ich so sehr in Gedanken versunken, dass ich ihn einfach fallen gelassen habe. In der Bahn habe ich das nicht geschafft.
Ich trete nach draußen. Das Wasser ist immer noch da, geht aber weiter seiner Wege. Es dämmert bereits. Ich beschließe, für ein paar Stationen die Füße anstelle der Bahn zu nehmen. Um mich herum ist es wie in einer Geisterstadt. Die Touristen, die einem tagsüber die Schuhe zertrampeln, sind verschwunden. Niemand ist zu sehen, und ich fühle mich, als wäre ich der letzte Mensch auf der Welt, oder wenigstens in der Stadt, oder zumindest wenigstens in diesem Bezirk. Ich freue mich über dieses Szenario und schaudere gleichzeitig.
Plötzlich schrecke ich zusammen. Ich stehe vor meiner Tür. War also wohl doch nicht so plötzlich. Ich muss so sehr in Gedanken versunken gewesen sein, dass ich den ganzen Weg bis zu mir nach Hause gelaufen bin. Niemand würde so etwas tun. Das mag Sie verunsichern, ich bitte Sie, haben Sie Nachsicht mit mir. Alles wird sich richten. Gerichtet wird immer. Mein Leben ist im Umbruch. Die Melodie geht mir nicht aus dem Kopf. Nein. Ich muss mich korrigieren. Der Gedanke an eine Melodie, die all das einfängt und trägt, geht mir nicht aus dem Kopf. Vielleicht würde ein Beobachter mich für einen Freak halten. Vielleicht hätte er recht. Vielleicht nicht. Wer weiß. Vermutlich ist das sogar egal. Der Beobachter müsste mich über Wochen verfolgt haben und das Puzzle der Erscheinung zu einem Bildnis zusammensetzen können. Hallo. Beobachter.
Ich spaziere gern. Nein, das ist kein thematischer Sprung. Ich spaziere gern. Es hilft mir, zu denken und zu verstehen. Besonders angetan hat es mir in den letzten Tagen dieser See im Osten, an dem Ort, den die Menschen hier Berg nennen und der an kalten Tagen so verlassen und an warmen Tagen so überlaufen ist. Ein Wald, am Rande einer Stadt, der sich kilometerweit verzweigt. Ein Paradies für jeden, der gerne Abstand von sich und den Menschen nimmt. Das ganze aber urban. Denn richtiger Wald, ohne Urbanität also, das ist für Urbane nichts. Mich eingeschlossen.
Und dann ist da auch noch Potsdam. Das werde ich ein wenig vermissen in den nächsten Wochen. Das ist mal klar. Ich bin gerne da. Klar. Wer nicht? Manchmal denke ich, dass ich ein bisschen wie Potsdam wäre, wäre ich eine Stadt. Was ich nicht bin. Schließlich bin ich ja ich. Manchmal weiß ich zwar auch nicht, was ich eigentlich darstelle, aber ich denke, eine Stadt bin ich nicht. Das wüsste man doch. All der Trubel, der in einem toben würde, das wüsste man doch. Wobei …
Nun, wäre ich eine Stadt, wäre ich wohl klein, spießig, möchtegerngebildet und in der Nähe einer bekannten größeren Stadt. Da möge sich jetzt jeder selbst ein Bild hauen. Ich habe mir eines geschnitzt. Aus den Gedanken meiner Spaziergänge, zwischen naiver Bildungsbürgertum-Stadt und Wald mit See am Fuße eines naiven Möchtegern-Bergs. Es hat gedauert, doch manchmal ist es erstaunlich, wie einfach alles zu sein scheint. In einer Sekunde weiß man nicht, was einen umtreibt, und im nächsten Moment ist man bereit, sein ganzes Leben umzukrempeln. Okay, ich gebe zu, das war zu hochtrabend. Aber gehen werde ich trotzdem. Wie der Regen. Ich will, nein, ich denke, ich muss hier weg.
Nach einem dieser Tage, die sich anfühlen, als wären sie einsame Sonntage, obwohl sie es nicht sind, habe ich diesen Entschluss gefasst. Ich gehe. Wie das Wasser. Genau genommen gehe ich sogar zum Wasser. Ich habe das nicht geplant. Ich habe auf die Karte getippt und mir gesagt, dass ich dahin gehe, wohin ich tippe. Und dann habe ich beschlossen, ans Meer zu fahren. Es war wie Schicksal. Nein. Ja. Vielleicht. Glauben Sie mir kein Wort. Das ist natürlich Quatsch. Nur Menschen ohne Plan tippen wild auf irgendwelche Karten. Menschen, die viel zu viel denken, tun das nicht. Und Pläne sind quasi Lebensgrundlage. Ich mag das Meer einfach. Ich habe von einer Insel in der Nordsee gelesen, die wunderbar kalt, abgeschieden und rau zu sein scheint. Luna. Ich baue auf diesen Widerspruch zwischen Namensklang und Realität. Luna ist mein Ziel. In zwei Tagen geht es los. Geplant – natürlich.
KAPITEL 2
Der Neue ist da. Der Neue trägt Krawatte. Der Neue hat hässliche Schuhe. Der Neue ist mir unsympathisch. Er steht in meiner Wohnung und glotzt. Der Neue glotzt. Er erinnert mich ein wenig an die Bratsche. Vielleicht könnten sie in einer anderen Welt gute Freunde sein, die Bratsche und er. Vielleicht sind sie in dieser Welt gute Freunde.
Der Neue, von dem ich bis jetzt nur weiß, dass er sich selbst als IT-Guru beschrieben hat, ohne dass mir klar geworden wäre, was das bedeuten könnte, ist auf meine Einladung hin hergekommen. Wir stehen in meiner Wohnung. Genau genommen stehen wir im dielengetäfelten Flur meiner mit Stuck überbewerteten Altbauwohnung direkt hinter der Eingangstür, die ich nach möglichst kurzer Zeit hinter ihm wieder geschlossen habe, und starren uns an. Er will meine Wohnung. Ich weiß noch nicht, ob ich sie ihm geben will. Ich kenne ihn nicht, und ich mag ihn nicht. Er trägt Krokodillederschuhe, so viel ist klar. Krokodillederschuhe, weinrot, glänzend. Muss Krokodilleder sein. Meine ungeübten Augen sind schnell und gewiss in ihren ahnungslosen Vorurteilen.
Er ist der Einzige, den ich eingeladen habe. Er hat sich als Erster gemeldet. Stellt man in Berlin seine Wohnung zur Untermiete in einer öffentlich gearteten Plattform zur Verfügung, kann man sich nicht mehr retten. Der Tag besteht fortan nur noch aus dem Lesen und Beantworten nichtssagender, aber dafür umso längerer Nachrichten, gepaart mit seltsam anmutenden Fotografien. Darauf habe ich keine Lust. Ich habe die Wohnung für eine Minute angeboten und das Angebot danach wieder aus dem Netz verbannt. Der Neue war schnell. Jetzt ist er hier. Er blickt sich um. Es scheint, als würde er etwas erwarten. Vermutlich erwartet er etwas von mir. Eine Reaktion, oder noch schlimmer, eine Aktion. Da kann er aber lange warten.
Er stellt sich vor. Dabei zuckt das karierte Einstecktuch in seinem Sakko leicht auf und ab. Einstecktuch und Krokodillederschuhe. Das kann ja heiter werden. Während ich noch überlege, ob ich die Wohnung doch noch einmal ins Netz stellen sollte, strecke ich meinen Arm aus, drücke seine Hand und gebe mich meiner Höflichkeit hin. Jetzt starren wir wieder. Ich gebe auf. Der Neue hat gewonnen. Ich führe ihn herum. Er tut interessiert, ja, begeistert, möchte man meinen, doch ich ahne, dass sich hinter seinem Zahnpflegelächeln und seinem Einstecktuch Langeweile, Arroganz und Gleichgültigkeit abwechseln.
Wir setzen uns in Bewegung. Der Flur erscheint mir plötzlich wie ein endloser Gang. Wie eine Reise in eine andere Welt. Der Flur führt mich in den Gang meiner Gedanken, in die Gedankenwelt zwischen See und Stadt. Abrupt bleibe ich stehen. Die Küche. Fast wäre ich an meiner eigenen Küche vorbeigelaufen. Ich schaue den Neuen an, doch es scheint, als hätte er nichts bemerkt. Mit abschätzigem Blick mustert er den Zustand der Wände, der Türen und des Bodens. Mit abschätzigem Blick mustere ich den Zustand des Neuen. So mustern wir beide und hängen in unseren Mustern fest.
Die Küche. Bei dem Blick in meine Küche und bei dem Gedanken an mein Vorhaben werde ich ein wenig wehmütig. Es ist nicht so, dass meine Küche sonderlich besonders wäre, auch nicht besonders sonderlich. Sie ist mir einfach ans Herz gewachsen. Meine Küche ist wohl der Inbegriff dessen, was meine Wohnung in Teilen seit Jahren widerspiegelt und was heute als hipp minimalistisch gilt. Ich wusste nicht, dass es hipp sein kann, sich nicht mit unnötigem Kram zu belasten oder sich einfach nicht dafür zu interessieren. So sind die Menschen. Seltsam.
Ich gebe zwei, drei Nichtigkeiten in Richtung des Neuen von mir. Dinge, die man eben so über seine Küche sagt. Herd. Spüle. Tisch. Regal. Fenster. Licht mit Sonne. Toll. Dann kommen wir zum Herzstück meiner Küche. Die Espressomaschine, ein Grund meiner Wehmut. Es widerstrebt mir, doch ich biete dem Neuen eine Kaffeezubereitung seiner Wahl an. Er verneint. Der Neue sinkt in meinem Ansehen. Ich mache mir einen Kaffee. Schlagartig ist die Luft in der Küche vom sanften Aroma eines Cafés erfüllt. Ich werde schwach bei diesem Geruch, verkörpert er doch für mich all die Träume, Sünden und Bestrebungen des Lebens zugleich, ohne dabei jemals aufdringlich zu sein. Doch mein Gegenüber scheint ihn nicht einmal zu bemerken. Also weiter.
Wir gehen in Richtung meines Wohnzimmers, welches wir durch die alte Flügeltür betreten. Ich lasse meinen Blick schweifen. Das Wohnzimmer ist kein klassisch eingerichtetes Wohnzimmer. Ich nutze es vielmehr als Wohn-Arbeitsraum. In der Ecke steht ein alter, kleiner Schreibtisch vor dem Stolz meines Bücherregals. Eine Ansammlung von Sofas und einem Ohrensessel, nebst drapiertem Cello, die um einen kleinen Tisch verteilt sind. Zugegeben, die Sofas und den Sessel hätte jemand anderes vielleicht mit mehr Ästhetik aufeinander abgestimmt. Ich finde, sie erhalten ihre Gemütlichkeit durch das Fehlen von Perfektion und Abstimmung.
Der Neue wendet sich an mich. »Kann man das einlagern?« Er zeigt auf den Flügel in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes. Kann man das einlagern? Ich starre ihn an. Manchmal traue ich den Dingen nicht. Manchmal denke ich, dass ich mir Dinge wohl nur eingebildet habe und niemand eine so dumme und unangebrachte Frage stellen könnte. Ich sehe ihn an. Er meint es ernst. Er hat die Frage in aller Wahrhaftigkeit gestellt. Kann man das einlagern? Kann man dich vielleicht einlagern? Ich schiebe meinen Ärger auf die Seite meiner Mundöffnung, die nicht für das Sprechen verantwortlich zu sein scheint.
»Nein, der Flügel bleibt hier drin. Der Transport wäre für die kurze Zeit zu aufwendig«, sage ich. Ich fühle mich rückgratlos, klein und falsch. Ich sollte ihn anschreien. Der Neue scheint sich größte Mühe zu geben, die Wohnung nicht haben zu wollen.
Wir schreiten durch das Wohnzimmer. Genauer gesagt, der Neue schreitet durch das Wohnzimmer, sieht sich alles an. Ich sehe ihm dabei zu. Er hält vor dem Weinregal, einem weiteren Schatz meiner Wohnung. Ich versuche, die Stimmung aufzuheitern: »Bitte nicht alles auf einmal austrinken, während ich weg bin. Da lagern einige feine Cabernet Sauvignons.« Stille. Der Neue starrt wieder. Jetzt erinnert er mich erneut an seinen möglichen Freund, die Bratsche. Offensichtlich ist er entweder resistent gegenüber Humor, unhöflich oder sieht nicht ein, wieso er einen schlechten Witz, der vielleicht auch kein Witz gewesen ist, kommentieren sollte.
»Sieht ja schon fast aus wie ein Lager«, sagt er herablassend, mit Blick auf die Weinsammlung. Ich eröffne vielleicht gleich ein Lager für tote Krokodillederschuhe mit Einstecktüchern, denke ich. Und wieso überhaupt redet er immer von Lagern und Lagerungen? Mir kommt zunächst ein schrecklicher Gedanke. Vielleicht ist der Neue ein Nazi? Vielleicht habe ich einen Nazi in meine Wohnung gelassen. Keine Zeit. Die Wut, die sich ob der Dummheit und Einfachheit des Möchtegernschönlings einzuschleichen beginnt, beraubt mich aller Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was oder wer er ist. Ich versuche, mich zu zügeln.
»Was war noch einmal die Miete für die Wohnung?« Ich nenne ihm einen Preis, der dreißig Prozent über dem liegt, was ich aktuell bezahle. Ich möchte ihn bestrafen. Er nickt nur akzeptierend. Nicht einmal diese kleine Strafe verschafft mir Hoffnung und Zufriedenheit.
»Und für wie lange suchen Sie einen Untermieter?«, führt er seinen imaginären Fragebogen fort.
»Erst einmal für vier Wochen. Danach sehen wir weiter.«
Er nickt wieder. Ich führe ihn zum Schlafzimmer. Davor angekommen, öffne ich langsam die Tür. Wenn ihm das Weinregal und der Flügel schon so zugesetzt haben, wage ich nicht zu prophezeien, was gleich passieren wird. Ich besitze keinen Kleiderschrank im klassischen Sinne. Meine Sachen, vorwiegend Hemden, hängen auf Bügeln, die an Wagen hängen, offen im Raum. Meine Unterwäsche ist in großen Schubfächern verstaut. Der Neue wird es nicht verkraften, denke ich. Ich öffne die Tür. Der Neue guckt und nickt. Sein Nicken ist ohne jede Bedeutung. Es signalisiert mir die pure Informationsaufnahme. Ich bin irritiert. Das Verhalten des Eindringlings meiner Privatsphäre läuft meinen Erwartungen immer entgegen. Vielleicht macht er das ja mit Absicht. Vielleicht will er mich ärgern, provozieren, die Miete mindern oder etwas anderes. Meine Gedanken rasen. Wir setzen unsere kleine Abenteuertour fort. Zuletzt ist das Bad an der Reihe. Er nickt wieder, dieses Mal anerkennend. Ich verstehe nicht ganz, wieso, nehme es aber hin. Anerkennendes Nicken. Hätte nicht gedacht, dass der Neue dazu fähig ist.
Wir sind zurück in der Küche. Wir wollen die Details besprechen, nachdem mir mein Gast mit mittlerweile begeistertem Nicken zu verstehen gegeben hat, dass er die Wohnung unbedingt bewohnen möchte. Ich mache mir einen Espresso. Angebotsversuch Nummer zwei schlägt wieder fehl. Er möchte lieber Chai-Tee. Ich mache ihm einen. Hinten im Schrank finde ich sogar welchen. Ich wusste nicht, dass ich Chai-Tee besitze und weiß auch nicht, wieso.
Gleich bin ich ihn los. Gleich werde ich ihn aus meiner Wohnung werfen, vergessen oder doch zumindest verdrängen können. Zumindest werde ich versuchen, ihn zu verdrängen. In meinem Kopf schwirren programmierende Krokodillederschuhe mit Einstecktüchern und einer Abneigung gegenüber Wein, Musik, Instrumenten, Espresso und allen anderen schönen Dingen des Lebens umher. In meinem Kopf schwirrt die Verlorenheit der Welt oder doch wenigstens die Vergessenheit, Oberflächlichkeit und Ignoranz Europas dunkler Nächte.
Wir setzen uns an den Tisch und klären den weiteren Ablauf. Ich gebe ihm meinen Zweitschlüssel und sage ihm, dass er morgen Abend einziehen kann. Er nippt derweil fleißig an seinem Tee, überfliegt den Mietvertrag, den ich zwischenzeitlich ausgedruckt habe – natürlich nicht, ohne den Mietpreis mit meiner vorangegangenen Äußerung in Einklang gebracht zu haben – und setzt eine schnörkelige Unterschrift auf die letzte Seite. Ich frage mich manchmal, ob es Menschen gibt, die ihre Unterschrift üben, um sie möglichst eindrucksvoll zur Schau stellen zu können. Möglichst verschnörkelt. Möglichst groß. Der Mann hat unterschrieben und wohnt somit für die nächsten Wochen zur Untermiete in meiner Wohnung. Ich habe Angst davor. Morgen ist der Auszug. Morgen ist der Einzug. Morgen ist alles neu. Der Neue wohnt dann hier.
KAPITEL 3
Jonas packt, denke ich. Jonas schaut sich beim Packen zu, denke ich danach. Manchmal rede ich von mir selbst in der dritten Person. Manchmal sehe ich mich als dritte Person. Manchmal glaube ich, eine dritte Person zu sein. Jonas packt Schallplatten in eine Kiste. Jonas packt Bücher zu den Schallplatten. Der Neue würde die Schallplatten nicht wertschätzen können. Der Neue würde die Bücher nicht verstehen. Ich traue dem Neuen nach wie vor nicht über den Weg und vertraue ihm dennoch alles an, was ich besitze.
Es knarzt. Der Knarzer ist wach und arbeitet sich wieder mit der Kraft allen Fleißes von A nach B. Mir kommt in den Sinn, dass der Knarzer vielleicht Karriere machen möchte und an seiner nächsten Entwicklungsstufe arbeitet, deren einzige Möglichkeit, der Logik entsprechend, die des Tramplers sein kann. Der Knarzer trampelt also. Ich gönne dem Neuen den zukünftigen Spaß mit dem Knarzer, respektive Trampler, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Neue überhaupt zu einer Aufnahme an Emotionen und Reaktionen in einem Maße fähig ist, dass er den Knarzer bemerkt oder sich an ihm stört. So bilden sie vielleicht in den nächsten Wochen eine süffisante Einheit aus knarzender Ignoranz und blindem Trampeln. Der Gedanke ruft Beklemmung in mir hervor. Wie sähe unsere Welt aus, wäre sie von Tramplern und Menschen wie dem Neuen regiert? Wie sieht unsere Welt nur aus? Schnell versuche ich, mich auf etwas Schönes zu fokussieren. Kurz kommt mir die zweite Querflöte mit der Stupsnase in den Sinn. Die Beklemmungen lösen sich.
Ich greife mir weitere Bücher aus dem Regal. Ich verstaue meine Schätze. Vermutlich wird mein neuer Untermieter keine Wertschätzung für die Schätze in den Regalen übrighaben, aber ich möchte ihm die Möglichkeit verwehren, sie für sich zu entdecken. Bilder, Schallplatten, Bücher. Ich trage die gepackten Kisten mit Dingen, von denen ich glaube, mir zumindest erhoffe, dass sie einen Teil von mir geprägt haben und definieren, davon. Die Weinsammlung und das Piano werde ich nicht retten können, denke ich mürrisch, während ich die steile, aber stets überraschend saubere Kellertreppe nach unten steige. Die Kellerräume in dem Mehrfamilienhaus, das ich bewohne, sind mir immer ein Rätsel. Normalerweise sind die Keller der Stadt modrig, von Ratten beheimatet, alt und verlassen. Unser Keller nicht. Er wehrt sich mit all seinen Kräften gegen den Verfall, den man ihm von außen ansieht und von innen vermutet. Ich hoffe, der Keller hält durch, solange ich weg bin. Welche Zukunft, welche Hoffnung bleibt mir für eine Rückkehr, wenn der Keller, mit all den Dingen, die zu beschützen ihm befohlen wurden, seinen Kampf aufgibt? Ich bemerke die aufkeimende Düsternis in meinen Gedanken. Ich düstere weiter. Heute soll ein neues Kapitel anbrechen, doch in diesem Augenblick fühlt es sich an, wie sich das Ende anfühlen muss. Kalt. Grau. Verlassen. Ich entledige mich der Kiste in meinen Armen und der Bilder, die ich vorsichtig, in alte Laken gehüllt, auf der Kiste balanciert habe, drehe mich um und kehre zurück in meine Wohnung.
Dort schaut mich der Flügel traurig an. Wunderschön, wie er so dasteht im einfallenden Licht der Sonne, zwischen spiegelndem Staub, der Flügeltür und meinen hängenden Schultern. Ein wunderschöner Anblick, der mich traurig macht. Ich schaue traurig zurück. Wir schweigen kurz. Dann erinnert mich ein Teil meines Verstandes daran, dass ich den Tag nicht mit Stehen verbringen wollte. Ich sende einen Befehl an meine Beine, sich zu bewegen. Sie weigern sich zunächst, dann jedoch tun sie ihrer Bestimmung Werk und setzen sich in Bewegung.
Ich packe eine Tasche, auch wenn ich nicht weiß, was ich alles mitnehmen soll. Nachdem ich eine voll ausgerüstete Tasche mit Inhalt versehen habe, packe ich noch eine. Sicher ist sicher. Man weiß nie, was kommt. Vorsicht ist besser als Nachsicht – bla. Die Düsternis in mir steigt in einem ähnlichen Maße wie die Sonne die Wohnung erobert. Ich gehe in die Küche und beginne damit, eingespielte Prozeduren abzuarbeiten, die schlussendlich zu dem Erfolg eines frischen Espressos führen sollen. Die Espressomaschine schaut mich traurig an, als ich sie einschalte. Vor lauter Trotz, vielleicht auch Angst davor, nun von jemandem verwendet zu werden, der keine Verwendung für sie hat, stottert sie zunächst. Ich werfe ihr einen bösen Blick zu. Sie räuspert sich und beschließt endlich, doch noch zum Leben zu erwachen. Danke.
Ich gehe ans Fenster, schaue hinab. Unten sehe ich die Straße einer Stadt, die mir fremd vorkommt und die gleichzeitig mein Zuhause ist. Auf der Straße herrscht zurückhaltende Betriebsamkeit. Cafés werden geöffnet. Buchläden werden geöffnet. Fahrräder fahren scheinbar ziel- und regellos umher, vorbei an Kinderwagen, deren Rolle in diesem Teil der Stadt von Tag zu Tag einnehmender wird. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich die Straße nicht vermissen werde. Doch, ich werde die Straße vermissen. Die Cafés mit ihren kleinen weißen Bänken sind hipp. Die Buchläden daneben, die sich für die Vermarktung unbekannter, aber äußert vielversprechender Autoren einsetzen, die uns Werke zur frühkindlichen Kulturerziehung, einem besseren Lebensstil oder schwedischer Romanistik schenken, sind ebenfalls hipp. Alles ist hipp in meiner Straße – ich gebe mich der Beanspruchung von Besitz öffentlichen Gutes hin. Selbst die Fahrräder wirken hipp. Hipp. Ein widerliches Wort. Ich schlürfe an dem Espresso, den die Maschine mir geschenkt hat, halte kurz inne. Früher haben wir oft gesagt, dieses oder jenes wäre modern, oftmals mit einem bitteren Beigeschmack der Verachtung. Heute ist das Wort modern zu alt, um noch hipp zu sein. Der Beigeschmack hat sich fancy unter die Ironie gemischt, die wir überall verteilen.
Ich blicke hinunter und sehe hippe Menschen, die glauben, hipp zu sein, aber zu alt sind, um dem Wort seine unangemessene Bedeutung nehmen zu können. Ich sehe Menschen, die zu alt sind, als dass sie – meiner stumpfen, naiven und hinterher hängenden Meinung nach – noch neue Kinderwagen durch die Straßen schieben sollten. Früher war alles besser, könnte ein imaginärer Gesprächspartner mir zuflüstern, wenn es denn einen gäbe. Das lässt mich zusammenzucken. Es ist gut, dass ich die Stadt verlasse. Hier bin ich düster, alt und verbittert. Hier bin ich nicht ich, hier bin ich nur der, der ich geworden bin.
Die Espressotasse ist leer. Die Taschen stehen gepackt im Flur. Erst jetzt fällt mir auf, wie viel ich meinem alten Volvo zumuten möchte. Aber ich bin optimistisch. Optimistisch düster gehe ich nach unten, auf die Straße, dem Zentrum meiner disruptiven Gedanken. Mein Wagen steht nicht weit von meiner Haustür entfernt. Der neue Kinderwagen einer zu alten Besitzerin, die mir durch die Nachbarschaft unserer Wohnungen, wenngleich auch nicht durch die Nachbarschaft unserer Seelen, bekannt ist, steht im Weg. Er ist angeschlossen an eine Laterne, die versucht, eine Zeit widerzuspiegeln, die seit über hundert Jahren nicht mehr existiert. Doch sie spielt ihre Rolle gut. Der Wagen steht vor dem Wagen. Der Wagen steht im Weg. Der Kinderwagen stört. Ich komme nicht gut an meinen Wagen, der an dem Weg steht, heran und stolpere fast über meine Gedanken.
Der alte blaue Volvo, dessen aktueller Zustand eher dem Regen als einem sattblauen Himmel ähnelt, steht zuverlässig. Auf ihn ist immer Verlass. Ruhig. Groß. Langsam. Ich öffne ihn und bugsiere den Kinderwagen der Nachbarin, soweit mich das Schloss am Fuße des Wagens (des Kinderwagens, nicht des großen Wagens) lässt, zur Seite. Jetzt beginne ich, das Auto zu beladen. Ich belade das Auto unaufhörlich. Das Auto quietscht. Das Auto meckert. Das Auto signalisiert mir, dass es kein Packesel ist, sondern ein altes Auto. Ich habe es übertrieben. Ich habe es überladen. Die Kofferraumklappe geht nicht zu. Ich entlade alles wieder, entlade mich selbst dabei. Die ersten Leute, die mir bei der Arbeit heimlich zusehen, fangen bereits an, ihre Heimlichkeit einzustellen und blicken amüsiert drein. Gleich wird sich eine kleine Traube um mich gebildet haben, denke ich. Da steht er da, der Herr Komponist, zu sehr Freigeist, um seine Hände nützlich zu gebrauchen. Dann ein erstes Lachen, dann ein zweites. Der Film meiner Gedanken nimmt Fahrt auf. Stoisch entlade ich weiter und versuche die Blicke, die meine Vorstellung in meinen Rücken zaubert, zu ignorieren.
Nachdem ich das Auto mit zu vielen Dingen beladen und mit allen Dingen entladen und einen Kreis von oben nach unten – Kellertreppe runter, Kellertreppe rauf – aufgeführt habe, belade ich den Wagen wieder mit einigen Dingen. Während ich so zwischen Kellertreppe runter, Kellertreppe rauf hin und her tanze, wird mir bewusst, dass ich dem Neuen keinen Kellerschlüssel gegeben habe. Die kleinen Momente der unbewussten, unterbewussten Weisheit. Der Neue hätte ja auch fragen können. Der Neue hat nicht gefragt. Ich habe nicht gelogen. »Was, Keller? Ne, Keller gibt’s hier schon seit Jahren nicht mehr. Alle alt, modrig, von Ratten bewohnt und verlassen. Also, ich würde ja nicht da runtergehen. Wenn es einen Keller gäbe, meine ich natürlich. Aber gibt ja keinen. Tja, kann man wohl nichts machen. Dumm, wie es manchmal läuft, oder eben nicht läuft. Gibt ja keinen Keller«, spult die Kassette eines imaginären Monologs von mir in meinem Kopf. Der Monolog ist weiter von der Realität entfernt als die Kassette in meinem Kopf, die eben diesen Monolog in Schleife spielt. Das Band hängt wohl irgendwo.
Jetzt stehe ich vor dem beladenen Auto. Die Straße ist leer. Ich habe alles verladen oder in den Keller, den es für den Neuen nicht gibt, geräumt. Die Straße ist leer. Keine Traube. Keine Lacher über den heillos verwirrt wirkenden Komponisten. Jonas spielt schon wieder eine Rolle, denke ich. Jonas spielt Jonas im Film Jonas und die Welt.
Ich steige ein letztes Mal die Treppe zu meiner Wohnung hinauf. Sie kommt mir länger und steiler vor als sonst. Auf dem Küchentisch liegt ein Stapel CDs neben meinem Klotz. Manchmal frage ich mich, wozu ich diesen Mobilitätsklotz mit Sprachfunktion und allgegenwärtiger Onlinepräsenz eigentlich besitze. Ich benutze ihn so gut wie nie. Einem spontanen Impuls folgend beschließe ich, das Gerät hierzulassen, meine kleine Abenteuerreise nach Luna zu einem Abenteuer zu machen. Luna. Ich war noch nicht dort und habe doch nichtexistente Bilder gemalt von dieser Insel der Einsamkeit, die ich vom Schreibtisch eines kleinen verlassenen Dorfes aus in mich aufzusaugen versuche, während die Gischt gegen die Felsen springt und das Meer so laut jault, dass die alten Mauern des Häuschens zittern. Ich schüttele kaum merklich den Kopf und schalte den Gedanken an Luna aus.
Ich stelle den Klotz auf schwarz und lege ihn zurück auf den Tisch. Es wird den Neuen verunsichern, wenn der Klotz da so offen in der Küche liegt. Meine Gedanken haben ihren Spaß.
Die Küchentisch-CDs werden von mir in die bekannte, zur Ablehnung freigegebene Umhängetasche gestopft. Dort warten schon meine Notizbücher und ein Buch, in dem es um Kreise und Äpfel geht. Es ist, als ziehe das Verpacken etwas anderes aus den Untiefen meines Gedächtnisses hervor. Ich stehe in der kleinen Stadt, von der ich manchmal zu viel schwärme, an dem See, der sich eigentlich viele Kilometer entfernt befindet, und träume, atme die Luft ein. Die Luft duftet nach Café und Wald, nach Milch, Honig, Tee und Nadeln. Meine Gedanken versuchen, ein Abbild ihrer selbst der vergangenen Wochen zu sein und versetzen sich zurück zu einem Punkt, an dem das Auf und Ab der Kellertreppe noch weit entfernt und die Freudigkeit zu neuen Entschlüssen noch rein und unverbraucht schien. Die Gedanken träumen, träumen von einer Melodie zwischen Café- und Waldluft und Meer und Perfektion. Meine Gedanken träumen manchmal, ohne dabei festen Regeln oder Gesetzen der Zeit zu gehorchen. Meine Gedanken träumen.
Ich unterbreche sie. Ich gehe zum Piano hinter der Flügeltür, setze mich auf den alten, aber noch bequemen Hocker davor und beginne zu spielen. Ich bin zu aufgewühlt, um sauber spielen, geschweige denn sauber denken zu können. Meine Finger rasen von einem Stück zum nächsten, unterbrechen mich, unterbrechen mein Denken, unterbrechen sich selbst. Sie wollen nur spielen. Etwas muss noch einmal aus ihnen ausbrechen, bevor die Angst, nicht ausbrechen zu können, sie zunächst übermannt. Ich habe ein elektronisches Klavier ins Auto geladen. Doch es wird nicht dasselbe sein. Es wird nicht der alte Flügel sein.
Die Töne fliegen hektisch durch den Raum, steigern sich, bäumen sich auf, fallen wieder auseinander. Die Zeit vergeht wie im Flug, und erst, als die Sonne hinter den Dächern verschwimmt und meine Wohnung Raum für Schatten lässt und Licht vergisst, höre ich auf. Ich bin immer noch aufgewühlt, gleichzeitig ganz ruhig. Ich bin fokussiert, auf mich, auf das was kommt und auf die Töne, die immer noch zwischen den Wänden hin und her zu tanzen scheinen. In meinem Kopf ergeben sie einen lustig anmutenden Rhythmus mit dem Auf- und Ab-Tanz der Kellertreppe und dem knarzenden Trampler über meinem Kopf, der von nun an die Irren und Wirren des behaupteten Krokodillederschuhs mit Einstecktuch erfreuen wird.
Im Flur greife ich meine Jacke. Meine Tasche springt mir förmlich in die Hand, nachdem ich die Flügeltür zum Wohnzimmer geschlossen habe. Ich schaue nicht zurück und gehe zielstrebig auf die Wohnungstür zu. Ich gehe nach draußen und lasse die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Ich kann ihn spüren und glaube, ihn zu hören – den traurigen Widerhall des Flügels, untermalt vom sanften Seufzen des Cellos, das hinter der Flügeltür vibriert hat. Ich spüre seine Vibrationen noch hier draußen. Ich spüre den stummen, aber vorwurfsvollen Blick des Flügels hinter der Tür, hinter der Flügeltür, der mich mit Zorn, Angst und Abschied ansieht. Ich schaue zurück. Wie ein Idiot stehe ich mit der Nase vor der geschlossenen Tür und starre die Wohnung an, die ich nicht sehe.
Irgendwann, Sekunden später, die mir wie endlose Stunden des Verharrens vorkommen, löse ich mich aus meiner Starre und gehe hinunter auf die Straße. Die Sonne hat ihren Tageszenit fast erreicht und bringt die Straße dazu, alles und jeden, der sich ihr nähert, zu blenden. Ein Fahrradfahrer quält sich auf seinem Hollandrad in seiner viel zu dicken Jacke über das Kopfsteinpflaster, als ich das Haus verlasse und die Straße betrete. Im hellen Schein, der alles mit Lebensfreude erstrahlen lässt, wirkt mein Auto viel zu trist, dunkel und dreckig auf mich. Normalerweise ist mir egal, wie es aussieht, aber wie die Sonne so auf die in grau und braun gefärbten Scheiben fällt, regt sich eine weitere Traurigkeit und Anspannung in mir. Ich schließe die Tür auf. Ich versuche, die Tür aufzuschließen, muss ich wohl sagen. Die Tür wird nach einigem Widerstand von mir aufgeschlossen.
Ich lasse mich auf den abgewetzten Sitz fallen, hieve meine Tasche auf den Beifahrersitz und will losfahren, als mir klar wird, dass ich meine Handlungen nicht wie sonst vollkommen automatisiert abspielen kann. Der Klotz hinterlässt ein schwarzes Loch durch seine Abwesenheit. Seitdem er gelernt hat, Musik immer, überall und von allen erdenklichen Künstlern abzuspielen, verlasse ich mich darauf, dass er das immer, überall und mit allen erdenklichen Mitteln und Kraftreserven tut. Heute ist der Klotz nicht hier. Der Klotz liegt in der Küche. Der Klotz wartet auf den Neuen, hört dem Trampler bei der Arbeit zu. Ich greife nach der lieblos abgelegten Tasche, die mir das lieblose Ablegen irgendwann zum Vorwurf machen wird.
Eine CD nach der anderen nehme ich heraus, drehe sie zweimal in meiner Hand, lege sie zur Seite, nur um sie dann erneut zu greifen. Entscheidungen fallen mir schwer. Kleine Entscheidungen und große Entscheidungen besonders. Haben wir es heute noch?, denke ich abwertend über mich selbst. Oh, Jonas hat offensichtlich eine CD seiner Wahl gefunden. Schlechte Wahl, aber immer noch besser als die Wahl der Stille, flüstert die zynische Stimme in meinem Kopf.
Normalerweise muss ich diese Entscheidung nicht treffen. Ich habe sie vorgefertigt, Künstler verteilt, neu zusammengestellt und lasse alles durcheinander abspielen. Das nimmt mir die Entscheidung ab. Von Zeit zu Zeit und Augenblick zu Augenblick beschäftigt mich die Frage, was all der Digitalkonsum mit uns tun wird. Wird er die Leidenschaften des Genusses steigern oder abnutzen, hervorkitzeln oder begraben? Diese Fragen verwirren mich, weil ich zwei Meinungen zu ihnen habe, zwei Personen verkörpere, den inneren Dialog nie ganz lösen kann. Ich drifte ab. Zur Abgeschiedenheit Lunas. Lege die gewählte CD ins Radio, starte den Motor und fahre los. Richtung Luna. Richtung Ruhe, Kreativität, Freiheit und Schaffenskraft, die alles einfängt, Klänge, Melodien, Gefühle und Gedanken. Auf geht’s, Jonas, sage ich in Gedanken zu mir, während die Musik, die ich angemacht habe, ergänzt: »I can’t sleep with the noise in this house.« Wie passend.
KAPITEL 4
Meine Reise beginnt, denke ich mit viel Pathos in meinen Gedanken. Es ist übertrieben. Ich fahre einfach los. Niemand schreit mich an, erklärt mir, dass ich das Falsche täte, obwohl ich das vielleicht ja tue, vielleicht aber auch nicht. Niemand zieht ihre Augenbrauen nach oben, während sie mir sagt, dass ich doch nicht einfach alles wegschmeißen kann. Niemand klopft mir auf die Schulter, mit der gutväterlichen Miene eines wettergegerbten Arbeiters, die mir zu verstehen gibt, dass das, was ich tue, genau das Richtige ist. Alles ist normal. Hinter mir hupt jemand. Auch das ist normal in Berlin. Irgendjemand hupt immer. Das gehört dazu. Berliner Liebe.
Ich biege in die Straße ein, die ihren Namen einer wo auch immer gelegenen, heilenden Quelle verdanken soll. Meine Straße, den Park, die alten Mütter, die Fahrradfahrer und Kinderwagen habe ich hinter mir gelassen. Selbst die blendende Sonne scheint für einen Moment im Grau meiner Umgebung zu verschwinden. Der Geruch im Wagen schmiegt sich wie ein sanftes Kissen perfekt in die Umgebung und bietet ein beachtlich abgestimmtes Bild. Nein, es stinkt nicht im Auto. Der Geruch des Alters liegt in der Luft. Der weise Geruch nach Muffigkeit, verschütteten Getränken, der kalte Rauch des Vorbesitzers, das alles vermischt sich mit dem alten Ledergeruch der Sitze.
Als ich an der Ampel vor besagter Straße stehe, bemerke ich den Fahrradfahrer neben mir. Es ist der blasse Typ mit der zu dicken Jacke. Er sieht aus wie jeder andere auch, der sich in diesem Teil der Stadt aufhält. Normal alternativ. Oder alternativ normal. Je nach persönlichem Gesichtspunkt. Das verwirrt mich nicht. Mich verwirrt der Hund. Der Hund guckt komisch. Außerdem habe ich den Hund vorhin nicht bemerkt. Der Hund führt dazu, dass das Fahrrad mit seinem Besitzer auf einmal wirkt wie aus einem billigen Film. Die Sonne scheint auf das Trio aus Fahrrad, Hund und Normalalternativen. Der Hund sitzt im Fahrradkorb vor dem Lenker und grinst mich an. Ich sehe sicherlich verwirrt aus. Der Hund sieht aus, als würde er mich auslachen. Ein Hund lacht mich aus.
Die Ampel springt auf grün. Hinter mir nehme ich in der Ferne wieder die Berliner Liebe war. Der Hund entfernt sich. Die Hupe klingt nun näher. Grünes Licht scheint durch die dreckigen Windschutzscheiben in mein Gesicht. Das Auto steht. Vermutlich sollte ich losfahren. Ich gebe Gas. Das Auto gibt ein kurzes Geräusch von sich, man könnte sagen, es brubbelt. Das Auto bleibt stehen. Die Hupe ertönt jetzt öfter, und mir wachsen Schweißperlen auf der Stirn, als mir bewusst wird, dass ich selbst schuld am Stillstand meines Autos bin. Das muss das letzte Mal passiert sein, als ich ein pickliger, blasser, dünner Junge war, auch wenn ich fürchte, dass ein Blick Richtung Innenspiegel mir verraten würde, dass sich daran nicht viel geändert hat. Falten statt Pickel. Zum Glück ist der Innenspiegel schon seit Monaten abgebrochen und liegt still im Handschuhfach und wartet.
Ich starte den Motor erneut, fahre los, dem Hund hinterher, und bekomme von den fahrenden Nachbarn hinter mir noch ein letztes Stück Freundlichkeit hinterhergeworfen, ehe sie, vermutlich durch mich verschuldet, an der Ampel stehen bleiben müssen.
Der Hund ist weg. Er muss abgebogen sein. Ein Hund hat mich aus der Fassung gebracht. Das lässt mir nur den Schluss, dass es davor schon nicht mit großer Gesundheit um meine Verfassung bestellt war. Überraschung. Eigentlich. Nicht.
Ich manövriere das Auto durch die grauen Gassen Berlins. Kreise anderen Fahrern hinterher und lausche der Musik, die nur ab und an nicht vom Rauschen meiner Gedanken übertönt wird. Mein dünner Körper sitzt ruhig und – Außenstehende möchten es wohl so nennen – apathisch da, doch mein Kopf rast, springt, tanzt, verkriecht sich, kommt wieder vor, bricht zusammen und steht wieder auf. Mein Kopf ist ein Hampelmann. Dann beginnt er von vorn. Er flötet und träumt dabei, von der zweiten Querflöte. Die mit der süßen Stupsnase, denke ich.
Ein Labyrinth. Ein steinernes, leuchtendes Labyrinth, umhüllt von lebendiger Verwesung und Rauch, so kommt mir die Fahrt durch die Stadt von Zeit zu Zeit vor. In diesem Labyrinth spielen Kanten, Kurven und Tunnel große Rollen, die sich trotz der ihnen innewohnenden Dramatik meist mit Tristesse füllen. Die Stadt erscheint wie ein riesiges, stummes Monster, dem man nur auf Irrwegen entkommen kann. Ich weiß, dass ich mit Freiheit belohnt werde, wenn ich das Monster besiege. Ab und an habe ich das schon geschafft, und ich bin vorsichtig optimistisch, es wieder zu schaffen. Ich weiß nur noch nicht, wie lange. Ich vermisse meine Irrwege schnell, denn sie weisen mir auch den Weg.
Die Gedanken sind düster, werden düsterer, je weiter ich mich von meiner Wohnung entferne. Ich nutze das tun können. Supergefühl. Also, das Supergefühl stellt sich sicherlich ein, wenn die düsteren Gedanken weg sind. Noch bin ich optimistisch. Ein optimistischer Pessimist. Was der Knarzer wohl ist? Ob er sich schon in einen Trampler verwandelt hat? Ob der Neue schon Ignoranz oder Verwirrung ob des liegen gelassenen Klotzes offenbart hat? Hat der Flügel ihn schon traurig angeschrien? Es sollte mir egal sein. Also schön. Es ist mir jetzt egal. Gelingt mir bis hierher ganz gut, denke ich, die Egalität.
Berlin verlässt mich, und ich verlasse Berlin, während ich der Ausfallstraße weiter folge. Hier draußen wird man nur noch vom Ortsausgangsschild daran erinnert, dass man sich noch in einer Millionenstadt befunden hat. Die Eindrücke sind anders. Blaue Schilder. Die blauen Schilder nehmen zu und erinnern mich wieder an Europa und meine Privilegien. Ich bin ein guter Mensch, denn ich habe hart dafür gearbeitet, in diesem Teil der Welt zu leben. Ich muss ein guter Mensch sein.
Die blauen Schilder weisen mir den Weg zu dem Rennen Richtung Hamburg, dem ich gleich beiwohnen werde. Nicht, dass ich daran teilnehmen würde. Niemals würde mir der Gedanke kommen, zu rasen, ich bin schließlich ein guter Mensch. Aber es wird ein Schauspiel sein, dabei zuzusehen, ein Genuss. Ich biege auf die dreispurige Rennstrecke und lasse mich auf ihr treiben. Ich habe es nicht eilig, und das merken mir wohl alle an. Ich lasse den Blick auf der Umgebung ruhen, an der ich vorbeiziehe. Felder wechseln sich mit Wäldern ab, erhellt vom grellen Licht der Sonne, das ihnen ein schönes Antlitz verleiht. Kommen Sie nicht an grauen Tagen her. Dann ist alles trostlos. Heute ist alles friedlich, grün und braun. So lasse ich mich treiben.
Eine Lampe und ein aufdringlicher Piepton reißen mich aus meinen Gedanken und sorgen dafür, dass ich kurz zusammenzucke. Das Symbol auf den Anzeigetafeln meines Autos, das mich anschreit, sieht aus wie eine kleine Tanksäule. Da hat wohl jemand ein Loch in den Tank geschlagen. Wenn ich denjenigen erwische. Es bestünde natürlich auch die Möglichkeit, dass einfach jemand vergessen haben könnte, dem Wagen etwas zu trinken zu geben. Nein. Ausgeschlossen. Wer sollte das gewesen sein? Wer sollte vergessen, den Wagen aufzutanken, in dem Wissen, oder wenigstens der Vermutung, lange keine Möglichkeit mehr dazu zu erhalten?
Während ich mich noch selbst verfluche, taucht in der Ferne wieder ein blaues Schild auf. Heute habe ich Glück. Die kleine Pfütze, die sich gut verschlossen im hinteren Teil meines Wagens befindet, wird doch noch Verstärkung bekommen. Die Rettung wird eintreffen, bevor die kleine Pfütze restlos verdursten muss.
Zehn Minuten später rolle ich mit fast leerem Tank auf die Säulen der Raststätte zu. Beim Blick auf die Preistafel verfluche ich mich noch einmal selbst. Ich steige aus, tue, was zu tun ist, stecke das metallene Schlauchende durch die metallene Öffnung, der verdurstenden Pfütze entgegen. Danach fahre ich das Auto auf einen Parkplatz vor dem Haus, das mir mein in Scheinen aufgeblättertes Leben, oder wenigstens einen Teil davon, nehmen möchte. Voller Trotz betrete ich das Haus, begleiche meine unnötig hohen Schulden, ergattere einen Kaffee von der abgenutzt wirkenden Mitarbeiterin und setze mich in die hintere Ecke der Raststätte, die aussieht wie jede andere, in der ich zuvor war und vermutlich auch wie jede andere, in der ich in Zukunft sein werde. Ich lasse meinen Blick über das Feld und den in der Nähe beginnenden Wald schweifen.
Auf dem Parkplatz, direkt neben meinem Volvo, parken zwei mit einem Hippie-Auto. Ihr Wagen ist ein alter Bus, voll beladen, Aufkleber an allen Ecken und Enden und mit Beulen übersät. Die beiden Frauen, die lachend aussteigen, betreten die Örtlichkeit. Ich ignoriere sie wieder. Eine von ihnen kann ich nicht so einfach ignorieren. Sie ist wunderschön. Ich bin wunderbar oberflächlich, schon klar. Man möge mich hängen. Ich versuche, nicht zu starren, ignoriere beide und konzentriere mich auf meinen Kaffee und das Treiben auf dem Feld. Vielleicht entsteht auf dem leeren Feld ja noch Treiben. Hier draußen kann man sich nie sicher sein, was passiert. Einen Moment nicht hingesehen – zack – die Umgebung ist verändert, in Trubel, und tausend Dinge sind zeitgleich passiert. Oder eben nichts. Heute passiert wohl eher nichts. Das Feld hat heute frei. Für das Feld ist heute wohl Sonntag. Muss auch sein. Sei ihm gegönnt.
Einige Zeit später habe ich den Kaffee mit mehr Genießertum, als er es verdient hätte, geleert und gehe nach draußen. Meine Gedanken sind so leer wie der Kaffeebecher. Meine Gedanken fliegen. Sie schwirren zwischen dem Knarzer, der Bratsche, meinem aufgegebenen Beruf, der doch meine Berufung war, der Querflöte und den neuen Krokodillederschuhen mit Einstecktuch hin und her. Und dann ist da natürlich noch Luna, mit all ihrer Ungewissheit und Spannung. Vielleicht ist Luna auch total langweilig und ich werde mich ärgern, mir nicht mehr Gedanken bei der Planung meiner Zukunft, meiner Träume, meiner Wünsche, meines Lebens gemacht zu haben. Luna ist sicherlich wunderschön, klingt es hohl in meinem Kopf.
Wolken ziehen auf, als ich den Motor starte. Ich setze meine Reise fort und lasse mich von blauen Schildern wieder zurück zur Rennstrecke treiben. Kurz nachdem ich sie erreicht habe, fahre ich in meinem Sitz zusammen. Es knallt. Vor mir ist überall Rauch. Der Rauch kommt aus meinem Auto. Der Motor ist verstummt. Lässt sich auch nicht neu starten. Tot. Die kleine Pfütze hat nicht überlebt, denke ich. Hat sich geopfert. Fraglich nur, für wen oder was. Ich lasse mich ausrollen, stelle den Wagen, mich und meine Habseligkeiten an den Seitenstreifen und versuche erneut einen Neustart. Vergeblich. Na toll. Super. Feld, Wald und ein stehendes Auto. Das ist also der Beginn meiner Reise. Passiert ja eigentlich nur Idioten in wenig budgetierten Fernsehproduktionen.
Ich greife zu der Stelle, an der sich sonst mein Klotz befindet. Nichts. Leere. Der Klotz liegt auf dem Tisch meiner verlassenen Küche und wartet auf den Neuen. Ich fluche. Sicher, sicher, Fluch und Segen. Ich kenne all die netten Sätze. Ich verfluche





























