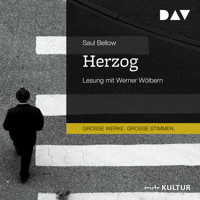9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein intelligentes Feuerwerk in bester Bellow-Manier« Ravelstein ist berühmt und hat ein Netzwerk von Freunden in der ganzen Welt. Als Philosophieprofessor an einer amerikanischen Universität war er verehrt, reich wurde er als Bestsellerautor und konnte sich dann endlich den Luxus leisten, den er zeit seines Lebens geliebt hat. Aber Ravelstein muss bald sterben. In Paris trifft er noch einmal seinen alten Freund Chick, einen amerikanischen Schriftsteller. Chick, Ich-Erzähler des Romans, soll Ravelsteins Biografie schreiben, gnadenlos offen und ungeschminkt. Beim eleganten Souper mit Chicks junger Frau und Ravelsteins schönem Liebhaber, beim Flanieren und Einkaufen oder im Café de Flore diskutieren die beiden Freunde Ravelsteins Leben, gemeinsame Erlebnisse, und sie mokieren sich über den Niedergang der amerikanischen Kultur, über den Ravelstein sein berühmtes Buch geschrieben hat. Aus diesen Gesprächen und Rückblenden entsteht Ravelsteins Leben, die Biografie, an der Chick arbeitet und in der sich auch sein eigenes Leben spiegelt. Der Roman, wie oft bei Saul Bellow voll autobiografischer Züge, besticht durch amüsante Anekdoten und Aperçus, wunderbar erzählte Episoden und treffende Charakterisierungen. Ein großes Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Saul Bellow
Ravelstein
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Saul Bellow
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Saul Bellow
Saul Bellow wurde am 10. Juni 1915 in Lachine / Quebec als Sohn jüdisch-russischer Einwanderer geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Montreal, 1924 zog die Familie nach Chicago. Dort besuchte er die Tuley Highschool und studierte später Anthropologie und Soziologie an der Northwestern University. Bellow übte verschiedene Tätigkeiten aus, bevor er seit 1938 dauerhaft an verschiedenen amerikanischen Universitäten lehrte, unter anderem in Princeton und an der Universität von Chicago. Am 5. April 2005 starb der Schriftsteller in Brookline, Massachusetts, im Alter von 89 Jahren. Bellow war mehrmals verheiratet und hatte vier Kinder. Saul Bellow selbst erhielt für sein umfangreiches literarisches Werk zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Nobelpreis für Literatur 1976.
Das gesamte Werk von Saul Bellow ist lieferbar bei Kiepenheuer & Witsch.
Willi Winkler, geboren 1957, ist ein deutscher Journalist, Autor, Übersetzer und Literaturkritiker. Er hat u. a. Werke von Julian Barnes, Anthony Burgess, John Updike und Saul Bellow übersetzt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ravelstein ist berühmt und hat ein Netzwerk von Freunden in der ganzen Welt. Als Philosophieprofessor an einer amerikanischen Universität war er verehrt, reich wurde er als Bestsellerautor und konnte sich dann endlich den Luxus leisten, den er zeit seines Lebens geliebt hat. Aber Ravelstein muss bald sterben. In Paris trifft er noch einmal seinen alten Freund Chick, einen amerikanischen Schriftsteller. Chick, Ich-Erzähler des Romans, soll Ravelsteins Biografie schreiben, gnadenlos offen und ungeschminkt. Beim eleganten Souper mit Chicks junger Frau und Ravelsteins schönem Liebhaber, beim Flanieren und Einkaufen oder im Café de Flore diskutieren die beiden Freunde Ravelsteins Leben, gemeinsame Erlebnisse, und sie mokieren sich über den Niedergang der amerikanischen Kultur, über den Ravelstein sein berühmtes Buch geschrieben hat. Aus diesen Gesprächen und Rückblenden entsteht Ravelsteins Leben, die Biografie, an der Chick arbeitet und in der sich auch sein eigenes Leben spiegelt. Der Roman, wie oft bei Saul Bellow voll autobiografischer Züge, besticht durch amüsante Anekdoten und Aperçus, wunderbar erzählte Episoden und treffende Charakterisierungen. Ein großes Lesevergnügen.
Inhaltsverzeichnis
Dank
Widmung
Ravelstein
Ich möchte meiner Lektorin Beena Kamlani für ihre Kunst und ihre Hellsicht danken.
S.B.
A la bella donna mia mente.
Für Janis,
der Stern, ohne den ich nicht navigieren könnte.
Und für die echte Rosie.
Seltsam, dass ausgerechnet die Wohltäter der Menschheit eher komisch sind. In Amerika jedenfalls kommt das häufiger vor. Wer hier herrschen will, muss das Land bei Laune halten. Im Bürgerkrieg beschwerte man sich über die komischen Geschichten, die Lincoln erzählte. Vielleicht spürte er, dass steifer Ernst weit gefährlicher war als ein Witz. Seinen Kritikern galt er als leichtfertig, und sein eigener Kriegsminister nannte ihn einen Affen.
Von den Entlarvern und Spöttern, die das Denken und den Geschmack meiner Generation bildeten, war H. L. Mencken der bedeutendste. Meine Freunde in der Highschool lasen den American Mercury und waren über den Scopes-Prozess auf dem letzten Stand, den ihnen Mencken lieferte. William Jennings Bryan, der bible belt und der Bloedianus Americanus fanden keine Gnade vor Menckens Augen, während Clarence Darrow, der Scopes verteidigte, als der Vertreter von Wissenschaft, Moderne und Fortschritt galt. Für Darrow und Mencken war Bryan, der an die Schöpfungslehre glaubte, eine zum Untergang verurteilte Absurdität, ein Dorfdepp. In der Sprache der Evolutionstheorie war Bryan ein abgestorbener Zweig am Baum des Lebens. Seine Propaganda für unbegrenztes Prägen von Silber war ebenso ein Witz, wie dass er mit dem altmodischen Pathos eines Kongressabgeordneten redete oder die ungeheuren, für Nebraska typischen Farmermahlzeiten, die er verschlang. Es war, wie Mencken bemerkte, die Esserei, die ihn umbrachte. Seine Vorstellung von einer »besonderen Schöpfung« machte ihn beim Prozess zur Zielscheibe des Spotts, und Bryan ging den Weg des Pterodaktylus – die plumpe Version einer Idee, die sich später durchsetzte –, jenes flatternden Reptils, aus dem sich ein Warmblüter entwickelte, der flog und sang.
Ich brachte ein ganzes Notizbuch mit Zitaten von Mencken zusammen und ergänzte es später mit Notizen von Parodisten oder Selbstparodisten wie W. C. Fields oder Charlie Chaplin, Mae West, Huey Long und Senator Dirksen. Sogar über Machiavellis Sinn für Humor findet sich eine Seite. Aber ich werde Sie nicht mit meinen Spekulationen über Witz und Selbstironie in demokratischen Gesellschaften behelligen. Keine Sorge. Ich bin sogar froh, dass die alte Kladde verschwunden ist. Ich möchte sie gar nicht wiederfinden. Vor Kurzem tauchte sie als eine Art umfänglicher Fußnote wieder auf.
Ich hatte schon immer eine Schwäche für Fußnoten. Eine kluge oder gemeine Fußnote hat mich für manchen Text entschädigt. Und wie ich sehe, benutze ich eine lange Fußnote, um ein ernstes Thema anzuschlagen – mit einem raschen Schnitt befinden wir uns in Paris, in einem Penthouse des Hôtel Crillon. Anfang Juni. Frühstückszeit. Zu Gast sind wir bei meinem guten Freund Professor Ravelstein. Abe Ravelstein. Meine Frau und ich wohnen ebenfalls im Crillon, weiter unten, siebter Stock. Sie schläft noch. Die gesamte Etage unter uns (nicht dass diese Tatsache besonders relevant wäre, aber ich muss sie einfach erwähnen) ist von Michael Jackson und seinem Tross belegt. Er tritt jeden Abend in irgendeiner Pariser Großhalle auf. Bald werden seine französischen Fans auftauchen, eine riesige Menge Gesichter wird sich nach oben wenden und unisono nach Miekell Jack-sown rufen. Eine Absperrung der Polizei hält die Fans zurück. Innen sieht man vom siebten Stock, wenn man über die Marmortreppe bückt, Michaels Leibwächter. Einer von ihnen ist ins Kreuzworträtsel der International Herald Tribune vertieft.
»Unglaublich, was, dieser Pop-Zirkus«, sagte Ravelstein. An diesem Morgen war der Professor ganz besonders glücklich. Er hatte der Leitung des Hauses zugesetzt, bis sie ihm diese begehrte Suite gab. In Paris – und im Crillon! Zum ersten Mal mit richtig viel Geld hier. Vorbei die Zeit der müffelnden Zimmer im Dragon Volant (oder wie immer es hieß) in der Rue du Dragon oder im Hôtel de l’Académie in der Rue des Saints Pères gegenüber der medizinischen Fakultät. Kein Hotel, das das Crillon an Stil und Luxus überträfe; während der Friedensverhandlungen waren hier die ganz großen Tiere aus Amerika einquartiert.
»Toll, was?«, sagte Ravelstein mit einer seiner heftigen Bewegungen.
Ich stimmte ihm zu. Das Zentrum von Paris lag uns zu Füßen – die Place de la Concorde mit dem Obelisken, die Orangerie, die Chambre des Députés, die Seine mit ihren pompösen Brücken, Paläste und Gärten. Der Anblick war natürlich toll, aber heute war er noch toller, weil ihn Ravelstein vorführte, der noch letztes Jahr mit hunderttausend Dollar verschuldet gewesen war. Vielleicht auch mehr. Er machte bei mir immer Witze über seine »schwindenden Ressourcen«.
Er sagte dann: »Ich schwinde mit ihnen – weißt du, was der Begriff in Finanzkreisen bedeutet, Chick?«
»Schwindende Ressourcen? Ich kann’s mir so ungefähr vorstellen.«
Schon bevor Ravelstein zu Geld gekommen war, hatte niemand daran gezweifelt, dass er unbedingt Armani-Anzüge brauchte und Koffer von Louis Vuitton, kubanische Zigarren, die in den USA nicht zu bekommen waren, Dunhill-Accessoires, Montblanc-Füller aus reinem Gold oder Kristallkelche von Lalique, um den Wein zu kredenzen – oder kredenzt zu bekommen. Ravelstein gehörte zu jenen großen Männern – groß, aber nicht dick –, deren Hände zittern, wenn sie kleine Aufgaben verrichten sollen. Grund dafür war keine Schwäche, sondern eine ungeheuer ehrgeizige Energie, die ihn schüttelte, wenn sie sich entlud. Jedenfalls mussten seine Freunde, Kollegen, Schüler und Bewunderer nicht mehr einspringen, um seine luxuriösen Gewohnheiten zu subventionieren. Gottlob ging es inzwischen ohne den ausgefuchsten Tauschhandel mit den Kollegen um Jensen-Silberzeug oder Spode oder Quimper. Jetzt war er sehr reich. Er war mit seinen Ideen in die Öffentlichkeit gegangen. Er hatte ein schwieriges, aber erfolgreiches Buch geschrieben, ein inspiriertes, intelligentes Buch, eine Kriegserklärung, das sich gut verkauft hatte und weiterhin in beiden Hemisphären und auf beiden Seiten des Äquators verkaufte. Er hatte es ganz schnell geschrieben, aber es war ihm Ernst damit: keine Zugeständnisse, kein Populismus, keine geistige Hurerei, keine Entschuldigungen, nichts Präzeptorales. Er hatte alles Recht, so zu schauen, wie er schaute, während der Kellner uns das Frühstück hinstellte. Ravelsteins Intellekt hatte ihn zum Millionär gemacht.
Es ist kein geringes Verdienst, reich und berühmt zu werden, indem man genau das sagt, was man denkt – mit seinen eigenen Worten, kompromisslos.
An diesem Morgen trug Ravelstein einen blau-weißen Kimono. Ein Geschenk aus Japan, wo er im vergangenen Jahr aufgetreten war. Man hatte ihn gefragt, was ihm besondere Freude machen würde, und er hatte gesagt, er hätte gern einen Kimono. Dieses Exemplar, das einen Shogun geschmückt hätte, musste eine Maßanfertigung sein. Ravelstein war sehr groß. Er war nicht besonders elegant. Das schöne Teil trug er locker gegürtet und halb offen. Seine Beine waren ungewöhnlich lang und sahen nicht übermäßig gut aus. Seine Unterhosen hingen auf halbmast.
»Der Kellner hat mir erzählt, dass Michael Jackson das Essen des Crillon nicht schmeckt«, sagte er. »In seinem Privatjet bringt er sich immer seinen Koch mit. Der Koch des Crillon hat eine Boxernase. Seine Künste waren gut genug für Richard Nixon und Henry Kissinger, sagt er, und für eine ganze Horde von Schahs, Königen, Generälen und Premierministern. Aber dieser kleine Glamour-Affe mag es nicht. Gibt es nicht in der Bibel eine Stelle über verkrüppelte Könige, die unter dem Tisch des Mannes leben müssen, der sie bezwungen hat – und von dem leben, was vom Tisch herabfällt?«
»Ich glaube schon. Ich erinnere mich, dass man ihnen die Daumen abgeschnitten hat. Aber was hat das mit dem Crillon oder Michael Jackson zu tun?«
Abe lachte und sagte, er wisse es nicht genau. Es sei ihm nur so durch den Kopf geschossen. Hier oben vermischte sich der Diskant der Fans, der Pubertanten von Paris – Jungen und Mädchen, die im Chor schrien – mit dem Lärm der Busse, Lastwagen und Taxis.
Diese historische Show bildete unseren Hintergrund. Wir ließen uns den Kaffee schmecken. Ravelstein war bestens gelaunt. Dennoch unterhielten wir uns nur gedämpft, weil Nikki, Abes Gefährte, noch schlief. Zu Hause in den USA hatte sich Nikki daran gewöhnt, bis vier Uhr morgens Kung-Fu-Filme aus seiner Heimat Singapur anzuschauen. Auch hier blieb er die halbe Nacht auf. Der Kellner hatte die Schiebetür zugezogen, damit Nikkis kostbarer Schlaf nicht gestört werde. Gelegentlich sah ich durch das Fenster auf seine rundlichen Arme und das lange schwarze Haar, das ihm in Wellen auf die glänzenden Schultern fiel. Der hübsche Nikki war mit Anfang dreißig noch immer knabenhaft.
Der Kellner war eingetreten und brachte Walderdbeeren, brioches, Marmeladetöpfchen und jene Kännchen und Schälchen, die ich schon lange als Hotelsilber kannte. Während er ein Brötchen zum Mund führte, kritzelte Ravelstein mit großer Geste seinen Namen auf die Rechnung. Ich konnte schöner essen. Bei Ravelsteins Versuch, gleichzeitig zu essen und zu reden, hatte man das Gefühl, einem biologischen Vorgang beizuwohnen: Er heizte sein System an und fütterte seine Ideen.
An diesem Vormittag drängte er mich wieder, in die Öffentlichkeit zu gehen, das zurückgezogene Leben aufzugeben und, wie er sich ausdrückte, »am öffentlichen Leben, an der Politik« teilzunehmen. Er wollte, dass ich es mit einer Biografie versuchte, und ich war einverstanden gewesen. Auf seinen Wunsch hatte ich eine Zusammenfassung von John Maynard Keynes’ Darstellung der Argumente für deutsche Reparationszahlungen und die Aufhebung der alliierten Blockade von 1919 verfasst. Ravelstein gefiel meine Arbeit, er war aber noch nicht ganz zufrieden. Seiner Meinung nach hatte ich ein rhetorisches Problem. Ich sagte, dass die Überbetonung der einzelnen Fakten ein größeres Interesse an dem Projekt verhindere.
Ich kann es ja ruhig zugeben: In der Highschool hatte ich einen Englischlehrer namens Morford (wir nannten ihn den »verrückten Morford«), der uns Macaulays Aufsatz über Boswells Leben Samuel Johnsons lesen ließ. Ich weiß nicht mehr, ob das Morfords eigene Idee oder im Lehrplan vorgesehen war. Macaulays Aufsatz, im 19. Jahrhundert für die Encyclopedia Britannica geschrieben, erschien in Amerika bei der Riverside Press als Schulbuch. Ich las ihn mit heißen Ohren. Macaulay begeisterte mich mit seiner Version dieser Biografie, mit der »Gewundenheit« von Johnsons Kopf. Seither habe ich manche nüchterne Kritik an Macaulays viktorianischen Exzessen gelesen. Dennoch war ich nicht zu heilen – von meiner Schwäche für Macaulay wollte ich nicht geheilt werden. Dank seiner Schilderung sehe ich den armen zuckenden Johnson, wie er gegen jeden Laternenpfahl stößt, verdorbenes Fleisch isst und ranzigen Pudding.
Die Form der zu schreibenden Biografie wurde zum Problem. Johnson hatte selber ein Beispiel mit der Biografie seines Freundes Richard Savage geliefert. Dann natürlich Plutarch. Als ich Plutarch einem Gräzisten gegenüber erwähnte, tat er ihn als »simplen Literaten« ab. Hätte es aber ohne Plutarch Antonius und Cleopatra gegeben?
Dann erwog ich John Aubreys Brief Lives.
Aber ich will Ihnen die Liste ersparen.
Ich hatte versucht, Ravelstein Mr Morford zu beschreiben: Der verrückte Morford war vor der Klasse nie regelrecht betrunken, aber offensichtlich ein Säufer – er hatte diese rote Trinkernase. Jeden Tag trug er den gleichen Schlussverkaufsanzug. Er wollte einen nicht näher kennen, ebenso wenig wollte er, dass man ihn kennenlernte. Sein düsterer, abstrakter Alkoholikerblick war nie auf jemanden gerichtet. Die Augen unter seinen wirren Brauen starrten nur auf die Wände, durch die Fenster, in das Buch, das er las. Die beiden Bücher, die wir in jenem Semester bei ihm lasen, waren Macaulays Johnson und Shakespeares Hamlet. Trotz seiner Skrofulose, seines verlotterten Zustands, trotz seiner Wassersucht konnte Johnson Freundschaften pflegen und seine Bücher schreiben, und Morford seinerseits hielt den Stundenplan ein und hörte zu, wenn wir die Verse rezitierten: »Wie ekel, schal, flach und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt!« Sein harter, kurz geschorener Schädel, sein gerötetes Gesicht, die Hand, die er hinter dem Rücken verkrampfte. Im Ganzen flach und unersprießlich.
Ravelstein interessierte sich nicht besonders für meine Schilderung. Warum sollte er den Morford kennenlernen, an den ich mich erinnerte? Doch Abe hatte Recht, als er mich auf Keynes’ Aufsatz hinwies. Keynes, der einflussreiche Wirtschaftstheoretiker und Staatsmann, den jeder als Autor der Wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages kennt, schickte seinen Freunden in Bloomsbury Briefe und Memoranden, in denen er von seinen Erlebnissen nach Kriegsende berichtete, vor allem über die Reparationsverhandlungen zwischen den besiegten Deutschen und den Staatsführern der Alliierten – Clemenceau, Lloyd George und die Amerikaner. Ravelstein, der sonst mit Lob geizte, versicherte mir, dass meine Wiedergabe der keynesschen Notizen für seine Freunde in jeder Hinsicht erstklassig sei. Für Ravelstein war Hayek als Wirtschaftswissenschaftler bedeutender als Keynes. Keynes hatte seiner Meinung nach die Härte der Alliierten übertrieben und den deutschen Generälen und letztlich den Nazis in die Hände gearbeitet. Der Versailler Vertrag war längst nicht die Bestrafung, die er hätte sein sollen. Hitlers Kriegsziele von 1939 unterschieden sich nicht von denen des Kaisers im Jahr 1914. Doch von diesem gravierenden Fehler einmal abgesehen, verfügte Keynes über viele persönliche Vorzüge. Er hatte Eton und Cambridge absolviert und war von der Bloomsbury-Gruppe gesellschaftlich und kulturell auf Hochglanz gebracht worden. Die großen politischen Ereignisse seiner Zeit förderten seine Entwicklung und vervollkommneten ihn. In seinem Privatleben verstand er sich vermutlich als Uranier – ein britischer Euphemismus für Homosexualität. Ravelstein erwähnte, dass Keynes eine russische Ballerina geheiratet hatte. Er erläuterte mir, dass Uranus Aphrodites Vater war, ohne dass es einer Mutter bedurft hätte. Aphrodite entstand aus dem Schaum des Meeres. Er erzählte mir dergleichen nicht, weil er mich für ungebildet hielt, sondern weil er beschlossen hatte, dass ich in einem bestimmten Augenblick meine Gedanken in diese Richtung lenken sollte. Also erinnerte er mich daran, dass der Titan Kronos Uranos tötete und dessen Samen sich ins Meer ergoss. Und das hatte irgendwas mit den Reparationen zu tun oder mit der Tatsache, dass die immer noch unter der Blockade lebenden Deutschen damals Hunger litten.
Ravelstein, der seine Gründe haben musste, wenn er mich auf Keynes’ Aufsatz hinwies, erinnerte sich am besten an die Passagen, in denen beschrieben wurde, wie wenig die deutschen Bankiers in der Lage waren, die Forderungen Frankreichs und Englands zu erfüllen. Die Franzosen hatten es auf die Goldreserven des Kaisers abgesehen und verlangten, dass das Gold auf der Stelle ausgehändigt werde. Die Engländer wollten sich mit Währungsreserven zufriedengeben. Einer der deutschen Unterhändler war Jude. Lloyd George verlor die Beherrschung und ging diesen Mann direkt an: Er lieferte ihm eine erstaunliche Judennummer, krümmte sich, buckelte, humpelte, spuckte, lispelte, drückte den Hintern raus und parodierte den spreizfüßigen jüdischen Gang. Keynes berichtete seinen Freunden in Bloomsbury davon in allen Einzelheiten. Ravelstein hielt nicht viel von den Bloomsbury-Intellektuellen. Er missbilligte ihr tuntenhaftes Auftreten, das schwule Mätzchenmachen, das ganze (seine Worte) »warme Getue«. An ihrer Leidenschaft für Klatsch wollte und konnte er nichts aussetzen, dafür liebte er selber Klatsch zu sehr. Aber für ihn waren sie keine Denker, sondern Snobs, und ihr Einfluss wirkte verheerend. Alle Spione, die die GPU oder der NKWD später in England rekrutierte, kamen aus dem Bloomsbury-Umfeld.
»Aber das ist dir glänzend gelungen, Chick, das mit Lloyd Georges ekelhafter youpin-Parodie.«
Youpin ist das französische Schimpfwort für einen Juden.
»Danke schön«, sagte ich.
»Ich würde nicht das Geringste daran ändern wollen«, sagte Ravelstein. »Aber du merkst schon, dass ich dir etwas Gutes tun will.«
Natürlich verstand ich seine Motive. Er wollte, dass ich seine Biografie schrieb, und mich gleichzeitig von meinen schlechten Gewohnheiten befreien. Seiner Meinung nach hatte ich mich im Privatleben verbunkert und sollte der Gemeinschaft wiedergewonnen werden. »Zu viele Jahre Innerlichkeit!«, pflegte er zu sagen. Ich bräuchte dringend die Nähe zur Politik – nicht Lokal- oder Parteipolitik, auch nicht Bundespolitik, sondern Politik im Geiste von Aristoteles und Plato, wie sie in unserer Natur verwurzelt sei. Man kann sich nicht von seiner Natur abkehren. Ich musste Ravelstein zugeben, dass die Lektüre dieser Keynes-Texte und das Abfassen der Schrift darüber für mich wie ein Urlaub gewesen war. Ich hatte zur Menschheit zurückgefunden, ein Bad in der Menschlichkeit genommen. Es gibt Zeiten, da muss ich während der Stoßzeit U-Bahn fahren oder in einem überfüllten Kino sitzen – das meine ich mit einem Bad in Menschlichkeit. So wie Kühe Salz lecken müssen, sehne ich mich manchmal nach körperlichem Kontakt.
»Ich habe ein paar Ideen zu Keynes und der Weltbank, seinem Abkommen von Bretton Woods und zu seinem Angriff auf den Versailler Vertrag. Über Keynes weiß ich gerade so viel, dass ich seinen Namen in ein Kreuzworträtsel einfügen kann«, sagte ich. »Ich bin froh, dass du mich auf seine privaten Aufzeichnungen hingewiesen hast. Seine Freunde konnten seine neuen Eindrücke von der Friedenskonferenz wahrscheinlich kaum erwarten. Er ermöglichte ihnen einen Platz in der ersten Reihe der Weltgeschichte. Und ich vermute, dass Lytton Strachey und Virginia Woolf richtig süchtig waren nach diesen Insider-Informationen. Sie vertraten die edleren Interessen der britischen Gesellschaft. Es war ihre Pflicht, das zu erfahren – die Pflicht des Künstlers.«
»Und wie stand es mit dem jüdischen Anteil bei der ganzen Sache?«, fragte Ravelstein.
»Der gefiel Keynes nicht sonderlich. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass er auf der Friedenskonferenz nur mit einem einzigen Mann Freundschaft geschlossen hat, mit einem jüdischen Mitglied der deutschen Delegation.«
»Nein, ein so gewöhnlicher Mann wie George Lloyd vermochte diese Bloomsburys natürlich nicht zu interessieren.«
Doch Ravelstein wusste die Vorteile eines linken Bundes zu schätzen. Er hatte seinen eigenen. Dazu gehörten Studenten, die er in Politischer Philosophie unterrichtet hatte, sowie alte Freunde. Die meisten von ihnen kamen, wie Ravelstein, aus der Schule von Professor Davarr und bedienten sich seines esoterischen Vokabulars. Einige der älteren Studenten Ravelsteins bekleideten wichtige Positionen in landesweit verbreiteten Zeitungen. Nicht wenige arbeiteten im Außenministerium. Einige unterrichteten am War College oder arbeiteten für den Nationalen Sicherheitsberater. Einer war ein Protégé von Paul Nitze. Ein anderer, ein Einzelgänger, hatte eine Kolumne in der Washington Times. Manche waren einflussreich, alle bestens informiert. Sie bildeten eine eng zusammenhängende Gruppe, eine Gemeinschaft. Ravelstein erhielt regelmäßige Berichte von ihnen, und wenn er zu Hause war, verbrachte er Stunden mit seinen Schülern am Telefon. Was sie ihm anvertrauten, behielt er mehr oder weniger für sich. Zumindest nannte er seine Quelle nicht. Selbst heute im Penthouse des Crillon hielt er das Handy zwischen den nackten Knien. Der japanische Kimono entblößte seine Beine, die bleicher waren als Milch. Ravelstein hatte die Unterschenkel eines Menschen, der im Sitzen arbeitet – langes Schienbein und wenig Wade, nicht gerundet. Vor einigen Jahren, nach seinem Herzanfall, hatten ihm die Ärzte Sport empfohlen. Also kaufte er sich ein teures Sweatshirt und elegante Turnschuhe. Ein paar Tage lang trabte er über die Aschenbahn, dann gab er auf. Fitness war nichts für ihn. Er sah seinen Körper als Fahrzeug – ein Motorrad, das er am Rande des Grand Canyon aufheulen ließ.
»Lloyd George überrascht mich nicht übermäßig«, sagte Ravelstein. »Er war ein streitsüchtiges kleines Arschloch. In den Dreißigern suchte er Hitler auf und hatte fortan eine hohe Meinung von ihm. Für politische Führer war Hitler der Traum. Alles, was er haben wollte, geschah, und zwar sofort. Kein Durcheinander, kein Getue. Ganz anders als in der parlamentarischen Demokratie.« Ravelstein über die von ihm so genannte »Große Politik« reden zu hören, machte Spaß. Oft spekulierte er über Roosevelt und Churchill. Vor de Gaulle hatte er großen Respekt. Gelegentlich ging es mit ihm durch. Heute zum Beispiel sprach er von Lloyd Georges »Bitterkeit«.
»Bitterkeit ist gut«, wandte ich ein.
»Bei der Sprache waren uns die Briten überlegen. Vor allem als ihre Stärke ausblutete und Sprache eine ihrer wichtigen Ressourcen wurde.«
»So wie Hamlets Hure sich Luft machen muss in Worten.«
Mit seinem kahlen, machtvollen Kopf pflog Ravelstein entspannten Umgang mit großen Worten, wichtigen Themen und berühmten Männern, mit Jahrzehnten, Jahrhunderten, ganzen Zeitaltern. Und mit Entertainern wie Mel Brooks war er ebenso vertraut wie mit den Autoren der Antike, weshalb es ihm mühelos gelang, den Bogen von Thukydides’ riesenhafter Tragödie zu dem von Brooks gespielten Moses zu schlagen. »Er kommt mit den Geboten vom Berg Sinai herunter. Gott hat ihm zwanzig gegeben, aber Mel Brooks entgleiten zehn, als er sieht, dass die Kinder Israels Veitstänze um das Goldene Kalb aufführen.« Ravelstein mochte diesen Catskill-Humor, und er besaß selber eine natürliche Begabung dafür.
Meine Keynes-Skizze gefiel ihm außerordentlich. Er erinnerte sich, dass Churchill Keynes einen Mann mit hellseherischer Intelligenz genannt hatte – Abe liebte Churchill. Als Wirtschaftswissenschaftler übertraf Milton Friedman die meisten, aber Friedman war ein fanatischer Anhänger des freien Marktes und konnte mit Kultur nichts anfangen, während Keynes über eine kultivierte Intelligenz verfügte. Allerdings schätzte er den Versailler Vertrag falsch ein und zeigte Schwächen in der Politik, ein Thema, bei dem Ravelstein seine eigenen Vorstellungen hatte.
Abes »Leute« in Washington okkupierten sein Telefon so gründlich, dass ich die Vermutung äußerte, er beaufsichtige dort eine Schattenregierung. Er nahm das hin und lächelte, als wäre mein Verdacht seltsam und nicht etwa sein Verhalten. Er sagte: »Alle Studenten, die ich in den vergangenen dreißig Jahren ausgebildet habe, wenden sich noch immer an mich. Das Telefon ermöglicht gewissermaßen ein ständiges Seminar, in dem die politischen Fragen, mit denen sie es Tag für Tag in Washington zu tun haben, mit dem Plato abgeglichen werden, den sie vor zwei, drei Jahrzehnten studiert haben. Oder mit Locke, Rousseau oder sogar mit Nietzsche.«
Wer Ravelsteins Anerkennung erlangt hatte, durfte stolz drauf sein. Seine Studenten wandten sich immer wieder an ihn – Männer, die inzwischen die vierzig überschritten und von denen einige eine wichtige Rolle im Golfkrieg gespielt hatten, berieten sich stundenweise mit ihm. »Diese besonderen Beziehungen sind mir sehr wichtig – oberste Priorität.« Warum sollte Ravelstein, der wissen wollte, was in der Downing Street vor sich ging oder im Kreml, nicht ebenso Bescheid wissen wie seinerzeit Virginia Woolf, die Keynes’ persönlichen Bericht über die deutschen Reparationen zu lesen bekam? Gut möglich, dass Ravelsteins Ansichten und Meinungen in politische Entscheidungen einflossen, aber darauf kam es nicht an. Ihm kam es darauf an, dass er weiter für die fortlaufende politische Erziehung seiner ehemaligen Schüler zuständig sein konnte. Auch in Paris hatte er seine Jünger. Männer, die seine Seminare an der École des hautes Études besucht hatten und vielleicht gerade von einer Reise nach Moskau zurückkamen, meldeten sich ebenfalls am Telefon.
Es gab sexuelle Beziehungen und intime Vertrauensverhältnisse. Zu Hause hatte er neben dem großen schwarzen Ledersofa ein elektronisches Armaturenbrett, das er virtuos zu bedienen wusste. Ich hätte nicht damit umgehen können. Ich verstehe nichts von Technik. Ravelstein aber mit seinen zitternden Händen kontrollierte seine Instrumente wie ein Prospero.
Jedenfalls brauchte er sich jetzt keine Sorgen mehr wegen der Telefonrechnung zu machen.
Aber wir befinden uns immer noch oben im Hôtel Crillon.
»Deine Instinkte sind gut, Chick«, sagte er. »Schade, dass du so gar kein Talent zum Nihilismus hast. Céline mit seiner nihilistischen Komödie oder Farce würde dir viel besser stehen. Die betrogene Frau, die zu ihrem Freund Robinson sagt: ›Warum sagst du nie, ich liebe dich? Was soll so besonders sein an dir? Bei dir wird er steif wie bei jedem anderen auch. Quoi! Tu ne bandes pas?‹ Ein steifer Schwanz ist für sie das Gleiche wie Liebe. Doch der Nihilist Robinson hat nur bei einem seine Prinzipien, er will bei den wenigen Dingen, auf die es wirklich ankommt, nicht lügen. Er ist zu jeder Obszönität bereit, aber irgendwann ist Schluss. Die tödlich beleidigte Hure erschießt ihn schließlich, weil er nicht sagen will: ›Ich liebe dich!‹«
»Will Céline damit sagen, das mache ihn authentisch?«
»Es bedeutet, dass Schriftsteller uns zum Lachen und zum Weinen bringen sollen. Das will die Menschheit haben. Die Szene mit Robinson ist eine Reprise des mittelalterlichen Dramas, wo die verworfensten Verbrecher zur Heiligen Jungfrau Maria zurückfinden. Aber damit wir uns nicht missverstehen: Ich möchte, dass du über mich wie über Keynes schreibst, nur breiter angelegt. Außerdem bist du zu freundlich mit ihm umgegangen. Das möchte ich nicht. Sei so streng zu mir, wie du willst. Du bist doch nicht das Schätzchen, nach dem du aussiehst, und vielleicht gelingt dir ja mit meiner Biografie der Befreiungsschlag.«
»Von was soll ich mich eigentlich freimachen?«
»Von dem, was dich beherrscht – über dir hängt irgendein Damoklesschwert."
»Nein«, sagte ich. »Es heißt Dummoklesschwert.«
Hätte unser Gespräch in einem Restaurant stattgefunden, die anderen Gäste hätten gedacht, wir erzählten uns Pikanterien und würden uns königlich dabei amüsieren. »Dummoklesschwert« war ein Witz nach Ravelsteins Tasse, und er lachte wie das verwundete, sich aufbäumende Pferd auf Picassos Guernica.
Ravelsteins Vermächtnis für mich war ein Thema – er wollte mir ein Thema geben, das beste womöglich, das ich je hatte, vielleicht sogar das einzige von Bedeutung. Dieses Vermächtnis war jedoch nur um den Preis zu haben, dass er vor mir starb. Sollte ich ihm im Tod vorangehen, würde er natürlich kein Erinnerungsbuch über mich schreiben. Alles, was über eine Seite hinausging, die bei einem Gedenkgottesdienst vorgetragen würde, wäre undenkbar gewesen. Dabei waren wir engste Freunde; es gab keine besseren. Wir lachten über den Tod, und der Tod schärft natürlich den Sinn für das Komische. Aber auch wenn wir zusammen lachten, hieß das nicht, dass wir aus dem gleichen Grund lachten. Natürlich war es komisch, dass ausgerechnet seine in Buchform gebrachten ernsthaften Anliegen Ravelstein zum Millionär gemacht hatten. Nur der allzeit findige Kapitalismus war in der Lage, Gedanken, Ansichten und Lehren in eine verkäufliche Ware zu verwandeln. Denn man darf nicht vergessen, dass Ravelstein vor allem Lehrer war. Er gehörte keineswegs zu jenen Konservativen, die den freien Markt vergöttern. In der Politik und bei Angelegenheiten der Moral behielt er sich seine eigene Meinung vor. Doch geht es mir nicht darum, hier seine Gedanken vorzutragen, ich möchte ihnen vielmehr im Moment lieber aus dem Weg gehen. Um es ganz kurz zu machen: Er war ein Erzieher. Fasste seine Gedanken in einem Buch zusammen, das ihn aberwitzig reich machte. Gab die Dollars beinah ebenso schnell wieder aus, wie sie hereinkamen. Eben lag ihm wieder ein neuer Buchvertrag über fünf Millionen Dollar vor. Auch bei den üblichen Vortragsreisen konnte er Spitzenhonorare fordern. Und schließlich war er ein gebildeter Mann. Niemand bestritt das. Man muss schon gebildet sein, wenn man die ganze Komplexität der Moderne erfassen und ihre menschlichen Kosten beziffern will. Bei Partys wirkte er vielleicht manchmal etwas seltsam, doch wenn er auf einem Podest stand, merkte man, wie gut seine Argumente begründet waren. Dann wurde überdeutlich, worüber er sprach. Die Öffentlichkeit betrachtete die weiterführende Ausbildung als Grundrecht. Das Weiße Haus bestätigte es. Studenten gab es wie Sand am Meer. Die durchschnittliche Studiengebühr betrug dreißigtausend Dollar pro Jahr. Was aber lernten die Studenten? Die Universitäten waren freizügig und lax. Der Puritanismus früherer Jahre war verschwunden. Alles wurde relativiert, und was in Santo Domingo richtig war, war in Pango-Pango falsch. Moralische Maßstäbe hatten ihre Verbindlichkeit verloren.
Ravelstein war aber keineswegs lustfeindlich oder ein Gegner der Liebe. Im Gegenteil sah er in der Liebe den womöglich größten Segen der Menschheit. Ohne Sehnsucht war die menschliche Seele deformiert, ihres höchsten Gutes beraubt, zum Tode erkrankt. Man bot uns ein biologisches Modell an, das die Seele abschrieb und stattdessen betonte, wie wichtig ein orgiastischer Spannungsabbau sei (Biostatik und Biodynamik). Ich habe nicht vor, hier auf die erotischen Lehren von Aristophanes und Sokrates oder die der Bibel einzugehen. Da müssen Sie schon Ravelstein im Original lesen. Für ihn waren Jerusalem und Athen die Zwillingsquelle der Zivilisation. Jerusalem und Athen sind nichts für mich. Aber bitte sehr – ich selber war zu alt, um Ravelsteins Schüler zu werden. Hier muss ich nur erwähnen, dass er sogar im Weißen Haus und in Downing Street sehr ernst genommen wurde. Mrs Thatcher lud ihn nach Chequers ein. Auch der Präsident vernachlässigte ihn nicht. Reagan bat ihn zum Essen, und Ravelstein gab ein Vermögen für Frack, Kummerbund, diamantene Kragenknöpfe und Lackschuhe aus. Ein Kolumnist der Daily News schrieb über Ravelstein, dass Geld für ihn etwas sei, das man von der hinteren Plattform eines anfahrenden Zuges aus wegwarf. Ravelstein brüllte vor Lachen, als er mir den Artikel zeigte. Das ganze Gewese machte ihm ungeheuren Spaß. Mir selber fehlten natürlich seine Voraussetzungen für diesen Spaß. Die gewaltigen hydraulischen Kräfte des Landes hatten ihn erfasst, nicht mich.
Zwar war ich eine Reihe von Jahren älter als Ravelstein, aber wir waren eng befreundet. Beide waren wir studentischen Scherzen nicht abgeneigt, und das ebnete die Unterschiede zwischen uns ein. Jemand, der mich gut kannte, sagte einmal, dass ich unschuldiger sei, als das einem Erwachsenen zustünde. Als wäre ich aus eigenem Entschluss naiv gewesen! Nebenbei gesagt, verstehen es auch extrem naive Menschen, ihre Interessen zu wahren. Selbst sehr schlichte Frauen wissen, wann es Zeit ist, bei einem schwierigen Ehemann Schluss zu machen – oder wann sie das Geld vom gemeinsamen Bankkonto holen müssen. Ich machte mir keine großen Gedanken um meine Selbsterhaltung. Doch glücklicherweise – oder vielleicht auch nicht – lebten wir im Zeitalter des Füllhorns, in der die zivilisierten Völker den Überfluss erleben dürfen. Materiell gesehen war es nie einfacher, eine große Bevölkerung vor Hunger und Krankheit zu bewahren. Und diese teilweise Entbindung vom Überlebenskampf macht die Menschen naiv. Damit will ich sagen, dass sich niemand um ihre Wunschvorstellungen kümmert. Nach einer ungeschriebenen Vereinbarung beginnt man die Bedingungen zu akzeptieren, mit denen die anderen auftreten, auch wenn sie sich unweigerlich als falsch herausstellen. Man hat die eigenen kritischen Fähigkeiten abgetötet. Man erstickt seine eigene Klugheit. Ehe man sich versieht, muss man nach der Scheidung eine astronomische Summe an eine Frau zahlen, die mehr als einmal erklärt hat, dass sie in Gelddingen so was von unbeleckt sei.
Um einen Mann wie Ravelstein zu beschreiben, empfiehlt sich wahrscheinlich die musivische Methode.
An diesem Junimorgen in Paris war ich nicht so sehr wegen des biografischen Aufsatzes in seine Luxussuite im Penthouse gekommen, sondern weil ich mir von ihm Angaben über seine Eltern und seine Jugend erhoffte. Ich brauchte nicht mehr Einzelheiten, als ich verwenden konnte, und war mittlerweile in groben Zügen mit seiner Lebensgeschichte vertraut. Die Ravelsteins stammten aus Dayton in Ohio. Seine Mutter, ein regelrechtes Kraftwerk, hatte die Johns Hopkins University absolviert. Seinem Vater blieb der Erfolg versagt. Er vertrat eine große landesweite Organisation und war nach Dayton verbannt. Ein dicker, neurotischer, klein gewachsener Mann, als Vater aber hysterisch und auf Disziplin versessen. Wenn der kleine Abe bestraft wurde, musste er sich nackt ausziehen und wurde dann mit den Hosenträgern seines Vaters verprügelt. Abe bewunderte seine Mutter, hasste seinen Vater und verachtete seine Schwester. Doch Keynes, um noch mal einen Blick auf ihn zu werfen, hatte über Clemenceaus Familiengeschichte wenig zu sagen. Clemenceau war ein erfahrener Zyniker; er verachtete die Deutschen und misstraute ihnen; am Verhandlungstisch trug er graue Glacéhandschuhe. Aber wir wollen die Handschuhe übergehen – das hier soll ja keine Psycho-Biografie werden.
An diesem Vormittag hatte Ravelstein allerdings keine Lust, sich nach seiner Jugend befragen zu lassen.
Die Place de la Concorde verlor allmählich ihre morgendliche Frische. Der Verkehr unten hatte nachgelassen, dafür verstärkte sich die Junihitze und stieg noch an. In der Sonne verlangsamte sich unser Puls. Nach der ersten Gefühlsaufwallung meldete sich das Herz wieder in diesem Leben, das durch einen unvollständigen Sieg über viele Absurditäten endlich gerechtfertigt war und zu dem auch gehörte, dass Abe Ravelstein, ein Akademiker, ein miserabler Professor für Politische Philosophie, seinen Platz ganz oben in Paris fand, unter Geschäftsführern im Crillon oder den Vorstandsvorsitzenden im Ritz oder den Playboys im Hôtel Meurice. In der Sonne geriet unsere Unterhaltung ins Stocken, und er schlummerte mit seinen hemisphärisch hochgezogenen Augenbrauen eine Weile ein. Seine Lippen, die gespitzt waren, um noch mehr zu sagen, sagten erst einmal nichts. Man ertappte sich dabei, auf seinem kahlen Schädel nach Fingerabdrücken dessen zu suchen, der ihn geformt hatte. Er selber war einen Augenblick woanders; er hatte diese Aussetzer von Zeit zu Zeit. Obwohl er die Augen offen hielt, sah er einen möglicherweise gar nicht. Da er kaum eine Nacht durchschlief, war es für ihn nicht weiter ungewöhnlich, dass er vor allem bei warmem Wetter kurz wegsackte, döste, entschwebte; zwei lange Arme hingen über die Lehnen seines Stuhls; dazu die seltsame Form seiner ungleichmäßigen Füße. Einer war drei Nummern größer als der andere. Schuld an seiner Verfassung war nicht bloß die gestörte Nachtruhe, es war die Aufregung, das Ausquetschen, die Anspannung durch seine Freuden, sein intellektuelles Leben.
Die Erschöpfung, in die er an diesem Vormittag sank, verdankte sich vermutlich dem großen Essen, das er uns am Abend zuvor gegeben hatte, eine außergewöhnliche Party an der Place de la Madeleine chez Lucas Carton. Wenn man sämtliche Gänge aß, war man unweigerlich erledigt. Als Hauptgericht gab es Huhn in Honig und in Lehm ausgebacken. Das altgriechische Rezept hatten Archäologen vor Kurzem in einer ägäischen Grabungsstätte gefunden. Wir aßen dieses köstliche Gericht in der Gegenwart von nicht weniger als vier Kellnern. Der sommelier mit dem Abzeichen seines Amtes an der Schlüsselkette sorgte dafür, dass die Gläser regelmäßig nachgefüllt wurden. Zu jedem Gang wurde der passende Wein gereicht, während die Kellner, Akrobaten vergleichbar, das Porzellan und das Silberbesteck wechselten. Ravelstein erglühte in wildem Glück, lachte und stotterte wie immer, wenn er betrunken war, und begann jeden Teil seiner langen Sätze mit »Da-a, da-ha, da-has ist die beste europäische Küche – di-, dihi-, dieser Chick hängt den Skeptiker raus, wenn es um die Franzosen geht. Er, de-her denkt, dass ihre Küche alles ist, was sie mit einigem Stolz vorweisen können nach der Erniedrigung von da-ha, da-ha damals 1940, als Hitler dieses Siegestänzchen vollführte. Chick erkennt la France pourrie in Sartre, im Beschimpfen der USA da-ha und in der Verehrung für den Stalinismus, in ihrer Philosophie und Linguistik. Da-ha, di-hiese Hermeneutiker – er nennt sie Harmoneutiker, sind winzige Sandwiches, die Musiker während der Pause essen. Aber du musst zugeben, dass du nirgendwo sonst ein solches Essen kriegst. Schau nur, wie Rosamund strahlt! Endlich eine Frau, die exquisites Essen und da-ha, die-hie Zubereitung durch den Koch zu schätzen weiß. Nikki auch, er weiß, was Kochkunst ist – das wirst du nicht bestreiten, Chick.«
Nein, würde ich nicht. Nikki besuchte eine Schweizer Hotelfachschule. Mehr kann ich nicht dazu sagen, weil ich nicht Experte genug bin, um die exakten Details wiederzugeben. Nikki war in jedem Fall ein ausgebildeter maître de. Er bekam regelmäßig einen Lachkrampf, wenn er den Cutaway seiner Branche für Ravelstein und mich vorführte und sich mit seinen berufsmäßigen Insignien schmückte.
Das Essen am Abend zuvor hatte zu meinen Ehren stattgefunden. Damit wollte Ravelstein seinem Freund Chick für die Unterstützung danken, die dieser ihm bei der Arbeit an seinem Bestseller gewährt hatte. Das ganze Buch sei ursprünglich meine Idee gewesen, sagte er. Es wäre niemals geschrieben worden, hätte ich ihn nicht dazu gedrängt. Abe gab das auf eine elegante Art immer zu – »Chick hat mich darauf gebracht«.
Es gibt eine Parallele zwischen dem Niedergang der Innenstädte und der geistigen Auflösung der USA, der Siegermacht des Kalten Kriegs, der einzigen verbliebenen Supermacht. Und es gibt eine Möglichkeit, beides zu entschärfen. Davon handelten Ravelsteins Bücher und Artikel. Er führte seine Leser von der Antike bis zur Aufklärung und dann – über Locke, Montesquieu und Rousseau weiter zu Nietzsche und Heidegger – zur Gegenwart, ins Hightech-Amerika der großen Konzerne, seiner Kultur und seiner Vergnügungsindustrie, seiner Presse, seinem Erziehungssystem, seinen Denkfabriken, seiner Politik. Er vermittelte das Bild der Massendemokratie und das dafür charakteristische – beklagenswerte – menschliche Ergebnis. In seinem Seminarraum (und die Vorlesungen waren immer überfüllt) hustete, stotterte, rauchte, brüllte, lachte er und elektrisierte seine Studenten, debattierte mit ihnen, reizte sie zum Kampf Mann gegen Mann, prüfte sie, hämmerte auf sie ein. Er fragte nicht: »Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?« wie diese religiösen Endzeitpropheten, sondern er fragte: »Was hast du deiner Seele in dieser modernen Demokratie zu bieten?«
Dieser hochgewachsene Knabe in Nadelstreifen mit seinem kahlen Kopf (immer fürchtete man sich dabei vor etwas gefährlich Bleichem, vor bleicher Gewalt, den Einkerbungen) stieg nicht vorn auf das Podest, um die Zuhörer mit der korrekten Abfolge der Epochen (Zeitalter des Glaubens; Zeitalter der Vernunft; Klassik und Romantik) tödlich zu langweilen. Er trat auch nicht als Akademiker auf oder als angestellter Universitätsrebell, der zu revolutionärem Verhalten ermutigte. Die Streiks und Campus-Besetzungen der Sechziger hatten das Land erheblich zurückgeworfen, sagte er. Er buhlte nicht um die Studenten, indem er Herrenrunden organisierte oder schockierte – sie unterhielt, wie das schauspielernde Dozenten tun – oder indem er ständig »shit!« oder »fuck!« rief. Er hatte so gar nichts vom wilden Campus-Mann an sich. Seine Schwächen waren unverkennbar. Er war geradezu besessen von dem Bewusstsein, wegen seiner Fehler oder Irrtümer unterzugehen. Doch bevor er unterging, schilderte er einem noch Platos Höhle. Er erzählte von der Seele, von der mageren und schnell schwindenden Seele, die noch schneller schwand.
Er zog begabte Studenten an. Seine Seminare waren immer überfüllt. Und bald kam ich auf den Gedanken, dass er das, was er viva voce aufführte, nur zu Papier zu bringen brauchte. Nichts wäre leichter für Ravelstein, als ein erfolgreiches Buch zu schreiben.
Um ganz offen zu sein, hatte ich es auch satt, immer von seinem unzureichenden Gehalt zu hören, seinem byzantinischen Borgverhalten und den Geschäften und Machenschaften, mit denen er seine Schätze verpfändete – seine Jensen-Teekanne oder seine alten Quimper-Teller. Nachdem ich mir eher gereizt als interessiert die Geschichte dieser schönen Jensen-Teekanne angehört hatte, die sich als Sicherheit für ein Darlehen von fünftausend Dollar fünf Jahre in der Hand von Cecil Moers, einem seiner Doktoranden, befunden hatte (und von diesem schließlich für zehntausend Dollar an einen Händler verkauft worden war), sagte ich zu Ravelstein: »Wie lang soll ich mir eigentlich deiner Meinung nach diese langweilige Geschichte von dieser langweiligen Teekanne und all deinen anderen langweiligen Luxusartikeln noch anhören? Abe, wenn du über deine Verhältnisse lebst, wenn du ein am Hungertuch nagender Aristokrat bist, der ein Opfer seines Verlangens nach schönen Dingen ist, warum verbesserst du dann diese Verhältnisse nicht?«
Als Antwort – ich erinnere mich genau – führte Ravelstein seine Hände an die Ohren. Diese Hände waren sorgfältig manikürt, die Ohren abstoßend. »Wie denn – soll ich nachts für einen Begleitservice arbeiten?«
»Der größte Tänzer bist du leider nicht. Aber du könntest dich als Konversationspartner für Abendessen verdingen. Tausend Dollar pro Abend vielleicht … Nein, bei dir schwebt mir ein Buch vor: Du könntest aus deinen Vorlesungsskripten ein allgemein verständliches Buch machen.«
»Klar«, sagte er, »wie Fieldings armer Pastor Adams, der nach London geht und seine Predigten drucken lässt. Der Pastor brauchte Geld, und außer seinen Predigten hatte er nichts zu verkaufen. Er hatte sie niedergeschrieben. Aber ich habe nicht einmal Notizen. Der Rat, den du mir gibst, Chick, ist der Rat eines Autors ohne Publikationsprobleme. Du erinnerst mich an Dwight Macdonald. Er sagte, als Venetsky, einer seiner Freunde, völlig pleite war – und in seiner Geldnot nicht mehr ein noch aus wusste ›Wenn du so in der Klemme steckst, Venetsky, warum verkaufst du dann nicht eine deiner Anleihen? Die kann man doch immer verkaufen.‹ Er kam gar nicht auf die Idee, dass Venetsky keine Anleihen haben könnte. Die Macdonalds hatten welche, die Venetskys nicht.«
»Macdonald spielt Marie Antoinette.«
»Genau!«, rief Ravelstein lachend. »De-der alte Witz aus der großen Wirtschaftskrise, wo der Landstreicher die alte Dame anhält und sagt: ›Ma’am, ich konnte drei Tage lang keinen Bissen essen.‹ Und sie: ›Ach, Sie armer Mann, Sie müssen sich dazu zwingen.‹
»Für mich ist das eine todsichere Sache«, sagte ich zu Ravelstein. »Du brauchst nur ein Exposé zu schreiben. Zumindest bekommst du einen kleinen Vorschuss dafür. Wenigstens 2500 Dollar. Ich vermute, er liegt näher bei 5000. Selbst wenn du von dem Buch nie ein einziges Wort schreibst, kannst du damit einen Teil deiner Schulden abzahlen und hast beim Pumpen wieder Kredit. Das kann doch gar nicht schiefgehen!«
Da biss er an. Einen Verlag um ein paar Tausend Dollar zu prellen und sich gleichzeitig die Freiheit für Handel und neue Geschäfte zu verschaffen, das hatte einen enormen Reiz für ihn. In seiner ganzen Haltung zeigte Ravelstein nichts Kleinliches. Aber er rechnete nicht damit, dass mein utopisches Gedankenspiel zu irgendwas führen könnte. Er hatte sich an das Schauspiel kleinerer Intrigen gewöhnt, wo er ironisch und satirisch seine außergewöhnliche Bedeutung und sein Können übertreiben und betonen konnte. Das Exposé wurde also entworfen und abgeschickt, ein Vertrag unterschrieben und der Vorschuss gezahlt. Die unschätzbare silberne Jensen-Teekanne war zwar für immer verloren, aber Ravelstein verfügte wieder über einen anständigen Kreditrahmen. Er telegrafierte Geld an Nikki in Genf, und der kaufte sich ein neues Outfit von Gianfranco Ferré. Nikki besaß die Instinkte eines Prinzen, und er zog sich auch so an; Ravelstein sah in ihm einen intelligenten jungen Mann, der unbedingt das Recht hatte, entsprechend aufzutreten. Das hatte nichts mit Stil zu tun oder mit der Art, wie er sich gab. Wir sprechen hier von der Natur eines jungen Mannes und nicht von seiner Taktik.
Ravelstein war dann selber überrascht, als er das Buch schrieb, für das er einen Vertrag hatte. Nicht weniger überrascht waren seine Freunde und die drei oder vier Generationen von Studenten, die er unterrichtet hatte. Einige waren nicht damit einverstanden. Ihnen widerstrebte, was sie als Verallgemeinerung oder Entwertung seiner Ideen sahen. Aber Unterrichten, und selbst wenn es sich um Plato oder Lukrez, um Machiavelli oder Bacon und Hobbes handelt, ist immer eine Art von Verallgemeinerung. Was diese großen Geister gedacht hatten, lag seit Jahrhunderten gedruckt vor und war einem großen Publikum zugänglich, das gar nichts von ihrer geheimnisvollen Bedeutung wusste. Alle großen Texte, so glaubte und lehrte er, besaßen nämlich eine geheimnisvolle Bedeutung. Das muss meiner Meinung nach erwähnt werden, und damit hat es sich auch schon. Schließlich ist noch das schlichteste menschliche Wesen esoterisch und zugleich durch und durch rätselhaft.
Noch eine merkwürdige Kleinigkeit von diesem Abend bei Lucas Carton,