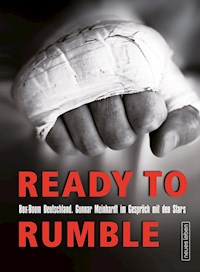
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Boxboom in Deutschland - das sind Riesenevents, Kämpfe von Weltklasseboxern, das ist das Gänsehautfeeling, wenn Michael Buffers "Let's get ready to rumble" durch die Box-Arenen schallt. Und das sind auch Geschichten, die sich außerhalb des Ringes abspielen. Boxexperte Gunnar Meinhardt hat befragt, was Rang und Namen in diesem Sport hat: Boxer, Trainer, Promoter, Kommentatoren ... und stellt auch die brisanten Fragen, die nach Rivalitäten, Intrigen, zerplatzten Träumen, die nach dem Geschäft. Rund 90 Interviews vereint dieses einzigartige Buch, das exklusive Storys sowie eine Fülle von Fakten und Meinungen bietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1468
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-355-50008-1
ISBN Print 978-3-355-01808-1
© 2013 Verlag Neues Leben, Berlin
Umschlaggestaltung: Verlag
unter Verwendung eines Fotos von Marianne Müller
Neues Leben Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Neues Leben
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Fotos von
Mike Tyson,
Óskar de la Hoya,
Emmanuel Dapidran Pacquiao,
und Evander Holyfield:
imago/ZUMA Press.
READY TO RUMBLE
Box-Boom Deutschland
Gunnar Meinhardt
im Gespräch mit den Stars
Mit Fotos von Marianne Müller
Ich danke allen, die mich bei der Realisierung des Projektes unterstützt haben und ohne die es dieses Buch nicht geben würde. Mein ganz besonderer Dank gilt Anja Rossmann und Arne Rossmann. Weiterhin danke ich Mascha Linke, Marianne Müller, Toni Aussermeier, Steffen Brauer, Benjamin Kliesch, Annegret Cziczkus und Christine Dassow.
Zu diesem Buch
Begonnen hat alles am 10. März 1993. Nach endlosem Warten zahlte sich meine jahrelange Beharrlichkeit aus. Ein journalistischer Traum erfüllte sich. Max Schmeling, damals siebenundachtzig Jahre alt, gab mir die Möglichkeit zu einem ungewöhnlichen Interview. Aus den vereinbarten dreißig Minuten entwickelte sich eine fünfstündige Plauderei. Wir redeten nicht nur über den Sport, der ihn zum Idol von Generationen machte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch über Gott und die restliche Welt.
Für Deutschlands einzigen Boxweltmeister in der Königsklasse des Faustkampfes stand danach fest, das ist mein »definitiv letztes Interview«. Für mich wurde diese unvergessliche Begegnung zum Schlüsselerlebnis, weckte das unvergleichliche Boxer-Leben dieses Jahrhundertzeitzeugen doch meine unendliche Neugier auf seine Berufskollegen.
Seitdem ließ ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten keine Gelegenheit ungenutzt, mit den Protagonisten seiner Zunft intensiv in den Dialog zu treten. Ob es nun mit den Initiatoren des deutschen Box-Booms nach dem Fall der Mauer war, der mit dem Gewinn des ersten Weltmeistertitels von Henry Maske am 20. März 1993 in Düsseldorf eingeläutet wurde, oder aber mit den Stars aus Amerika, England und anderen Ländern.
Ein Informationsfundus ungeahnten Ausmaßes ergab sich zu Beginn des neuen Jahrtausends durch die Mitarbeit am epischen Werk »GOAT«, das das einzigartige Leben von Muhammad Ali selbst und das Ausmaß seiner Errungenschaften widerspiegelt. Alle der noch lebenden Ringrivalen dieses außergewöhnlichen Champions standen mir seinerzeit ausführlich Rede und Antwort.
Damals wie heute inspiriert mich deren Denken, deren Fühlen, was sie antreibt, warum sie diesen archaischen Sport ausüben, wie sie ihn leben und erleben, wie sie zu millionenschweren Helden wurden und warum sie in ungeahnte Tiefen abstürzten, was das Fesselnde daran ist, in einen Boxring zu steigen, in dem sich Dramen und heroische Momente abspielen. Ob sie den Faustkampf tatsächlich so empfinden, wie die amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates in ihrem Essay »Über Boxen« schrieb:
»Boxen hat grundsätzlich nichts Spielerisches, nichts Helles, nichts Gefälliges an sich. In seinen intensivsten Momenten ist es ein so ungebrochenes und so machtvolles Bild des Lebens – seiner Schönheit, seiner Verletzlichkeit und Verzweiflung, seines unberechenbaren und oft selbstzerstörerischen Muts –, dass es das Leben selbst ist und kaum ein bloßer Sport.«
Max Schmeling hatte gehofft, dass nach Henry Maskes Titelgewinn das deutsche Profiboxen hoffähig wird wie zu seinen Glanzzeiten. Seine Hoffnung bestätigte sich. Nie zuvor wurde um so viele internationale Gürtel gekämpft. Nie zuvor konnten so viele Welt- und Europameister bejubelt werden. Die größten Hallen und auch Stadien waren wieder ausverkauft. Die öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender rissen sich um die Übertragungsrechte, zogen im Laufe der Jahre über eine Milliarde Menschen in ihren Bann. Es gab in dieser Ära unzählige grandiose Kämpfe mit großartigen Champions.
An der Erfolgsgeschichte einschließlich ihrer Schattenseiten schrieben viele mit. Nicht nur Boxer/Innen, Trainer, Promoter und Manager, die hierzulande leben. Nicht jeder von ihnen wollte sich äußern, doch diejenigen, die sich befragen ließen, zeichnen vielleicht kein vollständiges, aber mit Sicherheit einmaliges Bild boxerischer Zeitgeschichte. Dabei bietet ein Interview wesentlich authentischere persönliche Einblicke als die Schilderung aus Autorenwahrnehmung. Ausgangspunkt war dabei immer ein besonderes zeitliches Ereignis in der Karriere der 88 Befragten, woraus sich chronologisch die Abfolge der Gespräche ergibt.
In diesem schlagstarken Sinne: »Ready to rumble.«
Gunnar Meinhardt
10. Februar 2012
Inhalt
Zu diesem Buch
Wilfried Sauerland
Manfred Wolke
Kai Ebel
Burkhard Weber
Dr. phil. Werner Schneyder
Jean-Marcel Nartz
Markus »Cassius« Bott
Max Schmeling
Henry »Gentleman« Maske
Graciano »Rocky« Rocchigiani
Michael Buffer
Michel »Phantom« Trabant
Axel Schulz
George Foreman
Ralf »Rocky II« Rocchigiani
Fritz Sdunek
Francois Botha »The White Buffalo«
Artur »King Artur« Grigorian
Emanuel Steward
Bernd Bönte
Michael »Lion« Löwe
Muhammad Ali »The Greatest«
Stefan Angehrn
Juan Carlos Gómez »Black Panther«
Marco Rudolph
Willi »de Ox« Fischer
Eberhard »Ebby« Anton Thust
Bert Schenk
»Iron« Mike Tyson
Vitali Klitschko »Dr. Ironfist«
Markus »Boom Boom« Beyer
Ulf Steinforth
Chris Cornelius Byrd »Rapid Fire«
Larry Merchant
Timo Hoffmann »Deutsche Eiche«
Mario Veit
Oktay »Cassius« Urkal
Thomas Ulrich
Sebastian »Hurrikan« Sylvester
Dieter Gruschwitz
William »Billy« David Alexander Besmanoff
Wladimir Klitschko »Dr. Steelhammer«
Corrie »The Sniper« Sanders
Norbert Grupe »Prinz Wilhelm von Homburg«
Lennox Claudius Lewis »The Lion«
Dariusz »Tiger« Michalczewski
Trevor Berbick
Sven »Das Phantom« Ottke
Hans-Ullrich »Ulli« Wegner
Lamon »Relentless« Brewster
Daisy »The Lady« Lang
Felix »Leonidas« Sturm
Óscar de la Hoya »Golden Boy«
Yoan Pablo Hernandez Soarez
Peter Hanraths
Luan »Der Löwe« Krasniqi
Nikolai Walujew »The Russian Giant«
Hagen »Hako« Sevecke
Laila »She Bee Stingin’« Ali
Arthur Abraham »King Arthur«
Professor Dr. Dr. Walter Wagner
Kalle Sauerland
Waldemar »Waldi« Hartmann
Jürgen Blin
Virgil »Quicksilver« Eugene Hill
Ruslan Chagajew »Der Weiße Tyson«
Karl »Milde« Mildenberger
Firat »Der Löwe« Arslan
Regina Halmich
Torsten Schmitz
Marco »Käpt’n« Huck
Ina Menzer
Robert Stieglitz
Karsten Röwer
Frederick Steven Roach »The Choir Boy«
Vitali Tajbert
Ed Brophy
Sebastian Zbik
Rola El-Halabi
David »Hayemaker« Deron Haye
Don King
Michael Timm
Angelo Dundee
Thomas Pütz
Susianna Kentikian »Killer Queen«
Emmanuel Dapidran Pacquiao »Manny Pac Man«
Evander »The Real Deal« Holyfield
Klaus-Peter Kohl
Wilfried Sauerland
• Geboren: 29. Februar 1940 in Wuppertal
• Wohnort: Kapstadt/Südafrika
• Tätigkeit: Kaufmann, Unternehmer
• Box-Promoter und Manager seit 1978
• Arthur Abraham, Markus Beyer, Steve Cunningham, David Haye, Yoan Pablo Hernandez, Marco Huck, Mikkel Kessler, Henry Maske, John Mugabi, Sven Ottke, Graciano Rocchigiani, Sebastian Sylvester, Nikolai Walujew
• Weltmeisterin: Cecilia Brækhus
• Mitglied in der International Boxing Hall of Fame seit 2010
Wilfried, haben Sie noch das Foto, mit dem im Grunde genommen der deutsche Box-Boom eingeleitet wurde?
Sie meinen das legendäre Foto aus der Bild am Sonntag, auf dem Henry und Klaus-Peter Kohl zu sehen waren? Das habe ich nicht mehr.
Das Foto war in der Ausgabe vom 14. Januar 1990. Zu sehen sind darauf Henry Maske, fein rausgeputzt mit Schlips, weißem Hemd und Weste, sowie Universum-Promoter Klaus-Peter Kohl, mit dem er sich einen Tag zuvor im Berliner Hotel Intercontinental getroffen hatte. Die Schlagzeile lautete: »DDR-Maske will Rocky verhauen!«
Eigentlich hatte ich mich zu dem Zeitpunkt im Kopf schon vom Berufsboxen verabschiedet. Ich hatte zu viele Enttäuschungen erlebt. Dann aber kam der Fall der Mauer, und ich sah eines Tages diesen Artikel. Ich zeigte das Foto meiner Frau, und sie sagte: Das ist doch ein sympathischer Kerl. Mit dem könntest du doch sicherlich etwas machen. Das nahm ich zum Anlass, umzudenken und Kontakt aufzunehmen.
Wie lange dauerte es, bis Sie Kontakt zu Henry hatten?
Das ging innerhalb von ein oder zwei Tagen. Das erste Treffen mit Henry und seinem Trainer Manfred Wolke fand in Berlin statt. Auf der Rückfahrt nach Frankfurt (Oder) hatte Manfred, wie er mir später erzählte, zu Henry gesagt, dass ich wohl der Richtige für sie sei. Deshalb bin ich auch wenige Tage später zu ihnen nach Frankfurt gefahren, um noch einmal ausführlich miteinander zu reden.
War das Ihr erster Besuch in der Noch-DDR?
Ich war Jahre zuvor schon einmal dort, was mit sehr vielen Umständen verbunden war. Danach hatte ich genug von der DDR. Ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Weg nach Frankfurt (Oder) diese endlosen Brandenburger Alleen entlang gefahren bin. In Frankfurt holte ich Manfred Wolke zu Hause ab, und wir fuhren dann in ein Restaurant. Dort habe ich den besten Rotkohl seit langer, langer Zeit gegessen, das werde ich auch nie vergessen. Nach dem Treffen habe ich sie beide im Februar zu mir in die Schweiz nach Gstaad eingeladen, wo wir unsere Zusammenarbeit besiegelten. Das ging alles sehr zügig. Henry und Manfred hatten vorher schon mit allen anderen möglichen Promotern und Managern gesprochen. Ich war der Letzte, den sie kontaktierten, hatte aber das große Glück, dass wir uns problemlos einig wurden.
Welchen Eindruck hatten Sie bei der ersten Begegnung?
Ich hatte ein sehr positives Gefühl. Da ich jahrelang im Ausland gelebt hatte, war es kein Problem für mich, dass sie, obwohl wir die gleiche Sprache sprachen, als Boxer ein ganz anderer Menschenschlag waren als die, die ich bis dahin kannte. Außerdem erinnerte mich Henry an meinen Vater, also vom Aussehen, vor allem von seiner Frisur her.
War Ihr Vater Ihr großes Vorbild?
Nein, nicht mein Vorbild, aber er war jemand, den ich sehr gern hatte. Er hatte auch meine Begeisterung für den Boxsport geweckt. Mit ihm bin ich oft in die Westfalenhalle nach Dortmund gefahren und sah dort unter anderem die Kämpfe von Erich Schöppner und Willi Hoepner. Das waren einprägsame Erlebnisse. Ich fand aber nicht nur Henry sehr angenehm, auch Manfred kam sympathisch rüber.
Sie sagten, beide seien als Boxer ein ganz anderer Menschenschlag gewesen, als die, die Sie bislang kannten. Haben Sie ihnen von Anbeginn vertraut?
Sonst hätte ich ihnen nicht meine kostbare Lebenszeit gegeben. Ich hatte schon genug Zeit beim Profiboxen vergeudet.
Und auch genug Geld verschleudert?
Auch das. Dass die beiden es ernst meinten, war mir von Anfang an klar. Keine Sekunde habe ich daran gezweifelt. Beide standen unter extremem Erfolgsdruck. Es war nicht das erste Mal, dass ich auf Boxer traf, die sehr, sehr leistungssportorientiert dachten. Ich sah mich ja viel in den Boxgyms in England um. Die Profiboxer dort hatten eine ganz andere Einstellung als die in Westdeutschland. Ich kannte es also schon, dass man da auch ernsthafter sein kann. Aus den Gesprächen mit Manfred und Henry hatte ich zudem das Gefühl, dass die ganze ehemalige DDR darauf schaute, was die beiden machten.
Wie lange brauchten Sie, um die Entscheidung zu treffen, mit den beiden noch einmal einen Neuanfang im Profiboxen zu starten?
Das ging sehr schnell. Schon nach wenigen Minuten merkte ich, dass wir auf einer Wellenlänge liegen, die gleichen Ziele hatten, und dass mir beide sympathisch sind. Da war mir schon klar, dass ich es machen werde, wenn sie sich für mich entscheiden. Der erste Eindruck ist immer der wichtigste, alles andere kann man regeln.
Am 8. März, drei Monate vor der Währungsunion, kam es bei einem ungewöhnlich großen Medienauflauf im Berliner Hotel Hamburg zur Vertragsunterzeichnung.
Vorher bin ich mit ihnen erst einmal einkaufen gegangen und habe sie eingekleidet. Das ist bei beiden bis heute hängengeblieben. Beide legen heute großen Wert auf Kleidung.
Hatten Sie sich mit ihnen geschämt?
Nein, um Gottes willen. Doch ich dachte, wenn wir schon eine Pressekonferenz haben, dann sollen sie auch gut gekleidet sein. Nicht unbedingt Krawatte, aber ein Jackett, damit sie bei den Medienleuten einen guten Eindruck hinterlassen. Ich war ja auch mächtig stolz, dass mir der Coup gelungen war, Henry unter Vertrag zu nehmen. Einen Olympiasieger zu bekommen – noch dazu war er der einzige deutsche Amateur-Weltmeister –, das war schon ein großes Erfolgserlebnis.
Was sich daraus dann entwickelte, war doch aber auch für Sie nicht abzusehen, oder?
Nein, nicht in dem Umfang. Ich hegte schon große Hoffnungen, dass Henry auch Weltmeister bei den Profis werden würde. Ich hatte ja auch Graciano zum Weltmeister geführt. Aber dass Henry und Manfred eine so große Wirkung haben würden, habe ich nicht gedacht.
Die deutschlandweite Euphorie begann am 20. März 1993, als Henry in Düsseldorf den Amerikaner Charles Williams durch einen einstimmigen Punktsieg als IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht entthronte.
Die Euphorie setzte völlig überraschend schon vor dem Kampf ein. Bislang waren zu Henrys Kämpfen kaum mehr als 2000 Zuschauer gekommen. Es war mühselig, ihn bekannt zu machen. Es existierte damals schon ein Vertrag mit der ARD, die ab und zu mal Freitagabend ein paar Ausschnitte von ihm zeigte. Vor dem Kampf gegen Williams gab es aber schon Tage vorher keine Karten mehr. Das war der Wahnsinn, in die Düsseldorfer Phillipshalle gingen immerhin weit über 5000 Zuschauer rein.
Waren Sie erschrocken?
Ja klar. Viele Leuten, denen wir immer Karten gegeben hatten, riefen an und wollten Karten von uns, wir konnten ihnen keine geben, weil es einfach keine mehr gab. Henry war in diesem Kampf aber nicht der Favorit, weil Charles Williams als ein sehr starker Weltmeister galt. Henry löste die Herausforderung wahrhaftig weltmeisterlich. Das Ergebnis war total korrekt.
Wie fühlten Sie sich nach dem Schlussgong?
Wie auf Wolke sieben, es war traumhaft. Was sich aus dem Titelgewinn entwickelte, ist vielleicht vergleichbar mit dem, was heute mit den Klitschkos passiert. Die Gegner spielten bei Henry auch keine Rolle mehr, Hauptsache, Henry geht in den Boxring und gewinnt. Die Leute kamen zu einem Event. Das Wichtigste war, dabei zu sein, wenn Henry boxt. Einfach ein absolutes Phänomen! Sven Ottke hatte im Vergleich zu Henry viel schwerere Kämpfe zu bestreiten. Auch er zog viele Zuschauer in die Halle oder vor den Fernseher, aber er ist nie in die Regionen von Henry gekommen. Möglicherweise lag es auch daran, dass Henry der Erste war. Das lässt sich schwer sagen.
Selbst Ihnen bleibt es ein Rätsel?
Ja, bis heute. Man kann auch nicht sagen, nur weil Henry aus der DDR kam, haben viele ihren Fernseher eingeschaltet. Bei Sven Ottke dachten auch alle, er sei aus dem Osten. Natürlich hat RTL auch gepusht. Für die öffentliche Wahrnehmung ist es schon ein Unterschied, ob etwas auf RTL läuft oder auf einem öffentlich-rechtlichen Sender. Die privaten TV-Sender haben halt andere Vermarktungsstrategien, dadurch kannst du schon automatisch höhere Einschaltquoten erwarten. Der Vertrag mit RTL, den ich im Herbst 1992 schloss, war ein Segen für uns. Ohne RTL, ohne die großartige Unterstützung von RTL-Gründer Dr. Helmut Thoma, Sportchef Burkhard Weber und später auch Chefredakteur Hans Mahr wäre das alles nicht möglich gewesen.
Der erste Kampf, den RTL dann übertrug, war das Duell von Axel Schulz um die vakante Europameisterschaft im Schwergewicht gegen den Briten Henry Akinwande am 19. Dezember 1992 in Berlin. Der Fight endete unentschieden.
RTL hatte übrigens schon vorher Gracianos Titelverteidigung gegen Thulane Malinga übertragen. Allerdings nur diesen einen Kampf.
Das war am 27. Januar 1989, als Rocchigiani in Berlin gegen den Südafrikaner seinen IBF-Titel im Supermittelgewicht durch einen einstimmigen Punktsieg das letzte Mal verteidigte.
Dieser Kampf wurde gar nicht groß beworben, trotzdem hatte RTL eine Einschaltquote, die höher lag als bei Spielen von Steffi Graf, die RTL damals auch zeigte.
Fühlten Sie sich nicht ein wenig überfordert mit dem plötzlich einsetzenden Box-Boom?
Eigentlich nicht. Ich habe nur gewarnt, weil es auf Dauer nicht so weitergehen kann. Und ich habe auch immer wieder gesagt, dass es unheimlich wichtig ist, junge Boxer nachzuziehen. Sonst ist das alles schnell vorbei.
Hat Henry Maske nicht zu früh aufgehört? Nach dem 1 : 2-Punktrichterentscheid im Titelvereinigungskampf am 23. November 1996 in München gegen WBA-Weltmeister Virgil Hill beendete der IBF-Champion mit 32 Jahren seine Karriere. Zehn Jahre später, am 31. März 2007, wagte er gegen den Amerikaner ein Comeback und siegte einstimmig nach Punkten.
Er hätte schon noch ein bis zwei Jahre dranhängen können. Ihn zu überreden, hätte keinen Sinn gemacht, denn er hatte seinen Entschluss gefasst. Boxen ist ja kein ungefährlicher Sport, und wenn dann einer kommt und sagt, das war es, soll man ihn auch lassen. Deswegen halte ich mich aus Comebacks raus. Ich lasse mich nicht des Geldes wegen zu etwas verführen, hinter dem ich nicht stehe.
So wie bei den Comebacks von Henry Maske und Axel Schulz? Axel war nach sieben Jahren in den Boxring zurückgekehrt und verlor am 25. November 2006 gegen den Amerikaner Brian Minto durch Technischen K.o. in Runde sechs, wobei er schwer verprügelt wurde.
Axel hatte nach der schmerzhaften Niederlage gegen Wladimir Klitschko aufgehört, weil er selbst sagte, dass er in der Weltspitze nichts mehr zu suchen hatte. Eigentlich wollte er schon vor dem Klitschko-Kampf aufhören. Wegen einer Bandscheibenoperation hatte er über ein Jahr nicht geboxt. Wenn er sich dann nach so vielen Jahren entscheidet wieder einzusteigen, kann das nur einen Grund haben: Es geht ums Geld. Und das geht nie gut aus, wenn das Herz nicht dabei ist. Für mich war das eine Fortsetzung des klamauken Promiboxens, bloß dass die Boxer diesmal die Promis waren. Axel hatte mich zu seinem Comeback eingeladen.
Und warum saßen Sie nicht am Ring?
Zu der Zeit war ich in Südafrika. Ich hatte mich aber lange mit ihm unterhalten und zu ihm gesagt: »Wenn du zu mir gekommen wärst und mir gesagt hättest, du hast finanzielle Sorgen, hätten wir gemeinsam überlegen können, um etwas auf die Beine zu stellen. Aber dass du dich jetzt hinstellst und sagst, du boxt, weil du Boxen so gern hast, das kann ich dir nicht abnehmen.«
Und bei Henry Maske?
Bei Henry war das eher eine Frage der Ehre, weil ihn die Niederlage gegen Hill sein Leben lang ärgerte und wir auch nicht mehr drüber gesprochen haben.
War er an der Niederlage gegen Virgil Hill durch seine vorher gemachte Ankündigung, danach seine Karriere beenden zu wollen, nicht selbst schuld?
Ja klar, er hätte vorher nicht hinausposaunen müssen, dass er aufhört. Dass das auf Punktrichter einen Einfluss hat, ist nicht auszuschließen. Sven Ottke war da cleverer, er hatte von seinem geplanten Karriereende niemandem etwas erzählt.
Als 36-Jähriger trat er am 27. März 2004 in Magdeburg nach seinem einstimmigen Punktsieg gegen Arman Krajnc nach 34 Kämpfen als unbesiegter Weltmeister der IBF und WBA ab. Nach der letzten Runde verkündete er im Boxring seinen Rücktritt.
Wir hatten eigentlich vereinbart, dass er einen Kampf später aufhört. Daraus wollten wir eine große Sache machen. Doch er hat sich anders entschieden, das ist zu respektieren.
Wussten Sie wirklich nichts von seiner Rücktrittsabsicht?
Nein, ich wusste absolut gar nichts. Im Ring habe ich ihn in den Arm genommen und zum Sieg gratuliert, da sagte er mir, dass dies sein letzter Kampf gewesen sei. Ich kann nur sagen, Chapeau dafür, dass er das die ganze Zeit für sich behalten hat. Selbst sein Trainer Ulli Wegner wusste von nichts.
Waren Sie enttäuscht, dass Sven Ottke so plötzlich aufhörte?
Nein. Ich habe mir gesagt, okay, das ist jetzt so, trotzdem wird es weitergehen.
Sven Ottke hatte es mit seinem überraschenden 2 : 1-Punktrichterentscheid am 24. Oktober 1998 in Düsseldorf gegen IBF-Weltmeister Charles Brewer überhaupt erst ermöglicht, dass es nach dem Abtritt von Henry Maske erfolgreich mit Ihrem Boxstall weiterging. Zu diesem Zeitpunkt hatten Sie keinen Weltmeister, und RTL wollte sich schon zurückziehen.
Das stimmt so nicht. Bei RTL war nicht die Bedingung, dass wir einen Weltmeister haben müssen. Nach Henrys Rücktritt hatten wir ja längere Zeit keinen. Laut Vertrag mussten wir im Jahr eine gewisse Anzahl von Kämpfen oder Veranstaltungen machen. Entscheidend war dabei eine gewisse Qualität, sprich Quote. Die Kämpfe brachten zwar keine 18 oder 20 Millionen Zuschauer mehr wie zu Henrys oder Axels Zeiten, mit sechs, acht oder zehn Millionen war RTL aber zufrieden. Das waren natürlich auch Kämpfe, die RTL viel weniger Geld kosteten. Was wir dann am Ende anboten, lag an uns und nicht am Fernsehsender. Sonst hätte ja der Fernsehsender sagen können, dass er mal den oder den haben wollte.
Das letzte Sauerland-Event auf RTL war am 6. Mai 2000, als Supermittelgewichtler Markus Beyer seinen WBC-Titel an den Briten Glenn Catley verlor.
Danach sagte Hans Mahr zu mir, dass er jetzt nichts mehr für mich tun könne, der Vertrag mit RTL also nicht mehr verlängert würde. Doch ich hatte schon seit geraumer Zeit die ARD in der Hinterhand, mit der wir dann nahtlos weitermachten.
Das Quoten-Phänomen schlechthin ist Axel Schulz. Noch immer hält er mit 18,03 Millionen den Rekord. Aufgestellt hatte er ihn beim 1 : 2-Punktrichterentscheid im Duell um den vakanten IBF-Titel am 9. Dezember 1995 in Stuttgart gegen den Südafrikaner Francois Botha, der, wie sich später herausstellte, in diesem Kampf gedopt war.
Das ist für mich bis heute unfassbar. Axel verlor alle wichtigen Kämpfe, hatte aber diese gewaltige Resonanz, Wahnsinn.
Auf den Punktzetteln hat er nicht einen seiner jeweils drei WM- und EM-Kämpfe gewonnen. Aus der Sicht des objektiven Beobachters stellt sich das etwas anders dar, oder?
Also ich würde so sagen, gegen Akinwande hat er den ersten Kampf verloren, obwohl er Unentschieden ausging. Über das Rematch müssen wir nicht reden. Gegen George Foreman hätte er ein Unentschieden oder auch einen Sieg verdient gehabt. Gegen Botha ist es ganz schwer zu sagen, weil er die ersten vier, fünf Runden völlig verschlafen hatte. Es war ein echt enges Ding, und in Deutschland hätte man das schon Axel geben können. Ein Fehlurteil war es aber auch nicht.
Promoter von Botha war Don King, war das möglicherweise ausschlaggebend?
Das kann auch eine gewisse Rolle gespielt haben, aber ich habe keine Ahnung. Zumindest haben wir ihm später gezeigt, dass wir ihn vor Gericht besiegen können.
Inwiefern?
Als es ums Dopingvergehen ging. Mir hatte einer, der die Umkleidekabine von Botha bewachte, erzählt, ihm sei etwas Seltsames aufgefallen. Zuerst wäre Botha auf die Toilette gegangen und kurze Zeit später sein Trainer. Beide waren ziemlich lange dort gemeinsam. Mein Informant hatte dann die Tür aufgemacht und gesehen, wie Botha sich die Hose hochzog und der Trainer etwas in den Mülleimer warf, was wie eine Spritze aussah. Das teilte ich unserem Ringarzt Professor Walter Wagner mit. Auch meinem amerikanischen Partner Cedric Kushner erzählte ich davon. Ich vermutete, dass Botha sich gedopt hatte. Normalerweise liegt das Ergebnis der Dopingkontrolle nach zehn bis vierzehn Tagen vor. Als das nicht geschah, wurde ich unruhig. Zwischen Weihnachten und Neujahr rief mich Cedric an. Er meinte, dass ich mit meiner Vermutung recht haben könnte. Ein Bekannter von ihm, ein Apotheker, der auch Funktionär beim Boxen ist, hatte einen Anruf vom IBF-Präsidenten bekommen, der Informationen über ein bestimmtes Anabolika haben wollte. Ich bat Walter Wagner, bei der IBF anzurufen. Sie sagten ihm, dass ein positiver Dopingbefund vorliege, sie uns aber noch nichts offiziell mitteilen dürfen, weil erst noch die B-Probe geöffnet werden müsse. Kurz darauf kam ein Brief von der IBF, dass Bothas A-Probe positiv war. Die B-Probe sollte dann in einem Institut in Amerika geöffnet werden, woraufhin ich den Chef des Kölner Dopinglabors, Prof. Dr. Wilhelm Schänzer, anrief, der mir sagte, ich solle die im Dopinglabor des Olympischen Instituts in Los Angeles öffnen lassen. Ich habe Prof. Schänzer auch dorthin mitgeschickt, um als neutrale Person bei der Öffnung dabei zu sein. Auch einen Anwalt schickte ich mit. Die Probe war dann positiv. Die IBF wollte Botha irgendeine Strafe aufbrummen, aber den Titel wollten sie ihm nicht wegnehmen und auch das Ergebnis nicht ändern.
Woraufhin Sie intervenierten?
Natürlich. Es gab eine Anhörung bei der IBF in New Jersey. Dort gab Botha an, nur ein Mittel genommen zu haben, weil er Schmerzen im Arm hatte. Das Mittel gab es in den USA nicht zu kaufen, er hatte sich das aus Südafrika schicken lassen. Daraufhin habe ich mir in den USA den Anwalt genommen, der Donald Trumps Frau bei der Scheidung vertreten hatte. Als Erstes musste ich 250000 Dollar auf den Tisch legen, damit er den Fall überhaupt annahm. Außerdem hatte ich in Südafrika einen Privatdetektiv engagiert, weil ich weiß, dass dort jedes Rezept notiert wird. Wir bekamen schließlich die Listen mit allen Mitteln, die Botha bezogen hatte. In dem Ort, in dem er damals wohnte, gab es nur zwei Apotheken. Damit hatte er natürlich nicht gerechnet. Beim Prozess habe ich die Listen vorgelegt, auf denen eben nicht nur dieses eine Mittel draufstand. In der Verhandlungspause musste ich auf Toilette, als Botha plötzlich neben mir stand und mich fragte, warum ich ihm das alles antun würde. Der ganze Prozess kostete mich 400000 oder 450000 Dollar, wobei Axel später einen Teil übernahm. Es war natürlich ein großes Risiko, denn wenn wir verloren hätten, wäre alles weggewesen. Doch Gott sei Dank siegte die Gerechtigkeit.
Aber hätte nicht Axel zum Weltmeister ernannt werden müssen?
Ja, das stimmt. Diesen Prozess hätte ich aber nicht gewonnen. Die IBF legte deshalb auch fest, dass Axel gegen Michael Moorer boxen muss.
… dem er am 22. Juni 1996 bei Regen im Dortmunder Westfalenstadion im Duell um den vakanten IBF-Titel mit 1 : 2-Punktrichterentscheid unterlag …
Den Kampf hat er für mich verloren. Aber längst nicht so klar, wie seinen letzten EM-Kampf gegen Klitschko, was sehr deprimierend war. Darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren, da hat Axel mich enttäuscht wie kein anderer meiner Sportler.
Nach dem umstrittenen Urteil im Kampf gegen George Foreman waren Sie doch auch vors Gericht gezogen, woraufhin Foreman den WM-Titel niederlegte und Axel gegen Botha kämpfen durfte. Wäre der WM-Kampf gegen Foreman überhaupt zustande gekommen ohne die illegale Geldübergabe von Cedric Kushner an IBF-Präsident Bob Lee? Kushner hatte ihm 100000 Dollar gegeben.
Nein, denn Axel war damals ja nicht unter den ersten Fünfzehn der Weltrangliste vertreten. Lee hatte anscheinend jedes Mal versucht, etwas zu dealen.
Spätere FBI-Untersuchungen ergaben, dass auch Foremans Promoter Bob Arum 100000 Dollar und Foreman selbst 250000 Dollar an Lee zahlten, um gegen Schulz seinen IBF-Titel freiwillig verteidigen zu können. Nach Aufdeckung weiterer unlauterer Machenschaften trat Lee 1999 als Präsident zurück und wurde zu einer 22-monatigen Haftstrafe verurteilt. Hatte Lee Sie auch angerufen?
Nein, natürlich nicht. Ich hatte damit auch nichts zu tun, ich war nur der Geldgeber. Er hatte Cedric angerufen und gesagt, es würde 100000 Dollar kosten, damit Axel in die Rangliste aufgenommen wird. Man hätte natürlich auch damit argumentieren können, dass Axel sowieso in diese Rangliste reingehört, was aber zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte, und bis zu den nächsten Ratings wäre es zu spät gewesen. Das musste eben innerhalb von ein paar Tagen passieren.
War Axel Ihnen die 100000 Dollar wirklich wert?
Ja klar. Ich habe immer an Axel geglaubt. Die 100000 Dollar waren ja auch nicht alles. Ich hatte damals schon 450000 Dollar vorgelegt, um den Kampf überhaupt möglich zu machen. Die hätte ich dann vergessen können. Außerdem wusste ich doch, dass Axel von allen unterschätzt wird. Foreman suchte sich Fallobst. Axel passte da perfekt ins Raster. Und er kostete auch nicht so viel. Deswegen hatte sich Foreman auf den Kampf gar nicht richtig vorbereitet. Er dachte niemals, dass da so ein Teutone für zwölf Runden Kondition haben würde. Als ein Rematch angewiesen wurde, kniff er.
Ein Jahr zuvor hatten Sie aber nach einer schwachen Vorstellung von Axel in Chicago, als er den Amerikaner Jack Basting über zehn Runden nach Punkten besiegte, gesagt, dass aus Axel nichts wird.
Nun gut, ich dachte, dass er nicht ganz oben ankommen wird. Dann kam diese Anfrage mit Foreman. Da dachte ich, das sei Axels große Chance. Als ich Manfred Wolke anrief und fragte, was er davon halte, sagte erst einmal ja, wollte aber noch mit Axel darüber sprechen. Am nächsten Tag rief er an und sagte, dass sie das machen wollen. Die Börse war gar nicht mal so hoch. Es ging Axel und Manfred nur um die eine Chance, die sich so unverhofft bot. Die wollten sie nutzen.
Von dem Kampf lebt Axel heute noch, obwohl er ihn verloren hat.
Das stimmt. Es ist ihm von Herzen zu gönnen.
Hätte Axel möglicherweise den Trainer wechseln müssen? Manfred Wolke war für Henry der ideale Trainer, war er es auch für Axel?
Darüber zu orakeln, hat keinen Sinn. Manfred hat schon sehr, sehr viel aus Axel rausgeholt.
Manfred Wolke war der erste Trainer, den Sie nach dem Mauerfall unter Vertrag nahmen. Sie hatten ihm einen Vertrag auf Lebenszeit versprochen. Seit dem 1. Januar 2010 gehen Sie jedoch getrennte Wege.
Das größte Problem war einfach Frankfurt (Oder). In den letzten Jahren kam nichts mehr von dort, weil dort auch keine Boxer hinwollten. Ich hatte Manfred angeboten, nach Potsdam zu gehen. Da hatte ich die Möglichkeit, ein Gym für ihn zu bekommen. Das wäre in der Nähe von Berlin, wo ich schneller mal einen Boxer hinbeordern könnte als nach Frankfurt. Manfred überlegte auch eine Weile, wollte es dann aber wegen der Familie nicht machen. Ich glaube, er wäre gern nach Potsdam gezogen. Dort kommt er ja auch her.
War es bitter für Sie, als sich Ihre Wege trennten?
Natürlich. Unser Kontakt ist aber nicht gänzlich abgerissen.
Haben Sie auch noch Kontakt zu Ihrem langjährigen Matchmaker Jean-Marcel Nartz, der 2003 zum Konkurrenten Klaus-Peter Kohl nach Hamburg wechselte?
Nein, Marcel ist für mich eine große menschliche Enttäuschung.
Nach Marcels Weggang zu Universum Box-Promotion wurde gesagt, jetzt werde es den Sauerland-Boxstall nicht mehr lange geben.
Ja, das wurde gemunkelt, aber ich glaube, er hat sich selbst überschätzt und wurde das auch maßlos von anderen. Er hat sich auch bei Universum längst nicht so gut verkauft, wie jeder geglaubt hatte. Mit Hagen Döring hatte ich immer jemanden als Matchmaker in Hinterhand, so dass wir Marcels Weggang problemlos kompensieren konnten. Trotzdem war ich geschockt, als Marcel zu Universum ging, weil er mir das nicht gesagt hatte. Er sagte nur, er habe einen neuen Job. Erst später erfuhr ich, was er wirklich vorhatte.
Tat Ihnen das weh? Immerhin arbeiteten Sie mit ihm zusammen, seit Sie 1980 nach Deutschland kamen, um das Profiboxen wiederzubeleben.
Das hat schon ein wenig weh getan, aber ich bin kein Mensch, der großartig darunter leidet.
Ein konfliktfreudiger Mensch sollen Sie auch nicht gerade sein.
Das stimmt schon. Ich bin wie alle Rheinländer. Ich versuche immer, alles schönzureden. Mein Lebensmotto ist auch: »Leben und leben lassen«, wobei ich meine Entscheidungen zumeist aus dem Bauch heraus treffe. Ich bin kein Kopfmensch.
Sind Sie harmoniesüchtig?
Nicht süchtig, aber harmoniebedürftig. Wenn mich jedoch jemand arg enttäuscht hat, gibt es für denjenigen fast keinen Weg zurück. Da bin ich total stur. Marcel macht schon seit Jahren Anläufe über Dritte, um wieder mit mir ins Gespräch zu kommen, aber das habe ich von vornherein nicht zugelassen.
Dass Ihr Boxstall ohne Marcel Nartz nicht hätte weiterexistieren können, war kein Thema?
Nein, das habe ich auch nie gedacht. Seit 1989, als ich mich zurückziehen wollte, stand ein Aufhören nie wieder zur Diskussion. Wissen Sie, der Weggang von Marcel war für einige in der Firma sogar eine Befreiung. Aber ich möchte nicht so sehr auf die persönliche Ebene gehen.
Gab es in der Rivalität mit Universum Box-Promotion Situationen, in denen Sie dachten, jetzt will ich mit Klaus-Peter Kohl nie mehr etwas zu tun haben? Sie beide haben sich ja häufig öffentliche Verbalschlachten geliefert.
Im Vergleich zum sonstigen Geschäftsleben war das doch harmlos. Das klang manchmal auch nur so heftig, weil es in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Es war niemals so schlimm, wie es sich angehört hat.
War das Teil der Show, die zum Profiboxen dazugehört?
So war es. Ich muss auch sagen, dass es mir sehr leid tut, dass es Universum unter Peter Kohl nicht mehr gibt.
Am 19. November 2012 stellte dessen Nachfolger Waldemar Kluch beim Hamburger Amtsgericht einen Insolvenzantrag.
Das ist wirklich bedauerlich. Ich habe lieber eine kompetente Konkurrenz, wo es zur Sache geht und mit der man vernünftige Kämpfe untereinander austragen kann, als eben Gegenspieler, die man nicht einschätzen kann. Peter Kohl kenne ich seit den siebziger Jahren, als er noch mit dem Gong die Runden einläutete. Er war auch viele Jahre unser BDB-Präsident. Einige Jahre, nachdem ich angefangen hatte zu veranstalten, begann er dann auch damit.
Sie hatten damit 1978 in Afrika begonnen, als Sie dort als Exportkaufmann Getränke-Abfüllanlagen vertrieben.
1978 hatte mich die sambianische Regierung gebeten, meine Kontakte zu nutzen und einheimische Boxer nach Übersee zu vermitteln. Auf Anregung der Regierung Sambias organisierte ich in der Hauptstadt Lusaka einen Boxabend mit 70000 Zuschauern. Das gefiel mir derart, dass ich zwei Jahre später damit auch in Deutschland begann. Als ersten Boxer nahm ich übrigens den sambianischen Halbschwergewichtler Lotti Mwale unter Vertrag. Mit ihm bestritt ich auch meinen ersten WM-Kampf.
Den Ihr Schützling am 28. November 1980 in San Diego gegen Titelverteidiger Matthew Saad Muhammad durch K.o. in Runde vier verlor.
In Deutschland begann ich, mit René Weller und Manfred Jassmann zu veranstalten. Am Anfang kam ich gerade so über die Runden. Im Laufe der achtziger Jahre wurde es immer schwieriger, da habe ich viel mehr Geld investiert, als ich rausbekommen habe. Trotzdem war es eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
Klaus-Peter Kohl veranstaltete am 24. Februar 1984 das erste Mal in Hamburg, damals mit den Rocchigiani-Brüdern Ralf und Graciano. Er machte einen Verlust von etwa 150000 D-Mark. Aller Anfang war auch für ihn schwer. Doch von der Rivalität haben Sie beide über die Jahre profitiert?
Peter hatte schon tolle Boxer.
Waren Sie neidisch auf ihn? Er hat viel mehr Weltmeister als Sie hervorgebracht. Zeitweise tummelten sich bis zu zehn Champions in seinem Gym, bei Ihnen aber nur einer oder zwei.
Wir hatten auch viele Weltmeister. Momentan haben wir mit Arthur Abraham, Yoan Pablo Hernandez, Marco Huck, Mikkel Kessler und Cecilia Brækhus immerhin fünf. Aber Masse hat mich nie interessiert. Wichtig ist, dass du die richtigen Weltmeister hast, die die Leute interessieren und anziehen.
Einen Dariusz Michalczewski oder Wladimir und Vitali Klitschko hätten Sie doch sicher gern gehabt?
Natürlich. Dariusz und auch Michael Löwe waren ja erst bei mir, ehe sie mit Universum in Kontakt traten. Sie haben gefragt, ob sie bei mir anfangen können. Ich sagte nein. Mit meinen schwarzen Boxern hatte ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwer ist, einen ausländischen Boxer in Deutschland populär zu machen. Dass ich damals die beiden abgewiesen habe, sehe ich heute als Fehler. Wenn ich mir überlege, welche Klasse meine Veranstaltungen damals hatten, mit Frank Bruno, John Mugabi, John Mundunga, Lotti Mwale, Chisanda Mutti. Das waren alles Weltklasseboxer. Ich habe mit denen mal in der Berliner Deutschlandhalle veranstaltet.
Das war am 23. Oktober 1982, als auch René Weller und Manfred Jassmann boxten.
Es kamen gerade mal 1800 Zuschauer. Frank Bruno zog bei seinen Kämpfen in England mehr als 10000 Zuschauer. Nach diesem Desaster habe ich mir damals gesagt, dass ich die Finger von Ausländern lasse.
Sehen es Sie tatsächlich als Fehler, Dariusz Michalczewski nicht unter Vertrag genommen zu haben? Damals war doch schon Henry Maske bei Ihnen.
Ja, heute sehe ich das so. Dariusz kam durch seine Kämpfe, durch seine Kampfkraft, gut beim Publikum an. Er hatte auch ab und zu seine Skandälchen dabei, dadurch wurde er immer bekannter.
Hätten Sie die Klitschkos genommen, wären Sie bei Ihnen zuerst vorstellig geworden?
Ich glaube nicht. Vielleicht, wenn ich sie kennengelernt hätte und sich dadurch Sympathie entwickelt hätte, dann möglicherweise. Aber ich sage einfach mal so, freiwillig hingelaufen wäre ich nicht.
Konnten Sie mit Klaus-Peter Kohl gut zusammenarbeiten?
Eigentlich schon. Man muss immer vorsichtig sein, das ist klar. Aber ich bin mit Peter gut ausgekommen. Ich hatte nie ein großes Problem mit ihm, eher er eines mit mir. Ich hatte nie den Drang, der Größte, der Schönste oder der Beste zu sein. Peter ist ein absoluter Machtmensch, und er konnte die Rolle, auch mal nur Zweiter zu sein, nicht akzeptieren. Ich glaube, das hat ihn innerlich auch zerfressen. Darüber habe ich immer nur gelacht. Solange meine Sachen gut laufen, interessieren mich andere Dinge eher weniger.
Warum kam es aber nie zu den Kämpfen, die alle gern gesehen hätten? Wie Maske gegen Michalczewski oder Ottke gegen Michalczewski? Schließlich war es auch möglich, dass Maske zwei Mal gegen Graciano Rocchigiani kämpfte.
Klar, hätten die Kämpfe kommen müssen. Aber zum einen gibt es das Problem der verschiedenen Fernsehsender, bei denen die Boxer unter Vertrag stehen, und dann gibt es das Problem der Finanzen. Man darf eines nicht vergessen, wenn Henry gegen einen Amerikaner geboxt hat, war die Halle voll, der Fernsehsender hat bezahlt, aber der Amerikaner hat nur einen Bruchteil dessen gekostet, was ein Dariusz Michalczewski verlangt hätte. In dem Moment war eine Finanzierungslücke da, und beide Boxer hätten nachgeben und für weniger Geld boxen müssen. Die Amerikaner sind da besser dran. Große Kämpfe werden im Pay-per-View gezeigt und die Einnahmen prozentual aufgeteilt. Unsere Fernsehsender zahlen aber nicht, wenn ein Henry Maske gegen Charles Williams oder Dariusz Michalczewski kämpft. Wir hatten auch keine zusätzlichen Einnahmequellen. Das internationale Fernsehen ist an solchen nationalen Kämpfen nicht interessiert. Die erwähnten Kämpfe hätten also nur stattfinden können, wenn alle finanzielle Abstriche gemacht hätten. Darüber wurde aber nie diskutiert.
Ist es Ihnen im Interesse des Boxens nie in den Sinn gekommen, nachzugeben?
Nein. Meinen Fernsehsender, der mein Partner ist, kann ich ja nicht enttäuschen. Boxen ist nun mal kein Fußball, wo man Rückspiele vereinbaren kann.
Rematches können Sie doch auch vertraglich festlegen.
Sicher, aber wer weiß schon, wie der erste Kampf ausgeht, vielleicht möchte den zweiten ja keiner mehr sehen, und jeder Sender möchte natürlich den ersten bei sich haben.
Was war Ihre größte Enttäuschung?
Torsten May, als er auf Mallorca gegen Adolpho Washington verlor.
Das war am 31. August 1996 im Duell um den vakanten IBF-Titel. Torsten wurde dabei schwer verprügelt und ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte eine Gehirnerschütterung und ein Blutgerinnsel im Kopf diagnostizierten.
An den Kampf darf ich nicht denken, das war schrecklich.
Gut zweieinhalb Monate vor dem wichtigsten Kampf seiner Profikarriere hatte sich Torsten zusammen mit seinem Bruder Rüdiger May von Manfred Wolke getrennt, um sich beim Engländer Darkie Smith auf das WM-Duell vorzubereiten. War das nicht ein großer Fehler?
Natürlich. Wir haben auch alles versucht, dass er das nicht tut. Aber was soll ich machen, wenn sich einer anders entscheidet? Es ist einfach töricht, ein paar Wochen vor einem Weltmeisterkampf zu einem Trainer zu gehen, den ich gar nicht kenne und der meinen Stil total umstellt.
Waren Sie vielleicht nicht konsequent genug mit Ihren Anweisungen?
Es sind mündige Jungs, erwachsene Männer, ich kann sie zu nichts zwingen. Mehr als einen gutgemeinten Rat kann ich nun mal nicht geben.
Auch Arthur Abraham hörte nicht auf Sie. Nach seinen drei Niederlagen im Super-Six-Turnier hatten Sie ihm gesagt, dass er wieder im Mittelgewicht boxen soll.
Ja, aber sein Trainer und er sagten, dass er das nicht mehr schafft – was soll ich da tun? Es hieß auch nach den Niederlagen, ich hätte sie dort reingetrieben. Dabei hatte ich beiden hunderte Male gesagt, nehmt euch einen Ernährungsberater, einen Mentaltrainer, doch sie wollten nicht. Ich bin nun mal kein Boxtrainer, deshalb hat Ulli Wegner auch mein absolutes Vertrauen, ich würde ihm nie irgendwo reinreden, ich kann nur Ratschläge erteilen. Wenn er meint, dass es anders besser ist, vertraue ich ihm. Am Ende muss er auch die Verantwortung in der Öffentlichkeit tragen.
Trotzdem waren Sie doch sicherlich nicht erfreut, dass Torsten May vor seinem WM-Kampf den Trainer wechselte?
Natürlich nicht. Torsten hat sich von seiner Familie treiben lassen. Sein Vater und sein Bruder waren die maßgeblich treibenden Kräfte. Rüdiger hatte wohl Probleme mit Manfred Wolke. Ganz ähnlich, als Marco Huck sich von Ulli Wegner trennte und zu Manfred Wolke nach Frankfurt (Oder) ging.
Das war nach Marcos Niederlage im ersten WM-Kampf gegen IBF-Titelverteidiger Steve Cunningham, als sein Trainer in der 12. Runde das Handtuch warf.
Ich war total dagegen, dass Marco sich von Ulli trennt. Doch die Jungs entscheiden und gehen ihren eigenen Weg. Vier Monate später kam Marco zurück zu Ulli. Übrigens wollte ich auch den Kampf von Axel gegen Klitschko nicht. Das sagte ich Axel mehrfach, denn ich hatte einen unterschriebenen Vertrag von Mike Tyson vorliegen.
Er hätte, so hieß es, am 8. April 2000 in Mailand für eine Million Dollar gegen Tyson antreten können. Schon ein Jahr vorher bekam er wohl das Angebot, den Ex-Weltmeister herauszufordern, doch das Duell platzte, weil Tyson am 5. Februar 1999 eine einjährige Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung antreten musste.
Sie haben ja sehr gut recherchiert. Ich glaube, das war tatsächlich so. Ich habe Axel immer gesagt, wenn er gegen Tyson verliert, nimmt ihm das keiner übel. Das wäre genauso wie gegen Foreman, als jeder im Vorfeld sagte, wie können Sauerland und Wolke nur zulassen, dass Axel gegen diese Legende boxt. Tyson war zu dieser Zeit auch schon über seinen Zenit hinaus. Er hätte erst Tyson boxen sollen und dann Klitschko. Er wollte aber einen anderen Weg gehen.
Torsten May bescherte Ihnen noch eine andere unliebsame Überraschung, als er im WM-Ausscheidungskampf am 13. Dezember 1997 in Düsseldorf gegen den Schweizer Stefan Angehrn plötzlich in der 9. Runde selbst aufgab.
Ich war völlig perplex. Es war eine Kopfsache, da kann man nichts machen. Ich mochte Torsten an sich gut leiden und sah ihn auch als Boxer immer sehr gern. Es war schade, dass er als Profi nicht mehr aus sich gemacht hat. Die Entscheidung, sich von Manfred Wolke zu trennen, kostete ihn im Grunde genommen seine ganze Karriere.
Nutznießer Ihrer Inkonsequenz war aber Henry Maske, denn er wollte ja entgegen Ihres Ansinnens nach der IBF-Titelverteidigung gegen Graciano Rocchigiani, die er umstritten nach Punkten gewann, den sofortigen Rückkampf, den er dann auch am 14. Oktober 1995 für sich entschied.
Stopp mal, Henry wollte den sofortigen Rückkampf gar nicht. Manfred wollte den Kampf, nicht Henry. Und ich war auch für den sofortigen Rückkampf.
Alles klar. Hatte denn Henry den ersten Kampf gegen Graciano gewonnen?
Für mich ja. Ich habe mir den Kampf noch etliche Male angeschaut. Er hatte am Anfang einfach zu viele Runden gewonnen. Ich weiß noch, dass ich Graciano nach der 8. Runde in die Augen geschaut habe, und da war nur noch Resignation zu sehen. Er hatte sich eigentlich schon aufgegeben. Dann glückte ihm ein harter Treffer, und Henry war am Ende, weil Graciano noch mal aufdrehte und die zweite Luft bekam.
In der Ringpause zur 10. Runde, behauptet Manfred Wolke, hätte Henry ihm gesagt, dass er nicht mehr weiterboxen möchte.
Ja, genau. Doch mit seinem beeindruckenden Willen hat er den Kampf noch über die Runden gebracht. Was die Leute immer vergessen ist, dass im Boxen nicht der Gesamteindruck zählt, sondern die Runden. Von diesen zwölf Runden hat von der Anzahl her Henry die meisten gewonnen. Die Runden, die Graciano gewann, gewann er klar, aber die Anzahl der Runden war auf Seiten von Henry. Deswegen war das Ergebnis zu vertreten. Das war aber auch der Grund, dass ich für den Rückkampf war und zu Henry sagte, sein Ruf sei so runter, dass wir das mit einem sofortigen Rückkampf auffangen müssten. Henry hat das hinterher anders erzählt, das weiß ich.
Hatten Sie keine Bedenken, dass Henry verlieren könnte und damit seine Karriere möglicherweise zu Ende wäre?
Nein, denn Henry ging in den ersten Kampf nicht mit der gewohnten Einstellung. Er wollte boxen, wie er es nicht konnte. Er wollte zeigen, dass er auch hauen kann, weil in den Kampf ein bisschen Hass reinspielte. Und er hatte Gracianos Kampfkraft unterschätzt. Graciano war ja ein Tier.
Sie sprachen sich immer gegen das Frauenboxen aus, doch seit November 2007 haben Sie die Norwegerin Cecilia Brækhus unter Vertrag, die mittlerweile Weltergewichts-Weltmeisterin der WBA, WBC und WBO ist. Warum taten Sie das?
Hagen Döring und mein Sohn Kalle hatten auf mich eingeredet, Cecilia unter Vertrag zu nehmen. Ich gab mein Einverständnis, wollte aber damit nichts zu tun haben. Inzwischen muss ich aber sagen, dass ich sie sehr gern boxen sehe. Sie ist eine ganz tolle Frau und nimmt das Boxen wirklich ernst. Sie ist aber die einzige Frau, die mir gefällt, wenn sie boxt, weil sie richtig schön boxen kann.
Wer Sie an Kampfabenden am Boxring sitzen sieht, fürchtet um Ihre Gesundheit. Sie wirken überaus nervös.
Um meine Gesundheit brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Die Aufregung werde ich niemals ablegen. Ich bin einfach so sehr bei der Sache. Wenn ich mir einen Boxkampf im Fernsehen anschaue, ist das nichts anders. Ich kann hinterher auch nicht gleich ins Bett gehen, weil ich so aufgewühlt bin, selbst wenn es nicht um meinen Boxer ging. Wenn ich Kämpfe sehe, bin ich immer mit dem Herzen dabei.
Bei welchem Kampf haben Sie am meisten gelitten?
Als Arthur Abraham mit doppelt gebrochenem Kiefer seinen IBF-Titel gegen Edison Miranda verteidigte.
War es richtig, dass Ringarzt Professor Walter Wagner den Kampf nicht abbrach?
Im Nachhinein ja.
Und in der heiklen Situation selbst? Der Kieferbruch passierte in der 4. Runde.
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, da muss man so nah dran sein wie Walter Wagner und Trainer Ulli Wegner, die sich beide Runde für Runde abgestimmt haben. Man muss aber auch sagen, dass es schlimmer aussah, als es in Wirklichkeit war. Der enttäuschendste Kampf war für mich aber der von Axel gegen Klitschko.
Nicht der von Torsten May gegen Adolpho Washington?
Nein, das war mein niederschlagendstes Erlebnis. Verlieren kann jeder, aber so wie Axel damals gegen Klitschko verlor, das war sehr deprimierend. Axel ging so sang- und klanglos unter, das war für mich eine riesige Schmach.
Zumal es auch ein Prestigeduell der beiden größten deutschen Boxställe war.
Das kam noch hinzu. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau einen Tag nach dem Kampf von Köln nach Berlin flog, weil sie dort eine kleine Operation hatte, und ich allein durch die Stadt ging und mich wirklich geschämt habe. Ich rief einen guten Freund an, traf mich mit ihm und trank einige Glas Rotwein. Zwischendurch rief ich Axel an, um ihn an einen TV-Termin zu erinnern. Er war bester Laune. Das war für mich, nach dem, was passiert war, völlig unverständlich. Es ging ja auch um seine Ehre. Seitdem habe ich Probleme mit Axel, wegen der Art und Weise, wie er sich hinterher verhalten hat. Im Nachhinein erfuhr ich auch, dass er in der Vorbereitung in Südafrika nicht so trainiert hatte, wie es mir immer erzählt wurde. Er hatte viele Tage gar nicht trainiert und öfter mal zum Weinglas gegriffen. Axel und sein Trainer haben mich da ganz schön in eine Falle laufen lassen. Ich war auch auf Manfred richtig sauer und habe einige Monate nicht mit ihm gesprochen.
Manch ein Boxer von Ihnen musste schon Punktrichterurteile hinnehmen, die sehr zweifelhaft waren. Verliert man da auf Dauer nicht den Glauben an das Gute im Boxen?
Nein, irgendwo gibt es immer eine ausgleichende Gerechtigkeit. Natürlich, wenn es gegen uns geht, ärgert man sich zu Tode. Beispielsweise war für mich Sylvester gegen Geale ein ganz enges Ding, das man in Deutschland ruhig Sylvester hätte geben können.
Sebastian Sylvester verlor seine IBF-Titelverteidigung gegen den Australier am 7. Mai 2011.
Aber es gab natürlich auch Urteile, von denen unsere Boxer profitierten. Bei engen und spannenden Gefechten gibt es immer Leute, die mit dem Urteil unzufrieden sind, keiner kann hundertprozentig objektiv sein.
So manches Stirnrunzeln gab es bei einigen Kämpfen Ihres »russischen Riesen«, Nikolai Walujew, Ihrem einzigen Weltmeister im Schwergewicht. Haben Sie wirklich daran geglaubt, ihn zum Champion in der Königsklasse zu machen?
Als ich ihn im Sommer 2003 unter Vertrag nahm, war das mein einziges Ziel. Schade nur, dass er nicht fünf Jahre vorher zu uns kam. Er wäre viel weiter gekommen, denn seit er bei uns war, hat er sehr viel dazugelernt. Vielleicht in den letzten paar Kämpfen nicht mehr, weil er auch ein bisschen faul wurde.
Am 17. Dezember 2005 enthronte der 2,13 Meter große und 147 Kilogramm schwere Hüne den amerikanischen WBA-Champion John Ruiz umstritten nach Punkten.
Was heißt umstritten? Niko hat für mich gewonnen. Es war ein echtes Highlight, zumal im Vorprogramm Laila Ali boxte und ihr Vater dabei zusah. Muhammad Ali bei einer Veranstaltung in Berlin als Zuschauer in der Halle zu haben, mehr geht doch nicht! Ich habe Niko auch sehr gern. Er wirkte zwar furchteinflößend, ist aber ein sensibler, feinfühliger Mensch, auf den die von Don King, der Niko mit mir zusammen promotete, erdachten Gewaltausdrücke in keiner Weise zutrafen. Niko und ich haben King ins Gebet genommen, dass er die Metaphern »King Kong« oder »The Beast from the East« nicht verwenden soll. Es hat mich auch mächtig gefreut für Niko, dass er unser Ziel erreicht hat, weil er selbst nicht damit rechnete. Stolz bin ich darauf, dass er heute im russischen Parlament sitzt und in Russland ein Werbestar geworden ist.
Wer war oder ist Ihr Lieblingsboxer?
Wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen sagen, aber ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen aber verraten, welcher mein bedeutungsvollster Kampf war.
Und zwar?
Der von Henry und Charles Williams, denn damit begann alles. Aber auch der erste Kampf von Sven Ottke gegen Charles Brewer war ein echtes Highlight. Oder Markus Beyers Sieg in England gegen Richie Woodhall. Das war wirklich großartig. Gigantisch war natürlich auch Axels Kampf gegen Foreman – es gab so viele Highlights. Wenn ich die deutschen Boxer mal ausblende, war für mich der größte Kampf überhaupt der von John Mugabi gegen Marvin Hagler.
Den aber Ihr unbesiegter Mittelgewichtler am 10. März 1986 in Las Vegas gegen den WBC-, WBA- und IBF-Weltmeister durch K.o. in der 11. Runde verlor.
Das war der Kampf der Kämpfe. John bot eine tolle Vorstellung. Ich treffe Marvin Hagler noch regelmäßig. Er betont, dass Mugabi mit sein härtester Gegner war.
Wie lange wird es Sauerland Event noch geben?
Ich hoffe, noch viele, viele Jahre. Ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Wir haben wieder eine Reihe junger deutscher Talente, wie Jack Culcay, Enrico Kölling, Dustin Dirks, Tyron Zeuge oder Robert Woge, die bestimmt ihren Weg gehen werden. Für einen Teil dieser Boxer fungiere ich als Manager und sorge dafür, dass sie behutsam aufgebaut werden. Das Promotergeschäft wird aber nicht mehr durch mich, sondern durch meine Söhne Kalle und Nisse und das Team gelenkt. Ich würde ihnen nie vorschreiben, wie sie was zu machen haben. Wenn die Jungs zu mir kommen und mich etwas fragen, sage ich, dass ich nur Empfehlungen ausspreche. Zu neunundneunzig Prozent nehmen sie meine Ratschläge aber auch an.
Wer war eigentlich Ihr Lehrmeister, von wem holten Sie sich Ratschläge für Boxgeschäft?
Am Anfang hat mir Mickey Duff aus England viel beigebracht, alles andere habe ich im Laufe der Jahre hinzugelernt. In den ersten zehn Jahren habe ich mich intensiv informiert und jedes Buch übers Boxen gelesen. Man darf nicht vergessen, wenn man früher einen Gegner suchte, konnte man nicht einfach auf boxrec.com gehen, wo man auf einen Schlag alle Kampfrekorde findet. Die musste man sich mühsam zusammensuchen. Heute ist das alles viel einfacher.
Sehen Sie sich als Reanimator des deutschen Profiboxens?
Dafür fühle ich mich nicht allein zuständig, daran haben viele mitgearbeitet. Vor allem Henry, Manfred, Axel und Torsten May. Aber auch Graciano Rocchigiani, Sven Ottke und Ulli Wegner. Und Peter Kohl mit seinen vielen guten Boxern. Jeder hatte seinen Anteil daran.
Pflegen Sie Kontakt zu Ihren nicht mehr aktiven Boxern?
Hin und wieder sehe ich einen. Ich lebe ja nicht mehr in Deutschland. Ich bin auch für meine alten Freunde kaum greifbar, komme nur noch zu Veranstaltungen. Früher war ich oft beim Training dabei. Wenn man 73 ist, geht das alles nicht mehr so.
Welche Ziele verfolgen Sie noch?
Große Ziele habe ich nicht mehr. Ich freue mich über jeden guten Kampf und auf jeden Jungen, der Erfolg hat und nach oben kommt. Wer einmal Boxfan war, bleibt es bis zum Lebensende.
Ihre Karriere als Boxpromoter und Manager hat sich im Grunde genommen am 13. Juni 2010 vollendet, als Sie in Canastota in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen wurden.
Wenn Sie so wollen, war das wirklich die Krönung. Ich bin seitdem mit meiner Frau auch immer bei den feierlichen Neuaufnahmen dabei gewesen. Es ist so schön, diese alten Haudegen zu treffen, sich in den Arm zu nehmen, miteinander entspannt zu reden. Es ist aber auch rührend, wie die alle miteinander umgehen, auch wenn sie im Ring Gegner waren. Ich glaube, das gibt es in keiner anderen Sportart.
Manfred Wolke
• Geboren: 14. Januar 1943 in Potsdam-Babelsberg
• Wohnort: Wustrow
• Trainer seit 1973
• Weltmeister: Henry Maske
• Olympiasieger im Weltergewicht 1968
Manfred, zitterte Ihre rechte Hand, als Sie am 8. März 1990 im Hotel Hamburg in Berlin bei Promoter Wilfried Sauerland Ihren ersten Profivertrag unterschrieben?
Was heißt zittern? Es war in jedem Fall sehr, sehr aufregend, schließlich war es ein ganz besonderer Tag in meinem Sportler- beziehungsweise Trainerleben, was natürlich auch für Henry Maske galt. Mit unseren Unterschriften besiegelten wir unseren Übertritt in eine neue Sportwelt, zu der wir uns hingesehnt hatten. Ich hatte schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass das mit den Profis etwas für mich sein könnte. Henry hatte ja alles gewonnen, was er als Amateur gewinnen konnte. Er war Olympiasieger, Amateur-Weltmeister und Europameister. Plötzlich kam der Fall der Mauer und für uns aus der DDR, für die der Profisport bislang auf dem Index stand, boten sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Für uns als Boxer gab es da nur eins: Profi werden.
Wann haben Sie entschieden, ins Profilager zu wechseln?
Im Grunde genommen schon im September 1989 bei den Weltmeisterschaften in Moskau, als Henry Weltmeister wurde. Ich werde nie die großen Augen von Fritz Sdunek vergessen, mit dem ich damals auf einem Hotelzimmer lag, als ich ihm bei der Feier nach Henrys Sieg sagte: »Ich habe die Nase voll von den Amateuren. Ich gehe mit Henry zu den Profis.« Er war regelrecht geschockt, wie er mir später erzählte, und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Die Mauer war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Medial wurden wir das erste Mal mit der Problematik konfrontiert durch einen Artikel in der Bild-Zeitung, die am 14. November 1989 schrieb: »DDR-Olympiasieger Maske will Profi werden.« So viel ich weiß, wurde das damals durch Wolfgang Wilke, den Trainer von Graciano Rocchigiani, lanciert. Kurze Zeit später, Ende November, Anfang Dezember in Manila, festigte sich dann mein Plan. Ich war damals als DDR-Auswahltrainer mit Henry, Axel Schulz und Andreas Otto bei einem Turnier in der philippinischen Hauptstadt. Wegen eines Militärputsches mussten wir eine Woche länger als geplant bleiben. In dieser Zeit durften wir unser Hotel nicht verlassen, also schauten wir die ganze Zeit Fernsehen. Dort sahen wir ständig die Werbung für den als Kampf des Jahres promoteten Fight Sugar Ray Leonard und Roberto Duran …
… den WBC-Champion Leonard einstimmig nach Punkten gewann.
Den Kampf sahen wir dann auf dem Flughafen in Los Angeles, wo wir auf unserem Rückflug zwischenlandeten. Der Gedanke, das auch mit meinen Jungs machen zu können, ließ mich fortan nicht mehr los. Zu Hause war die Mauer gefallen. Und es wurden auch schon Gerüchte gestreut, dass Henry zu den Profis wechseln würde. Mir war klar, dass dieses Boxen, was wir von Leonard und Duran sahen, ein anderes war als das, was wir bisher machten. Aber mir war ebenfalls klar, dass wir dort mit unserer Haltung, unserer Einstellung zum Sport ganz vorn mitmischen können. Als wir wieder zu Hause waren, stand für mich endgültig fest, wir wechseln zu den Profis. Deshalb habe ich meine Jungs auch nicht mehr bei den DDR-Meisterschaften boxen lassen, die eine Woche vor Weihnachten in Gera stattfanden. Es folgten die ersten Gespräche mit Promotern und Managern aus Westberlin. Mit einigen trafen wir uns auch. Wie mit Klaus-Peter Kohl, mit dem Henry und ich am 13. Januar im Hotel Interconti in Berlin sprachen. Zehn oder elf Tage später trafen wir uns mit Wilfried Sauerland. Der kam unseren Vorstellung von allen am nächsten. Er wirkte auf uns am seriösesten. Auf der Rückfahrt nach Frankfurt (Oder) sagte Henry zu mir, dass Sauerland derjenige ist, mit dem er arbeiten will. Das war auch meine Auffassung.
Es war also wie eine Liebe auf den ersten Blick?
Ich würde sagen: ja. Wilfried hat sich auf seine Menschenkenntnis verlassen und wir auf unsere. Anfangs war naturgemäß vor allem von seiner Seite eine gewisse Distanz da, schließlich war ich für ihn nur ein erfolgreicher Amateurtrainer. Viele angebliche Experten hatten ihn gewarnt und meinten, mit Maske kann Wolke Kämpfe nur versauen. Ausgelacht haben sie uns. Doch mich hat das nicht berührt. Wenige Tage nach unserem Treffen in Berlin kam Wilfried nach Frankfurt (Oder), wo wir alles festmachten. Er sah allerdings das Boxen etwas anders als wir. Ich fand im Gegensatz zu ihm nicht, dass das Boxen das fünfte Rad am Wagen sein muss. In vielen anderen Ländern war es das ja auch nicht. Boxen ist eine sehr leidenschaftliche, begeisternde Sportart. Ich habe nie gezweifelt, auch bei den Profis Weltmeister herauszubringen und das Profiboxen in Deutschland so zu profilieren, dass es von einem großen Publikum angenommen wird. Ich war immer erfolgsorientiert, mein Ziel mit dem Wechsel zu den Profis war, dass die Boxenthusiasten in Amerika sagen: »Mensch, da drüben in Germany sind ein paar Verrückte, deren Kämpfe müssen wir unbedingt sehen.« Ich wollte, dass sie so wie ich einst bei Cassius Clay nachts aufstehen und gucken. Das Schöne daran war, dass ich dafür durch den Vertrag mit Wilfried Sauerland die eigene Verantwortung trug.
Wollte Herr Sauerland Sie klein halten?
Nicht unbedingt klein halten. Er sah eben Boxen nicht so erfolgversprechend wie ich. Wenn man die richtigen Boxer und auch Persönlichkeiten in den Ring stellt, ist es doch wahnsinnig interessant.
Haben Sie Ihren ersten Vertrag noch?
Ja.
Und was steht drin?
Ich glaube, wir hatten für fünf Jahre unterschrieben. An Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern.
Bekamen Sie ein Gehalt?
Über die Bezahlung reden wir am besten nicht, die war bescheiden. Ich war ja ein Ossi. Ich bekam damals 2500 D-Mark im Monat. Geld hat in meinem Leben nie eine besondere Rolle gespielt. Wäre ich als Spitzentrainer beim ASK Vorwärts Frankfurt (Oder) geblieben, hätte ich das Doppelte verdienen können.
Aber Sie durften dort bleiben und in einem eigenen Gym mit Henry trainieren.
Das war das Schöne daran. Ich habe nur nach vorn geschaut und wollte bei den Profis das Gleiche erreichen wie bei den Amateuren. Drei Monate später kam dann auch noch Axel Schulz hinzu.
Sie waren ja selbst Olympiasieger und galten als erfolgreichster DDR-Trainer. Sie brachten 1980 in Moskau mit Federgewichtler Rudi Fink und 1988 in Seoul mit Mittelgewichtler Henry Maske zwei Olympiasieger heraus. Henry erkämpfte am 1. Oktober 1989 in Moskau sogar den einzigen Amateur-Weltmeistertitel eines DDR-Boxers.
Als Amateurtrainer hatte ich alles erreicht, deshalb kam mir die politische Wende und die damit mögliche neue Herausforderung gerade recht. Bei den Amateuren hatte ich immer Angst vor den drei Runden. Die waren immer so schnell vorbei, und hinterher denkst du dann, hättest du nicht hier und da anders reagieren können. Bei den Profis bietet sich eben viel mehr Zeit, um richtig aufzudrehen. Man kann zeigen, was man konzeptionell drauf hat. Plötzlich geht es darum, dass man sich durchsetzen und klug kämpfen kann. Boxen wird da zu einer richtigen Auseinandersetzung. Diejenigen, die dabei ihren Kopf einsetzen, die eine starke Persönlichkeit besitzen, sind letztlich auch die, die sich durchsetzen. So bin ich dann auch an die neue Herausforderung gegangen. Ich habe Kampfführung anders gestaltet, das Tempo weggenommen und einen Kampf über acht, zehn oder zwölf Runden aufgebaut. Die Physis musste auch eine andere sein als bei drei Mal drei Minuten. Ich war mir von Anfang sicher, dass ich die Belastung über zwölf Runden auch hinbekomme. Es war mir auch klar, dass ich mit meiner Auffassung vom Boxen erfolgreich sein werde. Obwohl mir das kaum einer zutraute. Ich werde nie das letzte Trainingslager mit der DDR-Nationalmannschaft auf dem Rabenberg vergessen. Es war im Januar 1990, ich bin damals mit Henry am 12. Januar noch einen Tag nach Hause gefahren, weil wir uns am nächsten Tag mit Klaus-Peter Kohl treffen wollten. Ein Trainer aus Gera warnte mich, mit Henry zu den Profis zu wechseln. Er sagte: »Was willst du mit dieser Gurke bei den Profis? Die lachen euch doch nur aus.« Ich muss aber auch sagen, dass Henry kein Talent war. Was er erreichte, erreichte er durch härteste Arbeit, durch extrem hohe Belastungen, die er wegstecken konnte, und durch seine imponierende Nervenstärke.
Wären Sie auch ohne Henry Maske zu den Profis gewechselt?
Ohne eigene Sportler hätte ich das nicht getan und auch nicht ohne Henry. Darüber habe ich aber nie nachgedacht.
Von wem ging denn die Initiative aus – von Ihnen oder Henry?





























