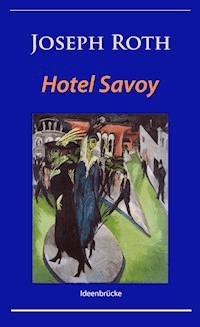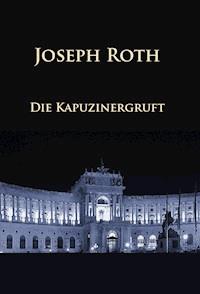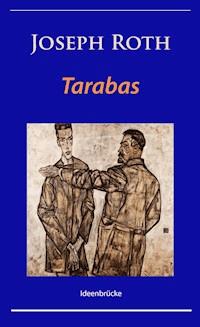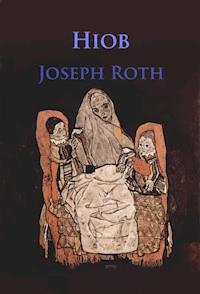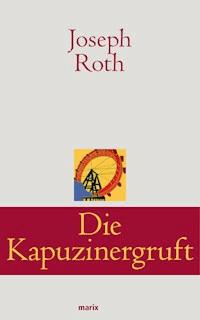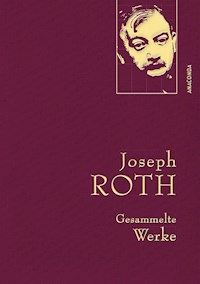Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Rechts und Links" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Bei Ausbruch des Krieges bricht Paul Bernheim seine Studien in Oxford ab. Er darf bei den Dragonern reiten, wird aber als Verpflegungsoffizier hinter die Front kommandiert. Tief enttäuscht wandelt er sich zum erbitterten Kriegsgegner. Im dritten Kriegsjahr dann gibt er seinen angenehmen Dienst auf und meldet sich freiwillig als Leutnant der Infanterie an die Ostfront. Paul wird verwundet. Als er das Spital verlässt, ist der Krieg vorbei und die Soldaten revoltieren. Paul trägt weiter seine Offiziersabzeichen und wird von Soldaten blutig geschlagen. Konservativ und patriotisch will er Karriere machen. Der jüngere Bruder Theodor verachtet ihn als Kriegsverlierer; sagt Paul ins Gesicht: "Wir werden keinen Krieg mehr verlieren". Auf Theodors Jackenärmel ist "ein Hakenkreuz angenäht". "Die Volksgenossen denken nach seiner Ansicht viel zu wenig an Deutschland." Die jüdische Herkunft seiner Mutter stört ihn. Antisemitisch und völkisch gesinnt, muss er ins Ausland fliehen. Unmittelbar vor der Flucht fordert Theodor von seinem Bruder Geld. Paul gibt nichts, sondern dessen neuer Geschäftsfreund Nikolai Brandeis zahlt. Brandeis' geschäftlicher Aufstieg ist unaufhaltsam. Joseph Roth (1894-1939) war ein österreichischer Schriftsteller und Journalist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rechts und Links
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
I
Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der Paul Bernheim versprach, ein Genie zu werden.
Er war der Enkel eines Pferdehändlers, der ein kleines Vermögen erspart hatte, und der Sohn eines Bankiers, der nicht mehr zu sparen verstand, aber vom Glück begünstigt wurde. Pauls Vater, Herr Felix Bernheim, trug ein sorgloses und hochmütiges Angesicht durch die Welt und hatte viele Feinde, obgleich ihn ein normaler Grad von Torheit befähigt hätte, von seinen Mitbürgern geschätzt zu werden. Sein ungewöhnliches Glück erweckte ihren Neid. Als hätte es das Schicksal darauf abgesehen, sie vollends zur Verzweiflung zu bringen, bescherte es ihnen eines Tages einen Haupttreffer.
Einen Haupttreffer pflegen die meisten geheimzuhalten wie einen Schandfleck in der Familie. Herr Bernheim aber, als hätte er Angst, man würde sein Glück nicht mit der nötigen Gehässigkeit zur Kenntnis nehmen verdoppelte seine demonstrative Geringschätzung für die Mitwelt, verringerte die ohnehin kleine Zahl der Grüße, die er täglich auszuteilen pflegte, begann, jenen, die ihn grüßten, mit verletzender und gleichgültiger Zerstreutheit zu erwidern. Nicht genug an all dem, ging er, der bis jetzt nur die Menschen herausgefordert hatte, auch daran, die Natur herauszufordern. Er bewohnte das geräumige Haus seines Vaters, nicht weit von der Stadt, an der großen Landstraße, die zum Tannenwald führte. Mitten in einem alten Garten lag das Haus, zwischen Obstbäumen, Eichen und Linden, gelb gestrichen, mit einem steilen, roten Dach und von einer mannshohen, grauen Mauer umgeben. Die Bäume, die am Rande des Gartens standen, überragten die Mauer, und ihre Kronen überwölbten die Landstraße bis zur Mitte. Seit alten Zeiten lehnten an der Mauer zwei breite, grüne Bänke, auf denen die Müden rasten konnten. Schwalben nisteten im Hause, in dem Laub der Bäume zwitscherte es an Sommerabenden – und die lange Mauer, die Bäume und die Bänke waren im heißen Staub der sommerlichen Straße ein guter und kühler Trost und versprachen an bitteren Wintertagen zumindest eine menschliche Nähe.
Eines Tages im Sommer verschwanden die grünen Bänke. Entlang der Mauer und höher als diese erhob sich ein nacktes Holzgerüst. Im Garten wurden die alten Bäume umgelegt. Man hörte, wie sie splitterten und krachten und wie ihre Kronen zum letztenmal rauschten, indem sie zum erstenmal die Erde berührten. Die Mauer fiel. Und durch die Löcher und Sparren des hölzernen Gerüsts sahen die Leute den kahl gewordenen Garten der Bernheims, das gelbe Haus, der brütenden Leere preisgegeben, und ein Unmut erfaßte sie, als wären es ihr Haus und ihre Mauer und ihre Bäume gewesen.
Einige Monate später stand an der Stelle des alten, gelben, giebeligen Hauses ein neues, weißes, strahlendes, mit einem steinernen Balkon, den ein Atlas aus Kalk auf seinen Schultern trug, mit einem flachen Dach, das an den Süden erinnern sollte, mit modischem Verputz zwischen den Fenstern, Engelsköpfchen und Teufelsfratzen abwechselnd unter dem First und einer geradezu pompösen Rampe, die würdig gewesen wäre, zu einem Oberlandesgericht, einem Parlament, einer Hochschule hinanzuführen. Statt der steinernen Mauer erhob ein dichtes Gitter aus weißlichgrauem Eisendraht scharf geschliffene Zinken gegen den Himmel, die Vögel und die Diebe. Langweilige runde und herzförmige Beete sah man im Garten, künstliche Rasen von einem dichten, kurzen, beinahe blauen Gras und dünne, hinfällige Rosenstöckchen, gestützt von hölzernen Latten. In der Mitte der Beete standen Zwerge aus gemaltem Ton, mit rötlichen Kapuzen, lächelnden Gesichtern, weißen Bärten, Spaten, Schaufeln, Hämmern, Gießkannen in den winzigen Händchen, ein ganzes Sagenvolk aus der Fabrik Grützer und Compagnie. Kunstvoll verschlungene Pfade ringelten sich wie Schlangen zwischen den Beeten, kiesbestreut und schon beim Anblick knisternd. Keine Bank weit und breit. Und obwohl man ohnehin draußen stand, wurde man in den Beinen müde vom Anblick dieser rastlosen Pracht, als wäre man stundenlang in ihr herumgewandert. Umsonst lächelten die Zwerge. Die dünnen Rosenstöckchen zitterten, die Stiefmütterchen sahen aus wie gemaltes Porzellan. Und selbst wenn der lange Schlauch des Gärtners zartes Wasser zerstäubte, verspürte man keine Kühlung, sondern wurde eher an die feinen und schwülen Flüssigkeiten erinnert, die der Billetteur im Kino über die entblößten Köpfe der Zuschauer rieseln läßt. Über dem Balkon ließ Herr Bernheim in goldenen, zackigen und schwer leserlichen Buchstaben die Worte »Sans souci« anbringen.
An manchen Nachmittagen sah man Herrn Bernheim zwischen den Beeten herumgehen und gemeinsam mit dem Gärtner die Natur vergewaltigen. Dann hörte man das zischende Schnappen der Gartenschere und das Krachen der kleinen Hecken, die frisch gepflanzt und kaum, daß sie zu wachsen begannen, schon ihr Dienstreglement kennenlernten. Niemals standen die Fenster des Hauses offen. Meist waren sie verhängt. An manchen Abenden sah man durch die gelben, dichten Vorhänge wandelnde und sitzende Schatten von Menschen, die Umrisse und die Lichtknoten eines Kronleuchters, und man ahnte, daß im Hause Bernheim ein Fest gefeiert wurde.
Die Feste der Bernheims verliefen in einer gewissen kühlen Würde. Der Wein, den man in ihrem Hause trank, verfehlte seine Wirkung, obwohl er von ausgewählter Herkunft war. Man trank ihn und wurde nüchtern. Herr Bernheim lud mit Vorliebe Gutsbesitzer aus der Umgebung ein, einige Herren vom Militär, immer Leute mit einem feudalen Einschlag und sehr gewählte Mitglieder der Industrie und der Finanz. Der Respekt vor seinen Gästen und die Angst, Haltung zu verlieren, hinderten ihn, fröhlich zu sein. Seine Gäste fühlten die Befangenheit ihres Wirtes und blieben den ganzen Abend, was sie beim Eintritt gewesen waren, nämlich korrekt. Frau Bernheim verstand Situationswitze nicht und fand Anekdoten nicht witzig. Sie war übrigens jüdischer Herkunft – und da die meisten Anekdoten, die unter ihren Gästen kursierten, mit den Worten begannen: »Ein Jude saß einmal in der Eisenbahn …«, fühlte sich Frau Bernheim auch verletzt, und sie geriet, sobald jemand Anstalten machte, eine kleine Geschichte zu erzählen, in ein trübes und verwirrtes Schweigen – aus Furcht, es könnte die Rede auf einen Juden kommen. Von seinen Geschäften mit den Gästen zu sprechen hielt Herr Bernheim für unpassend. Sie wieder hielten es für überflüssig, ihm von der Landwirtschaft, dem Militär, den Pferden zu berichten. Manchmal spielte Bertha, die einzige Tochter des Hauses und eine gute Partie, Chopin auf dem Klavier, mit der üblichen Virtuosität eines besser erzogenen Fräuleins. Manchmal tanzte man im Hause Bernheim. Eine Stunde nach Mitternacht gingen die Gäste nach Hause. Hinter den Fenstern die Lichter erloschen. Alles schlief. Nur der Wächter, der Hund und die Zwerge im Garten blieben wach.
Paul Bernheim ging, wie es in Häusern mit guten Kinderstuben üblich war, um neun Uhr abends schlafen. Mit seinem jüngeren Bruder Theodor teilte er das Zimmer. Paul blieb länger wach, er schlief erst ein, als es im ganzen Hause still geworden war. Er war ein empfindsamer Junge. Man nannte ihn »ein nervöses Kind« und schloß aus seiner Sensibilität auf seine besondere Begabung.
Diese zu zeigen, bemühte er sich in jungen Jahren. Als der Haupttreffer zu den Bernheims kam, war Paul, der Zwölfjährige, mit dem Verstand eines Achtzehnjährigen ausgestattet. Die rapide Verwandlung des gutbürgerlichen Hauses in ein reiches mit feudalen Aspirationen erhöhte seinen natürlichen Ehrgeiz. Er wußte, daß Reichtum und gesellschaftliche Geltung des Vaters den Sohn zu einer mächtigen »Position« führen können. Er ahmte den Hochmut seines Vaters nach. Er forderte Kollegen und Lehrer heraus. Er hatte weiche Hüften, langsame Bewegungen, einen vollen, roten, halboffenen Mund und weiße, kleine Zähne, eine grünlich schimmernde Haut, helle und leere Augen, beschattet von langen, tiefschwarzen Wimpern und lange, aufreizende, sanfte Haare. Lässig, zerstreut, lächelnd saß er in der Bank. Seine Haltung verriet den ständig wachen Gedanken: Mein Vater kann die ganze Schule kaufen. Ohnmächtig und klein standen die andern da, der Übermacht der Schule ausgeliefert. Er allein setzte ihr die Macht seines Vaters entgegen, seines Zimmers, seines angelsächsischen Frühstücks, des Ham-and-Eggs mit ausgelöffelten Orangen, seines Hauslehrers, dessen Nachhilfestunden er jeden Nachmittag zugleich mit Schokolade und Keks einnahm, seines Weinkellers, seines Wagens, seines Gartens und seiner Zwerge. Er roch nach Milch, Wärme, Seife, Bädern, Zimmergymnastik, Hausarzt und Dienstmädchen. Es schien, daß die Schule und ihre Aufgaben nur einen unwichtigen Teil seines Tages einnahmen. Mit einem Fuß stand er schon in der Welt. Das Echo ihrer Stimmen im Ohr, saß er wie ein Gast in der Klasse. Er war kein ganzer Kamerad. Manchmal holte ihn sein Vater ab. Im Wagen und eine Stunde vor Schulschluß. Am nächsten Tag brachte Paul ein Zeugnis vom Hausarzt.
Dennoch sah es manchmal so aus, als sehnte er sich nach einem Freund. Aber er fand keinen Weg. Immer stand sein Reichtum zwischen ihm und den andern. »Komm heut nachmittag zu mir, wenn mein Hauslehrer da ist – und er macht uns beiden die Arbeit«, konnte er manchmal sagen. Aber nur selten kam einer. Er hatte »mein Hauslehrer« betont.
Er lernte leicht und erriet vieles. Er las fleißig. Sein Vater hatte ihm eine Bibliothek eingerichtet. Er sagte manchmal, wenn es überflüssig war: »Die Bibliothek meines Sohnes!« oder zum Dienstmädchen: »Anna, gehen Sie in die Bibliothek meines Sohnes!« – obwohl es im Haus keine andere gab. Eines Tages versuchte Paul, seinen Vater nach einer Photographie zu zeichnen. »Mein Sohn hat ein frappierendes Talent«, sagte der alte Bernheim – und er kaufte Skizzierbücher, Farbenstifte, Leinewände, Pinsel und Öl, nahm einen Zeichenlehrer auf und begann, einen Teil des Dachbodens in ein Atelier umzubauen.
Zweimal in der Woche, am Vorabend, von fünf bis sieben, übte Paul mit seiner Schwester auf dem Klavier. Man hörte sie vierhändig spielen – immer wieder Tschaikowsky –, wenn man am Haus vorbeiging. Manchmal sagte ihm einer am nächsten Tag: »Ich habe dich gestern vierhändig spielen gehört!« »Ja, mit meiner Schwester! Sie spielt noch viel besser als ich.« Und alle ärgerten sich über das kleine Wörtchen »noch«.
Die Eltern nahmen ihn in Konzerte mit. Er summte dann Melodien, nannte Werke, Komponisten, Konzertsäle und die Dirigenten, die er nachzuahmen liebte. In den Sommerferien fuhr er in die weite Welt – damit er »nichts verlerne«, mit einem Hofmeister. Er fuhr in Berge, über Meere, an wildfremde Küsten, kam schweigsam und stolz zurück und begnügte sich mit hochmütigen Andeutungen, als setzte er die Kenntnis der Welt bei allen anderen voraus. Er hatte Erfahrungen. Alles, was er las und hörte, hatte er schon gesehen. Nützliche Assoziationen schuf sein flinkes Gehirn. Aus »seiner Bibliothek« bezog er überflüssige Details, mit denen er blendete. Sein Zettel mit »Privatlektüre« war der ausführlichste. Seine Lässigkeit wurde ihm »nachgesehen«. Sie warf keinen Schatten auf sein »sittliches Betragen«. Es wurde angenommen, daß ein Haus wie das Bernheimsche eine genügende Gewähr für gute Sitte böte. Widerspenstige Lehrer zähmte der Vater Pauls durch Einladungen zu einem »bescheidenen Abendessen«. Eingeschüchtert durch den Anblick des Parketts, der Bilder, des Dienstpersonals und der hübschen Tochter kehrten sie zurück in ihre kargen Behausungen.
Die Mädchen konnten Paul Bernheim keineswegs einschüchtern. Er wurde mit der Zeit ein flotter Tänzer, ein angenehmer Plauderer, ein wohldressierter Sportsmann. Im Laufe der Monate und Jahre wechselten seine Neigungen und seine Talente. Ein halbes Jahr galt seine Leidenschaft der Musik, einen Monat dem Fechten, ein Jahr dem Zeichnen, ein Jahr der Literatur und schließlich der jungen Frau eines Bezirksrichters, deren Bedarf an Jünglingen in dieser nur mittelgroßen Stadt kaum gedeckt werden konnte. In der Liebe zu ihr vereinigte er alle seine Talente und Leidenschaften. Für sie malte er Landschaften und weiße Kühe, für sie focht er, komponierte er, dichtete er Lieder über die Natur. Schließlich wandte sie sich einem Fähnrich zu, und Paul versenkte sich, um »sie zu vergessen«, in die Kunstgeschichte. Ihr beschloß er nun sein Leben zu widmen. Er konnte bald keinen Menschen sehn, keine Straße, kein Stückchen Feld, ohne einen berühmten Maler und ein bekanntes Bild zu zitieren. In der Unfähigkeit, etwas unmittelbar aufzunehmen und einfach zu bezeichnen, übertraf er schon in jungen Jahren alle Kunsthistoriker von Rang.
Aber auch diese Leidenschaft erlosch. Sie machte einem gesellschaftlichen Ehrgeiz Platz. Sie hatte vielleicht nur zu diesem übergeleitet. Sie war die Hilfswissenschaft einer gesellschaftlichen Karriere. Einen gewissen selig naiven, charmanten und fragenden Augenaufschlag mochte Paul Bernheim ganz bestimmten Heiligenbildern abgeschaut haben. Es war ein Blick, der halb den Menschen traf und ein wenig den Himmel streifte. Die Augen Pauls schienen das Licht des Himmels durch ihre langen Wimpern zu filtrieren.
Mit derlei Reizen ausgestattet, mit einem an der Kunst und ihren Kommentaren geschulten Geschmack stürzte er sich in das gesellige Leben der Stadt, das in der Hauptsache aus den Bemühungen der Mütter bestand, ihre heranwachsenden Töchter zu verheiraten. In allen Häusern, in denen Mädchen lebten, war Paul gerne gesehen. Er konnte jeden Ton anstimmen, der gerade verlangt wurde. Er glich einem Musikanten, der alle Instrumente des Orchesters beherrscht und der es versteht, mit Anmut falsch zu spielen. Eine Stunde lang konnte er gescheite (erdachte und erlesene) Dinge sagen. Eine Stunde später zeigte er einen warmen, lächelnden Plaudereifer, trug er zum zehntenmal eine platte Anekdote vor, stattete sie immer wieder mit einem neuen Zug aus, liebkoste er mit der Zunge einen banalen Aphorismus, hielt ihn noch eine Weile zwischen den Zähnen, schmeckte ihn mit den Lippen nach, brachte er mit leichtem Gewissen Witze vor, die andern gelungen waren, machte er sich schamlos lustig über abwesende Altersgenossen. Und die Mädchen kicherten, ein nacktes Kichern, sie entblößten nur ihre Zähne, aber es war, als enthüllten sie ihre jungen Brüste, sie schlugen nur die Hände zusammen, aber es war, als spreizten sie die Beine, sie zeigten ihm Bücher, Bilder und Notenhefte, aber es war, als schlügen sie ihre Betten auf, sie richteten sich das Haar, aber es war, als lösten sie es. Um jene Zeit fing Paul an, ins Bordell zu gehn, zweimal in der Woche, mit der Regelmäßigkeit eines alternden Beamten, um dann von der Köstlichkeit erfundener Mädchenkörper zu erzählen, die er natürlich mit berühmten Bildern verglich. Er berichtete Geheimnisse von der und jener Haustochter und beschrieb Brüste, die er gesehen und gefühlt haben wollte.
Immer noch malte, zeichnete, komponierte und dichtete er. Als seine Schwester sich verlobte – mit einem Rittmeister übrigens, – machte er ein längeres Gelegenheitsgedicht, vertonte, spielte und sang es. Später – weil sein Schwager Interesse für Maschinen hatte – begann auch Paul, sich für die Technik zu interessieren und den Motor seines Autos – es war eines der ersten in der Stadt – eigenhändig zu zerteilen. Schließlich nahm er Reitstunden, um seinen Schwager in der Reitallee im Tannenwäldchen zu begleiten. Die Bürger der Stadt fingen an, nachsichtiger dem alten Herrn Bernheim gegenüber zu werden, weil es ihm gelungen war, der Heimat ein Genie zu schenken. Manch einer von den Feinden Bernheims, der sich lange Zeit verletzt gefühlt hatte, begann, weil in seiner Familie indessen eine heiratsfähige Tochter heranwuchs, Felix Bernheim wieder untertänig zu grüßen.
Um jene Zeit verbreitete sich das Gerücht, daß Herrn Bernheim eine große Auszeichnung bevorstehe. Einige sprachen von einer Erhebung in den Adelsstand. Es war lehrreich, zu beobachten, wie diese Aussicht auf den Adel Bernheims die Gehässigkeit seiner Gegner beruhigte. Der zukünftige Adel Bernheims erschien als eine ausreichende Erklärung für den Hochmut des Bürgerlichen. Man kannte nunmehr die wissenschaftliche Grundlage seines Stolzes und fand ihn also berechtigt. Denn nach der Meinung der Stadt war die Arroganz die Zierde des Adligen, des Geadelten und sogar noch desjenigen, der bald geadelt werden sollte.
Es ist unbekannt, welche wirklichen Grundlagen jenes Gerücht hatte. Vielleicht wäre Herr Bernheim nur ein Geheimer Kommerzienrat geworden. Aber da ereignete sich etwas Unerwartetes, Unwahrscheinliches. Eine Geschichte, die so banal ist, daß man sich schämen würde, sie zum Beispiel in einem Roman zu erzählen.
Eines Tages kam ein Wanderzirkus in die Stadt. Während der zehnten oder elften Vorstellung geschah ein Unfall: Eine junge Akrobatin fiel vom Trapez, gerade in die Loge, in der Herr Felix Bernheim saß – allein (denn seine Familie hielt Zirkusvorstellungen für vulgäre Spektakel). Man erzählte später, Herr Bernheim hätte die Künstlerin »geistesgegenwärtig« in den Armen aufgefangen. Aber das ist nicht genau festzustellen – ebensowenig, wie jenes Gerücht noch zu kontrollieren ist, das wissen will, er hätte sich seit der ersten Vorstellung für das Mädchen interessiert und ihr Blumen geschickt. Sicher ist, daß er sie ins Krankenhaus brachte, sie besuchte und sie nicht mehr mit dem Zirkus abreisen ließ. Er mietete ihr eine Wohnung und hatte den Mut, sich in sie zu verlieben. Er, der Stolz des Bürgertums, der Anwärter auf den Adelsstand, der Schwiegervater eines Rittmeisters, verliebte sich in eine Akrobatin. Frau Bernheim erklärte ihrem Mann: »Du kannst deine Mätresse ins Haus nehmen, ich fahre zu meiner Schwester.« Sie fuhr zu ihrer Schwester. Der Rittmeister ließ sich in eine andere Garnison versetzen. Das Haus der Bernheims war nur noch von den zwei Söhnen und den Dienstboten bewohnt. Die gelben Gardinen hingen monatelang vor den Fenstern. Der alte Bernheim allerdings veränderte sein Gehaben nicht. Er blieb hochmütig, er trotzte aller Welt, er liebte ein Mädchen. Von seiner Auszeichnung war keine Rede mehr.
Es war vielleicht die einzige mutige Tat, die Felix Bernheim in seinem Leben gewagt hatte. Später, als sein Sohn Paul eine ähnliche hätte wagen können, dachte ich an die des Vaters, und es wurde mir wieder einmal an einem Beispiel klar, wie die Tapferkeit sich im Ablauf der Geschlechter erschöpft und um wieviel schwächer die Söhne sind, als die Väter waren.
Das fremde Mädchen lebte nur ein paar Monate in der Stadt. Als wäre sie nur zu dem Zweck vom Himmel gefallen, um Felix Bernheim noch in den letzten Jahren seines Lebens zu einer mutigen Handlung zu verführen, ihm noch einen flüchtigen Schimmer Schönheit zu schenken und seine echte Erhebung in den natürlichen Adelsstand zu vollziehen. Eines Tages verschwand das Mädchen. Vielleicht – wenn man einen romanhaften Abschluß dieser romanhaften Geschichte will – kam der Zirkus wieder in die Gegend, und das Mädchen sehnte sich schon nach ihrem Trapez. Denn auch die Akrobatik kann eine Berufung sein.
Frau Bernheim kehrte zurück. Das Haus belebte sich mäßig. Paul, den das Abenteuer seines Vaters traurig gemacht hatte, weil die erwartete Auszeichnung ausgeblieben war und weil der Rittmeister verschwand, erholte sich später schnell und fand sogar eine Freude an der Tatsache, daß »sein Alter doch ein Kerl« sei.
Im übrigen bereitete er seine Abreise vor.
Bald durfte er ein neues Leben beginnen.
II
Er bestand – wie vorauszusehen war – das Abitur mit Auszeichnung. Von nun an trug er ein paar neue Anzüge. Die alten Schülerkleider schienen ihm ungesund, wie Gewänder, die man während einer langen, epidemischen Krankheit getragen hat. Die neuen Anzüge waren locker, hell, von unbestimmter Färbung, weich und haarig, leicht und warm. Die Stoffe kamen aus England, dem Land, in das Paul Bernheim gehen wollte.
Keiner von all den jungen Leuten ging nach England. Ein einziger, der die zage Absicht äußerte, in Paris »perfekt Französisch« zu erlernen, erschien den andern verdächtig. Aber der alte Bernheim hatte einmal in einer Gesellschaft gesagt: »Meinen Sohn schicke ich in die Welt, sobald er das Abitur hat!« Und die Welt war für einen gewissen Kreis von gehobenen Bürgern England.
Diese Herren ließen schon seit einigen Jahren ihre Anzüge aus England kommen, waren Mitglieder von Flottenvereinen, rühmten die britische Politik und die britische Verfassung, trafen König Eduard den Siebenten oft und wie von ungefähr auf der Marienbader Promenade, machten Geschäfte mit Engländern, tranken Whisky und Grogs, obwohl ihnen Pilsner Bier schmeckte, schlossen sich in Klubs zusammen, obwohl sie sich lieber im Kaffeehaus getroffen hätten, simulierten Schweigsamkeit, obgleich sie beredt von Natur waren, wurden Sammler von verschiedenen nutzlosen Gegenständen, weil sie sich einbildeten, ein wohlgeborener Mann müsse einen »Spleen« haben, trieben Gymnastik in den Morgenstunden, verbrachten den Sommer an den Küsten und auf den Meeren, um eine salzluft-und windgerötete Haut zu bekommen, und erzählten Wunder vom Londoner Nebel, der Londoner Börse, den Londoner Polizisten. Manche gingen so weit, »well« statt ja zu sagen und englische Zeitungen zu abonnieren, die viel zu spät kamen, als daß man aus ihnen noch Neuigkeiten hätte erfahren können. Aber die Abonnenten nahmen Ereignisse, die sie noch nicht auf englisch gelesen hatten, vorläufig nicht zur Kenntnis. »Warten wir ab!« sagten sie, wenn etwas geschah, »morgen kommt die Zeitung.« Ihre Kinder lernten Englisch wie Deutsch sprechen. Und eine Zeitlang sah es aus, als wüchse eine kleine angelsächsische Nation mitten in der Stadt heran, um sich gelegentlich freiwillig dem britischen Imperium einverleiben zu lassen. Man mußte in dieser Stadt, die einen durchaus kontinentalen Charakter hatte, in der niemals die Spur von einem Nebel zu ahnen war, so essen, trinken, gekleidet sein wie an den meerumrauschten Küsten von England.
Sobald Paul seine englischen Anzüge ein paar Wochen getragen hatte, erklärte er, einige Jahre in England bleiben zu wollen. Und wahrscheinlich in der Angst, man könnte den Wert eines Studiums und eines Lebens in England leicht unterschätzen, erzählte er: »Die Bedingungen, in ein englisches College zu kommen, sind gar nicht so leicht, wie man sich einbildet. Ein Ausländer muß überhaupt von zwei repräsentativen Engländern empfohlen werden, sonst kommt er im Leben nicht hinein! Und vor allem muß man sich tadellos benehmen können, was bei uns ja leider so selten ist! Ich gehe nach Oxford! Nächste Woche übe ich mich noch im Schwimmen.«
Es klang, als hätte er die Absicht, das College schwimmend zu erreichen.
Da nach der Vorstellung, die er sich von den Engländern machte, mit Kunstgeschichte bei ihnen wenig auszurichten war und sie eine sozusagen praktische Veranlagung hatten, beschloß er, Staatswissenschaften zu studieren, Geschichte und Jurisprudenz. Von den Bildern und Malern war keine Rede mehr. Ehe man es sich versah, standen alle wissenschaftlichen Werke, die er brauchte, in seiner Bibliothek. Aus den Prospekten wußte er bereits, wie es in Oxford zugeht. Er erzählte Geschichten aus Oxford, als wäre er von dort hergekommen und nicht erst im Begriff, eben hinzugehen. Merkwürdiger aber noch als die Tatsache, daß er von den Colleges mit der Autorität eines langjährigen Kenners sprach, war das Interesse und die Gläubigkeit der Leute, die ihn fragten. Und nicht nur er, sondern auch sein Vater erzählte von Oxforder Studien, und alle Mitglieder des Klubs, dem der alte Bernheim angehörte, zitierten zu Hause den Stundenplan von Oxford. Und alle heiratsfähigen Mädchen erzählten einander: »Paul geht nach Oxford!« Sie sagten Paul, ebenso wie ihn eine ganze Schicht des Bürgertums nannte. Er war ihr Liebling. Es ist das Schicksal der liebenswürdigen Männer, von fremden Menschen beim Vornamen gerufen zu werden.
Paul fuhr nach Oxford, an einem schönen Junitag, von einigen jungen Damen zur Bahn begleitet. Seine Eltern hatten schon eine Woche früher die Stadt verlassen, waren in die Sommerferien gefahren, weil Pauls Mutter erklärt hatte: »Ich will nicht zurückbleiben, wenn Paul für so lange Zeit von uns wegfährt! Wenn ich unterwegs bin, fällt es mir leichter.« Paul trug einen seiner Anzüge von unbestimmter Färbung, hielt eine kurze Pfeife im linken Mundwinkel und stand, eine Figur aus einer Modezeitschrift, am Kupeefenster. Während der Zug aus der Halle rollte, warf er mit bewundernswerter Geschicklichkeit den drei schönsten Mädchen je eine Rose zu. Nur eine einzige fiel zu Boden, das Mädchen bückte sich, und als es wieder aufblickte, war Paul bereits außer ihrer Sichtweite. Er war endgültig fort, und die Stadt schien es an diesem stillen Sommerabend zu fühlen. Sie war traurig.
In gewissen Abständen kam an den und jenen ein Brief von Paul Bernheim. Es waren Musterbriefe. Gentleman-Briefe. Auf dreifach gefaltetem Papier, das an pergamentene Urkunden erinnerte und an dessen linkem oberem Rand in erhabenen Buchstaben Pauls Monogramm in dunkelbläulicher Tönung glänzte, marschierten die breiten Antiqualettern, ein wenig verwöhnt, ein wenig gespreizt, in großen Abständen und mit breiten Rändern. Der Absender nannte sich nie auf dem Umschlag. Ungefähr in der Mitte der Kuverts erhob sich in dunkelbläulichem Siegellack das Monogramm, ein P, das im Bauch des B kunstvoll eingelagert war wie eine Frucht im Mutterleib. In diesen Briefen herrschte meist ein sehr allgemeiner konventioneller Ton. Fachausdrücke aus dem Gebiete des Sports, erschütternd fremde Bezeichnungen für Ruder-und Segelboote wechselten mit vornehmen Familiennamen ab, und kurze, einsilbige Rufnamen der Kameraden, Bob, Tedd und Pitt, waren wie Knallerbsen in die Texte eingestreut.
Eines Tages ließ er sich in London von einem Konsulararzt in die Armee einreihen. Er bekam einige Jahre Aufschub. Selbstverständlich wurde er der Kavallerie zugeteilt.
Seine Aufnahme in den Soldatenstand teilte er folgendermaßen mit:
»Also, mein Lieber, nun ist es soweit! Kavallerie, hoffe Dragoner. Altem sofort telegraphiert. Zwei Jahre Aufschub, bis dahin reite ich echtes Wildwest. Habe hier Gaul gekauft, Kentucky getauft, leckt mir das Gesicht, hat Charakter wie ein Kater. Arzt war großartig, war auch der schönste Bursche da oben, Kunststück, die andern lauter Handelsangestellte, ein einziger Arbeiter. Armselige Rasse. Dennoch genommen. Als wäre Krieg. Dann zwei Tage London geblieben, rumgetrieben in finstersten Winkeln. Wieder mal Frauen gesehen, nach der langen Klostermoral im College. An den Katecheten gedacht, war doch ein famoser Mann. Lebt er noch? Also, mein Alter, noch ein Jahr, dann bin ich zwei Wochen zu Hause. Muß rasch hinaus, üben zur nächsten Woche! Monströs! Fechtturnier mit Ball anschließend. Habe Tanz fast ganz verlernt, muß neu ran. Du siehst, allerhand zu tun. Gut Glück und Prosit!«
Er schrieb ähnliche Briefe nach Hause. Es schien, daß er eigentlich gar nichts mitzuteilen hatte und daß seine Korrespondenz nur die unerbittliche Folge eines Stundenplans im College war, in dem das Schreiben an die Lieben daheim ebenso ein Gebot war wie das Fechten und Rudern.
»Ich möchte nur wissen«, sagte der alte Bernheim im Klub, »wann die Bengel Zeit haben zu lernen! Von der Wissenschaft schreibt er gar nichts.«
Der Fabrikant Lang, der die »besten Beziehungen« zu England hatte, ließ keinen Zweifel an der Unterrichtsmethode der Colleges zu und meinte, nicht ohne eine gelinde Indignation zu zeigen:
»Die Engländer werden schon wissen, was sie zu tun haben! Sehen Sie sich bitte die englischen Herren an, die wissen mehr als wir. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, sehen Sie, das ist das Prinzip.«
»Mens sana in corpore sano«, riefen darauf hastig vier oder fünf Herren auf einmal, und sie riefen es so durcheinander, daß es nur einem gelang, das Zitat zu Ende zu sprechen. Der Herr Lang, dem es leid tat, daß er die klassische Weisheit nicht selbst in der Ursprache vorgebracht hatte, beeilte sich, die Karten auf den Tisch zu werfen und zum ersten Male seit Jahren wieder »Alea iacta est!« zu sagen. Somit war festgestellt, daß alle angelsächsisch orientierten Herren vollkommene Humanisten waren.
Und das Tarock begann.
Es ist vielleicht günstig, bei dieser Gelegenheit nachzutragen, daß jenes amouröse Abenteuer des alten Herrn Bernheim kaum ein paar Wochen nach dem Verschwinden der Künstlerin aus dem Gedächtnis der Menschen spurlos verweht war. Es war geradezu eine Leistung an Vergeßlichkeit, wenn man die immerhin noch beträchtliche Anzahl der Feinde und der Neider Felix Bernheims in Betracht zieht. Beinahe hätte man daraus schließen können, daß die Menschen es nicht gerne haben, wenn selbst eine ihrer ungeliebten Autoritäten Gefahr läuft, sich zu blamieren. In der Tat hatte die Geschichte keine anderen Folgen von Dauer gehabt als die Versetzung des Schwiegersohnes und die Übersiedlung der Tochter. Frau Bernheim residierte längst wieder in ihrem rechtmäßigen Heim. Vielleicht behielt sie noch eine Bitterkeit gegen ihren Mann in ihrem Herzen. Aber sie verhielt sich »musterhaft«, wie man damals von ihr sagte, und sie verriet gar nichts. Sie hatte einen beschränkten, aber innerhalb seiner engen Grenzen sehr gut funktionierenden Verstand. Allerdings war sie oft geneigt, ihn zu überschätzen. Es kam vor, daß sie eine Meinung über einen Minister äußerte, über einen Dichter, über die Renaissance und über die Religion – – und über alles in der gleichen geringschätzenden Weise, mit der sie vom Hauspersonal zu sprechen gewohnt war. Es kam vor, daß sie mit verwöhnter Stimme eine Torheit sagte, die man gewiß sympathisch und sogar charmant gefunden hätte, wenn sie dreißig Jahre jünger gewesen wäre. Ja, es schien, daß ihr hübscher, kräftiger Mund einmal so lange alle Welt mit Dummheiten entzückt hatte, daß seine Besitzerin allmählich den Glauben gewann, es wäre charmant, sich in alles zu mischen, was sie nicht kannte. Sie vergaß, daß sie eine alte Frau geworden war. Sie vergaß es so sehr, daß immer noch, trotz ihrer ergrauenden Haare, die sie sachte nachzufärben begann, in den Augenblicken, in denen sie einen törichten Satz aufsagte, ein alter mädchenhafter Glanz in ihre schlaff gewordenen Züge kam, wie durch ihre Vergeßlichkeit heraufbeschworen, und daß man für die Dauer einer Sekunde den lieben Schatten ihrer Jugend über ihr Angesicht wehen sah. Aber der Schatten verschwand sehr schnell, und der Klang der Dummheit schwebte lange im Zimmer. Die Bestürzung der Zuhörer dauerte und wuchs noch, sobald Herr Bernheim den vergeblichen Versuch machte, die Situation durch einen geschmacklosen Witz zu retten. Seit wie vielen Jahren geriet er immer wieder in die gleiche Verlegenheit! Er allein unter allen Anwesenden wußte, wie erschreckend der Unterschied zwischen dem naiven Wort war, das einmal die blühenden Lippen seiner Frau geboren hatten, und demselben naiven Wort, das jetzt den erblaßten entfuhr. Er erschrak und machte einen Witz, wie einer einen Schrei ausstößt, wenn er erschrickt. Die Frau Bernheim aber wurde bei solchen Gelegenheiten »indigniert«. Sie schmollte, wie sie es einst in der Jugend mit soviel Erfolg getan haben mochte, und sie erschien infolgedessen um weitere zehn Jahre gealtert. Übrigens glaubte sie, ein gutes Recht auf weise Meinungen zu haben. Sie war überzeugt, daß die »Bildung« – von der sie sehr viel hielt – nicht nur ein Vorrecht der besseren Stände wäre, sondern auch ihr Erbteil und daß es genügte, einen reichen Mann zu haben und einen Sohn, der »eine Bibliothek« besaß, um über gebildete Themen sprechen zu können.
Sie war einmal hübsch gewesen, und man hatte sie verwöhnt. In ihrem breiten, sauber geschnittenen Gesicht – sie hatte das gleiche Haar und die gleiche Hautfarbe wie ihr Sohn Paul – lag eine unerschütterliche Ruhe, die kalte, unzugängliche Ruhe, die an ein geschlossenes Tor erinnerte, nicht etwa an die freie eines einsamen Landes. Ihr Gesicht kannte keine Sorgenfalte, schien schon die Falten des Alters als eine Beleidigung und als fremde, ungebetene Gäste zu empfinden. Ihre blanken, grauen, koketten Augen blickten werbend und feindselig zugleich. Man hätte ihren Blick für einen »königlichen« halten können – und dafür hielt sie ihn selbst –, wenn er nicht so deutlich verraten hätte, woran er sich übte: an Vorhängen, Kleidern, Ringen und Kolliers, sogenannten »Interieurs«, und an den Gegenständen des Haushalts. Ja, an den Gegenständen des Haushalts. Denn die Frau Bernheim hatte neben dem Ehrgeiz, »fürstlich« zu wohnen und eine »königliche Erscheinung« abzugeben, auch noch den, eine »bescheidene Frau« zu sein. Wenn sie vor Weihnachten überflüssige Stickereien an überflüssigen Decken anbrachte, um irgend jemanden zu »überraschen«, so war sie überzeugt, eines jener Opfer zu bringen, das die Tugend der Sparsamkeit bestätigt, und sie bereitete sich einen süßen, angenehmen Schmerz, der fast so wohltat wie Weinen. »Sieh her, Felix«, sagte sie, »die Frau Lang macht das sicher nicht selbst.«
»Du brauchst es ja auch nicht zu tun –«, erwiderte Felix.
»Wer soll’s denn machen? Willst du ein Vermögen dafür zahlen?«
»Ich kann überhaupt darauf verzichten.«
»Ja, und wenn’s nicht da wäre, würdest du ein Gesicht machen!«
»Sieh lieber die Knöpfe an meinem Winterrock nach – heute ist mir einer heruntergefallen.«
»Gib ihn her!« sagte darauf die Frau Bernheim erfreut. »Auf die Lisi ist ja doch kein Verlaß! Alles, alles muß man selbst machen!«
Und mit dem heiteren Seufzer, der die Arbeit schwerer erscheinen läßt, sie kostbarer macht und das Gewissen der Arbeiterin beruhigt, begann Frau Bernheim, den Knopf zu befestigen.
»Paul schreibt mir«, begann sie auf einmal, »daß du ihm zu wenig schickst!«
»Ich weiß, was ich tu’!«
»Ja, aber du kennst nicht Oxford!«
»Du kennst es nicht besser.«
»So?! Mein Vetter Fritz, war er nicht an der Sorbonne?«
»Das ist ganz was anderes, und überhaupt ist das gar nichts!«
»Aber Felix, ich bitte dich, sei nicht grob!« Und Felix überlegte, ob er vielleicht grob gewesen war. Er schwieg. Schließlich hatte Frau Bernheim alles vergessen.
»So, jetzt sitzt der Knopf ewig!« sagte sie mit der Freude eines Kindes. Und man ging schlafen.
Von Theodor, dem jüngeren Sohn, war selten die Rede. Da er dem Vater ähnlicher war als der Mutter – wenigstens behauptete es Frau Bernheim bei jeder Gelegenheit –, schätzte man ihn im Hause nicht als »genial« wie seinen Bruder. Denn Frau Bernheim hielt ihren Mann für ein Glückskind. Sie traute ihm keine Kenntnisse zu und auch nicht die Fähigkeit, welche zu erwerben. Sie hatte die Geringschätzung für Geschäfte und Kaufleute, die manche Töchter gutbürgerlicher Familien in den neunziger Jahren zugleich mit ihrer Bildung mitbekamen, mit der Aussteuer, dem Klavierspiel und der Belletristik. Nach der Ansicht der Frau Bernheim rangierte etwa ein Staatsbeamter über einem Bankier, war ein Finanzmann unfähig, »Kultur« anzunehmen. Da ihr Vetter Rechtsanwalt gewesen war, blieb in ihren Augen ihre Ehe für ewige Zeiten eine Mesalliance. In jüngeren Jahren hatte sie noch hie und da daran gedacht, ihren Mann mit einem Akademiker oder einem Offizier zu betrügen, um durch einen Beischlaf mit einem gesellschaftlich Würdigeren eine Genugtuung für die Hingabe an einen gewöhnlichen Bankier zu erlangen. Wenn man hörte, wie Frau Bernheim, die natürlich ihre »Nerven« hatte, die Worte »Aber Felix!« ausrief, wie sie, wenn der Wind ein Fenster oder eine Tür zuschlug, über »dieses laute Haus« jammerte, oder wenn ihr Mann zufällig einen Stuhl umwarf, ihm »Benimm dich vorsichtiger!« sagte, so konnte man in diesen Wendungen die unermeßliche Kränkung erkennen, die das Schicksal der Frau Bernheim zugefügt hatte.
Und dennoch wußte sie oft ihrem Mann einen überraschend guten Rat zu geben, geschäftliche Gefahren vorauszusehen, böse Absichten gewisser Personen zu wittern, ein hellsichtiges Mißtrauen gegen Dienstleute, Rechnungen, Lieferanten zu hegen, Ordnung im Haus zu halten, Sommerreisen zu organisieren und in Schaffnern, Seeoffizieren und Hotelpersonal einen Respekt zu erzeugen. Sie besaß einen animalischen Haus-und Familieninstinkt, er war die Quelle ihrer Vorsicht, ihrer Klugheit und auch ihrer Güte, die allerdings ihre Grenze an dem dichten Drahtgitter des Gartens fand.
Außerhalb des Gitters begann ihre Härte, ihre Unerbittlichkeit, ihre Blindheit und ihre Taubheit. Sie unterschied zwischen Armen, die auf irgendeine Weise einen Zutritt in ihr Haus bekamen, und den Bettlern, die sich nur in den Straßen aufhielten. Und sie verstand ihre Wohltätigkeit dermaßen zu organisieren, daß ihr Herz nur an bestimmten Stunden bestimmter Tage zu funktionieren brauchte. Dermaßen und in regelmäßigen Abständen Gutes zu tun war ihr ein Bedürfnis. Erzählte man ihr aber zum Beispiel von einem Unglück, das eine fremde Familie betroffen hatte, so galt ihr Interesse den näheren Umständen, unter denen sich jenes Unglück zugetragen hatte, ob es zum Beispiel ein Mittwoch gewesen war oder ein Donnerstag, Nacht oder Tag, die Straße oder das Zimmer. Dennoch hätte sie trotz ihrer Neugier, die Details zu erfahren, sich um keinen Preis in die Nähe des Unheils begeben. Denn sie mied Unglück und Krankheit, Friedhöfe und Kondolenzpflichten. Sie vermutete überall Ansteckungsgefahren. Wenn ihr der Mann einmal sagte: »Der Lang oder der Stauffer oder die Frau Wagram ist krank«, so erwiderte sie regelmäßig: »Geh nur nicht hin, Felix!« Jeder Fanatismus macht grausam. Auch der des Wohlergehens …