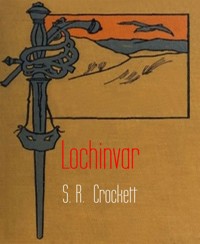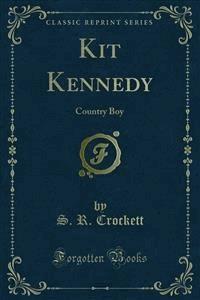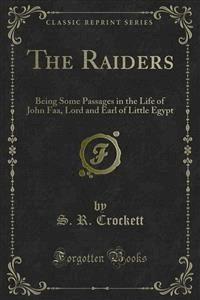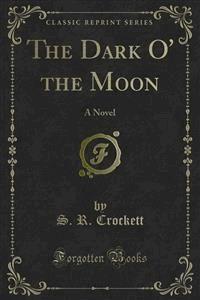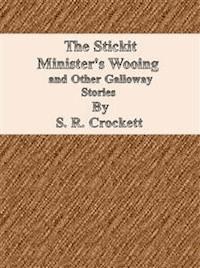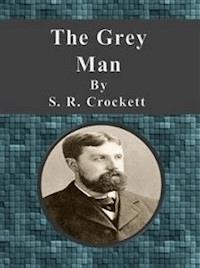Red Cap Geschichten
S.R. Crockett
Copyright © 2025 Michael Pick
All rights reservedThe characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author.No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898
[email protected]Red-Cap-Geschichten
Gestohlen aus der Schatzkiste des Zauberers des Nordens
Dieser Diebstahl wird von S. R. Crockett demütig anerkannt.
Neu aus dem Englischen von M. Pick
Das Warum!
Vier Kinder wollten Scott ums Verrecken nicht lesen. Also erzählte ich ihnen diese und andere Geschichten, um sie mit sanfter List ans gedruckte Buch zu führen – so wie man einem widerspenstigen Esel eine Karotte vor die Nase hält. Die vier Kinder sind zwar durchschnittlich clever, doch ihr Blick auf Geschichtenbücher ist streng modern und rigoros zeitgeistig. Vor allem Waverley konnten sie überhaupt nicht leiden.
Seit der ersten Erzählung dieser Red Cap Tales jedoch ist das Scott-Regal in der Bibliothek im Sturm genommen worden. Es ist über die ganze Länge hinweg mit Zahnlücken übersät – ein Schlachtfeld kindlicher Begeisterung. Außerdem kommt es zu nächtlichen Scharmützeln, sogar zu heiligen Handauflegungen, wenn es darum geht, wer mit Waverley unter dem Kopfkissen schlafen darf.
Mir fiel auf, dass es viele Alte auf der Welt geben muss, die – der eigenen Jugend zuliebe – wünschen, dass die verschiedenen Liebsten, die heute ihre einstigen Kinderzimmer bewohnen, Sir Walter mit derselben atemlosen Hingabe lesen wie sie selbst – vor wie vielen Jahren?Hauptsächlich für sie habe ich mehrere Zwischenspiele eingefügt, in denen ich erzähle, wie Liebste, Hugh John, Sir Toady Lion und Maid Margaret meine kleinen Diebstähle aus der vollen Truhe des Zauberers empfingen.
Jedenfalls war Rotkäppchen in einem Fall erfolgreich – warum sollte es nicht auch ein zweites Mal gelingen? Ich beanspruche kein Verdienst für das Erzählen der Geschichten, außer vielleicht das eine, dass die kleinen Patienten sie wie gut gezuckerte Medizin für Bonbons hielten – und dann … nach mehr verlangten.
Die Bücher sind offen. Jeder kann Scotts Geschichten auf seine Weise neu erzählen. Dies ist meine. – S. R. Crockett
Gewisse kleine Pharaonen, die Joseph nicht kannten.
Es war alles Sweethearts Schuld – und so kam es.
Sie und ich saßen in Dryburgh Abbey, stille Pilger, nebeneinander auf einer rustikalen Bank, den Blick auf den Mittelgang gerichtet, wo die Großen Toten ruhen. Das lang Erwartete war geschehen: Wir hatten unsere Pilgerreise zu unserem literarischen Mekka unternommen.
Doch trotz der stillen Schönheit dieses Junitages konnte ich sehen, dass ein Schatten auf Sweethearts Stirn lag.
„Oh, ich weiß, er war großartig“, platzte sie schließlich heraus, „und was du mir aus seinem Leben vorgelesen hast, war schön. Ich höre gerne von Sir Walter – aber –“
Ich wusste, was jetzt kam.
„Aber was?“, fragte ich, den Blick streng gesenkt, um mein Herz gegen das Pathos in Sweethearts Gesichtsausdruck zu panzern.
„Aber – ich kann die Romane nicht lesen – wirklich nicht. Ich habe es bei Waverley mindestens zwanzig Mal versucht. Und was Rob Roy betrifft –“
Sogar das kleine Einmaleins versagte hier, und darüber kicherten die kleineren Fische, die abwechselnd auf dem Rasen darunter lagen und in der Sonne glitzerten wie Spiegelscherben.
„Natürlich“, sagte Hugh John, der gerade damit beschäftigt war, Gras zu rupfen und wie ein Ochse darauf herumzukauen, „wissen wir ganz genau, dass es mit Rob Roy stimmt. Sie hat uns einen ganzen Band vorgelesen, und da kam weder Rob Roy selbst noch irgendeine ordentliche Keilerei drin vor. Also haben wir sie mit Tannenzapfen beworfen – damit sie endlich aufhörte und uns stattdessen Die Schatzinsel vorlas!“
„Ja, obwohl wir die schon zwanzig Mal gehört hatten“, warf Sir Toady Lion ein und versuchte mit aller Kraft, seinem Bruder heimlich unter dem Tisch in die Beine zu zwicken.
„Bücher ohne Bilder sind doof!“ sagte eine gewisse Maid Margaret, eine neue Gefährtin in der ehrenwerten Gesellschaft, die mit übereinandergeschlagenen Beinen fleißig Gänseblümchenketten flocht. In der Literatur hatte sie es bis zu einsilbigen Wörtern gebracht – und selbst die hielten bei ihr nicht allzu viel aus.
„Ich hatte alle Romane von Scott gelesen, lange bevor ich in eurem Alter war“, sagte ich tadelnd und mit leichtem Pathos in der Stimme.
Die Kinder nahmen diese Ankündigung mit jenem vorsichtigen Schweigen auf, mit dem jede Generation die Berichte der Älteren über vergangene Heldentaten anhört – besonders, wenn sie in abscheulichen Vergleichen daherkommen.
„Ähm!“, sagte Sir Toady, der Redner mit der Gelassenheit. „Das wissen wir. Oh ja: Und ihr mochtet kein Obst, ihr habt Medizin vom großen Löffel genommen, Haferbrei war euer Festessen und –“
„Oh, wir wissen – wir wissen!“, riefen alle anderen im Chor. Woraufhin ich ihnen mit einiger Würde erzählte, was uns vor dreißig Jahren passiert wäre, wenn wir es gewagt hätten, unsere Eltern derart flapsig anzusprechen.
Doch Sweetheart, die ihr eigenes Alter offenbar sehr ernst nahm, bemühte sich, die Diskussion wieder auf ein konstruktives Niveau zu heben.
„Scott schreibt so viel, bevor man zur Geschichte kommt“, wandte sie stirnrunzelnd ein. „Warum konnte er nicht einfach zur Sache kommen?“
„Mit Squire Trelawney und Dr. Livesey, die im eichengetäfelten Speisezimmer ihre Pfeifen rauchen, mit Black Dog an der Tür und Pew, der mit seinem Stock die Straße entlang klopft!“, rief Hugh John und warf schwärmerisch eine skizzenhafte Zusammenfassung seiner Lieblingsszenen in den Raum.
„Das nenne ich ein richtiges Buch!“, sagte Sir Toady und rollte sich hastig zur Seite, um einem drohenden Fußtritt zu entgehen. (Denn bei diesen ungewöhnlichen Kindern verbarg die glatte Oberfläche des Alltags eine stille Dauerfehde – kleine Kriege und Gerüchte über größere, die unter dem Tisch bei den Mahlzeiten, im Schulzimmer und – man munkelt – sogar in der Kirche ausgefochten wurden.)
Was die heitere Maid Margaret betraf, so sagte sie nichts – sie testete gerade die Rollfreudigkeit eines grünen Rasenhangs und war mit voller Hingabe bei der Sache.
„Zu Sir Walter Scotts Zeiten“, fuhr ich ernst fort, „wurden Romane nicht für kleine Mädchen geschrieben –“
„Warum hast du uns dann Miss Edgeworth zum Lesen gegeben?“, fragte Sweetheart rasch. Doch ich fuhr fort, als hätte ich nichts gehört:
„Wenn du möchtest, erzähle ich dir jetzt einige von Sir Walters Geschichten in meiner eigenen Fassung – und markiere dir in deiner kleinen Ausgabe die Kapitel, die du dann selbst lesen kannst.“
Der letzte Satz erstickte den Freudenschrei, den die Aussicht auf eine Geschichte – gleich welcher Art – hervorgerufen hatte. Ein unsicherer Ausdruck huschte über ihre Gesichter, als ahnten sie aus der Ferne den fahlen Hauch schulischer Trostlosigkeit: „Lektionen in der Ferienzeit“.
„Müssen wir die Kapitel wirklich lesen?“, fragte Hugh John mit hoffnungsloser Stimme.
„Erzähl uns die Geschichten trotzdem – und vertrau auf unsere Ehre!“, schlug Sir Toady Lion mit einem Augenzwinkern vor.
„Ist es eine Geschichte – oh, fang nicht ohne mich an!“, rief Jungfrau Margaret hinter den Bäumen hervor. Ihre kräftigen Fünfjährigenbeine trugen sie so schnell zum Ort des Geschehens, dass ihr Hut ins Gras fiel und sie keuchend umkehren musste.
„Nun“, sagte ich, „ich werde euch – so gut ich kann – die Geschichte von Waverley erzählen.“
„Wurde er nach den Stiften benannt?“, fragte der respektlose Schmeichler-Löwe leise. Doch seine Altersgenossen brachten ihn prompt und ernsthaft zum Schweigen – denn wer sich in das Erzählen einer Geschichte einmischt, gilt als ‚Wellhornschnecke‘ – der momentane Familienausdruck für alles Gemeine, Nutzlose und Würdelose, mit dem niemand in Verbindung gebracht werden möchte.
Aber zuerst erzählte ich ihnen von Waverleys Schriften – und der Hand am Hinterfenster in Edinburgh, die unablässig schrieb und schrieb. Nur davon, denn die Geschichte, wie Lockhart sie überliefert hatte, hatte meine eigene Fantasie als Junge tief beeindruckt.
„Habt ihr je von der Unermüdlichen Hand gehört?“, fragte ich sie.
„Das klingt nach einem tollen Titel“, sagte Sir Toady. „Hatte er nur eine?“
„Es war im Frühsommer des Jahres 1814“, begann ich, „nach einem Abendessen in einem Haus in der George Street, als ein junger Mann, der mit seinen Gefährten beim Wein saß, aus dem Fenster blickte, plötzlich blass wurde und seinen Nachbarn bat, mit ihm den Platz zu tauschen.“
„‚Da ist es – schon wieder!‘, sagte er und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Karaffen sprangen und die Gläser klirrten. ‚Es verfolgt mich – seit drei Wochen, jede Nacht. Kaum will ich mein Glas heben, schaue ich hinaus, und da ist es – es schreibt – es schreibt – es schreibt unaufhörlich!‘“
Die jungen Männer sprangen auf, drängten sich ans Fenster, schauten gespannt – und siehe da! Durch das hintere Fenster eines Hauses in einer rechtwinklig gelegenen Gasse sahen sie die Umrisse einer Männerhand, die mit sicherer Hast auf großen Quartseiten schrieb. Kaum war eine Seite vollendet, wurde sie einem wachsenden Stapel hinzugefügt, der sichtbar vor ihren Augen wuchs.
„So geht das die ganze Zeit“, sagte der junge Mann. „Sogar wenn die Kerzen längst brennen. Es beschämt mich. Ich finde keine Ruhe, solange ich nicht selbst bei meinen Büchern sitze. Warum kann dieser Mensch seine Arbeit nicht tun, ohne andere in Unruhe zu versetzen?“
Vielleicht, dachten manche, sei es gar kein Mensch, sondern eine gefangene Fee, an eine endlose Aufgabe gebunden – der dienstbare Geist des Zauberers Michael oder Lord Soulis’ Kobold Rotkäppchen, der mit einer Gänsefeder die Befehle seines Herrn ausführte.
Aber es war etwas viel Wunderbareres. Es war die Hand von Walter Scott – der Waverley schrieb. Und zwar: alle zehn Tage einen ganzen Band!
„Warum hat er so hart gearbeitet?“, fragte Hugh John, den selbst der Anblick von fünfzig schreibenden Händen nicht gestört hätte – nicht einmal, wenn sie wie Nähmaschinen gerattert hätten.
„Weil“, antwortete ich, „der Mann, der Waverley schrieb, immer mehr Geld brauchte. Er hatte Land gekauft. Er war in die Schulden anderer verwickelt. Und dazu kam – er war lange Zeit ein großer Dichter gewesen. Doch nun war ein noch größerer aufgetaucht.“
„Ich weiß!“, rief Sweetheart. „Lord Byron – aber ich finde nicht, dass er größer war.“
„Fitzjames und Roderick Dhu sind jedenfalls der Hammer!“, verkündete Hugh John, sprang auf und pfiff schrill, um den Gesetzlosen nachzuahmen. Es war eindeutig an der Zeit, sich den Dingen der Kinder zu widmen – solange die Flut ihrer Aufmerksamkeit noch standhielt.
„Ich glaube“, wagte ich zu sagen, „die Geschichte von Waverley würde euch gefallen – wenn ich sie jetzt erzählen würde. Und ich weiß, dass euch Rob Roy gefallen wird. Wer soll anfangen?“
Sofort erklangen Gegenrufe: „Waverley!“ – „Rob Roy!“ – die ganze Leidenschaft einer umkämpften Wahl.
Doch Sweetheart wartete, bis die Streithähne wieder Luft holten, und deutete mit leiser Stimme den eigentlichen Sinn unseres Treffens an:
„Erzählt uns die Geschichte, die die Hand geschrieben hat!“
Rotkäppchen-Geschichtenerzählt von Waverley
Die erste Geschichte von Waverley
Abschied von Waverley-Honour
An einem Sonntagabend, irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts, stand ein junger Mann in der Bibliothek eines alten englischen Herrenhauses und übte mit ernster Miene die Verteidigung mit dem Breitschwert. Der junge Mann war Hauptmann Edward Waverley, der erst kürzlich das Kommando über eine Kompanie in Gardiners Dragonerregiment übernommen hatte. Gerade als er mit einem eleganten Schwung parierte, trat sein Onkel ein, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln, bevor der junge Offizier sich auf den Weg zu den Fahnen machte.
Als Soldat und Held war Edward Waverley von Natur aus groß, gutaussehend und von anziehender Haltung. Doch durch seine Erziehung hielt ihn sein Onkel – ein hochnäsiger Mann der alten Schule – für „ein wenig zu belesen“ für einen anständigen Mann. „Er muss hinaus in die Welt!“, verkündete der alte Sir Everard mit Nachdruck. Ein junger Mann müsse das Leben kennenlernen – nicht nur Bücher.
Tante Rachel hingegen hatte einen ganz anderen Grund, den jungen Edward möglichst bald von Waverley-Honour fortzuschicken. Sie hatte nämlich beobachtet, wie ihr Neffe in der Kirche allzu oft zur Kirchenbank des Gutsherrn hinüberlinste! Nun – wäre diese Bank leer gewesen, hätte Tante Rachel nichts dagegen gehabt. Aber gerade dann – oh, wie unpassend! – wenn dort das liebe, altmodische, mit Blumen geschmückte Kleid und das frische, hübsche Gesicht von Miss Cecilia Stubbs saßen, war Edwards Blick besonders häufig dorthin gerichtet.
Außerdem war sich die alte Dame sicher, dass sie „diese kleine Celie Stubbs“ dabei ertappt hatte, wie sie ihren hübschen Edward auf eine Weise ansah, die – nun ja, die man sich wohl nur dann erlaubte, wenn man jung war...! An dieser Stelle bäumte sich die alte Dame innerlich auf, warf energisch den Kopf zurück, und obwohl sie viel zu damenhaft war, um es laut auszusprechen, stand ihr Ausdruck glasklar geschrieben auf den Lippen: „Das Biest!“
So war es selbst für die Einfachsten und Vorurteilslosesten offensichtlich, dass man schleunigst etwas mehr Distanz zwischen den Dachboden von Waverley-Honour und die Kirchenbank des Gutsherrn bringen sollte – je eher, desto besser.
Sir Everard, Edwards Onkel, hatte ursprünglich geplant, den jungen Mann zusammen mit seinem Lehrer, einem überzeugten jakobitischen Geistlichen namens Mr. Pembroke, auf eine Auslandsreise zu schicken. Doch Edwards Vater – ein Regierungsbeamter – verweigerte überraschend seine Zustimmung.
Sir Everard verachtete seinen jüngeren Bruder sowieso schon als politischen Überläufer – ein Mann, der in seinen Augen kaum mehr als ein Spion war. Dennoch musste er sich der väterlichen Autorität beugen, auch wenn er Edward selbst zum Erben seines Namens und Hauses erzogen hatte.
„Ich bin damit einverstanden, dass du Soldat wirst“, sagte er zu Edward. „Deine Vorfahren haben immer diesen Stand gewählt – also sei tapfer wie sie, aber nicht unbesonnen. Denk daran: Du bist der Letzte der Waverleys – die einzige Hoffnung unseres Hauses. Halte dich fern von Spielern, Wüstlingen und Whigs. Erfülle deine Pflicht gegenüber Gott, der Kirche von England und –“
Er wollte gerade „dem König“ sagen, doch er erinnerte sich im letzten Moment, dass Edward auf Wunsch seines Vaters unter den Fahnen von König Georg dienen sollte. Also schloss der alte Jakobit seinen Satz etwas lahm ab mit der Wiederholung: „… der Kirche von England und allen eingesetzten Autoritäten!“
Dann wagte der alte Mann nicht mehr zu sagen, verstummte abrupt und ging in den Stall hinunter, um die Pferde auszuwählen, die Edward nach Norden bringen sollten. Schließlich überreichte er seinem Neffen einen wichtigen Brief mit folgender ehrwürdiger Adresse:
„An Cosmo Comyne Bradwardine, Esquire von Bradwardine, auf seinem Hauptsitz Tully-Veolan in Perthshire, Nordbritannien“
Denn so schrieben angesehene Herren in jenen Tagen – lang, klangvoll und mit großem Ernst.
Die Verabschiedung von Mr. Pembroke, Edwards Lehrer, war noch länger – und deutlich feierlicher. Hätte Edward sich auch nur im Geringsten für dessen moralische Exkurse interessiert, wäre er vermutlich tief deprimiert gewesen. Zum Schluss überreichte ihm der ehrwürdige Geistliche ein beachtliches Bündel Kanzleipapier – sorgfältig beschrieben, mit enger, makelloser Handschrift.
„Diese“, sagte er andächtig, während er die Seiten wie Reliquien vorzeigte, „sind absichtlich klein geschrieben, damit Sie sie bequem in Ihrer Satteltasche verstauen können. Es sind meine Werke – meine unveröffentlichten Werke. Sie werden Ihnen die wahren Grundprinzipien der Kirche lehren. Prinzipien, über die ich während Ihrer Zeit als mein Schüler niemals mit Ihnen sprechen durfte. Doch jetzt, da Sie sie lesen – und das werden Sie ganz sicher! – wird Ihnen, davon bin ich überzeugt, ein Licht aufgehen. So oder so – mein Gewissen ist beruhigt.“
Edward warf in der Stille seines Zimmers einen Blick auf den Titel des ersten Manuskripts: „Eine abweichende Meinung von Andersdenkenden oder Das widerlegte Verständnis“. Er wog das schwergewichtige Konvolut in der Hand – und widerlegte den Verfasser sogleich auf seine eigene Weise: Er verbannte das Paket in die dunkelste Ecke seines Reisekoffers – dorthin, wo es am wenigsten wahrscheinlich war, je wiedergefunden zu werden.
Tante Rachel hingegen warnte kopfschüttelnd vor den freimütigen Damen, die er in Schottland treffen würde (obwohl sie selbst nie dort gewesen war). Praktischer veranlagt, drückte sie ihm einen Beutel mit schweren Goldstücken in die Hand und steckte ihm obendrein einen edlen Diamantring an den Finger.
Miss Celie Stubbs hingegen erschien am letzten Sonntag vor seiner Abreise in der Waverley-Kirche – herausgeputzt bis zur letzten Schleife, in Reifrock, Flicken und Seide. Master Edward aber, der zum ersten Mal seine Uniform trug – seinen goldbesetzten Hut neben sich auf dem Kirchenpolster, das Breitschwert an der Seite und die Sporen blitzend an den Fersen – würdigte die Kirchenbank des Gutsherrn kaum eines Blickes.
Über diese Vernachlässigung schmollte die kleine Celie zwar kurz, aber da sie innerhalb von sechs Monaten Jones heiratete – den Sohn des Verwalters von Waverley-Honour – und mit ihm bis ans Ende ihrer Tage recht zufrieden lebte, darf man annehmen, dass Edwards Unbeständigkeit ihr nicht allzu sehr zugesetzt hat.
[Als passenden ersten Vorgeschmack auf das Original las ich meinem kleinen Publikum nun aus einem alten Waverley-Taschenbuch das sechste Kapitel vor: „Der Abschied von Waverley“. Es wurde mit deutlich mehr Interesse aufgenommen, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ein ermutigender Auftakt. Doch Sir Toady – ungebrochen ungeduldig – rief dazwischen: „Genug von ihm. Jetzt sagen Sie uns, was er getan hat!“ Und so bemühte ich mich, zu gehorchen.]
Edward Waverley fand sein Regiment in Dundee in Schottland einquartiert. Doch es war Winter, und die Leute in der Umgebung mochten die „roten Soldaten“ nicht besonders – was das Soldatenleben weit weniger reizvoll machte, als er es sich vorgestellt hatte.
Sobald der Sommer kam, bat er um Erlaubnis, Schloss Bradwardine besuchen zu dürfen, um dem alten Freund seines Onkels seine Aufwartung zu machen.
Am Mittag des zweiten Tages nach seiner Abreise erreichte Edward das Dorf Tully-Veolan, sein Ziel. Noch nie hatte er einen solchen Ort gesehen.Denn in Waverley-Honour, dem Herrenhaus seines Onkels, standen die Cottages der Pächter – weiß getüncht und gepflegt – rund um einen Dorfanger, oder sie duckten sich efeuumrankt in den Schatten alter Parkbäume.
Doch die Hütten von Tully-Veolan – mit Torf gedeckt, ihre niedrigen Türen von aufgetürmten Haufen aus Torf und Schutt gestützt – schienen dem jungen Engländer kaum bewohnbar. Mit ihren offenen Herdstellen, ihrem dichten Rauch und ihrer tristen Verlassenheit wirkten sie auf ihn eher wie Zwinger – wären da nicht die zerlumpten Kinder gewesen, die sich im Straßenschlamm wälzten, und die alten Frauen, die mit Spindeln in der Hand hervorstürzten, um sie vor seinem Schlachtross zu retten.
Er kam an Gärten vorbei, in denen Brennnesseln mindestens ebenso reichlich wucherten wie Küchenkräuter, und durchschritt ein Tor, dessen Pfeiler von zwei galoppierenden Bären gekrönt waren.
Am Ende einer von Moos überwucherten Allee sah der junge Offizier schließlich die steilen Dächer und treppenförmigen Giebel von Bradwardine – halb Herrenhaus, halb Burg.
Edward stieg ab, übergab sein Pferd dem Soldaten, der ihn begleitet hatte, und betrat einen gepflasterten Hof, in dem nichts zu hören war außer dem Plätschern eines Brunnens.
Vor ihm erhob sich eine massive Holztür in der Fassade des alten Hauses. Er ging hinauf, hob den Klopfer – und sogleich hallte das Echo gespenstisch durch das Gebäude. Doch niemand kam.
Das Schloss wirkte wie ausgestorben, der Hof wie eine Wüste. Edward blickte sich um – halb in Erwartung, gleich einem Oger oder Riesen zu begegnen, wie jene Abenteurer in den Märchen seiner Kindheit.
Stattdessen sah er – Bären. Überall Bären. Große, kleine, steinerne Bären, die scheinbar auf Dächern hockten, über Fenster lugten, an Giebeln klebten.
Und über der Tür, an die er vergeblich geklopft hatte, stand in altmodischen Lettern: „Hüte dich vor der Bar.“
Doch alle diese Bären waren aus Stein – und jeder einzelne so schweigsam und unbewegt wie der Rest dieses merkwürdig stummen Anwesens. Nur der Brunnen hinter ihm plätscherte ungerührt weiter.
Edward Waverley verspürte ein wachsendes Unbehagen und überquerte den Hof in einen Garten, der zwar grün und angenehm war, aber ebenso verlassen wirkte wie der Schlosshof. Auch hier: steinerne Bären, die in Reih und Glied auf Brüstungen und Terrassen hockten, als genössen sie die Aussicht oder harrten eines uralten Befehls.
Edward wanderte suchend auf und ab – und hatte sich fast schon überzeugt, dass er tatsächlich ein verzaubertes Schloss entdeckt hatte, als er in der Ferne eine Gestalt auf einem der Wege auftauchen sah.
Etwas an dieser Erscheinung war – seltsam. Der Fremde wedelte ständig mit den Armen über dem Kopf, ließ sie dann wieder vor der Brust flattern wie ein Stallbursche an einem frostigen Tag, hüpfte mal auf einem, mal auf dem anderen Bein. Wurde ihm das zu eintönig, machte er Sprungübungen mit beiden Füßen zugleich.
Das Einzige, das er ganz offenbar nicht konnte, war: normal gehen. Er wirkte wie ein Gnom, ein Feenzwerg – der Wächter eines Märchenschlosses.
Er trug ein altmodisches graues Wams mit scharlachroten Schlitzen, dazu scharlachrote Strümpfe und eine rote Mütze, die mit einer stattlichen Truthahnfeder geschmückt war.
In tänzelnden Sprüngen kam er näher, bis er plötzlich den Blick hob und Edward entdeckte. Im selben Moment riss er sich die rote Mütze vom Kopf, verbeugte sich tief, salutierte – und verbeugte sich erneut, diesmal mit noch extravagantem Schwung.
Edward fragte das seltsame Wesen, ob der Baron von Bradwardine zu Hause sei – und erhielt zu seiner Verwunderung eine gereimte Antwort:
„Der Ritter schwingt zum Berg
sein Horn;
Die Dame bindet zum grünen Wald
ihren Kranz.
Die Laube von Burd Ellen
hat Moos auf dem Boden,
dass der Schritt von Lord William,
schweigt und seid sicher.“
Das klang beeindruckend, doch es brachte Edward der gesuchten Information nicht einen Zoll näher. Also fragte er den Sonderling weiter aus, übersah die Gedichtfetzen, und konnte schließlich – nach allerlei unverständlichem Murmeln – das rettende Wort „Butler“ heraushören.
Da hob Edward mit neu gewonnener Entschlossenheit die Stimme und befahl dem seltsamen Männlein, ihn auf der Stelle zum Butler zu führen.
Der Narr tanzte und sprang freudig und ohne jede Spur von Scheu voraus. An einer Biegung des Weges trafen sie auf einen älteren Mann, der – seiner Kleidung nach zu urteilen – halb Butler, halb Gärtner zu sein schien. Er war eifrig damit beschäftigt, in einem Blumenbeet zu graben.
Als er Hauptmann Waverley erblickte, ließ er seinen Spaten fallen, entfaltete seine grüne Schürze wie ein höfisches Accessoire und warf dem närrischen Führer einen finsteren Blick zu. Dieser hatte es doch tatsächlich gewagt, den Gast seines Herrn ohne Vorankündigung heranzuführen – und dann auch noch just in dem Moment, da der Haushofmeister bis zu den Ellenbogen in der Erde steckte.
Doch der Butler von Bradwardine fand rasch seine Haltung wieder und hatte eine Erklärung parat:
Seine Gnaden, so vertraute er Edward an, sei bei den Leuten im Dorf und habe sich zur Schwarzen Hexe begeben. (Was das genau bedeutete, ließ er offen.) Die beiden Gärtnerjungen waren abkommandiert worden, ihn zu begleiten. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte sich der würdige Majordomus selbst in Miss Roses Blumenbeeten nützlich gemacht. Eine Tätigkeit, für die er nur selten Zeit fand – obwohl er, wie er hinzufügte, die Gartenarbeit von Herzen liebte.
„Er schafft es nicht, mehr als zwei Tage in der Woche zu arbeiten – auf gar keinen Fall!“, rief da die Vogelscheuche in der roten Mütze mit der Truthahnfeder höhnisch dazwischen.
„Geh sofort zu Seiner Gnaden in der Schwarzen Hexe!“, herrschte ihn der Haushofmeister zornig an. „Sag ihm, dass ein Gentleman aus England im Haus auf ihn wartet!“
Edward, der das seltsame Geschöpf neben sich musterte, fragte mit berechtigtem Zweifel: „Kann dieser arme Kerl überhaupt einen Brief überbringen?“
„Mit größter Treue, Sir – jedenfalls gegenüber jenen, die er respektiert“, entgegnete der Butler. „Er ist mehr Schelm als Narr. Wir nennen ihn Davie Dolittle, obwohl sein richtiger Name Davie Gellatley ist.
Aber, um die Wahrheit zu sagen: Seit meine junge Herrin, Miss Rose Bradwardine, auf die Idee kam, ihn in hübsche Gewänder zu stecken, hat sich das Geschöpf partout geweigert, auch nur eine Handvoll ehrlicher Arbeit zu verrichten.“
Doch bevor Edward weiter fragen konnte, trat eine Gestalt auf den Weg hinaus, und der Butler fuhr fort:
„Aber sehen Sie – hier kommt Miss Rose selbst. Sie wird sich freuen, jemanden mit dem Namen Waverley im Haus ihres Vaters willkommen zu heißen!“
Rose Bradwardine war noch sehr jung. Kaum hatte sie ihr siebzehntes Lebensjahr erreicht, da galt sie schon in der ganzen Gegend als außerordentlich hübsch – mit einer Haut wie frisch gefallener Schnee und Haaren, die im Licht wie blasses Gold schimmerten.
Da sie so weitab jeder Gesellschaft lebte, war sie natürlich ein wenig schüchtern. Doch sobald diese erste Scheu überwunden war, sprach Rose frei und fröhlich – mit offenem Blick und leichtem Lachen.
Edward und sie hatten jedoch kaum Gelegenheit, ein paar Worte ungestört zu wechseln. Denn es dauerte nicht lange, bis der Baron von Bradwardine erschien – und mit solchen Schritten auf sie zueilte, als hätte er sich die Siebenmeilenstiefel eines Riesen ausgeliehen.
Der Baron war ein großer, schlanker Mann mit soldatischer Haltung, der viel von der Welt gesehen hatte. Unter seiner harten, manchmal strengen Schale verbarg sich ein warmes Herz, das sich nicht immer offen zeigte.
Er liebte französische Lieder, rezitierte mit Leidenschaft lange lateinische Zitate – und tat dies sogar mit Tränen in den Augen, als er Edward zum ersten Mal die Hand schüttelte und ihn dann nach ausländischer Sitte auf beide Wangen küsste. Alles, um seine Freude auszudrücken, in Tully-Veolan „einen würdigen Spross aus dem alten Hause Waverley-Honour“ willkommen zu heißen.
Während Miss Rose loslief, um ihr Kleid zu wechseln, führte der Baron Edward in einen Saal, der mit alten Piken und Rüstungen behängt war. Vier oder fünf Bedienstete in altmodischer Livree empfingen sie mit Ehrenbezeigungen, angeführt vom Haushofmeister – der Butler-Gärtner diesmal wohlgemerkt hellwach und tadellos gekleidet.
Der Baron bat Captain Waverley sodann in ein altes Speisezimmer, dessen Wände mit dunkler Eiche getäfelt waren. Porträts früherer Häuptlinge der Linie Tully-Veolan blickten ernst von den Wänden herab.
Irgendwo draußen erklang eine Glocke – das Zeichen, dass weitere Gäste eingetroffen waren. Edward bemerkte interessiert, dass der Tisch für sechs Personen gedeckt war. In dieser abgeschiedenen Gegend erschien ihm das beinahe rätselhaft.
Doch bald wurde ihm die Gesellschaft vorgestellt. Zunächst war da der Laird von Balmawhapple – ein „verschwiegener junger Gentleman“, wie der Baron betonte, „mit starkem Hang zum Feldsport“. Dann kam der Laird von Killancureit, ein Mann, der seine eigenen Felder bestellte und sich um sein Vieh kümmerte – was, so der Baron, seine einfache Herkunft deutlich beweise.
Hinzu kamen ein nicht besonders eifriger bischöflicher Geistlicher – das heißt einer, der sich geweigert hatte, den Treueeid auf König Georg zu leisten – sowie Mr. Macwheeble, der „Baron-Bailie“, also Landverwalter Bradwardines.
Macwheeble setzte sich, um seine untergeordnete Stellung zu betonen, so weit wie möglich vom Tisch entfernt. Und immer wenn er essen wollte, musste er sich beinahe zusammenklappen wie ein Taschenmesser, das im Begriff war, sich selbst zu verschlucken.
Nach dem Abendessen zogen sich Miss Rose und der Geistliche diskret zurück. Der Baron aber ließ, mit einem vielsagenden Wink an den Butler, aus einem verschlossenen Schrank einen goldenen Becher holen – den legendären „gesegneten Bären von Bradwardine“. In diesem stieß zunächst der Gastgeber und dann die gesamte Gesellschaft auf den jungen englischen Gast an.
Nach einer Weile machten sich der Baron und Edward auf den Weg, ihre Gäste ein Stück die Straße hinunter zu begleiten – bis zum Gasthof des Dorfes, wo Balmawhapple und Killancureit ihre Pferde untergebracht hatten.
Edward war müde – er hätte das Kopfkissen einem Trinkbecher jederzeit vorgezogen. Doch der Baron erlaubte ihm nicht, sich der „guten Gesellschaft“ zu entziehen.
So fanden sich die vier Herren unter dem niedrigen, spinnwebenverhangenen Dach von Lucky Maclearys Küche ein, um – wie der Baron es nannte – „die Süßigkeiten der Nacht zu genießen“.
Doch es dauerte nicht lange, bis der Wein Wirkung zeigte. Bald sprach oder sang jeder – mit Ausnahme von Edward – wild durcheinander, ohne auf die anderen zu achten.
Und schließlich kam, wie es kommen musste: Man wandte sich der Politik zu.
Balmawhapple erhob sich, um einen Toast auszubringen – einen Toast, der sowohl Edwards Uniform als auch den König, dem er diente, verächtlich machen sollte.
„Auf den kleinen Herrn im schwarzen Samt!“, rief der junge Laird, und stieß seinen Becher mit Nachdruck auf den Tisch. „Der 1702 so treue Dienste geleistet hat – und möge sich das weiße Pferd das Genick brechen an einem Hügel, den er selbst geschaffen hat!“
Der „kleine Herr im schwarzen Samt“ – so nannte man den Maulwurf, über dessen Hügel König Wilhelms Pferd gestolpert sein soll. Und das „weiße Pferd“ stand natürlich für das Haus Hannover.
Obwohl Edward aus einer jakobitischen Familie stammte, konnte er sich einen Anflug von Empörung nicht verkneifen – doch bevor er reagieren konnte, war ihm der Baron bereits zuvorgekommen.
„Dieser Streit ist nicht Ihrer, Hauptmann Waverley“, sagte Bradwardine bestimmt. „Solange Sie unter meinem Dach weilen, ist jeder Angriff gegen Sie ein Angriff gegen mich.“
Er wandte sich mit formeller Würde an den Laird: „Ich bin Ihr Stellvertreter, Sir. Und was Sie betrifft, Mr. Falconer von Balmawhapple, so warne ich Sie: Lassen Sie mich keine weiteren Ausfälle gegen Anstand oder Gastfreundschaft erleben.“
„Und ich sage Ihnen, Mr. Cosmo Comyne Bradwardine von Bradwardine und Tully-Veolan“, erwiderte der andere mit kalter Verachtung, „dass ich jeden, der meinen Toast ablehnt, für einen Narren halte – sei es ein englischer Whig mit gestutzten Ohren und einem schwarzen Band über der Nase, oder einer, der seine Freunde verrät, nur um sich die Gunst der Ratten von Hannover zu sichern!“
Augenblicklich wurden die Rapiere gezogen. Der Baron und Balmawhapple sprangen gleichzeitig auf – Klingen blitzten, Stühle kippten. Der jüngere Mann war kräftig und wendig, doch im Schwertkampf war er dem erfahrenen Baron deutlich unterlegen. Die Auseinandersetzung wäre wohl rasch entschieden worden, hätte nicht die Wirtin, Lucky Macleary, das unverkennbare Klirren der Klingen gehört.
Mit hochrotem Kopf stürzte sie in den Raum: „Meine Herren! Wollen Sie etwa Schande über das Haus einer ehrenwerten Witwe bringen? Haben Sie nicht das ganze weite Land vor Ihrer Tür, um sich dort zu schlagen?“
Mit einer entschlossenen Geste warf sie ihren karierten Plaid über die Waffen der Streithähne – und beendete den Kampf auf unbestreitbar schottische Weise.
Am nächsten Morgen erwachte Edward spät – und in denkbar schlechter Stimmung. In einer Zeit, in der Duelle zur Tagesordnung gehörten, schien ihm die Beleidigung durch Balmawhapple nur auf eine Weise zu beantworten.
Als er hinunterkam, fand er Miss Rose allein am Frühstückstisch. Doch Edward war nicht zum Plaudern aufgelegt – sein Blick finster, seine Laune noch finsterer.
Da sah er durch das Fenster etwas, das ihn stutzen ließ: Der Baron und Balmawhapple – Arm in Arm – spazierten gemächlich vorbei.
Im nächsten Moment erschien der Butler und bat ihn, sich in ein anderes Zimmer zu begeben.
Dort fand Edward Balmawhapple vor – mürrisch, schweigsam und mit steifem Blick zur Wand. Der Baron übernahm das Wort: In seiner Funktion als Gastgeber und Vermittler sprach er eine vollständige und ehrliche Entschuldigung für die Ereignisse des Vorabends aus – eine, die Edward ebenso würdevoll wie erleichtert annahm. Auch die Hand des jungen Lairds nahm er – wenn auch etwas vorsichtig.
Die Geste war nämlich buchstäblich schmerzhaft: Balmawhapple trug seinen rechten Arm in einer Schlinge – angeblich die Folge eines Sturzes vom Pferd, wie er später Miss Rose versicherte.
Doch die ganze Wahrheit kam erst am übernächsten Morgen ans Licht.
Es war der nicht ganz zu unterschätzende Davie Gellatley, der sie mit einer seiner rätselhaften Balladen andeutete – natürlich singend und tanzend wie immer:
„Der junge Mann wird am Abendtisch raufen,
Hört ihr die kleinen Vögel so fröhlich singen?
Doch der alte Mann wird im Morgengrauen das Schwert ziehen,
Und der Drosselhahnkopf ist unter seinen Flügeln.“
Edward bemerkte den verschmitzten Blick des Narren – und wusste sofort: Das galt ihm.
Er bombardierte daraufhin den Butler mit Fragen – und die Wahrheit kam ans Licht:
Der Baron von Bradwardine selbst hatte am Morgen nach dem Vorfall Balmawhapple zum Duell gefordert – und ihn im fairen Kampf am Schwertarm verwundet.
Hier lag also das Geheimnis der plötzlichen Reue und unerwarteten Entschuldigung des jungen Lairds. Oder, wie Davie Gellatley es poetisch formulierte: Balmawhapple war „mit blutigen Stiefeln nach Hause geschickt worden“!
Die erste Aktionseinsetzung
An dieser Stelle musste die Erzählung unterbrochen werden. Die Wolken begannen sich um die Gipfel des Eildon zu kräuseln, das Abendessen nahte – und vor allem: Nach so viel Geschichte wollten die vier Zuhörer endlich spielen – und zwar Waverley.
Sweetheart übernahm würdevoll die Rolle des Barons von Bradwardine – trotz Rock und Schleife am Zopf. Immerhin war sie eine geübte Cäsar-Darstellerin mit einem Vorrat an lateinischen Zitaten – wenngleich die meisten aus der Schulgrammatik stammten: „Illa incedit regina!“ Und in der Tat: Sie schritt wie eine Königin. Oder – um es passender im Geist des Barons auszudrücken:
„Stattvoll schritt sie nach Osten,
Und stattlich schritt sie nach Westen.“
Hugh John bestand darauf, den Helden zu spielen – wie in jeder Geschichte, versteht sich. Er haderte allerdings mit einer Schwäche der Figur: Waverley hatte bisher schlicht zu wenig getan. Besonders wurmte ihn der großartige Morgengrauenkampf zwischen dem Baron und dem übermütigen Balmawhapple – gespielt von Maid Margaret.
Sir Toady Lion, ein niederträchtiger Komiker („Camelion“ nannte er ihn stolz), glänzte in der Rolle des dämlichen Davie Gellatley. Er hatte sich mit kreativem Eifer kostümiert: einen gestreiften Pullover über den Mantel gezogen, die Cricketmütze mit sämtlichen Federn geschmückt, die er auftreiben konnte.
„Leg dich hin, Hugh John!“, rief er, während er singend um die Kämpfenden herumhüpfte, „du schläfst ja im Bett!“
Da dies – laut „Behörde“ – tatsächlich der Fall war, musste der verdutzte Held nachgeben und murmelte nur: „Jim Hawkins hätte nicht schlafen müssen, wenn so ein Kampf im Gange war!“
Doch Hugh John konnte sich sein natürliches Recht auf Regie nicht verkneifen.Immer wieder hob er den Kopf vom Kissen aus getrockneten Zweigen und beobachtete Sweetheart und Maid Margaret kritisch.
„Ihr streitet wie Mädchen!“, rief er empört. „Halt deine linke Hand zurück, Bradwardine – sonst haut dir Balmawhapple den Arm ab! Ich sag’s ja: Mädchen sind dumme Dinger. Ihr habt Angst, euch gegenseitig zu verletzen. Jetzt passt auf – ich und Toady Lion –“ Und er begann, mit sichtlicher Begeisterung von einem kürzlich ausgetragenen brüderlichen Duell zu berichten – ganz im Stile Froissarts.
Bemerkenswert war, dass sowohl Sweetheart als auch Maid Margaret die eigentlichen Frauenrollen verachteten. Letztere ging sogar so weit, zu behaupten, sie ziehe Celie Stubbs – die Tochter des Gutsherrn von Waverley-Honour – der Rose Bradwardine vor.
Auf die Frage nach dieser literarischen Ketzerei antwortete sie trocken: „Na ja – Celie Stubbs hatte wenigstens einen neuen Hut zum Kirchgang!“
Ich bemühte mich, mit etwas Feingefühl gegenzusteuern – las den Streithähnen das Kapitel „Buße und Versöhnung“ vor (Nummer zwölf in Waverley) –, doch ich sah es ihnen an: Wenn ich ihre Aufmerksamkeit behalten wollte, musste ich zu spannenderen Szenen übergehen.
Außerdem begann es zu regnen. Wir beendeten das Spiel hastig und kehrten zurück – über die grünen Hallen von St. Boswells nach Melrose.
Es war nach der Teestunde, und die Menge der Besucher hatte sich vom Gelände der Abtei zurückgezogen, bevor die Erzählung weiterging.
Ein flacher „Durchbruchstein“ diente dem Erzähler als Lehne, während sich die vier Kinder im sonnigen Gras niederließen – in jenen strengen Posen scheinbarer Unaufmerksamkeit, die nur junge Menschen beim Zuhören einer Geschichte einnehmen können.
Sweetheart vertiefte sich andächtig in das Innere eines Butterblumenblatts. Hugh John kratzte mit dem Fingernagel an einem halb versunkenen Sandsteingrab, bis ihm streng bedeutet wurde, das zu unterlassen.
Sir Toady Lion hatte eine „Kneifwanze“ gefangen und betrachtete sie vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger. Nur Maid Margaret – das Kinn mit den Grübchen auf ihre kleinen Knöchel gestützt – saß da und blickte gebannt nach oben.
Für sie gab es nichts Schöneres als eine Geschichte. Nur war sie noch zu jung, um zu wissen, dass man so etwas nicht eingesteht. Und das – genau das – machte den Unterschied.
Über unseren Köpfen erhob sich die herrliche Ruine, nun ganz in rotgoldenem Licht getaucht, purpurn schattiert in ihren Tiefen. Von den höchsten Türmen bis hinunter zu den tiefsten Bögen schrien und stürzten sich die Mauersegler in wilder Ekstase durch das Abendlicht.
Die zweite Geschichte aus „Waverley“
Am nächsten Morgen – fuhr ich fort und warf einen Blick zur Silhouette von Melrose, deren Zinnen sich scharf gegen den klaren Himmel zeichneten, wie einst, als „John Morow, Maurermeister“, sein Werk betrachtete und es „sehr gut“ befand – am nächsten Morgen also, als Hauptmann Edward Waverley zu seinem Morgenspaziergang aufbrach, fand er Bradwardine nicht mehr als verzauberten Palast der Stille vor, wie bei seiner Ankunft.
Überall herrschte Aufregung. Barfüßige Milchmädchen mit zerzausten Haaren rannten mit Eimern und dreibeinigen Hockern durcheinander und riefen: „Herr, steh uns bei!“ und „Eh, meine Herren!“
Bailie Macwheeble trabte auf seinem dicken Pony mit rundem Bauch hin und her, dicht gefolgt von der Hälfte aller zerlumpten Taugenichtse der Umgebung, die wild gestikulierend hinter ihm herliefen.Der Baron selbst schritt mit langen Schritten auf der Terrasse auf und ab und warf finstere Blicke unter seinen buschigen grauen Brauen hinauf zu den Hügeln der Highlands.
Weder von den Stallmädchen noch vom Bailie konnte Edward eine klare Auskunft erhalten. Und angesichts des wütenden Schritttempos des Barons erschien es klüger, ihn nicht direkt zu befragen.
Im Haus jedoch traf er auf Rose – beunruhigt, doch gefasst – und sie war bereit, ihm zu erklären, was geschehen war.
„Es hat einen Creach gegeben“, sagte sie, „einen Überfall von Viehdieben aus den Highlands.“ Dabei konnte sie ihre Tränen kaum zurückhalten – nicht, wie sie betonte, wegen des gestohlenen Viehs, sondern weil sie fürchtete, der Zorn ihres Vaters könnte zur Tötung einiger der Caterans führen – und damit zu einer Blutrache, die ein Leben lang dauern würde.
„Und das alles nur, weil mein Vater zu stolz ist, Vich Ian Vohr zu erpressen!“, fügte sie hinzu.
„Dieser Herr mit dem seltsamen Namen“, fragte Edward, „ist das ein Räuber – oder eine Art Gesetzeshüter?“
Rose lachte auf – hell, fast ungläubig über so viel südliche Unwissenheit. „Oh nein“, rief sie, „er ist ein großer Highland-Häuptling – und ein sehr gutaussehender Mann!
Ach, wenn mein Vater nur mit Fergus Mac-Ivor befreundet wäre, dann wäre Tully-Veolan wieder ein sicherer und glücklicher Ort. Aber sie haben sich bei einer Bezirksversammlung zerstritten – es ging um die Frage, wer zuerst Platz nehmen sollte. In seinem Zorn sagte Fergus zu meinem Vater, er stehe unter seinem Banner und zahle ihm Tribut!“
Sie senkte die Stimme. „Aber es war Bailie Macwheeble, der das Geld heimlich bezahlt hat – ohne meines Vaters Wissen. Seitdem – sind sie Feinde.“
„Aber was ist Erpressung?“, fragte Edward erstaunt. Er hatte gedacht, so etwas sei längst verschwunden – wie ausgerottet mit den alten Druiden oder den Grenzfesten. Das Ganze erschien ihm, als hätte er in der Bibliothek seines Onkels ein vergilbtes Frakturbuch aufgeschlagen.
„Es ist Geld“, erklärte Rose, „das man zahlen muss, wenn man in der Nähe der Highland-Grenze lebt – an den nächstgelegenen mächtigen Häuptling. Zum Beispiel an Vich Ian Vohr. Und wenn das Vieh dann doch gestohlen wird, muss man ihm nur Nachricht geben, und er sorgt dafür, dass es zurückkommt. Oder – dass anderes, ebenso gutes Vieh an seiner Stelle erscheint.“
Sie zögerte, dann sagte sie leise: „Oh, Sie wissen nicht, wie schrecklich es ist, mit einem Mann wie Fergus Mac-Ivor im Streit zu liegen. Ich war zehn, als mein Vater und seine Diener ein Gefecht mit seinen Leuten hatten – direkt beim alten Bauernhof unten am Fluss.
Die Kugeln schlugen in unser Haus. Einige Fenster wurden zerschmettert. Drei Männer aus den Highlands wurden getötet.“ Ihre Stimme wurde stiller.
„Ich erinnere mich noch, wie sie hereingetragen und in der Halle auf den Steinboden gelegt wurden – jeder in seinen Plaid gewickelt. Und am nächsten Morgen kamen ihre Frauen und Töchter, sie klatschten in die Hände, riefen den Coronach und kreischten.
Dann trugen sie die Toten davon – zu Klängen von Flöten, die ihnen voranschritten.
Wochenlang konnte ich nicht schlafen, ohne aufzuschrecken. Ich hörte sie wieder, diese Schreie.“
Edward war tief betroffen. Das alles erschien ihm wie ein Traum – diese junge, sanfte Siebzehnjährige, die so nüchtern und klar von Blut und Tod sprach. Von Dingen, die er selbst, als Soldat, bisher nur aus der Ferne gekannt hatte – und sie hatte sie mit eigenen Augen gesehen.
Gegen Mittag hatte sich die Aufregung etwas gelegt, und der Zorn des Barons war merklich abgekühlt. Er schien seine verletzte Ehre für den Moment zu vergessen – und sprach sogar davon, Edward, sobald die Angelegenheit beigelegt sei, vielen mächtigen Häuptlingen des Nordens vorzustellen.
In diesem Moment öffnete sich die Tür. Der Butler führte einen Highlander in voller Montur herein.
„Willkommen, Evan Dhu Maccombich!“, sagte der Baron, ohne sich zu erheben – und mit dem Ton eines Fürsten, der eine Gesandtschaft empfängt. „Was gibt es Neues von Fergus Mac-Ivor Vich Ian Vohr?“
Der Besucher verneigte sich und sprach ruhig und mit Bedacht: Fergus Mac-Ivor, so richtete er aus, bedauere die dunkle Wolke, die sich zwischen ihm und seinem alten Freund ausgebreitet habe. Er hoffe, dass auch der Baron dies bedauere – und dass er es ihm sagen möge. Mehr fordere er nicht.
Der Baron nickte, erhob sich mit Würde, trank auf das Wohl des Häuptlings der Mac-Ivors – und Evan Dhu revanchierte sich mit einem Toast auf das Haus Bradwardine.
Nachdem diese diplomatischen Dinge geklärt waren, zog sich der Highlander mit Bailie Macwheeble zurück – zweifellos, um stillschweigend über gewisse „Erpressungsrückstände“ zu sprechen, von denen der Baron offiziell nichts wissen sollte.
Danach begann Evan Dhu, gezielt Fragen zu stellen. Wie die Viehtreiber aussahen. Wo sie zuletzt gesehen wurden. Aus welcher Richtung sie kamen.
Edward war beeindruckt – von der Klarheit der Fragen, der Schnelligkeit der Schlüsse, dem messerscharfen Spürsinn dieses Mannes.
Evan Dhu wiederum schien vom offensichtlichen Interesse des jungen Engländers geschmeichelt – und lud ihn ein: „Wenn es Euch gefällt, Sir, macht mit mir einen kleinen Marsch in die Berge. Vielleicht finden wir das Vieh. Und wenn alles sich fügen sollte, wie ich hoffe, zeige ich Euch einen Ort, den Ihr nie zuvor gesehen habt – und vielleicht nie wieder sehen werdet.“
Waverley nahm das Angebot mit freudiger Neugier an. Und obwohl Rose bei der Vorstellung bleich wurde, ließ der Baron, der den Mut junger Männer stets zu schätzen wusste, ihn ziehen –
Nicht ohne Edward mit einem jungen Wildhüter zu versehen, der sein Gepäck trug und zugleich ein Mindestmaß an Anstand und Würde sicherte, wie es einem Gast des Hauses Bradwardine zustand.
Durch einen gewaltigen Pass, umgeben von schroffen Felsen und durchzogen von tosenden Sturzbächen – den berüchtigten Pass von Bally-Brough, in dem die Räuber zuletzt gesichtet worden waren – und über ermüdende, tückische Sümpfe, wo Edward gezwungen war, von Büschel zu Büschel groben Hochlandgrases zu springen, führte Evan Dhu unseren Helden tief hinein ins wilde Herz des schottischen Hochlands.
In eine Gegend, wo kein sächsischer Fuß einen Schritt zu setzen wagte – es sei denn, Vich Ian Vohr erlaubte es. So jedenfalls versicherte es Edward mehr als einmal sein Führer, der Milchbruder des berühmten Häuptlings.
Inzwischen war Nacht hereingebrochen. Evan Dhu schickte Edwards Begleiter mit einem seiner Männer voraus, um einen Schlafplatz zu suchen. Er selbst eilte weiter, um Donald Bean Lean, den mutmaßlichen Viehdieb, rechtzeitig vor der Ankunft des Engländers zu warnen.
Denn – so Evan – ein Cateraner wie Donald Bean könne sich verständlicherweise erschrecken, wenn plötzlich ein Sidier Roy – ein roter Soldat – ausgerechnet an seinem geheimsten Zufluchtsort auftauche.
Edward blieb also mit einem einzigen Highlander zurück – einem grimmigen Kerl mit einer Lochaber-Axt, der sich als wenig mitteilsam erwies. Alle Fragen nach dem weiteren Verlauf der Reise beantwortete er bloß mit kryptischen Andeutungen:
Donald Bean, so meinte er, sei möglicherweise bereit, den „Currach“ zu schicken, da der Sassenach offensichtlich müde sei.
Edward hätte nur zu gern gewusst, ob ein Currach ein Pferd, ein Wagen oder ein Boot sei. Doch egal wie sehr er bohrte – mehr als das stoische „Aich aye, ta currach! Aich aye, ta currach!“ war dem schweigsamen Highlander nicht zu entlocken.
Nach einem weiteren, mühsamen Marsch über unwegsames Gelände erreichten sie das Ufer eines dunklen Sees. Der Führer zeigte in die Ferne.
„Dort ist eine Bucht“, sagte er, und durch die Dunkelheit flackerte ein schwacher Lichtschein – kaum größer als das Glimmen eines Binsenlichts – am anderen Ufer.
Im selben Moment hörten sie Ruderschläge – dann einen schrillen Pfiff. Der Highlander antwortete kurz. Ein Boot erschien aus der Finsternis, und Edward stieg ein – bereit für seine Reise zur Räuberhöhle.
Das Licht, das eben noch fern und winzig gewesen war, wuchs rasch und warf einen roten Widerschein auf den schwarzen Wasserspiegel. Felsen erhoben sich um sie, warfen den Mond zurück, ließen das Licht verschwinden.
Je näher sie kamen, desto klarer erkannte Edward ein großes Feuer am Ufer. Dunkle Gestalten warfen eilig Kiefernzweige hinein, der Rauch stieg in spiralförmigen Säulen empor. Das Feuer loderte auf einem schmalen Felsvorsprung – direkt am Eingang einer schwarzen Höhle, in die sich die Bucht zu erstrecken schien.
Die Männer ruderten geradewegs auf diesen schwarzen Rachen zu. Dann zogen sie die Ruder ein – das Boot glitt lautlos weiter.
Sie ließen das Feuer hinter sich, durchquerten einen gewaltigen Felsbogen – und glitten in die Schwärze hinein.
Am Fuß einer natürlichen Steintreppe hielt das Boot. Die Fackeln, die ihnen Orientierung geboten hatten, wurden zischend ins Wasser geworfen. Edward wurde von kräftigen Armen aus dem Boot gehoben – fast wie schwerelos – und durch die Dunkelheit getragen.
Bald durfte er wieder auf eigenen Füßen gehen, doch zwei Männer führten ihn weiterhin an beiden Seiten, bis sich plötzlich – nach einer Biegung im Gang – die Höhle öffnete.
Und dort stand er nun: Dem berühmten Cateraner Donald Bean Lean gegenüber, umgeben von seiner finsteren, aber sorgfältig organisierten Einrichtung.
Die Höhle war von flackernden Kiefernfackeln erleuchtet. Rund um ein prasselndes Holzkohlenfeuer saßen fünf oder sechs Highlander, während im Halbdunkel dahinter mehrere andere schliefen – in ihre Plaids gehüllt, wie Schatten, die die Wand träumten.
In einer großen Nische zur Seite hingen, ordentlich an den Fersen aufgereiht wie in einer Metzgerei, die Kadaver von Schafen und Rindern. Einige davon waren – das war allzu deutlich – einst Bestandteil der Herden des Barons von Bradwardine gewesen.
Der Herr dieser ungewöhnlichen Behausung trat vor, um Edward willkommen zu heißen. Evan Dhu stand an seiner Seite, um die notwendige Vorstellung zu übernehmen.
Edward hatte erwartet, dem Anführer solcher Banditen in der Gestalt eines gewaltigen, bärtigen Kriegers zu begegnen. Doch zu seiner Überraschung war Donald Bean Lean ein kleiner, blasser Mann mit unscheinbarem Äußeren – nichts an ihm schien wild, nicht einmal hochländisch.
Tatsächlich trug er auch nicht die übliche Tracht eines Highlanders. Einst hatte Donald in der französischen Armee gedient, und ausgerechnet zu Ehren seines englischen Gastes hatte er sich in eine alte, ausgediente Uniform von blau-rotem Tuch gezwängt, die ihm schlecht saß und in der er eine derart skurrile Figur machte, dass Edward sich das Lachen nur mit Mühe verbeißen konnte.
Auch die Konversation des Freibeuters wirkte reichlich fehl am Platz. Er sprach lang und breit über Edwards Familie und gesellschaftliche Verbindungen – insbesondere über die jakobitischen Neigungen von Sir Everard Waverley, was ihn offenbar veranlasste, dem jungen Mann eine Herzlichkeit entgegenzubringen, die Edward als Offizier in königlichen Diensten eher beunruhigend als schmeichelhaft empfand.
Doch die Szene, die darauf folgte, passte dann wieder besser zu Ort und Stunde.
Bei einem halbwilden Festmahl bekam Edward frisch geschnittene Steaks serviert – offensichtlich von Rindern des Barons –, die auf offener Glut gegrillt und mit kräftigem Highland-Whiskey hinuntergespült wurden.
---ENDE DER LESEPROBE---