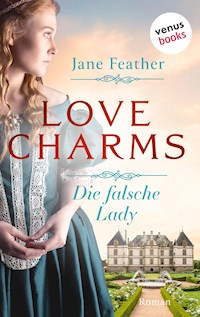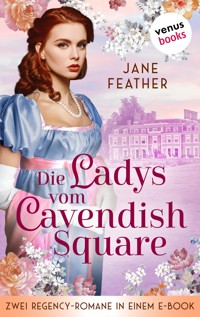4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Angels
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Reiz des Verbotenen: Der fesselnde historische Liebesroman »Regency Angels – Die verführerische Diebin« von Jane Feather jetzt als eBook bei dotbooks. England im 18. Jahrhundert. Nachdem gewissenlose Betrüger sie um ihren Besitz und ihr gesellschaftliches Ansehen gebracht haben, bleibt der jungen Octavia Morgan keine andere Wahl, als sich in den Straßen Londons als Taschendiebin zu verdingen. Mit geschickten Händen ist es ihr ein Leichtes, Snobs und hochnäsige Ladys um das ein oder andere Kleinod zu erleichtern – doch der geheimnisvolle Lord Warwick lässt sich nicht von ihrer unschuldigen Schönheit täuschen. Anstatt sie jedoch der Polizei auszuliefern, macht er ihr ein unerhörtes Angebot: Sie soll am Königshof einen Ring entwenden, der rechtmäßig ihm gehört. Eigentlich keine Herausforderung für Octavia – würde der gutaussehende Warwick nicht ständig ihr Herz aus dem Takt bringen … »Jane Feather schreibt Romane zum Sammeln – man muss sie einfach alle haben!« Romantic Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Regency Angels – Die verführerische Diebin« von New-York-Times-Bestsellerautorin Jane Feather ist Band 2 ihrer romantischen Historien-Saga »Regency Angels«, deren Einzelbände unabhängig voneinander gelesen werden können – ein fesselndes Vergnügen für alle Fans von Julia Quinn. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 18. Jahrhundert. Nachdem gewissenlose Betrüger sie um ihren Besitz und ihr gesellschaftliches Ansehen gebracht haben, bleibt der jungen Octavia Morgan keine andere Wahl, als sich in den Straßen Londons als Taschendiebin zu verdingen. Mit geschickten Händen ist es ihr ein Leichtes, Snobs und hochnäsige Ladys um das ein oder andere Kleinod zu erleichtern – doch der geheimnisvolle Lord Warwick lässt sich nicht von ihrer unschuldigen Schönheit täuschen. Anstatt sie jedoch der Polizei auszuliefern, macht er ihr ein unerhörtes Angebot: Sie soll am Königshof einen Ring entwenden, der rechtmäßig ihm gehört. Eigentlich keine Herausforderung für Octavia – würde der gutaussehende Warwick nicht ständig ihr Herz aus dem Takt bringen …
»Jane Feather schreibt Romane zum Sammeln – man muss sie einfach alle haben!« Romantic Times
Über die Autorin:
Jane Feather ist in Kairo geboren, wuchs in Südengland auf und lebt derzeit mit ihrer Familie in Washington D.C. Sie studierte angewandte Sozialkunde und war als Psychologin tätig, bevor sie ihrer Leidenschaft für Bücher nachgab und zu schreiben begann. Ihre Bestseller verkaufen sich weltweit in Millionenhöhe.
Bei dotbooks erscheinen als weitere Bände der Reihe »Regency Angels«:
»Die unwiderstehliche Spionin – Band 1«
»Die verlockende Betrügerin – Band 3«
Außerdem ihre Reihe »Love Charms« mit den Bänden:
»Die gestohlene Braut – Band 1«
»Die geliebte Feindin – Band 2«
»Die falsche Lady – Band 3«
In der Reihe »Regency Nobles« erschienen:
»Das Geheimnis des Earls – Band 1«
»Das Begehren des Lords – Band 2«
»Der Kuss des Lords – Band 3«
Außerdem erscheinen in der Reihe »Die Ladys vom Cavendish Square«:
»Das Verlangen des Viscounts – Band 1«
»Die Leidenschaft des Prinzen – Band 2«
»Das Begehren des Spions – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Vanity« bei Bantam Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Diebin meines Herzens« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Jane Feather
Published by Arrangement with Shelagh Jane Feather
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-301-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Angels 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jane Feather
Regency Angels – Die verführerische Diebin
Roman
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Haenchen
dotbooks.
Prolog
Sussex, England: 1762
Die drei Jungen kämpften sich den steil ansteigenden, grasbewachsenen Hang zum Felsplateau der Steilküste von Beachy Head hinauf. Eine heftige Windböe erfaßte den Drachen und jagte ihn höher in den strahlend blauen Himmel hinein. Philip Wyndham straffte die Schnur und stürmte noch wilder voran.
Gervase, der älteste der drei, blieb erschöpft stehen, sank vornüber und rang mit dem gequälten Keuchen des Asthmatikers nach Luft. Cullum faßte seinen Bruder an der Hand und zog ihn mit zum Plateau hinauf. Er war ein kräftiger Kerl und hatte, obwohl zwei Jahre jünger, keine Mühe, den schmächtigen Gervase zu schleppen. Schon lachten beide wieder, als sie Philip oben einholten.
Einen Augenblick lang standen die drei ganz still am Rande des Plateaus und schauten atemlos in den scharf ins Gestein gemeißelten, jäh abstürzenden Trichter, an dessen Sohle tief unter ihnen die Brandung gegen schartige Felsen donnerte.
Schaudernd zog Gervase die schmalen Schultern hoch. Schon immer hatte der Trichter eine eigenartige Faszination auf ihn ausgeübt. Sein unerbittlicher Abgrund schien ihn zu locken, sich fallen zu lassen, hinein in diesen Schlund, hinein in die enge Röhre, in der sich der heulende Wind in wilden Wirbeln fing – sich fallen zu lassen bis ganz hinunter zu den gischtgekrönten, messerscharfen Felsenzähnen.
Er trat einen Schritt zurück. »Philip, gib mir den Drachen. Ich bin jetzt dran!«
»Bist du nicht!« Philip schlug Gervase den Arm weg, als er nach der Drachenschnur griff. »Wir haben ausgemacht, daß ich ihn eine halbe Stunde haben darf.«
»Und diese halbe Stunde ist jetzt vorbei«, sagte Cullum mit der ihm eigenen Autorität und streckte ebenfalls fordernd die Hand nach der Schnur aus.
Eine Möwe schoß im Sturzflug auf die Klippen nieder. Ihr klagender Schrei wurde von einer zweiten, dann einer dritten aufgenommen. Die drei Jungen begannen, sich um die Drachenschnur zu balgen, während hoch über ihren Köpfen die Möwen kreisten, wie schwarze Schatten vor den weißen Quellwolken.
Cullum rutschte bei dem Gerangel auf einem losen Grasbüschel aus und fiel aufs Knie. Als er sich wieder aufrappelte, sah er, wie Gervase gerade nach der Drachenschnur hechtete, die Philip höhnisch lachend noch immer festhielt. Dessen schiefergraue Augen verengten sich plötzlich zu tückischen Schlitzen. Erneut schnellte Gervase nach oben, um Philip am Handgelenk zu packen, doch dieser sprang blitzschnell zur Seite und trat mit dem Stiefel zu. Er traf seinen Bruder mit voller Wucht an der Wade.
Gervases langgezogener Schrei mischte sich mit der heiseren Klage der Möwen, bis er endlich verklang.
Die beiden Jungen auf dem Plateau starrten in den Trichter, hinab zu dem leblosen Bündel, das tief unten auf einem flachen Felsen lag. Es war, als saugten die Wellen an der Seidenhose ihres Bruders.
»Du warst es«, stieß Philip hervor. »Du hast ihm ein Bein gestellt.«
Cullum starrte ihn fassungslos an. Blankes Entsetzen stand in seinem Gesicht. Sie waren Zwillingsbrüder, doch ihre Ähnlichkeit beschränkte sich auf die charakteristischen grauen Augen der Wyndhams. Philip sah wie ein kleiner Engel aus mit seinem runden, von üppigen goldenen Locken umrahmten Gesicht. Er war zwar schmächtig, wirkte aber, anders als der unglückliche Gervase, recht robust. Cullum dagegen war ein kräftiger Junge mit breiten Schultern und muskulösen Beinen. Ein dichter dunkelbrauner Haarschopf betonte seine ausdrucksstarken Züge.
»Was meinst du damit?« flüsterte er voller Angst. Seine Augen flackerten gespenstisch.
Philip funkelte ihn hinterhältig an. »Ich hab’s genau gesehen«, zischte er. »Du hast ihm ein Bein gestellt. Ich hab’s genau gesehen.«
»Nein«, flüsterte Cullum. »Nein, ich war’s nicht. Ich wollte mich gerade hochrappeln ... du hast ...«
»Du warst es!« unterbrach ihn Philip. »Ich werde allen sagen, was ich gesehen habe, und sie werden mir glauben. Du weißt, daß sie mir glauben werden!« Sein Blick durchbohrte den Bruder, und als Cullum den Triumph des Bösen in Philips engelsgleichem Gesicht wahrnahm, überwältigte ihn wieder das altbekannte Gefühl lähmender Hilflosigkeit. Man würde Philip glauben wie immer. Alle glaubten Philip.
Mit einem Ruck wandte sich Cullum ab, stürzte an den Rand des Plateaus und suchte verzweifelt einen Abstieg zu dem leblosen Körper seines Bruders. Philip rührte sich nicht von der Stelle und sah unbeteiligt zu, wie Cullum schließlich, ein paar Meter weiter, vorsichtig mit den Händen tastend, begann, sich vom Grasrand des Plateaus aus die gefährliche Steilwand hinunterzuhangeln.
Als Cullum verschwunden war, rannte auch Philip los. Er stürmte in die andere Richtung, den steilen Hang hinab auf die schmale Landstraße zu, die nach Wyndham Manor führte, dem Sitz des Earl of Wyndham. Seine Lippenbewegungen verrieten, daß er sich bereits seine Version des Unfalls zurechtlegte, dem der älteste Sohn des Earl of Wyndham zum Opfer gefallen war. In seinen Augen sammelten sich die ersten Tränen.
Hoch über ihm tanzte munter der Drachen im Wind.
Kapitel 1
London: Februar 1780
Schon vor Tagesanbruch waren die Massen in die Stadt geströmt. Im Kampf um die besten Plätze an der Straße nach Tyburn schoben und stießen sich die Menschen, und die Glücklichsten schafften es, sich direkt am Fuß des Galgens zu postieren. Es schneite ein wenig, und dazu blies ein eisiger Wind, doch die Leute ließen sich ihre Festtagslaune nicht verderben. Die Bauern aus der Umgebung waren mit ihren Weibern in die Stadt gekommen. Freigebig teilten sie den Inhalt ihrer Proviantkörbe mit den Nachbarn, während die Kinder Fangen spielten. Mal verschwanden sie im Getümmel, bald tauchten sie lachend wieder auf und purzelten als raufende Knäuel auf das Pflaster. Die Hausbesitzer an der Straße nach Newgate witterten ihre Chance, denn hier mußte der Henkerskarren vorbeikommen. Immer wieder brüllten sie ihre Preise für einen Platz auf dem Fensterbrett oder auf dem Dach in die Menge.
Denn es versprach in der Tat ein Spektakel zu werden, für das es sich lohnte, tief in die Tasche zu greifen: die Hinrichtung von Gerald Abercorn und Derek Greenthorne, zwei berüchtigten Straßenräubern, die fast zehn Jahre lang unter den Reisenden in der Umgebung von Putney Heath Angst und Schrecken verbreitet hatten.
Eine dralle, rotwangige Frau, die sich eine Taubenpastete schmecken ließ, schmatzte mit vollem Munde: »Jetzt, wo sie die zwei erwischt haben, kann es doch nicht schwer sein, den dritten auch noch zu schnappen.«
Ihr Mann kramte aus der geräumigen Tasche seines weiten Mantels eine Flasche Rum hervor. »Nee, Alte«, gab er zurück, »Lord Nick werden sie nicht kriegen, laß dir das gesagt sein!« Er nahm einen herzhaften Schluck und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.
»Na, Sie scheinen ja sehr überzeugt, Sir«, ertönte eine amüsierte Stimme hinter ihm. »Warum sollte denn dieser sogenannte Lord Nick schwerer zu fassen sein als seine unglücklichen Kumpane?«
Der Mann tippte sich an die Nase und zwinkerte dem Fremden vielsagend zu. »Weil er einen Riecher hat, verstehen Sie? Weil er ein unheimlich schlauer Fuchs ist. Bis jetzt ist er ihnen noch jedesmal durch die Maschen geschlüpft. Man munkelt sogar, daß er in einer Rauchwolke verschwindet, er und sein weißer Gaul. Wie Old Nick, der Leibhaftige selbst.«
Sein Gesprächspartner lächelte ein wenig spöttisch, schwieg jedoch und nahm eine Prise Schnupftabak. Er war gut einen Kopf größer als seine Umgebung, so daß er freien Blick auf den Galgen hatte. Als er vom Ende der Tyburn Road her das verhaltene Raunen der erregten Menge vernahm, das die Ankunft des Karrens mit den Todeskandidaten ankündigte, war sein Lächeln wie weggewischt. Mit harten Ellbogenstößen schob er sich durch die Massen, ohne auf Flüche und Verwünschungen zu achten, bis er die Richtstätte erreicht hatte.
John Dennis, der Henker, hatte bereits seinen Platz auf dem breiten Karren eingenommen, der unter dem Galgen stand. Er schlug sich den Schnee von den schwarzen Ärmeln und spähte angestrengt durch das mittlerweile dichte Gestöber in die Richtung, aus der seine Kunden kommen mußten.
»Kann ich Sie einen Moment sprechen, Sir?«
Dennis fuhr zusammen und schaute von seinem Karren hinunter. Vor ihm stand ein unauffällig gekleideter Herr in schlichtem braunem Mantel und Reithosen, der ihn mit seinen grauen Augen durchbohrte. »Was verlangen Sie für die Leichen?« fragte er und zückte einen ledernen Geldbeutel. Verheißungsvoll klimperte der Inhalt, als er den prallen Sack in die andere Hand fallen ließ. Dennis kniff die Augen zusammen. Er musterte den Mann genauer und bemerkte, daß auch seine übrige Kleidung zwar unauffällig, aber aus bestem Material und tadellos geschnitten war. Das Leinenhemd des Gentleman war blütenweiß, wenn auch ohne Spitzenkrause, und sein Hut großzügig mit einem silbernen Band verziert. Dennis’ taxierender Blick glitt über die feinen weichen Lederstiefel, deren Schnallen, die, wie er sofort erkannte, ebenfalls aus reinem Silber waren. Straßenräuber – zumindest Mr. Abercorn und Mr. Greenthorne – hatten offenbar wohlhabende Freunde.
»Fünf Guineen für jeden«, entgegnete er knapp, ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen. »Und drei für die Kleider.«
Der Fremde verzog angewidert den Mund, öffnete jedoch wortlos seine Börse.
Dennis beugte sich hinab, und der Mann in Braun zählte ihm die geforderten Goldmünzen in die ausgestreckte Hand. Dann wandte er sich ab und winkte vier stämmige Träger heran, die etwas abseits des Gedränges an ihre Karren gelehnt standen. »Bringt die Leichen zum ›Royal Oak‹ in Putney«, befahl er knapp und warf jedem eine Guinee zu.
»Wahrscheinlich werden wir uns mit den Leuten des Chirurgen um die Leichen schlagen müssen«, sagte einer der vier mit scheelem Blick.
»Wenn ihr sie sicher zum ›Royal Oak‹ gebracht habt, gibt es noch einmal eine Guinee«, erwiderte kalt der Mann in Braun. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und bahnte sich den Weg zurück durch die Menschenmasse. Er hatte seine Mission erfüllt und dafür gesorgt, daß die sterblichen Überreste seiner Freunde nicht auf dem Seziertisch des Chirurgen zerstückelt würden. Aber ihren Tod mit eigenen Augen mitanzusehen, nein, das war ihm unerträglich.
Er war bereits bis zur Mitte der Menge vorgedrungen, als der Lärm aus der Tyburn Road anschwoll. Jetzt mußte die Ankunft der Delinquenten aus Newgate unmittelbar bevorstehen. Fieberhafte Erregung erfaßte die Menschen. Ungestüm drängten sie zum Galgen, so daß der Mann keinen Schritt mehr vorankam. Resigniert blieb er stehen und versuchte, sich gegen den Strom der Gaffer zu stemmen. Sie knufften und pufften, schimpften und fluchten und stellten sich auf die Zehenspitzen, um einen besseren Blick auf den Ort des Geschehens zu erhaschen.
»Nehmen Sie den Hut ab, Frau!« Den Schrei aus rauher Kehle begleitete ein nicht minder rauher Stoß gegen ein Ungetüm aus Stroh und scharlachrot gefärbten Federn.
Zornbebend fuhr die Besitzerin desselben herum, eine Kutschersfrau mit rosigen Wangen, und schleuderte dem Übeltäter ihre gewaltige Ginfahne sowie einen Schwall obszöner Flüche entgegen, die der Betroffene in gleicher Münze zurückzahlte. Der Mann in Braun seufzte und hielt sich die Nase zu, denn es stank penetrant nach billigem Fusel und verschwitzten Leibern. Die Atmosphäre unter den Zuschauern hatte sich trotz Schneefalls und beißenden Windes immer mehr aufgeheizt. Plötzlich verspürte er einen leichten Stoß gegen die Brust, dann eine schnelle Bewegung an der Weste. Augenblicklich war er hellwach, doch als er sich an die Westentasche griff, ahnte er es bereits: Seine Uhr war weg.
Fuchsteufelswild schaute er um sich. Er sah ein Meer von erregten Gesichtern mit glühenden Augen und offenen, keuchenden Mündern.
Da blieb sein zorniger Blick an einem Gesicht hängen, das ganz nah bei ihm war, so nah, daß eine zarte Strähne zimtbraunen Haars seine Schulter berührte. Es war das Antlitz einer Madonna. Ein blasses, vollkommen geformtes Oval mit braungoldenen, weit auseinanderstehenden Augen unter sanft geschwungenen, breiten Brauen. Die dichten, dunkelbraunen Wimpern flatterten, und der wunderschöne Mund bebte.
Plötzlich brüllte eine erregte Stimme: »Passen Sie auf Ihre Taschen auf! Hier treibt sich ein gemeiner Dieb herum!« Ein Chor der Entrüstung erhob sich. Jedermann griff sich sofort ängstlich an die Weste, befühlte seine Hosentasche, und so manch einer stellte entsetzt fest, daß auch er um einen wertvollen Gegenstand leichter war.
Fast im gleichen Augenblick schwankte das Mädchen an seiner Seite. Sie seufzte auf und sank in Ohnmacht. Blitzschnell fing der Mann in Braun sie auf und bewahrte sie davor, von den groben Stiefeln auf dem Pflaster zertrampelt zu werden. Hilflos hing sie in seinen Armen. Ihr Gesicht war noch blasser geworden. Winzige Schweißperlen standen auf ihrer Stirn.
»Bitte um Vergebung, Sir«, murmelte sie mit nervös zuckenden Lidern, bevor sie wieder das Bewußtsein verlor und seiner Umarmung zu entgleiten drohte.
Er hielt sie fest, hob sie hoch und bahnte sich mit dem Mädchen in den Armen einen Weg durch das Gewühl. »Lassen Sie mich durch!« rief er immer wieder in barschem Ton, »die Lady ist ohnmächtig!« Endlich gelang es ihm, sich aus der Menge herauszukämpfen, die jetzt von dem Spektakel vorn am Galgen ganz gebannt war. Er hatte sich eben einen etwas ruhigeren Platz erobert, als der Mob laut aufbrüllte. Der Mann wußte – in dieser Sekunde hatte der Henker Derek und Gerald den Karren unter den Füßen weggezogen, und die beiden baumelten am Galgen. Seine Züge verhärteten sich. Kalt wie arktisches Eis wurde sein Blick. Er schloß die Augen.
»Ich danke Ihnen, Sir«, wisperte das Mädchen in seinen Armen, das in dem Augenblick aus seiner Ohnmacht erwachte. »Ich hab’ meine Freunde in dem Gedränge verloren, und ich hatte solche Angst, daß die Masse mich tottrampelt! Aber nun geht es mir wieder gut.«
Ihre Stimme klang jetzt überraschend kräftig und voll. Ihr Samtumhang hatte sich im Gedränge ein wenig geöffnet und gab den Blick auf ein schlichtes Musselinkleid frei. Den Ausschnitt bedeckte ein einfaches weißes Halstuch, wie es sich für ein anständiges Mädchen aus gutem Hause ziemte. Ihre Hände steckten in einem Samtmuff. Sie schaute zu ihm auf und lächelte unsicher, als er keine Anstalten machte, sie abzusetzen.
»Wie wollen Sie denn Ihre Freunde wiederfinden?« fragte er und warf einen Blick auf das brodelnde Menschengetümmel. »Die können überall sein. Das ist hier nicht der Ort für eine wohlerzogene junge Dame, allein herumzulaufen.«
»Bitte, Sir, ich möchte Sie nicht länger belästigen«, erwiderte sie bestimmt. »Ich bin sicher, daß ich meine Freunde finden werde ... Sie werden nach mir suchen.« Sie stemmte sich gegen seine Umarmung, und es überraschte ihn, mit welcher Entschlossenheit sie sich zu befreien versuchte.
Da keimte in ihm ein Verdacht auf. Er erinnerte sich an den seltsamen Ablauf des Geschehens. Alles hatte einfach zu gut zusammengepaßt ... aber nein, er mußte sich täuschen. Es konnte einfach nicht wahr sein, daß dieses unschuldige Engelsgesicht mit der honigsüßen Stimme ein gerissener Langfinger war!
Plötzlich tauchte Philips Gesicht vor ihm auf. Philip, als er ein Kind war – der engelsgleiche, sanfte, schmeichelnde, unschuldige kleine Philip. War seinen Eltern jemals eine einzige Klage über ihren Liebling zu Ohren gekommen? Oder dem Kindermädchen, oder dem Hauslehrer? Oder sonst irgend jemandem in dem Schloß, in dem Klein-Philip das Zepter führte?
»Lassen Sie mich herunter, Sir!« Die jetzt deutlich ungehaltene Stimme des Mädchens brachte ihn mit einem Schlag in die Gegenwart zurück.
»Ja, gleich«, beruhigte er sie. »Aber lassen Sie uns doch erst einmal nach Ihren Freunden Ausschau halten. Wo genau haben Sie sie denn verloren?«
»Wenn ich das so genau wüßte, Sir, hätte ich wohl kaum Probleme, sie wiederzufinden«, gab sie in scharfem Ton zurück. »Sie sind sehr zuvorkommend gewesen, und mein Onkel wird Ihnen äußerst dankbar sein, daß Sie mich gerettet haben. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse geben, werde ich dafür sorgen, daß Sie in angemessener Weise entlohnt werden.« Wieder wand sie sich heftig, um sich aus seinem Griff zu befreien.
Doch er ließ nicht locker und hob sie noch höher. »Verehrteste, Sie beleidigen mich«, wiedersprach er mit samtweicher Stimme. »Ein Schuft, der ein unschuldiges Mädchen wie Sie in dieser Situation sich selbst überließe!« Er sah sich mit gespielt besorgter Miene um. »Nein, ich werde nicht eher ruhen, als bis ich Sie persönlich zu Ihrer Familie zurückgebracht habe.«
Er schaute sie an. Die Kapuze ihres Umhangs war zurückgefallen, und Schneeflocken hatten sich auf ihr leuchtendbraunes Haar gesetzt, das sie zu einem Zopf geflochten und locker hochgesteckt hatte. Der Ausdruck weiblicher Schwäche und Hilflosigkeit war heller Empörung gewichen. »Jetzt verraten Sie mir doch erst einmal Ihren Namen«, schlug er in beruhigendem Ton vor, »und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie wir Ihre Freunde wiederfinden können.«
»Octavia«, stieß sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Sie betete zu Gott, daß er sich damit zufrieden geben und sie endlich wieder absetzen würde. Sobald sie wieder Boden unter den Füßen hatte, würde sie verschwinden, so schnell sie konnte. »Octavia Morgan. Und ich versichere Ihnen, es gibt nicht den geringsten Grund, sich weiter um mich zu bemühen.«
Er lächelte. Seine Ahnung hatte ihn also nicht getrogen. »Oh, ich glaube doch, Miß Morgan. Octavia ... was für ein ungewöhnlicher Name.«
»Mein Vater ist Altphilologe«, erwiderte sie wie immer, wenn sie auf ihren lateinischen Namen angesprochen wurde. In ihrem Kopf rasten die Gedanken. Sie hatte begriffen – er spielte mit ihr. Aber warum bloß? Hatte er vor, ihre mißliche Lage auszunutzen? Aus der Art, wie er sie festhielt, sprach jedoch ein gewisser Respekt. Dieser Mann war kein Wüstling, der vorhatte, eine junge Frau zu entführen. Sein Aussehen und seine Sprache verrieten den Gentleman, auch wenn die schlichte Kleidung und das ungepuderte Haar nahelegten, daß er nicht adligen Geblüts war.
Aber warum ließ er sie nicht laufen? Die Ausbeute ihrer morgendlichen Arbeit lag wohlverborgen unter ihren Unterröcken in einem Beutel, der sich dicht an die Schenkel schmiegte. Durch einen unsichtbaren Schlitz im Kleid konnte sie ihn jederzeit mühelos erreichen. Zum Glück konnte der Mann den Beutel durch das sperrige Fischbeingestell ihres Reifrocks nicht ertasten, so fest er sie auch umschlungen hielt. Trotzdem fand sie es an der Zeit, diese höchst unerfreuliche Begegnung zu einem Ende zu bringen.
Blitzschnell zog sie ihre zierliche Hand aus dem Muff, ballte sie zu einer Faust und versetzte ihm einen Kinnhaken, daß sein Kopf in den Nacken flog. Gleichzeitig drehte sie sich in seiner Umklammerung und biß ihn mit aller Kraft in den Oberarm.
Er ließ sie fallen wie eine heiße Kartoffel, und schon war sie auf und davon. Wie ein Wiesel schlüpfte sie durch das Gedränge, wohlwissend, daß er ihr auf den Fersen war – ein lautloser, bedrohlicher Verfolger. Sie hastete durch das Getümmel. In einer dunklen Seitengasse duckte sie sich in einen Hauseingang, um Atem zu schöpfen. Ihr Herz raste. Hatte sie ihn abgeschüttelt? Doch nein, da war er schon wieder, am anderen Ende der Gasse, ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen.
Voller Angst stürzte sie sich wieder in die Menge, die sich jetzt langsam zu zerstreuen begann. Die Leute waren in gereizter Stimmung. Von überallher hörte man heftige Wortgefechte, laute Flüche, an manchen Stellen entstanden Handgemenge, als einzelne Gruppen vergeblich versuchten, sich aus der Masse zu lösen. Ein paar Sänftenträger warteten am Rande des Platzes auf Kundschaft, während die Menschen an ihnen vorbeiströmten. Das war die Rettung! Octavia kämpfte sich durch das Gewühl auf die Sänften zu. Ein hastiger Blick über die Schulter – hatte sie ihren Verfolger in der Seitengasse abgehängt? Nein – er war schon wieder hinter ihr. Ruhigen Schrittes schob er sich durch das Gewimmel, kam ihr immer näher, ohne sich offenbar beeilen zu müssen. Octavia war den Tränen nahe. Ihr Versuch, ihm zu entkommen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Panik wallte in ihr auf. Sie besaß seine Uhr. Wenn er Verdacht geschöpft hatte und sie fangen wollte, um sie der Polizei auszuliefern, noch dazu mit dem Corpus delicti unter ihren Röcken – unvorstellbar! Sie würde am Galgen enden, genau wie die beiden Pechvögel, die der Menge so einen vergnüglichen Morgen und ihr ein so einträgliches Geschäft beschert hatten.
Ihre Hand fuhr unter die Röcke und betastete den vollen Beutel. Die Bänder, an denen der Sack aufgehängt war, hatte sie um die Taille geschlungen und am Rücken fest verknotet. Sie konnte sie unmöglich mit einer Hand lösen, um sich des Beutels zu entledigen. Außerdem wollte sie das auch gar nicht. Die Arbeit eines ganzen Morgens sollte nicht umsonst gewesen sein. Mit dem Ertrag ihrer Beute konnte sie die Miete bezahlen, Papas teure Bücher aus dem Pfandhaus einlösen, ihm seine Medizin besorgen und einen Monat lang genügend Essen auf den Tisch bringen. Wenn sie jetzt ihre Beute wegwarf, war die ganze Angst, die sie ausgestanden hatte, umsonst. Umsonst all die riskanten Manöver, als sie schweißgebadet, mit zitternden Fingern und bis zum Halse klopfendem Herzen ihre betuchten Opfer um ein paar Pretiosen erleichtert hatte!
Entschlossen zog sie die Hand wieder unter ihren Röcken hervor und schlüpfte durch eine Gruppe von Leuten, offenbar eine Familie, die sich gerade gegenseitig mit heftigen Vorwürfen überschütteten, da sie im Gedränge ein Kind verloren hatten. Hinter ihr schloß sich die Menge wieder. Die Sänftenträger waren nicht mehr fern ... nur noch drei Schritte ...
»Nach Shoreditch!« rief sie außer Atem dem vorderen Träger zu und wollte sich erschöpft in die Sänfte fallen lassen.
»Nein, so geht das nicht, Miß Morgan«, ertönte hinter ihr eine ruhige Männerstimme mit leicht spöttischem Unterton, und beschützend legte sich ein Arm um ihre Schultern. »Wissen Sie, ich kann es einfach nicht verantworten, Sie gehen zu lassen, bevor ich Sie nicht wieder sicher im Schoße Ihrer Familie weiß.«
Sie war gefangen. Fieberhaft überlegte sie. Er hatte keinerlei Beweise dafür, daß sie im Besitz seiner Uhr war. Sie sah nun wirklich nicht nach einem Langfinger aus, und er hatte nur den einzigen Anhaltspunkt für seinen Verdacht, daß sie neben ihm stand, als jemand vor einem Taschendieb gewarnt hatte. »Sir, Ihre Begleitung ist mir alles andere als erwünscht«, wandte sie sich mit hochmütig zurückgeworfenem Kopf an ihr Gegenüber. »Muß ich erst die Polizei holen?«
»Aber nicht doch, Madam«, versetzte er ironisch, »das übernehme ich gerne für Sie, wenn Sie dies wünschen!« In seinen grauen Augen blitzte der Schalk.
»Wollen Sie nach Shoreditch, Lady, oder nicht?« fragte der Träger verärgert, noch ehe sie sich, da ihr Bluff nicht verfangen hatte, eine neue Taktik überlegen konnte.
»Jawohl, das will ich!« entgegnete sie bestimmt und machte sich daran, endgültig in die Sänfte zu steigen.
»Nein!« hielt ihr ungebetener Begleiter in liebenswürdigstem Ton dagegen. »Nein, das glaube ich nicht.« Er packte sie mit entschlossenem Griff am Arm und zog sie von der wartenden Schlange der Sänftenträger fort. Sie verstand – die Zeit der neckischen Spielchen war vorbei. Jetzt würde man zur Sache kommen. »Wissen Sie, Miß Morgan«, sagte er, »ich glaube, ich habe ein Wörtchen mit Ihnen zu reden.«
Trotzig reckte sie das Kinn. »Und worum geht es, wenn ich fragen darf?«
»Oh, ich denke, Sie wissen Bescheid«, antwortete er gelassen. »Über Privateigentum zum Beispiel und über Attacken in der Öffentlichkeit. Aber verlassen wir doch erst einmal diesen unwirtlichen Ort.«
Sie hatte keine Wahl. Aber zumindest war jetzt nicht mehr von der Polizei die Rede. Vielleicht würde er sie ja laufen lassen, sobald sie ihm seine Uhr zurückgegeben hatte. So schwieg sie und setzte ihm auch keinerlei Widerstand mehr entgegen, als er sie mit sanftem Druck vor sich durch die Menge schob.
Plötzlich kam eine eigenartige, bedrohliche Stimmung auf. Der Mob begann wieder wilder zu schieben und zu stoßen, und erregtes Raunen ging durch die Reihen, das sich langsam zu hektischem Geschrei steigerte. »Die Preßpatrouille!« tönte es von überallher. Panik machte sich in den Gesichtern breit.
»Das gibt noch Blutvergießen«, murmelte Octavias Begleiter. Er packte sie fester am Arm. »Die Preßpatrouille weiß, wo sie am besten neue Matrosen ausheben kann. Wir müssen hier fort, bevor die Leute durchdrehen.«
Octavia hatte jetzt jede Lust auf einen weiteren Fluchtversuch verloren. Ihr Verfolger hatte sich in einen Beschützer verwandelt. Ängstlich drückte sie sich an ihn. In dem Moment kamen in dem allgemeinen Gedränge und Geschiebe hinter ihr ein paar Leute ins Straucheln, und hätte er ihr nicht blitzschnell unter die Arme gegriffen, wäre sie mit zu Boden gerissen und von der nachrückenden Menge überrannt worden. Brüllend und kreischend drängte die Meute in rhythmischen Wogen über den Platz. Männer, Frauen und Kinder kämpften wie Besessene darum, sich aus der Masse zu befreien und sich in die Seitenstraßen zu retten. Und dann waren sie da! Aus der Edgware Road stürmte eine Armee knüppelschwingender Matrosen unter der Führung einiger Marineleutnants auf den Platz, umzingelte die Menge und begann, sich die jungen und kräftigen Männer wahllos zu greifen. Das herzzerreißende Schluchzen der Frauen, denen man Ehemänner und Söhne von der Seite riß, wurde nur von dem panischen Gebrüll der Masse übertönt.
Die Preßpatrouille würde es nicht wagen, einen Gentleman anzurühren, und Octavias Begleiter war zweifellos ein Gentleman. Die Gefahr bestand jetzt darin, von der Meute niedergetrampelt zu werden. Überall hörte man das verzweifelte Schreien am Boden Liegender, das langsam in schmerzgequältes, dumpfes Stöhnen überging, während eisenbeschlagene Stiefel achtlos über sie hinwegstampften.
Octavia hatte jede Orientierung verloren. Das einzige, was ihr Sicherheit gab, war der feste Griff ihres Begleiters, während sie von der Menschenflut mitgerissen wurden. Sie sah nur Körper, Arme und Beine vor sich, bis sie aus dem Augenwinkel plötzlich etwas wahrnahm.
»Da rüber!« schrie sie, so laut sie konnte. Mit eingezogenem Genick schoß sie nach links und kämpfte sich wie eine Löwin durchs Getümmel, unterstützt von den starken Armen ihres Begleiters, bis sie endlich den rettenden Hauseingang erreichten, den Octavia entdeckt hatte. Atemlos standen sie im Dunkeln und rangen nach Luft, während die Menschen weiter an ihnen vorbeitfluteten.
»Gott sei Dank!« stöhnte Octavia und lehnte sich an die Tür in ihrem Rücken. Ihr Haar hatte sich gelöst. Das Halstuch war aufgegangen und gab den Blick auf ihren weißen, wogenden Busen frei. Als sie bemerkte, daß er seine Augen genüßlich über ihren Körper gleiten ließ, zog sie instinktiv den Umhang enger zusammen, um ihre Blöße zu bedecken. Am Schenkel spürte sie das schwere Gewicht des Beutels.
»Kompliment, Miß Morgan, Sie haben einen hervorragenden Überblick!« bemerkte ihr Begleiter und starrte stirnrunzelnd auf die Horden, die an ihren Augen vorüberhasteten. »Wir warten hier, bis alles vorbei ist.«
»Ach übrigens ... Sie haben sich mir noch gar nicht vorgestellt«, bemerkte Octavia spitz, bemüht, ihr Selbstbewußtsein zurückzugewinnen.
»Ja, richtig«, pflichtete er bei und zog eine mit Japanlack überzogene Schnupftabakdose aus seiner tiefen Manteltasche. Er öffnete den Deckel und nahm umständlich eine Prise.
Neugierig wartete Octavia auf eine Antwort, doch er blieb sie ihr schuldig. »Und, Sir«, fragte sie nach einer Weile und stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf den Steinboden, »darf ich jetzt Ihren Namen erfahren?«
Er schaute sie an, die eine Augenbraue leicht hochgezogen. »Ich gebe zu«, begann er, »das war sehr unhöflich von mir. Nun ... wenn Sie gestatten«, er deutete mit elegantem Schwung eine Verbeugung an. »Im Moment bin ich Lord Nick – stets zu Ihren Diensten!«
Sie schaute ihn an und überlegte, wo sie den Namen schon einmal gehört hatte. Und was meinte er bloß mit ›im Moment‹? Dann plötzlich sank ihr vor Überraschung das Kinn herab. »Oh! Lord Nick, der Räuber?«
Lächelnd zuckte er die Achseln. »Alles pure Verleumdung. Weiß der Himmel, wo die Leute diese Geschichten herhaben.«
Fassungslos schüttelte Octavia den Kopf, als ob sie einen bösen Traum verscheuchen wollte. Also überhaupt kein Gentleman, sondern Lord Nick, der berühmt-berüchtigte Straßenräuber, den bisher noch kein Sterblicher zu fassen bekommen hatte! Wenn er es wirklich war – denn er sah nach allem anderen, nur nicht nach einem Straßenräuber aus –, dann würde er wohl wenig Interesse daran haben, sie der Polizei zu übergeben. Aber in Anbetracht der Umstände und nicht zuletzt zum Dank, daß er sie aus den Fängen der Masse gerettet hatte, schien es ihr eine Frage der Ehre, ihm seine Uhr zurückzugeben. So fuhr sie mit der Hand unter die Röcke, um sie aus dem Beutel zu angeln. Doch als sie bemerkte, daß er jede ihrer Bewegungen süffisant grinsend verfolgte, zog sie ihre Hand mit einem verlegenen Lächeln wieder zurück.
Nein. Der Ausdruck seiner schiefergrauen Augen gefiel ihr nicht, und hier mitten in der Öffentlichkeit war nicht der richtige Ort, ein Schuldbekenntnis abzulegen, noch dazu ein unerbetenes. Auch nicht gegenüber einem Kollegen aus dem Gewerbe.
Die Menge hatte sich inzwischen verlaufen. Nur von ferne hörte man gelegentlich noch Schreie gellen.
»Kommen Sie«, sagte Lord Nick. »Die Luft ist rein.«
»Ich denke, unsere Wege trennen sich jetzt, Sir«, entgegnete sie kühl und trat aus dem Hauseingang. Leider war weit und breit keine Sänfte in Sicht. Die Träger hatten sich wohl beim Auftauchen der Preßpatrouille sofort verdrückt, denn sie waren junge, kräftige Männer, geradezu ideale Kandidaten für die Marine Seiner Majestät.
Lord Nick zog überrascht die Brauen hoch. »Sie sind zwar ein helles Köpfchen, Octavia, aber hin und wieder offenbar ein wenig begriffsstutzig«, bemerkte er. »Wir haben doch noch ein kleines klärendes Gespräch zu führen, wenn ich Sie daran erinnern darf.«
Er schaute sich um. »Mein Pferd steht am ›Rose and Crown‹ ... hier entlang, wenn ich bitten darf.«
Das ›klärende Gespräch‹ war also nicht zu vermeiden. Aber der Gedanke, daß in seinem Gasthof ja eine gewisse Öffentlichkeit herrschte, beruhigte sie. Resigniert ließ sie sich durch die jetzt menschenleeren, aber von Abfällen übersäten Straßen zum ›Rose and Crown‹ führen.
Doch statt zum Vordereingang ging er auf den Stall am Rückgebäude zu. »Wollen Sie vor oder hinter mir sitzen?« fragte er und winkte den Stallburschen heran.
»Weder noch«, entgegnete sie scharf. »Worüber reden Sie eigentlich?«
Er seufzte. »Ich stehe nicht in dem Ruf, mich undeutlich auszudrücken ... bring mir mein Pferd, Junge ... Wir haben einen Weg von fünf Meilen vor uns, Miß Morgan. Also ...« Er zuckte die Achseln, als verstünde sich der Rest von selbst.
Octavia geriet in Harnisch. Bis jetzt hatte sie seine Befehle bereitwillig befolgt, denn sie fühlte sich zum einen schuldig, weil sie ihn bestohlen hatte, zum anderen war sie ihm dankbar, weil er sie beschützt hatte. Aber jetzt war das Maß voll.
»Ich komme nicht mit Ihnen«, versetzte sie grimmig, bemüht, nicht die Beherrschung zu verlieren. Sie war kreidebleich vor Wut, und ihre Augen schossen Blitze. »Ich weiß nicht, was Sie im Schilde führen, aber wenn Sie meinen, mich entführen zu können, dann sind Sie im Irrtum. Ich werde schreien, daß Gott und die Welt zusammenläuft!«
Er tat so, als hätte er ihre Worte nicht gehört und widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem Pferd, das der Stallbursche am Zügel heranführte. Es war ein breitschultriger Rotschimmel, kräftig genug, zwei Reiter zu tragen.
»Nun, Miß Morgan ... vorne oder hinten?« Er wandte sich Octavia zu. »Beide Sitze sind zu empfehlen. Peter ist ein ruhiges, sehr zuverlässiges Tier.«
»Sagen Sie, sind Sie schwerhörig?« zischte sie. »Ich wünsche einen angenehmen Tag!« Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und stolzierte von dannen. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Jeden Moment erwartete sie, seine eiserne Hand auf ihrer Schulter zu spüren, doch nichts dergleichen geschah. Und so gelangte sie unbehelligt aus dem Hof des ›Rose and Crown‹ hinaus auf die schmale Gasse. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. Offenbar hatte er eingesehen, daß sie für seine Spielchen nicht zu haben war. Sie war erleichtert, daß ihr gefährliches Abenteuer doch noch gut ausgegangen war.
Das holprige Pflaster war von einem Flaum frisch gefallenen Schnees bedeckt. Es wehte ein kalter Wind, und sie fröstelte. Von einer Kirchturmuhr schlug es neun. Nach all dem Theater und all der Aufregung, die sie heute schon erlebt hatte, war sie überrascht, daß es noch so früh war. Ihr Vater würde um diese Zeit wie immer über seinen Büchern sitzen und sich weder um die Tageszeit noch um das Wetter scheren, wahrscheinlich nicht einmal bemerkt haben, daß sie nicht da war. Wenn sie auf sein Rufen nicht erschiene, würde sich Mistress Forster um ihn kümmern.
Mistress Forster. Sie schuldeten ihr schon zwei Wochen Miete. Unwillkürlich beschleunigte Octavia ihren Schritt. Jetzt endlich konnte sie diese Peinlichkeit bereinigen.
Das Klappern von Pferdehufen hinter ihr drang anfänglich gar nicht in ihr Bewußtsein. Sie lief in der Mitte der Straße, um nicht dauernd dem fauligen Wasser und den Abfällen im Rinnstein ausweichen zu müssen. Jetzt, wo das Pferdegetrappel immer näher kam, blieb ihr nichts anderes übrig, als schnell zur Seite zu springen und durch die Gosse zu planschen, wollte sie nicht zu Boden getrampelt werden. Immer wieder passierte es, daß harmlose Passanten von rücksichtslosen Reitern niedergeritten wurden.
»Pest und Cholera an deinen Hals, du räudiger Hund!« fluchte sie alles andere als damenhaft, als das verdreckte Rinnsteinwasser durch ihre Stiefel drang und den Saum ihres Reifrocks beschmutzte, den sie nicht rechtzeitig hatte hochheben können. »Der Teufel soll dich ...«
Der Rest ihrer Verwünschung ging unter, als der Reiter, inzwischen auf ihrer Höhe, sich in fliegendem Ritt aus dem Sattel beugte und sie mit der Kraft und dem Geschick eines Zirkusakrobaten zu sich aufs Pferd riß.
Als Octavia begriff, was passiert war, war es schon zu spät. Sie saß auf dem Rücken des Rotschimmels, hinter sich den mächtigen Körper Lord Nicks, der sie mit eisernem Griff umklammert hielt.
Octavia holte Luft und stieß dann einen schrillen Schrei aus, so laut und so gellend, daß überall in der Gasse die Läden aufflogen und neugierige und ängstliche Gesichter aus den Fenstern schauten.
»Wollen wir bei der Polizei vorbeischauen?« murmelte Lord Nick an ihrem Ohr, der keinerlei Anstalten machte, ihr den Mund zuzuhalten. »Ich bin sicher, man wird sich sehr dafür interessieren, was Sie alles Schönes unter Ihrem Rock verborgen haben.«
Octavias Schrei verhallte im Wind. »Und ich bin sicher«, schoß sie zurück, »daß man sich sehr dafür interessieren wird, wer der Gentleman ist, der die Anzeige erstattet. Heute morgen haben sie schon zwei von Ihrem Schlage aufgeknüpft. Sie werden begeistert sein, wenn ich ihnen den Dritten im Bunde liefere.«
»Und wer sollte mich identifizieren, verehrte Miß Morgan?«
Sie erschrak. Tatsächlich, sie hatte keinerlei Beweise außer seinen eigenen Worten. Für ihren Diebstahl dagegen gab es jede Menge Beweise unter ihren Röcken. Wieder mußte sie sich zähneknirschend eingestehen, daß sie verloren hatte. Und so verfiel sie in bitteres Schweigen.
Sie hatten inzwischen die Gasse verlassen. Der Schnee fiel in dichten Flocken, und Octavia wußte nicht, wo sie waren.
»Wohin entführen Sie mich jetzt?« fragte sie, auch wenn sie zugeben mußte, daß ihr das unter den gegebenen Umständen ja eigentlich ziemlich egal sein konnte.
»Aufs Land. An einen stillen Ort, an dem wir in aller Ruhe unser kleines Gespräch führen können.«
»Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
»Aber ich.«
»Lassen Sie mich runter, dann gebe ich Ihnen in Gottes Namen Ihre verdammte Uhr zurück«, brach es aus ihr heraus.
»O ja, natürlich«, stimmte er mit sanfter Stimme zu. »Die werden Sie mir zurückgeben. Aber alles zu seiner Zeit, Miß Morgan. Alles zu seiner Zeit.«
Kapitel 2
Sie ritten durch ein Gewirr von Straßen und Gäßchen, die immer enger und armseliger wurden, bis sie den Fluß erreichten. Octavia kam alles wie ein Alptraum vor. Einen kurzen, verzweifelten Augenblick lang hatte sie überlegt, ob sie vom Pferd springen sollte. Aber der holprige und glitschige Boden tief unter ihr und der stahlharte Griff, mit dem Lord Nick sie gepackt hielt, ließen jeden Gedanken an eine Flucht absurd erscheinen. Es geschah oft, daß Frauen von der Straße weg, manchmal sogar aus ihrem eigenen Hause entführt wurden, aber meist waren es reiche Witwen oder junge Erbinnen, die auf diese Weise in die Ehe gezwungen werden sollten. Sie selbst war weder reich noch hatte sie ein Erbe zu erwarten. Hatte der Straßenräuber also nur vor, sie zu vergewaltigen?
»Was wollen Sie von mir?« fragte sie. »Was für ein Interesse haben Sie an einem ganz gewöhnlichen Taschendieb?«
»Nein, einem ganz und gar ungewöhnlichen Taschendieb«, verbesserte er sie in seinem üblichen amüsierten Ton. »Einem schönen, gebildeten, elegant gekleideten und höchst kunstfertigen Taschendieb. Die Idee mit der gespielten Ohnmacht war wirklich genial. Erst bestehlen Sie Ihr Opfer, und dann benutzen Sie es noch, Ihnen zur Flucht vom Tatort zu verhelfen.« Er lachte lauthals. »Für was für einen Tölpel müssen Sie mich gehalten haben!«
»Sie wollen sich also nur an mir rächen«, überlegte sie laut, obwohl seine Worte nicht sonderlich rachelüstern klangen. »Was wollen Sie mit mir anstellen? Vergewaltigen? Ausrauben? Umbringen?«
»Was haben Sie für eine blühende Phantasie, Miß Morgan! Frauen zu vergewaltigen hat mich nie interessiert.« Er schmunzelte. »Und auf die Gefahr hin, daß Sie mich für einen Aufschneider halten – bisher hatte ich es auch noch nicht nötig.«
Octavia wußte nichts darauf zu antworten, da ihr seine Erklärung durchaus plausibel erschien. Denn trotz ihrer Wut und Angst mußte sie zugeben, daß dieser Straßenräuber verdammt attraktiv aussah.
»Andererseits«, wandte er bedächtig ein, »wenn Sie die Idee so reizt, dann denke ich, können wir es so einrichten, daß wir beide unseren Spaß dabei haben.«
Was für eine Unverschämtheit! Mit erhobener Hand fuhr Octavia im Sattel herum, um mit einer schallenden Ohrfeige das anzügliche Grinsen aus seinem Gesicht zu wischen.
Doch diesmal kam er ihr zuvor. Noch ehe sie ihn treffen konnte, hatte er den Schlag abgefangen und ihre Faust mit Gewalt wieder in den Schoß gedrückt. »Ihnen scheint die Hand ein wenig zu schnell auszurutschen, Miß Morgan«, stieß er gefährlich leise hervor. »Ich habe Ihre Attacke von heute früh nicht vergessen, und so leid es mir tut, ich werde dafür Vergeltung fordern müssen.« Jedes Lächeln war auf seinem Gesicht erstorben, und seine Augen blickten grau und kalt. »Ich reagiere höchst empfindlich auf körperliche Angriffe, Miß Morgan. Merken Sie sich das.«
»Sie provozieren sie ja!« konterte sie, bleich vor Wut. »Heute morgen wollten Sie mich nicht loslassen, und gerade eben haben Sie mich beleidigt!«
»Ich bitte um Verzeihung, ich hatte nicht vor, Sie zu beleidigen«, erwiderte er mit einem achtlosen Achselzucken, ohne den eisernen Griff um ihr Handgelenk zu lösen. »Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, meine Liebe. Ich könnte mir vorstellen, daß wir beide unter entsprechenden Umständen die helle Freude aneinander haben könnten.«
»Arroganter, aufgeblasener Köter!« zischte sie. Was für eine Demütigung, nur seine Zunge als Waffe einsetzen zu können!
»Ja, so hat mich schon manch einer genannt«, antwortete der Straßenräuber ungerührt. »Aber wenn Sie verzeihen – dieses Gespräch beginnt mich zu langweilen, und wenn ich mich nicht irre, reiten wir außerdem geradewegs in einen Schneesturm hinein. Deshalb schlage ich vor, daß Sie Ihr freches Mundwerk halten, bis wir im Trockenen sitzen.«
Das Wetter hatte sich verschlechtert. Schwarze Wolken waren am Horizont aufgezogen. Als sie über die Westminster Bridge ritten, peitschte ihnen der tückische Wind Schwaden eisigen Schnees ins Gesicht. Die wenigen Passanten, denen sie begegneten, stemmten sich mit gesenktem Kopf gegen den Wind, den Umhang eng um die Schultern geschlungen.
In schnellem Galopp passierten sie das Dorf Battersea, in dem man die Türen dicht verrammelt hatte. Als sie an einem Gasthof vorbeikamen, warf Octavia einen sehnsüchtigen Blick auf den anheimelnden Rauch, der aus den schmalen Schornsteinen stieg, doch der Straßenräuber hatte offenbar ein festes Ziel vor Augen und keine Zeit einzukehren. Langsam erreichten sie das offene Land. Die Häuser standen immer vereinzelter, kleine Weiler duckten sich in den Schnee. Sie wirkten wie ausgestorben, nur ein paar räudige Straßenhunde kauerten in den engen Gassen. Octavia dachte an ihren Vater. Ob er sich wohl Sorgen um sie machte, daheim in ihrem möblierten Zimmer in der Weaver Street? Sicher nahm er an, daß sie irgendwo Schutz vor dem Schneesturm gesucht hatte ...
Aber vielleicht würde sie ihn auch nie wiedersehen.
Je weiter sie aufs offene Land hinausritten, desto wahrscheinlicher erschien ihr diese letzte Möglichkeit. Seit ihrer Ankunft in London vor drei Jahren hatte es sie noch nie so weit aus der Stadt verschlagen. Wie sollte sie allein den Weg zurückfinden, selbst, wenn ihr Entführer sie schließlich laufen lassen würde, nachdem er ihr angetan hatte, was immer er wollte ... Was meinte er nur mit ›Vergeltung fordern‹? Warum regte er sich so auf? Schließlich hatte sie sich doch heute morgen in Tyburn gar nicht anders aus seinem Griff hatte befreien können!
Es ärgerte sie, als sie fühlte, daß ihr die Tränen kamen. Tränen der Angst, der Verzweiflung und der Hilflosigkeit. Sie kullerten angenehm warm über die kalten Wangen und mischten sich mit den Schneeflocken. Doch sie biß sich auf die Lippen, wartete trotzig, bis der Anfall von Schwäche vorüber war. Nein, die Genugtuung, sie weinen zu sehen, wollte sie ihrem widerwärtigen Entführer nicht geben.
»Sie brauchen keine Angst zu haben«, ertönte plötzlich seine Stimme hinter ihr. Konnte er ihre Gedanken lesen? »Ich werde Ihnen kein Haar krümmen.«
»Ich habe keine Angst!« begehrte sie auf. »Ich bin wütend und will nach Hause. Mein Vater wird sich Sorgen um mich machen. Sie können sich doch nicht einfach mit Gewalt irgendeine unschuldige Person von der Straße greifen! Ich habe Familie, habe Verantwortung!«
»Ach, Miß Morgan, so unschuldig sind Sie doch gar nicht«, entgegnete er mit sanfter Stimme. Sie hatten jetzt das Dorf Putney erreicht, ein wenig einladendes Nest auf der Kuppe eines Hügels inmitten einer eintönigen, schneebedeckten Heidelandschaft. »Wenn man sich sein Brot auf so fragwürdige Weise verdient wie Sie, muß man auf Überraschungen gefaßt sein.«
»Und Sie?« fuhr sie ihm in die Parade. »Sie verdienen sich Ihr Geld doch auf mindestens ebenso fragwürdige Weise!« Octavia seufzte entmutigt. Angesichts des Schneesturms in dieser endlosen Einöde verspürte sie nicht mehr den geringsten Wunsch, zu fliehen. Wenn er mit ihr zum Mond geritten wäre, wäre es ihr auch recht gewesen.
»Nun, ich bin aber auch stets auf Überraschungen gefaßt«, sagte er ernst, während er das Pferd in eine Seitenstraße am Ortsrand lenkte. »Oder fänden Sie es nicht auch äußerst überraschend, von einer schönen jungen Frau so raffiniert bestohlen zu werden?«
Eben wollte ihm Octavia eine schlagfertige Antwort geben, da zog das gemütliche Licht eines einladenden Gasthofs ihre Aufmerksamkeit auf sich. Über seiner Tür rüttelte der Sturm am Zeichen des ›Royal Oak‹. Lord Nick zog die Zügel an, und Peter schnaubte heftig, erschöpft von dem langen Ritt durch Schnee und Wind. Schon flog die Tür auf, und ein kräftiger Mann mit einer Schürze um den Bauch und ein schlaksiger Pferdeknecht kamen herausgelaufen.
»Mensch, Nick, was für ein Sauwetter! Wir haben schon auf dich gewartet«, rief der Mann, während der Bursche Peter am Zügel nahm. »Ist die Sache erledigt?«
»Jawohl. Sie bringen die Leichen hierher.« Der Straßenräuber schwang sich aus dem Sattel und schüttelte mit festem Griff die Hand des Mannes, und sie nickten sich beide wortlos zu, so als ob sie eine schwere Aufgabe in Würde zu Ende gebracht hätten. Dann wandte sich Lord Nick wieder seinem Pferd zu. »Wir sind angekommen, Miß Morgan«, sagte er und half ihr aus dem Sattel. »Nichts wie rein mit Ihnen«, und mit sanftem Druck bugsierte er sie in den Gasthof und von dort einen mit Steinplatten gefliesten Flur entlang in ein Zimmer, aus dem ihnen eine enorme Hitze entgegenschlug.
Der Raum war vom flackernden Licht zweier wuchtiger Kamine sowie einer Reihe Talgkerzen erleuchtet. Um die Tische saßen die Gäste dicht gedrängt und schauten Octavia, die verlegen dastand, neugierig an. Aus der Küche strömten Gerüche, die Octavia das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. Sie erinnerte sich, daß sie seit heute morgen, als sie vor ihrem Aufbruch nach Tyburn hastig ein Stück Brot mit Butter gegessen hatte, nichts mehr zu sich genommen hatte.
»Hey, Nick, wen hast du denn da mitgebracht?« ertönte eine gutmütige Stimme aus der Kaminecke. Ein älterer Mann saß dort und zog gemütlich paffend an einer langen Tonpfeife.
»Liebe Freunde, ich darf euch Miß Octavia Morgan vorstellen«, erwiderte Nick und schüttelte den Schnee von seinem Umhang, bevor er ihn zusammen mit Hut, Peitsche und Handschuhen zum Trocknen auf die Wandbank am Kamin legte.
»Ach, ja?« ließ sich eine Frau in der Küchentür vernehmen, die eine über und über mit Mehl bestäubte Schürze trug. Sie hatte die Arme über der mageren Brust verschränkt und hielt in der einen Hand eine hölzerne Schöpfkelle. Ihre stechenden Adleraugen ruhten mit einer deutlichen Mißbilligung auf Octavia, von deren Umhang der geschmolzene Schnee heruntertropfte und rund um ihre durchnäßten Stiefel eine große Pfütze bildete. »Und wer ist bitte Miß Morgan, Nick?«
»Eine höchst kunstfertige junge Dame, Bessie«, antwortete der Straßenräuber lapidar und warf Octavia ein anzügliches Grinsen zu, das ihre Unsicherheit nur noch verstärkte. »Aber legen Sie doch ab, Miß Morgan.«
Als sie nicht gleich reagierte, öffnete er persönlich mit beherztem Griff den Verschluß ihres triefenden Umhangs und reichte ihn einem Hausmädchen, das mit großen, ängstlichen Augen an Bessies Seite aufgetaucht war. »Da, häng das zum Trocknen auf, Tabitha«, befahl er. »So, und jetzt den Muff und die Handschuhe, Miß Morgan.«
Nachdem sie sich der Kleidungsstücke entledigt hatte, wäre Octavia am liebsten im Boden versunken, so hilflos fühlte sie sich den Blicken der Gäste ausgesetzt, die neugierig ihr cremefarbenes Musselinkleid begutachteten. Nervös nestelte sie an ihrem weißen Spitzenhalstuch. Hier in diesem stickigen Raum, in dem außer der adleräugigen Bessie im Türrahmen und dem verhuschten kleinen Dienstmädchen nur rauhbeinige Bauern versammelt waren, kam sie sich völlig fehl am Platze vor.
»Und jetzt«, fuhr Lord Nick mit freundlicher Stimme fort, »kommen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Miß Morgan, Sie haben, wenn ich mich recht erinnere, gewisse Schulden zu begleichen.« Mit beiden Händen packte er sie an der Taille, hob sie mit Schwung hoch und stellte sie auf den großen Tisch in der Mitte der Gaststube. Augenblicklich verstummten alle Gespräche.
Einen Moment lang war Octavia dermaßen verblüfft, daß es ihr die Sprache verschlug. Fassungslos starrte sie auf das Meer von Gesichtern, die ihr jetzt voll begierigen Interesses zugewandt waren, als erwarteten sie eine mitreißende Varieténummer.
»Irgendwo an ihrem Körper trägt Miß Morgan die Früchte ihrer morgendlichen Arbeit in Tyburn«, klärte Lord Nick in feierlichem Ton die Zuschauer auf. »Unter anderem meine Taschenuhr. Eines der wertvollsten Stücke, die ich besitze.«
»Doch nicht etwa die, die du dem alten Denbigh abgenommen hast, Nick?«
»Genau die, Thomas«, versicherte er dem Zwischenrufer mit bedächtigem Nicken. »Und nun, Miß Morgan, bitte ich Sie in aller Form, uns sowohl Ihr Versteck als auch Ihre Schätze zu offenbaren.«
Purpurne Röte überzog ihr Gesicht, als sie verstand, was er von ihr verlangte. Er wußte genau, wo sie die ›Früchte ihrer Arbeit‹ versteckt hatte. Denn in dem Hauseingang, in den sie sich vor dem wütenden Mob gerettet hatten, war er Zeuge geworden, wie sie verstohlen ihre Hand in den Schlitz in ihrem Kleid schob, um ihm aus freien Stücken sein Eigentum zurückzugeben. Und deshalb mußte ihm auch klar sein, daß sie den Beutel mit Bändern um ihre Taille geschnürt hatte und daß sie die Knoten nicht lösen konnte, ohne ihre Röcke hochzuheben.
»Sie räudiger Bastard!« zischte sie.
»Vergeltung, Miß Morgan, erinnern Sie sich nicht?« erwiderte er mit hochgezogener Braue. Gelassen nahm er sich aus dem Ständer über dem Tresen eine der Tonpfeifen. Bewegungslos schaute Octavia ihm zu, wie er sie genüßlich stopfte und anzündete. Ein Schmauchwölkchen entstieg der Pfeife, mischte sich mit dem Qualm des Kaminfeuers, um dann in die dichten Rauchschwaden einzugehen, die über den Köpfen der Gäste schwebten.
»Bessie wird Ihnen selbstverständlich zur Hand gehen, wenn Sie da... gewisse Schwierigkeiten haben sollten«, bemerkte er süffisant und wies mit einer Handbewegung auf die Frau mit der mehlbestäubten Schürze, die immer noch im Türrahmen zur Küche lehnte. Kochend vor Wut starrte Octavia ihn an, doch er hielt ihrem Blick stand. Er musterte sie kühl, jedoch jetzt ohne jeglichen Hauch von Spott in den Augen. Gegen diesen Mann hatte sie keine Chance. Verzweiflung packte sie, und ihre Knie wurden weich, als sie sah, wie Bessie auf sie zukam und sich mürrisch die Hände an der Schürze abwischte.
Sie hatte also keine andere Wahl als seinem Wunsch nachzukommen, wenn sie verhindern wollte, daß die Köchin ihr vor aller Augen das Kleid vom Leibe zog.
So biß sie die Zähne zusammen, ignorierte die grinsenden Gesichter der Umstehenden, die sich jetzt näher um den Tisch drängten, und hob ihr Kleid sowie ihren oberen Unterrock hoch. Nervös und beschämt wie sie war, verhedderten sich ihre Finger prompt in dem Wirrwarr von Schnüren, und es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bis sie die richtigen Bänder gefunden und gelöst hatte. Schließlich fiel der Lammfellsack mit einem dumpfen Plumps auf den Tisch.
Mit teilnahmsloser Miene stand der Räuber vor ihr. Die eine Hand war fordernd ausgestreckt, die andere spielte genüßlich mit der Pfeife. Als Octavia sein unbewegtes Gesicht sah, wallte eine unheimliche Wut in ihr auf. Sie packte den schweren Lederbeutel und schleuderte ihn ihrem verdutzten Gegenüber mit aller Kraft an den Kopf. Dann sprang sie vom Tisch, bahnte sich einen Weg durch das überraschte Publikum und rannte zur Tür. Dem Mädchen, das immer noch im Türrahmen stand, riß sie den Umhang aus den Händen und stürzte dann über den Flur hinaus in den tobenden Schneesturm. Sie wußte nicht, wohin, sie wollte nur fort, fort! Und so rannte sie blindlings die Straße entlang, die inzwischen fast kniehoch mit Schnee bedeckt war.
Eisig fuhr der Wind durch das dünne Kleidchen, während sie im Laufen versuchte, den Umhang überzuziehen. Muff und Handschuhe hatte sie vergessen, und so waren ihre Finger bald taub vor Kälte, aber es war ihr egal. Mit gesenktem Kopf kämpfte sie sich gegen den peitschenden Wind voran. Tränen der Wut und Verzweiflung rannen ihr übers Gesicht.
Der Schnee hatte das Geräusch der Schritte hinter ihr gedämpft, und so schrak sie zusammen, als sie plötzlich eine Hand auf ihrer Schulter verspürte. »Ja, zum Teufel, Frau, haben Sie völlig den Verstand verloren?« hörte sie die Stimme des Straßenräubers.
»Lassen Sie mich los!« Sie entwand sich seinem Griff und starrte ihn haßerfüllt durch den Schleier des Schneegestöbers an. »Widerwärtiger Abschaum! Sie haben, was Sie wollten, also lassen Sie mich in Ruhe!«
»Ich will aber nicht Ihren Tod auf dem Gewissen haben!« erklärte er.
»Gewissen? Sie haben doch gar keines! Sie elender Kotzbrocken, Sie ekelerregendes Gossenschwein!«
Überraschenderweise brach der Straßenräuber bei ihren Verwünschungen in schallendes Gelächter aus. Doch diesmal war es ein gutmütiges, menschenfreundliches Lachen, ganz anders als sein übliches spöttisches Grinsen. »Ja, Sie haben recht, wenn Sie mich beschimpfen«, gestand er. »Aber sehen Sie, die Rechnung für den Kinnhaken und den Biß in den Oberarm war einfach noch offen. Ich habe Ihnen körperlich keinen Schmerz zugefügt, und Sie mußten nicht mehr als einen Unterrock lüften. Schließen wir also einen Waffenstillstand, und kommen Sie zurück ins Warme, bevor Sie sich hier draußen den Tod holen!«
»Ich denk’ nicht daran!« Zornbebend wandte sie sich ab und stapfte die schmale Straße weiter, geblendet von den eisigen Schneeflocken, die ihre Lider verklebten.
»Sie neigen zu ungewöhnlicher Ausdrucksweise und unerwarteten Temperamentsausbrüchen, Verehrteste.« Mit diesen Worten nahm er sie mit Schwung auf den Arm und trug sie, ungerührt von ihrem Strampeln und ihrem Schreien, zurück in den ›Royal Oak‹.
Er stieß die Eingangstür mit dem Fuß hinter sich zu und stieg dann mit seiner süßen Last die Treppe hoch. »Bessie«, rief er, »schick Tabitha mit Glühwein und Handtüchern nach oben! Und in einer halben Stunde Essen, bitte.«
Bessie erschien im Türrahmen und schaute Lord Nick nach, der, unbeeindruckt von Octavias Flüchen, zwei Stufen auf einmal nehmend, nach oben marschierte. Abschätzig schürzte sie die Lippen und kehrte in die Küche zurück. »Hast ja gehört, Tab, Glühwein auf sein Zimmer.«
»Jawohl, Mistress.« Tabitha knickste artig und eilte zum Herd, auf dem eine Kupferkanne mit köstlich duftendem Glühwein stand.
Oben hörte man lautes Türenknallen.
»Zum Teufel noch mal, für so ein zierliches Persönchen sind Sie aber verdammt schwer, Teuerste«, stöhnte der Straßenräuber und stellte seine Gefangene mit einem Seufzer der Erleichterung auf die Füße. »Und jetzt hören Sie auf, mich zu beschimpfen und beruhigen Sie sich wieder. Sie sind bei dem Wetter im Augenblick nun einmal an dieses Haus gefesselt, drum sollten sie meine Gastfreundschaft mit ein bißchen mehr Dankbarkeit annehmen.«
Aus seinen Worten sprach eine unbestreitbare Logik, die Octavia trotz ihrer Rage einleuchtete. Außerdem mußte sie hier oben nicht mehr die Blicke der feixenden Männer ertragen, die Zeuge ihrer Schmach geworden waren.
So schwieg sie und begann sich in dem Zimmer umzuschauen. Weiße Wachskerzen tauchten den Raum in ein mildes Licht. Die Eichendielen am Boden schmückte ein bunter Teppich, am Fenster stand ein runder Tisch. Links und rechts des flackernden Kaminfeuers, das eine angenehme Wärme verströmte, luden zwei gepolsterte Sessel zum Entspannen ein. Es roch angenehm nach Lavendel und Bienenwachs. Der Feuerbock glänzte ebenso wie die polierten zinnernen Kerzenhalter, und auch das schimmernde Holz der Möbel zeugte davon, daß es mit Liebe gepflegt wurde.
Plötzlich überkam Octavia eine grenzenlose Müdigkeit, und auch ihr Magen knurrte vernehmlich, als etwas von den köstlichen Düften aus der Küche bis zu ihr hochstieg.
Sie seufzte schicksalsergeben, warf den Umhang ab und ging zum Kamin, um die klammen Hände aufzuwärmen. Ihr Haar war immer noch voller Schnee, der ihr jetzt eiskalt in den Nacken tropfte, und auch der Rocksaum troff vor Nässe. Besonders ihre Füße in den durchnäßten Stiefeln waren taub vor Kälte. Octavia wurde von einem heftigen Schüttelfrost erfaßt.
Der Räuber beobachtete sie schweigend. Ein mißtrauisches Stirnrunzeln lag auf seinem Gesicht. Ihr schlanker Körper, der sich graziös zum wärmenden Feuer beugte, war angenehm anzuschauen. Und jetzt, da sie nicht nur ihren Widerstand, sondern auch ihre haßerfüllten Schmähungen aufgegeben hatte, rührte ihn auch wieder ihr madonnenhaftes ovales Gesicht und die Unschuld ihrer rehbraunen Augen.
Aber gerade im schönsten Apfel sitzt der Wurm, dachte er. Seine Lippen verhärteten sich, als er wieder das engelsgleiche Antlitz seines Zwillingsbruders vor sich sah und ihn die Wut überkam, die diese Erinnerung seit nunmehr achtzehn Jahren begleitete. Doch nicht mehr lang, und er würde diesem elenden Zustand ein Ende setzen, würde seinem Bruder die Maske vom Gesicht reißen, die Ketten sprengen, in die ihn Philips Machenschaften geschlagen hatten ...
Ein Klopfen an der Tür riß ihn aus seinen Gedanken. Mit schüchternem Knicks trat Tabitha herein. Sie trug ein Tablett mit einer Kupferkanne und zwei Krügen. Unter den Arm hatte sie sich ein paar Handtücher geklemmt.
»Hier, Sir. Soll ich dann schon den Tisch decken?«
»In zehn Minuten, Tab.« Er bedeutete ihr zu gehen. Sie stellte das Tablett ab, knickste und ging.
Als Octavia sich umwandte, reichte der Straßenräuber ihr eines der Handtücher. »Trocknen Sie sich die Haare, Miß Morgan.« Sie löste die Haarnadeln und begann, ihr offenes Haar zu rubbeln, während er Glühwein in die Zinnkrüge ausschenkte. Doch nach wie vor zitterte sie vor Kälte in ihrem dünnen, durchnäßten Musselinkleid, und ihre Füße waren noch immer taub.
»Trinken Sie das.« Er reichte ihr einen der Krüge. Sie nahm ihn, wärmte ihre Hände daran und inhalierte das betörend würzige Aroma. Sie fühlte sich so schwach, daß sie es nicht schaffte, sich seinen Kommandoton zu verbitten.
Unvermittelt stand er auf und verließ den Raum. Erleichtert ließ sich Octavia in einen der Sessel fallen und trank in gierigen Zügen von dem köstlichen Getränk, bevor sie ihre klatschnassen Stiefel und Strümpfe auszog und die Füße ans wärmende Feuer hielt. Es schmerzte, als das Blut wieder in die Zehen schoß.
»Ziehen Sie ihr Kleid aus und dieses hier an. Tab wird alle Ihre Sachen trocknen.«
Sie zuckte zusammen, denn sie hatte die Rückkehr ihres Entführers völlig überhört. Entgeistert schaute sie auf. Er hielt ihr mit unbewegtem Gesicht ein Samtgewand entgegen.
»Mein Kleid trocknet schon von allein an meinem Körper«, entgegnete Octavia unsicher.
»Reden Sie keinen Unsinn und tun Sie, was ich Ihnen sage. Sonst haben Sie morgen eine Lungenentzündung.« Er warf ihr das Samtkleid in den Schoß. Sie saß da und blickte ihn treuherzig aus großen Augen an, ein berückendes Bild argloser Sittsamkeit, und für einen Moment war er drauf und dran, ihr diese Unschuld abzunehmen.
Gerade im schönsten Apfel sitzt der Wurm, rief er sich ins Gedächtnis zurück. Sie hatte ihm heute schon einmal etwas vorgemacht, hatte eine Probe ihrer verblüffenden Schauspielkunst abgelegt. In Wahrheit war sie eine erwachsene Frau, eine Diebin, die sich auf der Straße herumtrieb. Und sie würde auch mit ihrem Körper bezahlen, wenn sie es für nötig hielt.
»Erzählen Sie mir bloß nicht, Sie hätten sich noch nie vor einem Mann ausgezogen«, erklärte er mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Aber wenn Sie darauf bestehen, dann spiel’ ich eben mit.« Ein gemeines Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. »Sie haben recht, Spiele bringen mehr Pfeffer in die Sache. Soll ich mich umdrehen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, wandte er ihr den Rücken zu.
Ein wahnsinnger Zorn wallte in Octavia auf. Kochend vor Wut suchte sie nach einem Messer ... nach irgendeinem harten Gegenstand. Ihr Blick fiel auf den Feuerhaken.
Er hörte das Klirren des Eisens, als es das Kamingitter streifte, fuhr herum und sah sie mit erhobener Waffe. Ihre Zähne blitzten, und in ihren Augen las er die Bereitschaft zu töten.
»Himmel und Hölle!« Im letzten Moment sprang er zur Seite, als der Feuerhaken mit einer Wucht herabsauste, die ihm den Schädel zertrümmert hätte. Kaum hatte der Schlag sein Ziel verfehlt, stürzte sie sich wie eine Besessene auf ihn. Es gelang ihm, sie am Handgelenk festzuhalten, und sie kämpften miteinander wie zwei Tiger. Er war verblüfft, welche Kraft in ihr steckte. Oder war es nur die rasende Wut, welche sie so über sich hinauswachsen ließ?
Grimmig drehte er ihr das Handgelenk um, bis sie die Finger öffnen und das Mordwerkzeug fallen lassen mußte.
»Was zum Teufel ist denn bloß in Sie gefahren?« schrie er sie an, packte sie an den Schultern und schüttelte sie. »Sie hätten mich umbringen können!«