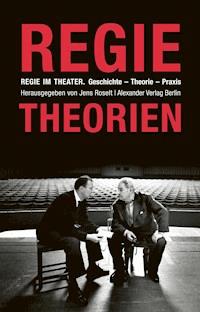
Regie im Theater. Regietheorien E-Book
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Hand- und Lesebuch mit kommentierten Originaltexten bedeutender Regisseure. Der Band versammelt Grundlagentexte, die nachvollziehbar machen, wie sich Regie in den vergangenen gut 250 Jahren von einer handwerklichen Tätigkeit zu einer künstlerischen Praxis entwickelt hat. Die ausgewählten Texte stammen von namhaften Theatermachern, die selbst als Regisseure gearbeitet haben und ihr Praxiswissen reflektieren. Sie forschen nach den Regeln und Gesetzmäßigkeiten ihrer eigenen Praxis. Mit Texten von Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, Konstantin Stanislawski, Wsewolod Meyerhold, LeopoldmJeßner, Max Reinhardt, Gustav Gründgens, Bertolt Brecht, Richard Schechner, Anne Bogart, Katie Mitchell u. a. Theaterwissenschaftler, Dramatiker und Übersetzer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
REGIE IM THEATER
Geschichte – Theorie – Praxis
Herausgegeben und mit einer Einführung von Jens Roselt
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2015
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
www.alexander-verlag.com | info@alexander-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat/Redaktion: Christin Heinrichs-Lauer
Satz, Layout, Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Umschlagphoto: Fritz Kortner und Martin Held auf der Bühne des Berliner Schiller-Theaters. Foto © Heinz Köster/Archiv Heinz Köster/ Deutsches Theatermuseum München/Archiv der Akademie der Künste
ISBN 978-3-89581-370-2 (eBook)
Jens Roselt, Professor für Theorie und Praxis des Theaters an der Universität Hildesheim, Forschungsschwerpunkte: Diskursgeschichte der Regie, Theorie der Schauspielkunst, Ästhetik des zeitgenössischen Theaters, Aufführungsanalyse. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Theorie und Ästhetik des Theaters (u. a. Phänomenologie des Theaters, Seelen mit Methode – Schauspieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischen Theater, Chaos & Konzept – Proben und Probieren im Theater) sowie Dramen und Shakespeare-Bearbeitungen.
INHALT
Jens Roselt
Regie im Theater – Theorien, Konzepte, Modelle
Einführung
Der Regisseur als Vermittler und Organisator – August Lewald
August Lewald: »In die Scene setzen«
Der Regisseur als Feldherr – Franz Grüner
Franz Grüner: Kunst der Scenik in ästhetischer und ökonomischer Hinsicht
Der Regisseur als Historienmaler – Herzog Georg II. von Meiningen
Herzog Georg II. von Meiningen: Inszenierungsregeln
Der Regisseur als Lichtkünstler – Adolphe Appia
Adolphe Appia: Wie läßt sich unsere Inszenierung reformieren?
Der Regisseur als Szenograf – Edward Gordon Craig
Edward Gordon Craig: Die Kunst des Theaters
Der Regisseur als Autor der Inszenierung – Max Reinhardt
Max Reinhardt: Von der modernen Schauspielkunst und der Arbeit des Regisseurs mit dem Schauspieler
Das Regiebuch
Der Regisseur als Vermittler – Carl Hagemann
Carl Hagemann: Regie als Kunst
Der Regisseur als Transformator – Herbert Scheffler
Herbert Scheffler: Regie und Regisseur
Regisseur und Arrangeur
Der Regisseur als souveräner Interpret – Leopold Jeßner
Leopold Jeßner: Die künstlerische Verantwortung des Regisseurs, seine Rechte und Pflichten
Regie
Der Regisseur als Pädagoge – Konstantin Stanislawski
Konstantin Stanislawski: Die Kunst des Schauspielers und des Regisseurs
Der Regisseur als Experimentator – Wsewolod E. Meyerhold
Wsewolod E. Meyerhold: Zur Geschichte und Technik des Theaters
Die Kunst des Regisseurs
Der Regisseur als Steuermann des Theaters – Alexander Tairow
Alexander Tairow: Der Spielleiter
Der Regisseur als Inszenator – Alfred Kerr
Alfred Kerr: Spanische Rede vom deutschen Drama oder das Theater der Hoffnung
Der Regisseur als Dirigent – Otto Falckenberg
Otto Falckenberg: Der sichtbare und der unsichtbare Dirigent
Der Schauspieler als Regisseur – Gustaf Gründgens
Gustaf Gründgens: Regie
Der Regisseur als Probenleiter – Bertolt Brecht
Bertolt Brecht: Haltung des Probenleiters (bei induktivem Vorgehen)
Die Regie Bertolt Brechts
Fragen über die Arbeit des Spielleiters
Regie als Reduktion: Jean Vilar
Jean Vilar: Mord des Regisseurs
Regie in dynamischen Gruppenprozessen – Richard Schechner
Richard Schechner: Regisseur
Regie als Sprung ins Leere – Anne Bogart
Anne Bogart: Die Arbeit an sich selbst
Die Geschicke der Regie – Katie Mitchell
Katie Mitchell: Die ersten Probentage
Anhang
Quellennachweise
Literatur (Auswahl)
Personenverzeichnis
REGIE IM THEATER – THEORIEN, KONZEPTE, MODELLE
Einführung
Auftritt: Ein Regisseur kommt auf die Bühne
»Herzlich willkommen«, sagt Nicolas Stemann (*1968) zu Beginn seiner Inszenierung von Goethes Faust bei den Salzburger Festspielen 2011. Der Regisseur steht mit einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne und wendet sich direkt an das Publikum. Die freundliche Begrüßung entpuppt sich rasch als veritable Moderation, mit der Stemann die Zuschauer kenntnisreich auf die anstehende gut achtstündige Aufführung beider Teile der Faust-Tragödie vorbereitet. Er führt in die Gliederung der Inszenierung ein, weist auf die Pausen hin, macht witzige Anspielungen auf den Probenprozess und lockt die Zuschauer mit dem Versprechen: »Gegen Ende wird es richtig gut.« Stemann wird in jeden Teil der als Marathon angekündigten Inszenierung einführen. Der Regisseur macht dabei Interpretationsangebote für Goethes Text, erläutert »in groben Zügen das, was gleich passiert«, stellt dramaturgische Überlegungen an und erklärt einzelne Aspekte seiner Inszenierung wie z. B. den Übergang von Faust I zu Faust II: »Nachdem es im ersten Teil um den Mikrokosmos, die kleine Welt, ging, geht es jetzt um die große Welt, die Welt der Wirtschaft, der Politik und der Wissenschaft. Entsprechend wird es ein wenig komplizierter und unübersichtlicher.« Der für Zuschauerinnen und Zuschauer im Gegenwartstheater notorischen Frage »Was wollte der Regisseur uns sagen?« wird gewissermaßen prophylaktisch begegnet, indem der Regisseur es gleich selbst sagt.
Der Auftritt des Regisseurs im Rahmen seiner Inszenierung stiftet im Publikum eine eigentümliche Form von Aufmerksamkeit. Erstauntes Schweigen und amüsiertes Gekicher lösen im Auditorium einander ab. Auch wenn ein Publikum heutzutage weiß, dass im Theater mit Regisseuren zu rechnen ist, hatte man diesen leibhaftig auf der Bühne wohl doch nicht erwartet. Nicht, was Stemann sagt, sondern dass er überhaupt vor die Zuschauer tritt und die eigene Arbeit erläutert, vermag zu verblüffen. Zwar ist es keine Seltenheit, dass Regisseure als Schauspieler in den eigenen Inszenierungen mitwirken, doch Stemann erscheint eben nicht als Darsteller in der Rolle eines Conférenciers, sondern verkörpert sich selbst in der Rolle des Regisseurs, die er ausstellt und zu genießen scheint. Zumindest kaschiert er nicht, dass er entscheidende Verantwortung für die folgende Aufführung hat, auch wenn er stets vom »wir« spricht und damit sämtliche Beteiligte der Produktion vor und hinter den Kulissen meint, deren Namen er am Ende der Aufführung auf der Bühne verlesen wird. Stemann inszeniert sich als eine Figur, die genaue Kenntnis über die folgende Inszenierung hat und insofern über Mehrwissen gegenüber dem Publikum verfügt. Zugleich macht er seine Interpretationshoheit über Goethes Text geltend, indem er den Zuschauerinnen und Zuschauern vorab sagt, wie sie das anschließende Geschehen auf der Bühne verstehen können oder aufzufassen haben. Da Stemann sich unmittelbar an das Publikum wendet, setzt er sich als Mediator in Szene, der zwischen dem Text, seiner Inszenierung und den Zuschauern vermittelt. So unkonventionell sein Aufritt auf den ersten Blick auch erscheinen mag, so spiegelt sein Verhalten doch auch ein gängiges Verständnis von der Tätigkeit und Funktion der Regie im Theater.
Dass Regisseure in ihren eigenen Inszenierungen auftreten und dabei ihre Regiefunktion zeigen, thematisieren oder problematisieren, ist keine Neuigkeit. Legendär sind die Auftritte von Christoph Schlingensief (1960–2010), der auf die Bühne sprang und mit Mikro- oder Megafon die Darsteller kommandierte, das Publikum instruierte und gleichzeitig den reibungslosen Ablauf der eigenen Inszenierung zu stören schien (z. B. 100 Jahre CDU – Spiel ohne Grenzen, Berlin 1993). Auch Einar Schleef (1944–2001) ist in seinen Inszenierungen in Erscheinung getreten und hat dabei seine Funktion als Regisseur thematisiert, so als er 1996 als Titelfigur von Bertolt Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti am Berliner Ensemble wie ein Dompteur oder Dirigent in der Mitte der Bühne die übrigen Darsteller um sich kreisen ließ. Auch Stemann war bereits 2009 in seiner Inszenierung der Uraufführung von Elfriede Jelineks Die Kontrakte des Kaufmanns am Schauspiel Köln auf der Bühne erschienen. Diese Regisseure verzichteten durch ihre Auftritte auf jene pathetische Distanz zur eigenen Arbeit, die ein Regisseur wie Gustaf Gründgens (1899–1963) Mitte des 20. Jahrhunderts noch exemplarisch als Merkmal von Regiekunst stilisierte, als er feststellte, dass er sich drei Stunden vor der Premiere von der Inszenierung zu lösen beginne: »Ich kann ja nichts mehr tun. […] Aber nun muß diese Arbeit ohne mich leben. […] Ich meide die Bühne, ich bin nicht imstande, im Zuschauerraum zu sitzen. Am liebsten möchte ich nie mehr etwas von dem, was da oben geschieht, sehen oder hören.«1 Unabhängig von den Vorlieben und Schwächen einzelner Regiepersönlichkeiten wird hier ein bestimmtes Verständnis von Regie als einer künstlerischen Tätigkeit kenntlich, die modellhaft auch die Erwartungen von Zuschauern prägen kann. Regisseurinnen und Regisseure sind demnach die Frauen und Männer hinter den Kulissen oder eine Größe, die über allem schwebt oder sich im Publikum verborgen hält oder sich in die Kantine verzieht, falls sie oder er das Theater nicht ohnehin verlässt, wenn die Zuschauer kommen. Diese Abwesenheit ist gleichzeitig die Voraussetzung für die Auratisierung einzelner Personen wie des gesamten Berufsstands. Damit einher geht die Zugrundelegung eines bestimmten Schöpfungsmythos, der Regie als Kunstform in Analogie zu anderen Künsten setzt und die Regisseurin oder den Regisseur als verantwortliches Künstlersubjekt stilisiert, das hinter seinem »Werk« steht. Ein Regisseur wirkt demnach durch seine Inszenierung, anstatt in ihr mitzuwirken. Er gilt gleichsam als Autor der Inszenierung oder als Schöpfer, der das Material des Theaters ordnet, bearbeitet und maßgeblich formt.
Ihre reale Abwesenheit hält das Publikum allerdings selten davon ab, Regisseurinnen und Regisseure zu zentralen Bezugsgrößen der eigenen Rezeption zu machen. Man sieht zwar einzelne Schauspieler auf der Bühne, betrachtet ihre Körper, verfolgt ihre Bewegungen und hört ihre individuellen Stimmen in einem eigens gestalteten Bühnenraum den Text eines bekannten Autors sprechen und ist doch gewohnt, all dies als eine Leistung zu begreifen, die aus der Arbeit der Regie hervorgeht und auf ihre Intentionen oder Konzepte zurückzuführen ist. Diese Auffassung ist nicht selbstverständlich, sondern historisch bedingt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























