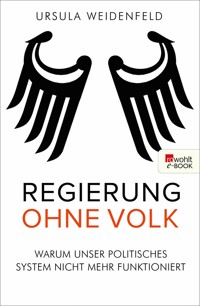
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Kluft zwischen Politik und Bevölkerung wird größer. Was ist los mit unserer Demokratie? Noch nie war die Kritik am politischen Establishment so stark wie heute – und es bleibt nicht bei der bloßen Kritik. Offenbar bildet die parlamentarische Demokratie die Meinungen der Bevölkerung nicht mehr ausreichend ab, das Gefühl macht sich breit, nicht gehört zu werden. Populisten mit allzu einfachen Formeln und Erklärungen nutzen das immer mehr aus, es scheint nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns einen Trump, eine Marine Le Pen gibt, die das hergebrachte System grundlegend in Frage stellen. Ist das nur eine Krise der Parteien? Nein, sagt Ursula Weidenfeld, seit vielen Jahren kritische Beobachterin des Berliner Politikbetriebs. Wenn die Wähler sich im Parlament nicht mehr wiederfinden, nagt das an den Fundamenten der Demokratie. Wenn Politik und Volk nicht weiter auseinanderdriften sollen, dann muss umgesteuert werden. Ursula Weidenfeld zeigt auf, was jetzt zu tun ist, damit unser politisches System wieder seine Aufgabe erfüllen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ursula Weidenfeld
Regierung ohne Volk
Warum unser politisches System nicht mehr funktioniert
Über dieses Buch
Die Kluft zwischen Politik und Bevölkerung wird größer. Was ist los mit unserer Demokratie?
Noch nie war die Kritik am politischen Establishment so stark wie heute – und es bleibt nicht bei der bloßen Kritik. Die Protest- und die Nichtwähler zusammen sind deutlich zahlreicher als jene, die SPD und CDU/CSU, die früheren Volksparteien, gemeinsam mobilisieren können. Offenbar bildet die parlamentarische Demokratie die Meinungen der Bevölkerung nicht mehr ab, das Gefühl macht sich breit, nicht gehört zu werden. Populisten mit allzu einfachen Formeln und Erklärungen nutzen das immer mehr aus, es scheint nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns einen Trump, eine Marine Le Pen gibt, die das hergebrachte System grundlegend in Frage stellen. Ist das nur eine Krise der Parteien?
Nein, sagt Ursula Weidenfeld, seit vielen Jahren kritische Beobachterin des Berliner Politikbetriebs. Wenn die Wähler sich im Parlament nicht mehr wiederfinden, nagt das an den Fundamenten der Demokratie. Wenn Politik und Volk nicht weiter auseinanderdriften sollen, dann muss umgesteuert werden. Ursula Weidenfeld zeigt auf, was jetzt zu tun ist, damit unser politisches System wieder seine Aufgabe erfüllen kann.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-10019-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1. Die Ohnmacht der anderen
Jeder Aufstand der Indianer, den ich erlebt habe, war das Resultat gebrochener Versprechen und Verträge der Regierung.
Buffalo Bill
Sie wollen neue Mauern bauen, sie lehnen das Fremde ab und sehnen sich nach der heilen Welt der fünfziger Jahre. Überall im Westen sind die Populisten auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland – aber warum nur? Hier stehen wir vor dem seltsamsten Paradox der neuesten deutschen Geschichte: Nie ging es den Menschen so gut wie heute, nie waren mehr von ihnen erwerbstätig, nie war der allgemeine Wohlstand so groß. Nie war eine deutsche Politikerin im Ausland so angesehen und geachtet wie Angela Merkel. Und doch gelingt es nicht mehr, diese Erfolge zu einem politischen Guthaben im eigenen Land umzumünzen. Vertrauen ist in Misstrauen umgeschlagen, Zufriedenheit in Verdruss. Die Regierung und die Wähler – sie verstehen sich nicht mehr.
In dem Augenblick, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel unerschrocken einen eigenen politischen Akzent gesetzt hat, sind alle Schäden am Gebäude der deutschen Demokratie schlagartig sichtbar geworden. Die Flüchtlingsentscheidung vom August 2015 hat die Legitimationskrise der Regierungschefin offenbart. Sie hat allein verfügt, syrische Flüchtlinge ohne weitere Kontrolle ins Land zu lassen. Sie hat so gehandelt, weil sie allein entscheiden konnte. In drei Legislaturperioden hat sie sich diesen eigenen Entscheidungsspielraum geschaffen. Sie hat das Parlament immer öfter außen vor gelassen. Beim Atomausstieg, in der Finanz- und Staatsschuldenkrise und zuletzt in der Flüchtlingsfrage hat sie die Abgeordneten wie dumme Jungs stehen lassen. Die Große Koalition ersparte es ihr, um Mehrheiten im Parlament werben zu müssen. So hat sie die eigene politische Handlungsfähigkeit ausgebaut. Doch die Demokratie hat sie damit beschädigt.
Alle Charakteristika des modernen Staates – Souveränität, Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt – scheinen nun zur Disposition zu stehen, ohne dass ein neues zustimmungsfähiges Modell einer modernen Demokratie in Sicht ist.[1]
Die Wähler üben ihren Einfluss nur durch die von ihnen gewählten Abgeordneten aus. Werden die entmündigt, wird auch der Souverän entmachtet. Die Regierung tritt an die Stelle des Parlaments. Zuerst vergisst sie das Volk. Dann verliert sie es.
Darüber hat es keinen großen Krach gegeben. Es war kein offener Kampf um die Fundamente einer demokratischen Gesellschaft. Es war eher so, wie ein Reisender seine Tasche versehentlich im Zugrestaurant stehen lässt. Der Verlust wird erst bemerkt, wenn der Schaffner den Fahrschein sehen will.
Wie in vielen anderen Demokratien haben sich auch in Deutschland die Gewichte verschoben. Zuerst unbemerkt, dann immer dramatischer. Die Regierung – die Exekutive – hat an Macht und Einfluss gewonnen. Das Parlament – die Legislative – hat verloren. Dieser Befund klingt erst einmal nur nach einem Proseminar in Politikwissenschaften. Doch in Wirklichkeit ist er für das ganze Volk entscheidend.
Viele Bürger fühlen sich durch die gewählten politischen Vertreter nicht mehr repräsentiert. Sie stemmen sich gegen die politische Klasse. Sie misstrauen dem Establishment und wählen es schließlich ab. Sie verachten die etablierten Politiker und entscheiden sich für neue Gesichter. Sie unterstellen Experten und Beratern, käuflich zu sein. Sie hassen Unternehmer und Manager. Sie werfen den Journalisten falsche Berichterstattung vor. Das ganze System ist ihnen verdächtig.[2]
Es nutze nur den Insidern und schade den Außenstehenden, lautet der Vorwurf. Unter dem Deckmantel von Volkssouveränität und repräsentativer Demokratie habe sich eine Klasse eingerichtet, die alles andere als demokratisch gesinnt sei: Sie beschütze nur sich selbst und ihr Herrschaftswissen und schotte sich gegen die Ärmeren, weniger Gebildeten und gegen die weniger Gewandten ab. Sie pflege eine gemeinsame Sprache, die für den normalen Bürger nicht mehr verständlich sei. Sie beute das gesellschaftliche System aus und habe das Gemeinwohl aus den Augen verloren. Deshalb gehöre sie davongejagt.[3]
Eine Konsequenz aus diesen Vorurteilen ist die Repolitisierung der Öffentlichkeit. Nach Jahren zurückgehender Wahlbeteiligung und wachsenden Desinteresses an der Politik scheint sich nun ein Wandel anzubahnen. Seit mit der AfD eine politische Alternative für die Frustrierten aufgetaucht ist, aber auch seit auf der Gegenseite mit dem Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, ein unerwartetes Gesicht die Politik belebt, steigen sowohl das Interesse an Politik als auch die Wahlbeteiligung.[4]
Im Januar 2017 hielten zwei Präsidenten Reden, die aus unterschiedlichen Gründen als bedeutend gelten können. Die erste war die Abschiedsrede des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Gauck zeichnete zunächst das Bild eines starken, selbstbewussten und energischen Landes und nannte es «das beste, das demokratischste Deutschland, das wir jemals hatten». Anschließend aber diagnostizierte der erste Mann im Staat einen dramatischen Einbruch der politischen Steuerungsfähigkeit. «Wir erleben vielfältige Bemühungen, die Kontrolle zu behalten oder wiederzugewinnen.» Am Ende seiner Rede konnte es keinen Zweifel mehr geben. Der Altbundespräsident ist nicht nur wegen der politischen Lage in der Welt und in Europa sehr besorgt. Er ist auch nicht sicher, ob die deutsche Demokratie den Herausforderungen standhalten wird.[5]
Die zweite wichtige Rede war die Antrittsrede des US-Präsidenten Donald Trump. Er gab eine verstörende Antwort auf die Sorgen um die Zukunft des Westens. Der amerikanische Präsident versprach den Bürgern zwar, ihnen die Kontrolle über die Politik zurückzugeben. Doch er sprach nur einen Teil der amerikanischen Bürger an. Mit ihm seien nun diejenigen an die Macht gekommen, die bislang vom Establishment verachtet, vom Parlament nicht repräsentiert und von der gebildeten Mittelschicht der Großstädte belächelt worden seien.[6] Trump versteht sich nicht mehr als Hüter der Interessen aller Amerikaner. Er präsentiert sich als Revolutionär, der mit den Entrechteten auf die Barrikaden geht. Er nimmt die weitere Spaltung der Gesellschaft nicht nur in Kauf, er treibt sie an: «Heute entreißen wir Washington die Macht und geben sie zurück an euch, das Volk.»
Trump wies den Weg, der den westlichen Demokratien bevorsteht, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre politischen Systeme zu stabilisieren und die Zustimmung ihrer Bürger zurückzugewinnen. Es ist die Entwicklung der repräsentativen Demokratie zur Autokratie, zu einem politischen Ein-Mann-Betrieb. Ein Dauerplebiszit diktiert die politischen Entscheidungen. Stimmungen beeinflussen die Politik stärker als Überzeugungen, Spontaneität ersetzt die großen Visionen.
Der deutsche Präsident hatte in seiner Rede gemahnt, die Politik sei kein Versandhaus, das jedem Konsumenten genau die politischen Ergebnisse liefern werde, die er erwarte. Der amerikanische eröffnete genau diesen politischen Supermarkt.
Europa und der Westen stehen an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Die heilige Allianz von Demokratie, Wohlstand und Globalisierung ist zerbrechlich geworden. «Disruption», der radikale Bruch mit dem Gewohnten, ist nicht nur das Schlüsselwort für die Digitalisierung der Welt. Es scheint auch der Begriff zu werden, der die radikalen Veränderungen der demokratischen Gesellschaften beschreibt.
Würde jemand versuchen, die politische Verfassung der westlichen Welt auf einen Begriff zu bringen, käme das Wort «Kontrollverlust» heraus. Die Staaten des Westens haben die Kontrolle verloren: Sie, die einstmals Mächtigen, stehen ratlos vor der zerfallenden Weltordnung, die sie selbst geschaffen haben – und die sie nun kaum noch stabilisieren können. Sie blicken hilflos auf die abtrünnigen Verbündeten in England. Sie schütteln entgeistert den Kopf über die gewählten neuen Anführer in Partnerländern wie den USA. Sie sind entsetzt über den wachsenden Egoismus der Nationalstaaten und über die zunehmende Polarisierung im Inneren dieser Länder. Und: Sie machen sich immer noch Illusionen über den Zustand ihres eigenen Landes.
Der Zusammenhalt in den westlichen Gesellschaften wird unterdessen immer schwächer. Der Konsens darüber, bei allen Schwächen des demokratischen Systems doch in der besten aller Welten zu leben, zerbricht. Auch in Deutschland suchen die Bürger Halt und erleben einen haltlosen Staat. Sie wünschen sich Orientierung und bekommen ein Diskursangebot. Sie erwarten ein funktionierendes Gemeinwesen und sollen mit Bürokratie vorliebnehmen. Sie möchten ihre Stimme in der Demokratie repräsentiert sehen und fühlen sich nicht mehr gehört.
Digitalisierung und Globalisierung wirken als gewaltige Kräfte nicht nur auf die Unternehmen und das Arbeitsleben des Einzelnen. Sie bringen auch die scheinbar unverrückbaren Gewissheiten der demokratischen Gesellschaften ins Wanken. Sie zerrütten das demokratische Fundament der westlichen Welt, sprengen ihre Ordnung und lassen die Staaten wie die Einzelnen mit ihren Ohnmachtserfahrungen zurück. Es ist also nicht überraschend, dass sich die Wähler in dieser Lage von den alten Parteien und den gewohnten Gesichtern abwenden.
Die Behauptung, kein Politiker zu sein, ist international zum erfolgreichsten Wahlslogan geworden. Donald Trump ist mit diesem Versprechen in das Weiße Haus eingezogen. Der britische Europa-Gegner Nigel Farage präsentierte sich im Kampf für den Brexit überzeugend als Anti-Establishment – obwohl er selbst natürlich dazugehört und seit seiner Schulzeit parteipolitisch aktiv ist.
Dabei steht Deutschland in all diesem Chaos eigentlich noch gut da. Hier scheinen sich die beschriebenen Entwicklungen langsamer zu vollziehen als in vielen anderen hochentwickelten Industrieländern. Populisten bekommen zwar viel Zustimmung, aber sie haben (noch?) kein Gesicht, hinter dem sich die ganze Bewegung versammeln könnte. Die Verdrossenheit wächst, doch der allgemeine Wohlstand tut es eben auch noch. Dennoch wirken auch hier dieselben Kräfte wie in den anderen Gesellschaften des Westens: Seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die gesellschaftliche Aufwärtsdynamik der Nachkriegszeit zum Erliegen gekommen. Die Hoffnung von Eltern, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selbst, macht vor allem in der Mittelschicht Zukunftsängsten und Resignation Platz. Sozialer Aufstieg ist keine allgemeine Hoffnung mehr, sondern die Ausnahme. Der Abstieg scheint vielen wahrscheinlicher zu sein als der Statuserhalt. Nachbarschaften und Schulen entmischen sich.[7] Das Wirtschaftswachstum ist zu schwach, um die alten Versprechen wieder zum Leben zu erwecken. Für Deutschland kommt hinzu: Mit der Wiedervereinigung wurde die Freiheit Ostdeutschlands gewonnen, gleichzeitig aber wurden auch die Qualifikationen, Ambitionen und Lebenserwartungen eines ganzen Landesteils abgewertet. Die Enttäuschung darüber wirkt bis heute nicht nur in der Gesellschaft und äußert sich in einer skeptischeren Einstellung zu den demokratischen Verfahren.
Längst hat sich die Skepsis zu einem Grundmisstrauen gegen den Staat verdichtet. Der Zerfall der Öffentlichkeit in viele Teilöffentlichkeiten verstärkt den Verdruss derjenigen, die ohnehin schon verdrossen sind. In den sozialen Medien können sie ihren Generalverdacht gegen das politische System täglich neu aufladen. Eine «Publikumsdemokratie» entsteht, die keine Vermittler mehr akzeptiert. Das Volk selbst soll sprechen dürfen.[8] Wer will, bekommt nur noch die Meinungen und Einstellungen gespiegelt, die sein Leben allmählich verdüstern.
Viele Bürger beklagen, dass die politischen Mechanismen, die mit der Finanzkrise auf den Plan getreten sind, immer noch fortwirken. Die Schwachen müssten für die Starken bezahlen, der Staat nutze denen, denen es ohnehin schon gut geht. Von dem Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre hätten die Armen dagegen nichts gehabt, im Gegenteil. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe weiter auseinander. Nun drohe auch noch die Mittelschicht in den Sog zu geraten. Sieht so eine gute Demokratie aus, die dem Gemeinwohl dient? Müssen gute Politiker eine solche Entwicklung nicht verhindern?
Auch wenn es für viele dieser Ansichten keinen Grund gibt: Sie haben sich längst zu einer Art neuer Gewissheit verdichtet, die die Realität färbt, beeinflusst und andere Wahrnehmungen verblassen lässt. Der Soziologe Heinz Bude stellt fest, dass sich die Stimmung im Land nachhaltig verändert hat: Das prägende und vereinigende Versprechen der Wirtschaftswunderjahre («Wohlstand für alle») verschwindet, das Selbstbewusstsein der Mittelschicht erodiert. Das neue Momentum ist ein altbekanntes: «Ihr da oben – wir hier unten» heißt es nun wieder.
Bewusst wurde das allen in der Flüchtlingskrise. Als Deutschland im Sommer 2015 mit einer wachsenden und im Laufe des Herbstes nicht mehr beherrschbaren Zahl von Flüchtlingen konfrontiert war, spaltete sich das Land in zwei Lager. Die einen begrüßten die Flüchtlinge, nahmen sie auf, engagierten sich ehrenamtlich. Die anderen lehnten sie ab. Die abgehobene Elite gebe sich nicht mehr damit zufrieden, den großen Teil des Reichtums für sich zu behalten. Nun zwinge sie auch noch den Rest der Gesellschaft in eine Willkommenskultur, die dem Land schade und unkalkulierbare Gefahren mit sich bringe. Sie gestehe den Neuankömmlingen deutlich mehr staatliche Leistungen zu als den Bedürftigen des eigenen Landes. Das politisch-journalistische Komplott habe alle Konflikte und Bedenken unter den Teppich gekehrt und den Verdacht von Neonazitum und Fremdenhass über alle verhängt, die sich dem Mainstream widersetzten. Damit ist die Flüchtlingskrise zur Bruchstelle für die Konsensgesellschaft geworden.
Deshalb betrachten viele Deutsche heute den politischen Alltagstrott in der Hauptstadt, in den Regionalparlamenten, in den Städten und Gemeinden argwöhnisch. Sie wenden sich von den Politikern ab. Das Misstrauen metastasiert in die Kernbereiche der Demokratie. Es sind Zeichen des Verfalls einer politischen Verfassung, die sich in der Nachkriegszeit herausgebildet hat und die bis zur Jahrtausendwende bemerkenswert stabil war.
Wer trägt die Schuld? Es sind viele Faktoren, die unheilvoll zusammenspielen und sich gegenseitig verstärken. Sie werden in diesem Buch geschildert. Die Kanzlerin spielt eine Haupt-, das Parlament eine Nebenrolle. Angela Merkel hat in der Flüchtlings- wie zuvor in der Finanz- und Staatsschuldenkrise «durchregiert». In den dramatischen Jahren nach dem Konkurs der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 hat nicht nur sie sich angewöhnt, die großen Fragen Europas ohne das Parlament zu entscheiden. Auch andere Regierungschefs taten das. Zuerst war es nötig, dann war es unkomplizierter. Denn die Realität entwickelte sich schneller als das politische System. Sie verlangte Entscheidungen, für die es keine eingeübten Verfahren oder Institutionen gab. Sie diktierte einen Takt, mit dem die üblichen Verfahren parlamentarischer Debatten und Entscheidungsfindung nicht Schritt halten können. Für Verfassungsdebatten blieb keine Zeit, schlimmer noch: Es fehlte auch der Mut. Das Alleinregieren und Problemlösen ersparte den Regierungschefs außerdem viele ätzende Auseinandersetzungen, die sie sonst mit widerspenstigen Volksvertretern hätten führen müssen. Sie erkannten nicht, dass diese Widerspenstigkeit für das sperrige, spröde und anstrengende Gespräch mit dem Souverän steht, ohne das eine Demokratie nicht auskommt. «Europa kommt nur in seinen Krisen voran» – diesen Satz des Europa-Gründungsvaters Jean Monnet verinnerlichte vor allem die deutsche Regierung. Sie ließ diese Erkenntnis zum Drehmoment auch der deutschen Politikagenda werden.
Die Lösungen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Bundesfinanzminister Peer Steinbrück und Wolfgang Schäuble in langen Nachtsitzungen in Brüssel verhandelten, durften im Deutschen Bundestag nicht mehr verändert, verbessert oder gar abgelehnt werden. Die Abgeordneten gehorchten. Sie stimmten zu. Sie sagten auch dann noch ja, als sie längst dagegen waren. Sie sagten ja, als die eurokritische Alternative für Deutschland begann, in ihren Wahlkreisen Plakate zu kleben. Sie sagten ja, und sie meinten nein. Der Erfolg sprach für das System Merkel: Die deutsche Wirtschaft erholte sich schnell, das Wirtschaftswachstum kehrte zurück, die Löhne stiegen ordentlich, die Renten erhöhten sich schneller als alle Jahre zuvor.
Für die Volksvertreter und für die repräsentative Demokratie aber ging die Sache nicht so gut aus. Sie wurden zu «Hilfstruppen des Exekutivbetriebs» degradiert und zogen sich murrend in die zermürbende Kleinarbeit der politischen Ausschüsse und Gremien zurück.[9] Als die Krise bewältigt war, blieben beide Seiten bei dieser Arbeitsteilung. Für die Politiker mag das funktionieren. Das Leben wird bequemer. Doch für die Wähler funktioniert es nicht. Ihr ohnehin schwacher Einfluss auf die Politik wird dadurch weiter beschnitten.
Nicht nur die Regierung greift die Macht der Abgeordneten an. Immer größere Bereiche der Politik werden an neugeschaffene Ämter und Behörden übertragen. Ob die Energiewende, die Suche nach einem Atommüll-Endlager oder der Umgang mit Flüchtlingen: Am Ende entscheiden nicht mehr die Parlamentarier, wie mit den komplizierten aktuellen Problemen verfahren wird. Behördenchefs tun es. Damit wird ein immer größerer Teil des öffentlichen Lebens der Mitsprache und Mitentscheidung der Abgeordneten entzogen. Begründet wird dies damit, dass man schwierige und kontroverse Themen lieber Experten und neutralen Beamten überlassen sollte. Eher als Politiker seien sie in der Lage, unparteiische Lösungen zu finden, die dem Gemeinwohl am besten dienten.
Das offenbart ein neues Politikverständnis: Konfliktträchtige Themen werden aus dem politischen Scheinwerferlicht ins politische Hinterzimmer oder in eine Behörde verschoben. Dort dagegen, wo sie hingehören, werden sie nicht mehr verhandelt. Zu heftiger Streit schade der Akzeptanz der politischen Arbeit bei den Bürgern, lautet das Argument der Politiker. Das Gegenteil ist der Fall: Wenn die wichtigen Themen aus der Politik verbannt werden, läuft die Demokratie leer.
Nicht nur das. Am Beispiel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurde deutlich, dass der vermeintliche Königsweg nicht funktioniert. Behörden unterscheiden sich grundlegend von politischen Entscheidungsgremien, weswegen sie diese nicht ersetzen können. Sie definieren ihren Auftrag nicht selbst, sie erfüllen ihn. Je stärker sie politisch aufgeladen werden, desto höher wird das Risiko des Amtsversagens. Je mehr politische Beamte in ihnen regieren, desto unzuverlässiger werden die Ergebnisse ihrer Arbeit.
Denn dass die alten und neuen Beamtenapparate der Bundes- und der Landesregierungen funktionieren und ihre wechselnden Aufträge tatsächlich erfüllen können, ist längst keine Gewissheit mehr. Das katastrophale Bürokratieversagen der Berliner Bürgerämter und Flüchtlingsbehörden ist zum Sinnbild des neuen Zweifels geworden: Ausgerechnet da, wo der Bürger dem Staat täglich begegnet – in seiner Stadt oder seiner Gemeinde –, macht er oft die schlechtesten Erfahrungen mit ihm. Die jahrzehntelange Vernachlässigung der Verwaltungen rächt sich: Statt für den Bürger arbeiten Bürokratien hauptsächlich für sich selbst.
Die Behörden könnten dafür sorgen, dass das Vertrauen der Wähler in den Staat wieder wächst. Zuverlässige Verwaltungen, unparteiische Experten, eine straff organisierte und öffentlich präsente Polizei würden das Bedürfnis der Wähler nach Ordnung und Sicherheit erfüllen. Sie würden Probleme lösen, anstatt neue zu schaffen. Doch die wenigsten erfüllen diesen Auftrag. Nach einem Besuch in einem Berliner Bürgeramt wünscht sich der Einwohner nichts sehnlicher, als seinem Staat vorerst nicht mehr begegnen zu müssen.
So wird die Legitimationskette zwischen der Politik und dem Wähler schwächer und schwächer. Andere Akteure bedienen sich und dehnen ihren Einfluss aus. Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel bestimmen die politische Agenda stärker denn je. Sie prägen die Sprache der Politik, die von Bürgern außerhalb des politischen Betriebs nicht mehr verstanden wird. Sie setzen den Rahmen, in dem sich Politiker gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen müssen. Die meisten von ihnen erfreuen sich großer Zustimmung der politisch aktiven Bürger. Doch demokratisch legitimiert sind sie deshalb noch lange nicht. Sie verstärken tendenziell den Einfluss der im politischen Leben ohnehin Aktiven zu Lasten der Bürger, die von ihrer Stimme keinen Gebrauch machen.
In die gleiche Richtung wirken Überlegungen, das System durch mehr direkte Demokratie zu stärken. Die Forderung nach mehr Partizipation für den Bürger ist im Augenblick in allen politischen Lagern sehr populär. Townhall-Meetings, öffentliche Debatten, Bürgerhaushalte und breit angelegte Beratungsprozesse sollen die Wähler motivieren, sich freudig und aktiv zum Demokratiediskurs zurückzumelden. Denn auch die Politiker merken, wie die Zustimmung zu ihrer Arbeit sinkt, wie immer mehr Bürgerinitiativen politische Vorhaben verzögern oder zunichtemachen.
Eine Direktwahl beispielsweise des Bundespräsidenten könnte die Bürger wieder für die Politik gewinnen, meinen die Grünen. In der CDU würden viele Landespolitiker gern ihre Gesetze durch zusätzliche Referenden legitimieren lassen. Die SPD fragt ihre Mitglieder sogar bundesweit, ob sie in eine Regierungskoalition eintreten soll. Die AfD schließlich würde am liebsten Volksentscheide auf Bundesebene einführen, um die Abgeordneten dauerhaft kontrollieren und korrigieren zu können. Selbst Verfassungsrichter wie der frühere saarländische Ministerpräsident Peter Müller können direkten Demokratieelementen auf Bundesebene neuerdings viel abgewinnen.
Die Sache hat nur einen bedauerlichen Haken: Dieses zusätzliche Element der Demokratie würde zwar zu mehr Entscheidungen führen. Es würde die Wähler öfter um ihre Meinung fragen. Aber es würde diese Entscheidungen wahrscheinlich nicht auf eine breitere demokratische Basis stellen. Denn die Teilnahme an Volksentscheiden ist in den meisten Fällen sozial noch selektiver als Bundestags- oder Landtagswahlen. An Volksabstimmungen nehmen dieselben Leute teil, die auch sonst regelmäßig zur Bundestagswahl gehen. An der Ohnmacht der anderen – zum Beispiel der rund dreißig Prozent Nichtwähler auf Bundesebene – ändern auch Direktwahlen nichts.
Die Anhänger der direkten Demokratie verkennen, dass die meisten Bürger über die Wahlen hinaus gar nicht aktiv werden wollen. Maximal zwei Prozent der Wahlberechtigten übernehmen in demokratischen Gemeinwesen tatsächlich eine aktive politische Rolle.[10] Den meisten anderen reichen die Mitsprachemöglichkeiten, die sie haben. Sie erwarten, dass sie in der Politik repräsentiert werden, ohne dass sie zusätzliche Aufgaben übernehmen. Diese Haltung muss die Politik wieder ernst nehmen. Sie muss ihre Bürger so akzeptieren lernen, wie sie sind. Statt eiliger Reparaturmaßnahmen wäre es richtig, das Funktionieren der Wahlen und der Parlamente wiederherzustellen. Sonst wird nur die existierende politische Klasse durch neue Verfahren weiter gestärkt.
Die direkte Demokratie soll politische Entscheidungen breiter legitimieren. Dieses Ziel erreicht sie meistens nicht. Denn auch da, wo sie ein starkes Votum bekommt, wird die Abstimmung über die Sache oft von Augenblicksstimmungen und spontanen Regungen überlagert. Der Brexit hat seine Schockwirkung auch bei den Freunden der Volksinitiativen auf dem Kontinent nicht verfehlt. Nicht die Frage nach Bleiben oder Gehen stand im Zentrum der öffentlichen Auseinandersetzung vor der Abstimmung am 23. Juni 2016. Es ging um alles: «Wir haben gegen die Multis gekämpft, gegen Big Business, gegen die große Politik, gegen Lügen und Korruption», triumphierte der Anführer der Leave-Fraktion, Nigel Farage, nach dem Referendum. Den Gegnern Europas war es gelungen, das Ja oder Nein zu Europa mit den offenen Fragen der westlichen Gesellschaften aufzuladen. Komplizierte Entscheidungen auf ein Referendum mit einem einfachen Ja oder Nein zu reduzieren ist riskant. Zu riskant, um Entscheidungen großer Tragweite von Augenblicksstimmungen abhängig zu machen.
Zumal sich immer öfter die Frage stellt, wer denn das Wahlvolk sein soll, das solche Referenden abhält. Spätestens in der Finanz- und in der Flüchtlingskrise wurde auch dem letzten Wähler klar, dass viele Entscheidungen inzwischen gar nicht mehr national getroffen werden (können), sondern von internationalen Abkommen und Institutionen geregelt werden. Argwöhnisch sehen Wähler wie Abgeordnete, dass ihr Einflussgebiet bei weitem nicht an das ihrer Regierungen heranreicht. Während die Staats- und Regierungschefs Griechenlandhilfen und Bankenrettung auf übernationaler Ebene beschließen, bleiben das Parlament und die Bürger auf ihren nationalen Rahmen beschränkt. Einmal vereinbart, erscheinen internationale Verträge und Mitgliedschaften unverrückbar durch den Willen des nationalen Souveräns. Das Parlament hat nur noch die Wahl zwischen Drinnen und Draußen. Der Staat zerfasert, wird vom «Herrschaftsmonopolisten zum Herrschaftsmanager».[11]
Vor allem die Wirtschafts- und Finanzpolitik leiden darunter. Die Welt verändert sich in einem immer höheren Tempo, die politischen Systeme aber bleiben so, wie sie unter völlig anderen Voraussetzungen beschlossen worden sind.
Davon profitieren nicht nur die Regierungen. Auch die großen Unternehmen und den Banken dehnen ihren Einfluss wieder aus. Nach der Finanzkrise hatten zwar alle Politiker versprochen, dass die Banken nun aber wirklich kontrolliert und den Gesetzen der Länder unterworfen würden, in denen sie aktiv sind. Das ist ihnen aber nur für einen Teil der Unternehmen gelungen.
Bei den anderen haben sich die Machtverhältnisse umgekehrt. Große international aktive Unternehmen entscheiden heute selbst, wo sie ihre Steuern bezahlen. Wer ihnen ein gutes Angebot macht, bekommt den Zuschlag. Firmen wie McDonald’s oder Apple stellen sich neben die Demokratien des Westens. Sie entscheiden, welches Recht sie anwenden, welche Regeln sie akzeptieren und welche Sonderbehandlungen sie verlangen.
Dieses Verhalten schadet den hochentwickelten Gesellschaften, deren Leistungen die Unternehmen gerne in Anspruch nehmen. Sie beschäftigen Absolventen, für deren Schulbildung sie nicht zahlen wollen. Sie nutzen Straßen, Schienen und Wasserwege, zu deren Erhalt sie nicht beitragen. Sie pochen auf Rechtssicherheit und Vertragstreue, doch ihre Pflichten als Bürger des Gemeinwesens erfüllen sie allenfalls widerwillig. Sie verlassen sich auf die Forschung und den Fortschritt der Wissenschaft, investieren selbst aber lieber nicht mehr in die Grundlagenforschung. Damit untergraben sie den Glauben der Bürger, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Sie brechen mit dem Grundsatz, dass die Stärkeren mehr zum Funktionieren des Gemeinwesens beitragen sollen als die Schwachen. So schaden sie der Demokratie und zerstören deren Legitimation.
Der amerikanische Soziologe Colin Crouch macht für den Machtverlust der demokratischen Institutionen den Neoliberalismus und die Deregulierung der achtziger und neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verantwortlich.[12] Doch es sind nicht die Unternehmen, die die Demokratie zerstören. Sie nutzen die Schwäche der politischen Systeme und spielen sie aus. Die Regierungen selbst treiben diese Entwicklung voran.
Der Weg aus dieser Legitimationskrise beginnt nicht oben. Er muss da angefangen werden, wo der Bürger lebt: in den Städten und Gemeinden. «In der Stadt hat der moderne Staat seinen Anfang genommen», schreibt Wolfgang Nowak. Hier wird er sich auch zuerst erneuern und legitimieren müssen.[13] Wer es ernst meint mit dem Versuch, die Wähler wieder dauerhaft für die Politik zu gewinnen, muss den Städten, Gemeinden und Regionen mehr Bedeutung zugestehen.
Bürgermeister, Stadtverwaltungen, Schulen und die Müllabfuhr sind wichtiger für das demokratische Gefüge einer Gesellschaft, als es auf den ersten Blick scheint. Funktionieren sie gut, nimmt der Bürger das meist nur als freundliches Grundrauschen einer gut geölten Gemeinwesenmaschine wahr. Funktionieren sie aber dauerhaft nicht, wird er zum Bittsteller gemacht. In seiner unmittelbaren Umgebung erfährt er dann, dass Sicherheit, Bildung, Mitsprache oder auch nur ein aufgeräumter öffentlicher Raum Wohltaten sind, die ihm die Gemeinde bei Gelegenheit gewährt. Anspruch darauf hat er aber nicht. In solchen Gemeinwesen werden die Bewohner zuerst gleichgültig. Dann reagieren sie mit Ablehnung, Verachtung und Zorn. Die Probleme der Müllabfuhr oder der Zustand der Schultoiletten, die Überforderung der Bürgerämter oder der Polizei in einer rheinischen Silvesternacht werden ihnen zum Symbol für das Versagen der Demokratie.
Der Kontrollverlust auf dieser Ebene ist nur zu verstehen, wenn man sie zusammen mit der Abwertung der Kommunalpolitik in den vergangenen Jahrzehnten begreift. Wer etwas gelten will in der Politik, bewirbt sich tunlichst nicht um ein Bürgermeisteramt. Ein Sitz im Landtag oder sogar im Bundestag gilt als Mindestvoraussetzung für eine schöne politische Karriere. Ausnahmen wie Martin Schulz bestätigen die Regel. Ein Blick in andere Länder sollte die deutschen Nachwuchshoffnungen der Politik eines Besseren belehren. In den USA oder in England, vor allem aber in den schnell wachsenden Metropolen Asiens oder Lateinamerikas sind gute Bürgermeister die Stars. Wer es schafft, die Stadt zu einem Platz von Kreativität und Wachstum, Hoffnung und Aufstieg, aber auch von Ordnung und Sicherheit zu machen, tut mehr für die Demokratie als ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender im nationalen Parlament.
Die jüngsten Entwicklungen der deutschen Demokratie sollen in diesem Buch skizziert werden. Nicht alle Probleme werden genannt, nicht alle Themen ausführlich behandelt. Das Buch ist eine Momentaufnahme, mit allen Stärken und Schwächen eines solchen Vorgehens. Es enthält keine politische Botschaft zugunsten einer Partei oder einer Person. Es wird gezeigt, wie sich das demokratische System dieses Landes in den vergangenen Jahren verändert hat – und was sich ändern muss, damit sich die Legitimationskrise nicht zu einer Staatskrise auswächst. Nicht nur die USA und England, Griechenland und Italien haben ein Problem. Deutschland hat auch eines. Die gute Nachricht ist: Noch bleibt Zeit zum Umsteuern. Aber die Zeit läuft.
2. Angela Merkel und die drei Todsünden der Demokratie
Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?
Bert Brecht
Mehr Ansehen war nie: Die deutsche Bundeskanzlerin soll den Friedensnobelpreis bekommen? Warum eigentlich nicht! Angela Merkel als zukünftige UN-Generalsekretärin? Das wäre doch mal eine gute Nachricht für die Welt. Die ostdeutsche Pfarrerstochter als Vorbild, zum Beispiel für die britische Spitzenpolitikerin Theresa May oder die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet?
Wenn man mächtig in der Welt werden will, dann kann man sich bei Angela Merkel einiges abgucken. Selbst der britische Economist fand, dass Deutschland mehr Einfluss und Verantwortung in der Welt übernehmen solle – und meinte eigentlich: Angela Merkel soll mehr Einfluss und Verantwortung übernehmen. Das war im Sommer 2015. Die deutsche Kanzlerin stand für alle Tugenden des Landes und der Politik: So wünschten sich viele einen Spitzenpolitiker. Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihres Ansehens.
Wenige Wochen später der Absturz: Als die Kanzlerin im September die Grenzen für Flüchtlinge aus Syrien – und damit aus allen anderen Ländern – nicht schloss, verlor sie zuerst nur die Kontrolle über die deutschen Außengrenzen. Dann verlor sie das Volk. Dann die Zustimmung Europas. Dann das Wohlwollen der Welt.
Es war, als habe jemand urplötzlich einen Scheinwerfer auf die adrette, moderne deutsche Regierungsstube gerichtet: Staubmäuse wurden sichtbar, wo man poliertes Parkett gesehen hatte. Küchenschaben huschten eilig in die Lücke hinter dem Schrank, die im Sommer noch nicht sichtbar gewesen war. Abgeschabte Fußleisten, übervolle Mülleimer, Weinflecken auf dem Teppich – alle Abnutzungserscheinungen der zehnjährigen Regierungszeit wurden auf einmal schonungslos ausgeleuchtet. Alle Schwächen und Unfertigkeiten der Regierungszeit Angela Merkels zeigten sich in grellem Licht. So überschwänglich das Lob gewesen war, so unbarmherzig war nun die Kritik.
Dabei gilt: Uneitel, fleißig, beharrlich – so hat Angela Merkel regiert, gearbeitet und ihrem Land gedient. Als erste Frau auf diesem Posten hat sie die Gleichstellung von Frauen gefördert, als erste Ostdeutsche an der Spitze der Bundesregierung hat sie dem Selbstbewusstsein der Politiker der neuen Bundesländer aufgeholfen. Energisch, zielstrebig und erfolgreich hat sie Deutschland durch die vielen Krisen des 21. Jahrhunderts gesteuert. Sie hat das Land verändert. Deutschland hat die Finanzkrise bestens überstanden und in der darauffolgenden Krise Europas eine starke Figur gemacht. Die Atomkraftwerke wurden erst wieder an-, nach dem Atomunfall in Fukushima dann endgültig abgeschaltet. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft, die Frauenquote eingeführt, die Rente mit 67 beschlossen, die Altersversorgung von Müttern und Arbeitern aufgestockt. Die Kanzlerin hat mehr reformiert, umstrukturiert, neu begründet, als ihr pragmatischer Stil es auf den ersten Blick erwarten lassen würde.
Den Bürgern des Landes geht es nach zwölf Jahren Kanzlerschaft Merkels besser denn je. Das Wirtschaftswachstum ist ordentlich, die Sozialkassen erwirtschaften Überschüsse, die Arbeitslosigkeit ist niedriger als in den vergangenen zwanzig Jahren. Die global wachsende Ungleichheit wird in Deutschland vergleichsweise gut bewältigt. Selbst die Pisa-Ergebnisse deutscher Schüler haben sich verbessert. Das persönliche Lebensglück bewegt sich ebenfalls auf historischem Höchststand, verkündete die Deutsche Post, die den Deutschen einmal im Jahr im sogenannten Glücksatlas ins Gemüt schaut. Und die Bundesregierung wird nicht müde, das Glück der Deutschen zu preisen: So zufrieden, so wohlhabend, so bei sich selbst sei das Land noch nie gewesen, attestiert der Glücksbericht (im Auftrag der Bundesregierung) im Oktober 2016.
Und doch gibt es eine hässliche Kehrseite dieser Erfolgsgeschichte. Deutschland ist nicht ein Land des allgemein empfundenen Wohlstands, der Zufriedenheit und der Reformbegeisterung geworden, sondern eines der Zukunftsangst, der Verdrossenheit und der Verrohung. Es ist ein Land, das nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin verunsichert und verängstigt ist. Es ist ein Land, das die Flüchtlingskrise exemplarisch nutzt, um der Kanzlerin das Misstrauen auszusprechen. Denn Angela Merkel hat sich an der schönsten Utopie Deutschlands versündigt: Sie hat den Status quo in Frage gestellt.
Die Deutschen haben Angst. Sie wollen keine Veränderung, und doch sehen sie, dass sich alles ändert. Sie fürchten um ihre Sicherheit im eigenen Land, und sie sehen mit Grauen die Zinseinkünfte ihrer Lebensversicherungspolicen verschwinden. Sie registrieren, wie die traditionelle Arbeitswelt vor ihren Augen zerfällt, und finden kein Rezept, damit umzugehen. Vor allem aber sehen sie nicht, wie die Flüchtlingsfrage zufriedenstellend gelöst werden kann. Alles zusammen ergibt ein Klima der Überforderung, so analysierte die Meinungsforscherin Renate Köcher im vergangenen Jahr. Das Land hat bei allem Glück, allem Wohlstand, allem Erfolg die Kontrolle über sich selbst verloren. Die Kanzlerin hat das nicht verhindert.
Im September 2016 war Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, fast auf den Tag genau ein Jahr nach der legendären «Wir schaffen das»-Bemerkung von Angela Merkel. Mit diesem Satz hatte die Kanzlerin die gesellschaftliche Herausforderung durch die Flüchtlinge als lösbar bezeichnet. Sie wählte dafür einfache Worte, so wie sie im Baby-Comic «Bob der Baumeister» fallen. Beispielsweise, wenn der Held eine schwere Schubkarre einen Hügel hochschieben will. Er fragt «Können wir das schaffen?» und motiviert sich mit einem zuversichtlichen «Ja, wir schaffen das!». Der Merkel-Satz kam nur bei wenigen gut an. Die meisten nahmen ihr diese Vereinfachung nicht nur übel, sie waren aufgebracht.
So wurde eine eigentlich unbedeutende Wahl in einem der bevölkerungsärmsten und strukturschwächsten Bundesländer Deutschlands zum Fanal für die Kanzlerin: Die Nordostdeutschen wählten die CDU nur noch mit knapp 20 Prozent der Stimmen in den Landtag. Ausgerechnet die Alternative für Deutschland (AfD) zog an den Christdemokraten vorbei. Ein paar Wochen später ergab sich für Berlin ein ähnliches Bild: Die CDU deutlich unter 20 Prozent, diesmal nahezu gleichauf mit den Grünen und der Linkspartei. Für eine Volkspartei sind solche Ergebnisse eine Katastrophe.
Warum sind die Bürger so undankbar, ja geradezu rachsüchtig? Anders als in anderen Ländern Europas kann die Erklärung nicht darin liegen, dass es den Deutschen heute schlechtgeht, dass eine Konjunktur- oder Strukturkrise auf die Stimmung drückt. Die Gründe für den deutschen Verdruss liegen tiefer, und ausgerechnet die Erfolgskanzlerin Merkel hat einen großen Anteil daran. Die Bürger trauen dem politischen System, den etablierten Parteien nicht mehr zu, die Sache in den Griff zu bekommen. Sie fühlen sich schlecht repräsentiert durch ihre gewählten Abgeordneten und schlecht regiert von der Kanzlerin und ihrem Kabinett.[1]
Die Kanzlerin hat die Demokratie geschwächt, um realpolitisch voranzukommen. Sie hat die Große Koalition zum Prinzip effizienten Regierens gemacht und damit die gewählten Abgeordneten zu Statisten degradiert. Sie hat ihre politischen Gegner gelähmt und deren Wähler demotiviert, indem sie ihre Themen, Forderungen und Vorstellungen aus taktischen Gründen übernommen hat. Sie hat zugelassen, dass die politische Alltagsarbeit im Parlament und in seinen Ausschüssen vernachlässigt wurde. In Krisen hat sie «durchregiert» – und damit den Wählern suggeriert, dass die Gefahr überall lauert und das Land und seine Leute ständig bedroht. Offene politische Auseinandersetzungen scheut sie. Im Hinterzimmer und nicht in demokratischen Abstimmungen fallen die Entscheidungen. Das gewohnte politische System dient als Kulisse für Entscheidungen in kleinem Kreis.[2] Diese Todsünden haben das Land verändert, ohne dass die Bürger jemals gefragt worden wären, ob sie das für richtig halten.
Sie halten es für falsch. Das haben sie im Sommer 2015 erstmals deutlich gemacht, als die Kanzlerin beschloss, Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien ohne die üblichen Prüfungen und ohne Rücksicht auf europäische Vereinbarungen aufzunehmen. Damals wurde auch einer breiten Öffentlichkeit klar, wie sehr sich das politische System Deutschlands in den vergangenen Jahren zugunsten der Regierung und ihrer Chefin verschoben hat.
Angela Merkel hat in der Flüchtlingsfrage so entschieden, weil sie allein entscheiden konnte. Kein Parlament, kein Bundesrat, kein Parteivorstand und keine Bundestagsfraktion konnte sie daran hindern.
Klar: Es ist das Wesen der Demokratie und des Staates, sich zu verändern. Die Demokratie sei nun einmal das zum «politischen Gestaltungsprinzip erhobene Dauerprovisorium», das sich ständig weiterentwickelt und nie fertig wird. So sieht es Bundestagspräsident Norbert Lammert.[3] Gemeint ist damit aber nicht, dass eine einzige Person und ihr Mitarbeiterstab dieses Provisorium nach eigenem Geschmack vorantreiben sollen. Gemeint ist auch nicht, dass Deutschland sich unter der Hand zu einer unechten, weil nicht legitimierten, Präsidialdemokratie entwickeln soll. Heiligt hier der (gute) Zweck die Mittel? Das stimmt nur, wenn man den inneren Zustand des Landes für unwesentlich hält. Oder wenn man gar nicht erkennt, dass in einem demokratischen Land einsame Entscheidungen ohne eine Rückkopplung an das Parlament und damit an den Wähler auf die Dauer nicht funktionieren.
Das Prinzip Große Koalition
In acht von zwölf Jahren regierte die Kanzlerin in einer Großen Koalition mit der SPD, von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017. Für die Bundesrepublik Deutschland waren das in ihrer fast sechzigjährigen Geschichte erst das zweite und dritte Kabinett aus CDU und SPD in der Regierungsverantwortung. Es handelt sich also historisch betrachtet um Ausnahmekonstellationen. Wenn es ging, haben die beiden Volksparteien bis dahin lieber mit einem kleinen Partner regiert. Meist mit den Liberalen, oder im Fall der SPD mit den Grünen.
Die jeweils andere Partei ging in die Opposition und bemühte sich nach Kräften, sich als die bessere Alternative für eine Regierung zu empfehlen. Sie versprach Wandel und Wechsel, stellte frische Gesichter und neuen Wind in Aussicht. In einer Großen Koalition passiert das nicht. Beide Parteien werden sich immer ähnlicher. Keine von beiden kann sich in den nächsten Wahlen als unverbrauchte Alternative anbieten. Man versteht also nur zu gut, warum Große Koalitionen in der Geschichte der Bundesrepublik so unbeliebt waren.
Dennoch waren genau diese Bündnisse der politische Normalzustand in den vergangenen Merkel-Jahren – und nicht die Zeit zwischen den beiden Großen Koalitionen: Erfolgreich waren die Konservativen mit dem großen Partner und Wettbewerber, mit der politisch eigentlich bekämpften SPD. Mit dem Wunschpartner FDP dagegen versagten sie kläglich.
Nachdem der bissige Altbundeskanzler Gerhard Schrö der («Sie werden es nicht!») das Feld geräumt hatte, hellte sich die Stimmung im Laufe des Jahres 2006 gewaltig auf. Geradezu liebevoll regierten Angela Merkel und Franz Müntefering miteinander, die gemeinsame Sommerpressekonferenz nach dem ersten Regierungsjahr fand in allerschönster Harmonie statt. Als es dann hart auf hart kam, in der Finanzkrise ab September 2008, gaben die Kanzlerin und Finanzminister Peer Steinbrück ein gesetztes Paar in fortgeschrittenem Alter ab, das absolute Verlässlichkeit signalisierte. Gemeinsam versprachen sie ihren Bürgern, dass die Sparguthaben sicher seien. Das waren unhaltbare Zusagen, doch sie hatten Glück: Sie wurden nicht beim Wort genommen.
Hand in Hand bearbeiteten Merkel und Steinbrück auch die Regierungsfraktionen, damit diese den Bankenrettungspaketen zustimmten. Gemeinsam setzten Merkel und Müntefering die Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch. Konjunkturpakete wurden geschnürt, Erziehungszeiten eingeführt, Kita-Plätze ausgebaut.
In den ersten vier Jahren mit der SPD war die parlamentarische Opposition so verblüfft von ihrer Bedeutungslosigkeit und die außerparlamentarische so unprofessionell, dass niemand kontinuierlich Druck auf die Regierungsparteien ausübte. Die Finanzkrise jagte allen einen gewaltigen Schrecken ein, sodass selbst Abgeordnete der Grünen und der Liberalen mit den Regierungsparteien stimmten, wenn es um Auswege aus dem Weltwirtschaftskrisen-Chaos ging. Die Große Koalition präsentierte sich als die angemessene politische Antwort auf das Desaster und signalisierte, es mit den weltweiten Herausforderungen schnell und entschlossen aufnehmen zu können. Der Staat erschien zunächst als einzige Instanz, die noch handlungsfähig war. Er ging mit großem Selbstbewusstsein und noch mehr Gestaltungswillen aus der Krise hervor.[1]
Grund zur Auseinandersetzung hätte es mehr als genug gegeben. Denn die Kanzlerin suchte nie nach den besten Lösungen. Sie fand einzig und allein die möglichen und prägte so nicht nur die eigene Partei, sondern auch die SPD. Ausgerechnet der erste Beschluss der schwarz-roten Regierung wies den Weg: Die CDU hatte im Wahlkampf dafür plädiert, die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte anzuheben, um trotz der wachsenden Ausgaben für Arbeitslosen-, Renten- und Sozialleistungen die Vorgaben des Maastricht-Vertrages über die Staatsverschuldung wieder einhalten zu können. Die SPD





























