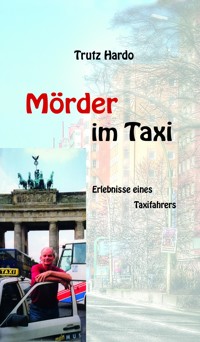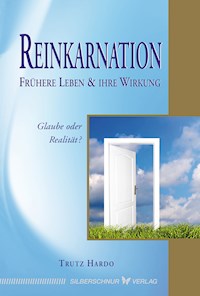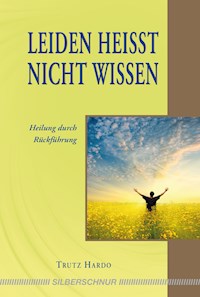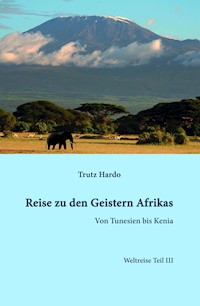
4,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1975 begab sich Trutz Hardo auf seine große Afrikareise, nachdem er zweieinhalb Jahre in Berlin lebte. Wieder ist der Abenteurer per Anhalter unterwegs. Der hier vorliegende Band ist der erste von zweien über die Reise durch Afrika. Spannend wie alle seine Reisen geht es durch die Sahara nach Niger, Nigeria, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Central Afrikanische Republik, weiter durch den Sudan nach Jemen, durch Äthiopien bis Kenia und Tansania. Folgen Sie Trutz Hardo durch das atemberaubend schöne und mystische Afrika zu Hexenmeistern und Medizinmännern, die mit wahren Geistern in Verbindung stehen - oder sie nur vortäuschen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Du kannst von fernen Ländern träumen oder sie aufsuchen.
(Oscar Wilde)
Impressum:
© 2016 by Trutz Hardo
3. Auflage
Umschlaggestaltung, Bildmaterial: Trutz Hardo
Satz: Angelika Fleckenstein; spotsrock.de
Verlag: tredition GmbH Hamburg
ISBN:
978-3-7345-1229-2 (Paperback)
978-3-7345-1230-8 (Hardcover)
978-3-7345-1231-5 (eBook)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Trutz Hardo
Reise zu den Geistern Afrikas
Von Tunesien bis Kenia
Weltreise Teil III
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Vorbereitungen
1. Im Hurrikan der Liebe
2. Das unheimliche Klopfen
3. Auf Umwegen nach Afrika
2. Kapitel Durch die Sahara nach Westafrika
1. Auf Karl Mays Spuren über den Chott EI-Djerid
2. Bei den Tuaregs im Süden Algeriens
3. Den Zähnen eines Krokodils in Niger entkommen
4. In der Hexenküche eines Medizinmannes im Norden Nigerias
5. Hypnotische Abenteuer auf dem Dach der Heilsarmee in Lagos
6. Im Zentrum nigerianischer Geister
7. Im Ältestenrat der Männer von über hundert Jahren
8. Bei den Besessenen in den Bergen Westkameruns
9. Mit dem Gorillahändler bei den Pygmäen Kameruns
3. Kapitel Von Gabun zum Kongo und weiter nach Sudan
1. Als Kranker im Hospital von Dr. Albert Schweitzer
2. Geistervertreibung und Beschneidungszeremonie in Gabun
3. Meine lange Fahrt mit Ratten auf dem Kongo hinauf
4. Von Zentralafrika nach dem südlichen Sudan
5. Auf dem Schiff den Weißen Nil hinunter
6. Mein unvergessliches Weihnachten auf einer Pyramide von Meroe
4. Kapitel Im Jemen, dem orientalischen Märchenland
1. Meine unangenehmen Erlebnisse in Jiddah
2. Sana’a, die Stadt aus ‚Tausend und einer Nacht‘
3. Im Reich der Königin von Saba
4 Meine blutige Operation in Taiz
5. Kapitel Im ehemaligen Kaiserreich Äthiopien
1. Bei den Leprakranken im Osten Äthiopiens
2. In der Hauptstadt Addis Abeba
3. An einem Seil hoch zum ältesten Kloster Äthiopiens
4. Die in Stein gehauenen Wunder von Lalibela
6. Kapitel Ostafrika
1. Ein für mich sensationeller Buchfund in Nairobi
2. Im ehemaligen Deutsch-Ostafrika
3. Bei dem Medizinmann der mehr als 200 Frauen heiratete
4. Die Hexe von Lamu
5. Die Magier der bösen und guten Geister
6. Im Ngorongoro-Krater der Serengeti
1. Kapitel
Vorbereitungen
1. Im Hurrikan der Liebe
Heute, am 11. Juni 2007 bin ich mit dem Flugzeug aus Deutschland zur Insel Djerba in Tunesien geflogen, um selbigen Tags noch mit der Fortsetzung meines Berichts über meine Weltreise zu beginnen, die, wie Sie, lieber Leser meiner bisherigen Weltreiseabenteuer, sich erinnern mögen, im Herbst 1972 aufgrund meiner Krankheit in Mali abgebrochen werden musste, nachdem ich von dort im Flugzeug liegend über Paris nach Deutschland zurückgeflogen wurde. Im Frühjahr 1973 schrieb ich auf Kreta den während meiner Reisejahre im Kopf konzipierten Roman T & F und begann am 25. April 1973 in Berlin als Referendar für die Fächer Geschichte und Deutsch an einem Steglitzer Gymnasium.
In der Schule wurde ich sogleich zum Klassenlehrer einer siebten Klasse ernannt, hatte jedoch auch Probeunterricht in anderen Klassen abzuhalten und manches Mal bei plötzlicher Erkrankung anderer Kollegen und Kolleginnen für sie den Unterricht spontan zu übernehmen. Mit den Schülern und Schülerinnen meiner Klasse gingen wir in die Oper (Mozarts Die Zauberflöte), besuchten ein Theater (Schillers Die Räuber) und ließen uns auch nicht ein Rockkonzert (Deep Purple) entgehen. Während meiner Lehrtätigkeit wurde der Wunsch wieder übermächtig in mir wach, nach Abschluss der Referendarzeit meine Weltreise fortzusetzen. Doch bevor ich nach bestandenem Referendariat meinen Rucksack wieder schulterte und „das Weite“ suchte, wurde ich von zwei wichtigen Ereignissen überrascht, die auch für meine Afrikareise von entscheidender Bedeutung werden sollten, weshalb ich diese etwas ausführlicher beschreiben möchte.
Schon in den ersten Wochen meines Lehramts war mir eine 17-jährige Schülerin wegen ihrer besonderen Schönheit aufgefallen, die von mir eigentlich nur bei meinen Pausenaufsichten immer wieder heimlich beobachtet werden konnte. Ihre Erscheinung ging mir nicht aus dem Kopf. Als ich ein Jahr später meine Osterferien auf Capri verbrachte, gestand ich mir ein, dass ich sie heftig liebte. Ich geriet in einen Liebestaumel, sodass ich unentwegt an sie dachte und mich entschloss, ihr, der bald achtzehnjährigen Abiturientin, in den nächsten Wochen Briefe zu schreiben, ohne meinen Namen zu nennen. Und als die Schule wieder begonnen hatte, stellte ich mich allmorgendlich in den Eingangsflur, um sie, die immer auf die letzte Minute das Schulgebäude betrat – wohnte sie doch nur 100 Meter entfernt von diesem –, mit meinen sehnsüchtigen Blicken zu erhaschen, ohne merken zu lassen, dass ich mich nur ihretwegen dort eingefunden hatte. Ich war wie besessen von dieser Liebe. Als heutiger Psychotherapeut würde ich sagen, dass mein Verhalten an einen Liebeswahn grenzte, wenn nicht schon in ihn hineingeglitten war. In was hatte ich mich eigentlich hineingestürzt? Ich wusste, dass es strengstens verboten war, als Lehrer sich mit einer Schülerin einzulassen, was, so es aufgedeckt würde, eine Kündigung zu Folge haben könnte, war ich doch als Referendar nur als beamteter Lehrer auf Probezeit eingestellt worden. Und immer wieder versuchte ich, mich von meinen Gedanken an diese Schülerin zu befreien. Doch je mehr ich mich gegen diesen Liebestaumel wehrte, desto heftiger steigerte sich meine Liebe zu dieser jungen Frau. Und ich bat ihre Deutschlehrerin, während ihres Unterrichts hospitieren zu dürfen, sodass ich auf einem Stuhl hinten Platz nehmen konnte, wobei ich meine Augen heimlich auf die etwas an der Seite sitzende heimlich Geliebte lenkte. Ja, ich musste mich irgendwann ihr nähern. Ich musste sie wissen lassen, dass es einen Mann gab, der sie wahnsinnig liebte. Ich fragte ihren Klassenlehrer über seine Schüler aus, um somit indirekt etwas über sie, die Maria hieß, herauszufinden. Nun erfuhr ich, dass sie die einzige Tochter eines Berliner Spediteurs war, dessen Lastwagen mit seinem breit zu lesenden Namenszug nicht nur auf Berliner Straßen, sondern auf den Autobahnen in ganz Deutschland zu erblicken waren. Ich bekam einen Schreck, denn sicherlich hätte ich keinerlei Chancen, die Tochter eines Millionärs zu heiraten, würde sich ihr Vater als Schwiegersohn doch einen studierten und bewährten Betriebsleiter wünschen. Außerdem war ich fast doppelt so alt wie Maria. Würde sie sich auch in mich verlieben können? Ich zögerte immer wieder mein Vorhaben hinaus, ihr zu schreiben. Doch nahezu jeden Tag erblickte ich die Möbelwagen mit ihrem Nachnamen. Schließlich fasste ich mir im Juni ein Herz und schrieb meinen ersten Brief an sie, dessen Entwurf ich noch in meinen Unterlagen vorfand.
Liebe Maria!
Sie werden sich wohl wundern, einen Brief von jemandem zu lesen, den Sie wohl gelegentlich gesehen, jedoch noch nie mit ihm ein Wort gewechselt hatten.
Ich wollte Ihnen eigentlich schon seit einer geraumen Weile schreiben. Sie sind nicht nur eine aparte Erscheinung. Apart und schön zu sein sind keine eigenen Verdienste, obgleich sie den Betrachter beglücken. Aber, wie ich glaube, wodurch sie sich von anderen Schönen unterscheiden, ist die innere Würde und Vornehmheit. Nicht jedem werden diese beiden Eigenschaften an Ihnen auffallen. Vielleicht muss man selbst ein wenig davon haben, um sie bei einer Person bemerken zu können. Aber es gibt auch anderes, von dem ich glaube, mit Ihnen gemeinsam zu haben. Ich meine zum Beispiel die Scheu, sich vor anderen offenbaren zu sollen. Wenn ich als Schüler aufgerufen wurde, war ich verlegen und bekam zu oft einen roten Kopf. Ja, ich war ein Mensch, der ganz aus seinem Inneren heraus wirkte, und so konnte ich mich in einer Welt, die ganz auf Äußerlichkeit abgestellt war, nie zu Hause fühlen. Mein Zuhause waren meine Gedanken und meine Gefühle. Als ich so alt war, wie Sie jetzt sind, dichtete es in mir. Aber diese Gedichte waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie waren mein Geheimnis. Eines dieser meiner Geheimnisse will ich für Sie auf ein Blatt schreiben. Es soll Ihnen gewidmet sein, im Vertrauen darauf, dass Sie es auch weiterhin als Geheimnis bewahren werden
Damals, als ich so alt war wie Sie und meine innere Welt sich nicht vorstellen konnte, in der äußeren Welt überleben zu können, dachte ich oft daran, mein Leben zu beenden. Heute könnte ich über mich lachen, denn ich finde mich sehr gut in der Welt zurecht, ja ich wünschte, 120 Jahre alt werden zu können. Ich nehme überreichlich an diesem Lebenteil, vielleicht mehr als andere. Ich habe Erfolg in nahezu allen Dingen, die ich beginne. Ja, ich bin eigentlich mit mir und der Welt zufrieden.
Habe ich mich in den Jahren eigentlich verändert, oder bin ich mir in meiner Seele treu geblieben? Ich glaube, dass beides zutrifft. Wenn ich Sie manches Mal heimlich betrachte, so erkenne ich in Ihnen sehr viel von dem, was ich damals war und empfand. Vielleicht ist es das, was mir die Kühnheit gibt, Ihnen zu schreiben und Sie wissen zu lassen, dass jemand lebt, der stolz darauf ist, dass es Sie gibt.
Mit herzlichem Gruß, Ihr Unbenannter
Und auf einem gesonderten Blatt fügte ich folgendes Gedicht bei:
Der Dichter
Der Dichter ist der Menschheit Brunnen,
in den so manche Träne fällt,
und unsere Augen werden lichter durch Glanz,
den er in Händen hält
Erahnt er doch, was uns verdrießet,
erfühlet er des Menschen Schmerz.
Macht er nicht, dass die Liebe fließet
in unser tränenschweres Herz?
Beugt er sich nicht vor manchem Bilde
und bittet für uns Linderung?
Irrt er nicht durch der Welt Gefilde
und fraget nach des Wehs Warum?
Sucht er denn nicht für uns den Frieden,
da ihm sein eigen Ich nichts wert,
und er mit seinem ganzen Lieben
für unser Glück sich selbst verzehrt?
Drum weiset ihm ein wenig Güte
für seine Lieb’ euch zugetan,
denn seines Liedes Herzensblüte
kann nur erglüh’n auf eurer Bahn.
Mit welchen Gefühlen werde ich wohl diesen Brief in den Postkasten geworfen haben? Und als ich am übernächsten Tag wieder auf dem Eingangsflur des Schulgebäudes stand, beobachtete ich sie heimlich, ob sie vielleicht den Brief gelesen und auch herausgefunden haben könnte, wer dieser unbekannte Briefschreiber gewesen sein mochte. Und nahezu jeden Morgen stand ich im Flur und beobachtete sie, doch ließ sie sich nie durch Blicke irgendeinen Bezug zu mir anmerken, sondern ging mit einem flüchtigen „Guten Morgen“ an mir vorbei.
Wie ich bald herausfand, hatte sie am 25. August Geburtstag. Ich war soeben aus New York zurückgekehrt, wo ich bei meiner Freundin Doris meine Arbeit für das zweite Staatsexamen geschrieben hatte. Dort kam mir der Gedanke, Maria eine Luxusausgabe von Thomas Manns Der Zauberberg auszuleihen. Auf jeder der hinteren Seiten schrieb ich in der oberen Ecke in umgekehrter Reihenfolge je einen Buchstaben meines Vor- und Zunamens samt meiner Adresse in der Hoffnung, dass sie, so sie beim Lesen dieses Romans auf die letzten Seiten gestoßen sein sollte, meinen Namen und meine Anschrift erfuhr, um mir somit zu antworten. Diese Geburtstagssendung wurde nun ergänzt von den Geschenken einer Schallplatte mit Auszügen aus Richard Wagners Lohengrin und einem indischen Ring. Der Gedanke, ihr das Buch anstatt zu schenken nur auszuleihen, war daran geknüpft, sie zu veranlassen, mir auf jeden Fall zu antworten, wollte ich doch Gewissheit darüber haben, wie sie über meine Zuneigung dachte. Dieser in geistige Höhen hinaufsteigende Roman und diese aus Himmelshöhen kommende Musik sollten eine Brücke bauen helfen von ihrem Herzen zu dem meinen. Und auch nach diesem Geburtstagsbrief wie auch vor diesem hatte ich so manchen Brief für sie bestimmt, den ich dann aber nicht abzuschicken wagte, stattdessen ihn zerriss oder aufbewahrte. Einer dieser nicht abgeschickten Briefe lautete folgendermaßen:
„Liebe Maria,
beinahe wäre ich Ihnen vor kurzem zufällig begegnet, aber bei dem Beinahe ist es geblieben. Ich habe mir schon oft vorgestellt, Sie unvermutet irgendwo zu treffen. Ich glaube, ich wäre anfangs sehr verlegen, würde mich aber nach den ersten Worten bestimmt schnell wieder fangen. Ich bin augenblicklich in etwa der gleichen Position wie Sie. Sie stehen noch vor der letzten Prüfung, während die meinige einen Monat später stattfinden wird. Danach wäre ich Studienrat z. A. Aber ob ich jemals Studienrat werde, ist sehr fraglich. Nicht dass ich befürchten müsste, mein Examen nicht zu bestehen oder dass es mich von allem Schulischen graulte. Ganz im Gegenteil. Es ist ein wunderschöner Beruf. Trotzdem habe ich schon an der Schule zum Bedauern des Direktors gekündigt, denn mich treibt es wieder hinaus in die Welt. Diesmal will ich für zwei Jahre Afrika bereisen, so nicht noch etwas passieren sollte, was mir wichtiger sein könnte als abenteuerliches Reisen. Mein zweites Staatsexamen wollte ich eigentlich nur ablegen, um zum einen wieder einmal für einige Zeit in Deutschland zu leben, zum anderen aber, um mich beruflich abzusichern, denn bei eventuell sich ergebenden familiären Umständen könnte ich auf einen Schulberuf in Deutschland immer zurückgreifen.
Aber ich habe in diesem Leben ein anderes Vorhaben zu erfüllen, als zu arbeiten und behaglich zu leben. Ich habe nämlich der Dichtung zu dienen und für sie zu leben. Dies ist mein ganzes Geheimnis. Und alles, was ich tu und treibe, steht unter dem Bewusstsein, der Poesie dienen zu müssen. Sicherlich werden Sie mich für einen Kauz und Spinner halten, aber ich meine es ernst mit meiner Aussage, ungeachtet, was man von mir halten mag. Übrigens sind Sie eine der ganz wenigen Personen, denen ich davon erzähle. Denn Sie stehen meinem Herzen näher, als Sie sich vorstellen können…“
Obwohl ich mich in diesem Liebesbann verstrickt sah, hatte ich immer wieder neue Freundschaften mit Frauen geschlossen, in denen ich das Weibliche in all seinen verschiedenen Darbietungen ausschöpfte, wobei der Libidodrang vorherrschte. Doch jeder Gedanke an Maria schloss eine Erotik aus. Meine Liebe zu ihr war ganz und gar platonisch oder – gesteigert ausgedrückt – „überirdisch-himmlisch“. Und in der Folge beobachtete ich sie auf dem Flur oder Pausenhof weiterhin, ob sie mit irgendeinem Blick wohl herausgefunden haben könnte, wer ihr unbekannter Geburtstagsgratulant gewesen sein mochte. Nun wurde ich von ihrer Deutschlehrerin aufgefordert, den Deutschunterricht in dieser Oberprima probeweise zu übernehmen, wobei Goethes Tasso-Drama zu besprechen war. Ich gab mir alle Mühe, Maria nicht in die Augen zu schauen, da ich befürchtete, rot zu werden oder gar meine Sinne zu verwirren. So kam ich jeden Tag mit zitterndem Herzen zur Schule. Auch malte ich mir immer wieder in Gedanken aus, wie ich oder sie sich verhalten würden, wenn wir uns zufällig auf der Straße oder in einem Geschäft begegnen sollten. Einerseits wünschte ich mir solch eine Begegnung, andererseits hatte ich Angst davor, denn vielleicht könnte sie mir kühl entgegnen, dass sie sich meine Bedrängungen verbiete. Doch wenn sie meine Zuneigung erwidern würde und wir uns heftig ineinander verlieben würden, dann könnte es zu einer baldigen Eheschließung kommen. Ihr Vater könnte mich in seinen Betrieb einspannen wollen – und meine Weltreiseabenteuer wären zu einem Ende gelangt. Denn ein Liebestoller wäre zu jeder Einwilligung bereit, so sein Liebesverlangen dadurch seine Erfüllung fände.
Endlich nahte sich im Dezember das mündliche Abitur, nachdem das schriftliche schon erfolgt war. Nach dieser letzten bestandenen Prüfung war sie keine Schülerin mehr, und ich durfte mich aus schulbehördlicher Sicht ungestraft ihr nähern. Sie als gute Schülerin würde sicherlich bestehen. An diesem letzten Tag der mündliche Überprüfung wurde Maria eine halbe Stunde, bevor sie dem Prüfungsgremium gegenüberzutreten hatte, in einen Raum geführt, wo ich, der dort die Aufsicht führte, ihr einen vorzubereitenden Text zu übergeben hatte. Jetzt befand ich mich zum ersten Mal allein mit ihr in einem Raum. Hoffentlich konnte sie sich auf den vorgelegten Text konzentrieren. Vielleicht hatte sie ja schon den Zauberberg gelesen und also den Namen ihres heimlichen Verehrers herausgefunden und wusste nun, wer vor ihr saß. Ich hatte mich am Vortag in einen Blumenladen begeben und für sie einen großen Strauß ausgesucht, der ihr mit meinem Begleitbrief samt meiner Anschrift und einer beigefügten Eintrittskarte für die Philharmonie am nächsten Tag nach zwölf Uhr an ihre Adresse zu überbringen war. Und während nun Maria das vor ihr liegende Gedicht las, über das sie gleich befragt werden sollte, dachte ich daran, wie sie wohl reagieren würde, wenn sie nachher nach Hause kommt und den Blumenstrauß sieht und alsbald den Brief liest, der folgendermaßen lautet:
„Liebe Maria!
Zu Ihrem Bestehen des Abiturs möchte ich Ihnen herzlichst gratulieren. Es freut mich für Sie, endlich die Stufe erreicht zu haben, wo man frei entscheiden kann, was man mit seinem Leben anfangen will.
Ich wollte Sie schon seit längerer Zeit einmal persönlich kennenlernen, aber bisher sah ich Sie nur aus einer Distanz, aus der man keine persönlichen Worte zu wechseln pflegt. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, Sie in ein Konzert einzuladen, zu welchem ich hiermit die Karte schicke. Ich würde Sie am Tag des Konzerts um 19Uhr mit dem Wagen von zu Haus abholen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund verhindert sein sollten, mitkommen zu können, so bitte ich Sie, mir telefonisch (8851713) Bescheid zu geben. Falls meine Wirtin am Telefon sein sollte, bitte ich Sie, ihr das Nötige auszurichten.
Ich werde im Januar nach meinem Referendarsexamen wieder auf Weltreise gehen. Afrika steht diesmal auf meinem Programm. Wie lange ich außerhalb Deutschlands verweilen werde, weiß ich noch nicht. Ich verspüre den Drang in mir, viel in der Welt kennen zu lernen, denn die Welt ist wundersam und voll von Offenbarungen.
Mit herzlichem Gruß, Trutz“
Sie bestand ihre mündliche Prüfung, der ich beiwohnte, mit Bravour. Und nun, nachdem sie nicht mehr die Schulbank zu drücken hatte, wartete ich auf ihre Antwort. Schon am übernächsten Tag erhielt ich ihren Brief mit der darin zurückgeschickten Eintrittskarte:
Berlin, den 11.12.74
„Lieber Herr Hockemeyer,
für die Zeichen Ihrer Aufmerksamkeit, insbesondere dem schönen Blumenstrauß zum bestandenen Abitur, möchte ich mich hiermit herzlich bei Ihnen bedanken. Ihrer freundlichen Einladung kann ich aus Gründen, die zu nennen ich mir vorbehalten möchte, nicht Folge leisten.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihren weiteren Lebensweg.
Maria H.“
Nun war es also entschieden. Maria legte keinen Wert auf eine Begegnung mit mir. Hiermit hätte mein Liebeswerben eigentlich zu einem Ende gekommen sein müssen. Vielleicht kam für sie alles zu überraschend, und sie benötigte Zeit, sich erst in ihr neues Leben einzufinden, als sich in eine für sie ungewisse Beziehung zu stürzen. Ich war einerseits froh, meine Weltreise im Frühjahr fortsetzen zu können, wollte jedoch auch weiterhin, wenn auch aus der Distanz, um sie werben und nach meiner Rückkehr um ihre Hand anhalten. Als im Januar nach den Weihnachtsferien ihre Abiturfeier in der Aula abgehalten wurde, konnte ich ihr, die sie neben ihrer in kostbarem Pelz gehüllte Mutter stand, zum ersten Mal die Hand schütteln und in ihre Augen sehen.
Bevor ich nach bestandenem Referendarexamen die Schule verließ und im Februar 1975 meinem Freund Jochen meine Klasse als neuem Klassenlehrer übergeben konnte, schrieb ich Maria folgenden Abschiedsbrief:
„Liebe Maria!
Verzeihen Sie, wenn ich Sie nochmals mit einem Schreiben belästige. Aber mich drängt es Ihnen ebenfalls einen Abschiedsbrief zu schreiben, weil ich Ihnen vieles zu danken habe, zu danken für etwas, wozu sie wahrscheinlich jeglichen Dank als unberechtigt von sich weisen würden. Denn seit etwa zehn Jahren war es das erste Mal, dass ich wiederjemanden liebte, jemanden, an den sich meine Gedanken mit Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hingebung und ungebrochener Ehrlichkeit schmiegten. Als ich zur Osterzeit letzten Jahres auf Capri verweilte und ich mir wünschte, Sie an meiner Seite zu haben, da gestand ich mir ein, dass ich sie liebe. Seitdem kamen Sie mir nicht mehr aus meinen Gedanken und Träumen. Ich beschloss nun, um sie zu werben. Und in meinen kühnsten Gedanken sah ich Sie schon als meine Frau, mit der ich nochmals um die Welt reiste, um ihr die Wunderbarkeiten dieser Erde zu zeigen.
Verzeihen Sie, wenn ich über Dinge offen rede, die Ihnen wohl als peinlich erscheinen könnten. Aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass es besser ist, offen zu sein und über Dinge auch zu reden, die man sonst allzu gern verschwiegen mit sich herumträgt.
Im letzten Jahr schrieb ich einen Roman, und ich trug mich mit dem Gedanken, diesen Ihnen zu widmen. Doch da sein Autor aus gewissen Gründen anonym bleiben wird, war es nicht schicklich, eine Widmung dem Buch voranzustellen. Aber in gewisser Weise bleibt dieser Roman mit Ihnen verbunden, da das Ihnen gewidmete Gedicht Thema dieses Romans ist. Wenn ich in einigen Jahren aus Afrika zurückkehren sollte und das Buch liegt gedruckt vor, dann möchte ich mir erlauben, Ihnen im Vertrauen auf Ihre Verschwiegenheit ein Exemplar schicken zu dürfen.
Sie haben sich wohl in der Wahl ihres Studiums dazu entschlossen, in die „Fußstapfen“ Ihres Vaters zu treten. Dies ist ein mutiges Unterfangen und verdient volle Hochachtung. Ich war lange genug in führender Stellung der Niederlassung eines Weltkonzerns, um zu wissen, wie aufregend und interessant es ist, ein Unternehmen zu leiten. Aber solche Leitung erfordert auch alles von einem Menschen, was er zu geben vermag, wobei der zeitliche Aufwand (12 bis 14 Stunden am Tag) nur eine der persönlichen Leistungsanforderungen ausmacht. Zu diesem Beruf gehört u. a. Leidenschaft, bedingungslose Hingabe und ein unbezwinglicher Glaube an den Erfolg. Ich hatte damals in Neuseeland diese Fähigkeiten entwickeln können. Und meine Zeit als „district manager“ möchte ich in meinem Leben nicht missen. Aber ich fühlte doch ständig,dass ich zu etwas anderem berufen zu sein schien und habe dieser inneren Berufung endlich nachgegeben und mich in ihren Dienst gestellt.
Da ich für Sie als Weihnachtsgeschenk schon seit Monaten ein ganz bestimmtes Buch ausgewählt hatte, das nun an jemanden weiterzuschenken mir unpassend erscheinen will, möchte ich mir erlauben, Ihnen dieses zuzuschicken. Es ist von einer jungen Frau geschrieben, die– als sie es schrieb – nur um ein Weniges älter war als Sie.
Leben Sie wohl, und mögen Sie auf Ihrem mutigen Lebensweg viel Freude erleben.
Trutz,
(der Sie nicht so schnell aus seinem Gedächtnis verlieren wird.)“
Ich hatte den Roman T & F als gebundenes Schreibmaschinenmanuskript anonym ohne Rückadresse an die UNESCO in Genf gesandt, da diese auch schriftstellerische Werke internationaler Autoren in einer besonderen Reihe verlegte. Der Grund, meinen Namen als Autor nicht zu nennen, ging von der Vorstellung aus, dass wir Menschen eins sind, sodass auch der Dichter mit seinem Werk sich nicht hervorheben sollte, um bewundert und verehrt zu werden. Außerdem wollte ich die Autorenrechte und somit die Tantiemen dieser Menschheitsorganisation der UNO als finanzielle Unterstützung zukommen lassen, damit durch den Verkauf meines Buches manch anderes Gute geschaffen werden könnte wie zum Beispiel die Drucklegung der Werke unbekannter oder diffamierter Schriftsteller.
2. Das unheimliche Klopfen
Eingangs hatte ich erwähnt, dass ich von zwei wichtigen Ereignissen überrascht worden war, die für meine Afrikareise von entscheidender Bedeutung werden sollten. Das eine war die Liebe zu Maria, die wie ein Hurrikan durch mein Herz stürmte, und das andere Ereignis werde ich Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, jetzt beschreiben.
Kurz nach dem bestandenen Abitur von Maria besuchte ich eine Lehrerkollegin namens Lilia. Und da es meine „Unart“ ist, bei einem Erstbesuch das Bücherregal nach der dortigen Lektüre durchzusehen, um mir ein Bild von der Geistesart der betreffenden Person zu verschaffen, entdeckte ich dort ein Buch mit folgendem Titel: Bericht vom Leben nach dem Tod einem gewissen Arthur Ford. Und folgender Dialog mag sich damals ergeben haben:
Tom1:
„Was? Ein Leben nach dem Tod gibt es doch gar nicht. Wie kann man ein Buch über solch ein Thema schreiben?“
Lilia:
„Doch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Du solltest dieses Buch lesen.“
Tom:
„Solch einen Unsinn lese ich nicht. Mit dem Tod ist alles aus. Unser Körper zerfällt ebenso wie die Blätter, die im Herbst von den Bäumen fallen und dann sich auflösen.“
Lilia:
„Ja, der Körper zerfällt. Aber wir sind mehr als der Körper. Unsere Seele lebt weiter.“
Tom:
„Dafür gibt es keine Beweise.“
Lilia:
„Lies dieses Buch, darin wirst du genug Beweise finden.“
Tom:
„Ja, die Buddhisten und die Hindus glauben an ein Leben nach dem Tod und sogar an eine Wiedergeburt der Seele in einem neuen Erdenkörper. Aber das sind alles Wunschgedanken, da man Angst davor hat, sich einzugestehen, dass mit dem Tod alles aus ist. Nein, solch ein Buch beschmutzt nur meine Hände. Ich stelle es wieder zurück.“
Lilia:
„Bevor man kritisch über etwas urteilt, sollte man sich mit dem Thema erst einmal intensiv beschäftigt haben. Die meisten Menschen äußern sich aus Voreingenommenheit ablehnend über etwas, ohne sich vorher mit dem Gegenstand ihrer Abwertung wirklich auseinandergesetzt zu haben. Nimm dieses Buch mit nach Hause, lies es. Wir können uns dann gemeinsam über den Inhalt unterhalten.“
Also nahm ich widerwillig dieses von mir als Schundlektüre bezeichnete Buch mit.
Und in meinem Zimmer in einem Wohnblock am unteren Kurfürstendamm angekommen, vertiefte ich mich sehr bald in dieses Buch. Der amerikanische Autor schildert darin sein Leben und Wirken als Medium und Geistlicher, der Kontakte zur jenseitigen Welt und deren Bewohnern, unseren Verstorbenen, herstellt. Er wird in seiner Heimat und in Kanada von spiritistischen Gemeinden eingeladen. In Kirchen und Gemeindesälen setzt sich dieser Pastor vor den Versammelten auf einen Stuhl und schließt seine Augen. Alsdann versetzt er sich in einen Trancezustand, woraufhin sein Geistführer namens Fletcher durch seinen Mund spricht. Dieser ist sein Geistführer aus der jenseitigen Welt, der nicht nur Fragen aus der Zuhörerschaft beantwortet, sondern – und das ist das Besondere – die Versammelten fragt, wer von ihnen mit einem seiner eigenen verstorbenen Freunde oder Verwandten Kontakt hergestellt haben möchte. Er fragt, ob sich unter den sich Meldenden auch ein Lehrer, Bürgermeister, Arzt oder ein Polizist befinde, da man davon ausgehen könne, dass sich solch eine allgemein bekannte Person der Gemeinde nicht vorher mit dem Medium abgesprochen haben könnte. Und zum Erstaunen der Anwesenden vermag Fletcher nun wirkliche Kontakte zwischen jemandem der Anwesenden und einem von dessen Verstorbenen herzustellen. Arthur Ford wurde von vielen Forschern und so genannten „Geisterjägern“ geprüft. Doch niemals konnte man ihm Betrug nachweisen, da sich die vermittelten Kommunikationen mit Jenseitigen immer als korrekt herausstellten.
Als ich derlei Beweise für die Existenz von einem Leben nach dem Tod und der möglichen Kontaktaufnahme mit Verstorbenen las, saß ich bis zwei Uhr nachts mit dem aufgeschlagenen Buch in meinem Bett. Ich konnte nicht einfach etwas lesen und das Dargestellte, so überzeugend es sich auch darbieten mochte, akzeptieren. Ich musste eigene Beweise für die Richtigkeit des Vorhandenseins von Geistern erhalten, denn nur dann konnte ich von deren Realität überzeugt werden. Deshalb flüsterte ich in den Raum hinein: „Wenn es euch wirklich geben sollte, dann klopft bitte dreimal ganz deutlich, damit ich es hören kann.“ Ich wartete etwa fünf Minuten, ob sich ein Klopfen hören ließ. Doch nichts geschah. Alsdann wiederholte ich flüsternd meine Bitte. Und plötzlich klopfte es dreimal laut, und zwar an die Schlafzimmertür meiner Wirtin, die „Herein!“ rief. Ich bekam einen Schreck. Also waren die Unsichtbaren meiner Bitte nachgekommen und hatten sich deutlich bemerkbar gemacht. Ja, warum sie an die Tür meiner Wirtin laut klopften und nicht in meinem Zimmer an die Wand oder an die Tür, war sicherlich mit Vorbedacht geschehen. Denn hätten sie diese Klopfzeichen in meinem Zimmer zu Gehör gebracht, hätte ich mir spätestens am nächsten Morgen eingeredet, dass das nächtlich Gehörte nur Einbildung, Wunschdenken oder Halluzination gewesen sein müsse. Als ich am Morgen die Wirtin fragte, ob sie in der vergangenen Nacht ein Klopfen an ihrer Tür gehört habe, verneinte sie es. Die Geister hatten sie also im Schlaf das Herein rufen lassen. Jetzt war in mir die Neugier geweckt. Ich wollte weitere Bücher zu dem Thema „Leben nach dem Tod“ und über Jenseitskontakte lesen.
Arthur Ford befand sich bei seiner Kontaktaufnahme mit Verstorbenen in Trance, die er durch Selbsthypnose herstellte. Ich kaufte mir nun zwei Bücher über Hypnose und suchte dann in den Gelben Seiten des Telefonbuches nach einem Hypnotiseur, um mich von ihm in Trance versetzen zu lassen und womöglich auch die hypnotische Induktion bei ihm zu erlernen. Unter der Rubrik Heilpraktiker fand ich einen Therapeuten für Hypnotherapie. Diesen suchte ich in der Konstanzer Straße auf. Doch leider versetzte er mich nicht in die erwünschte Trance, sondern geleitete mich in ein kleines Zimmer, wo ich mich liegend bei geschlossenen Augen auf seine von einem Tonband wiedergegebene Stimme zu konzentrieren hatte, die mich in einen so genannten Alphazustand versetzte. Nach etwa zwanzig Minuten betrat er wiederum dieses Zimmer und gab mir hypnotische Suggestionen ein. Im Grunde erlernte ich bei ihm nichts weiter als das so genannte Autogene Training, das mir in der Folge gute Dienste leisten sollte. Ich suchte ihn mehrere Male auf und ließ mich in den Zustand versetzen, in welchem man seinen Körper nicht mehr spürt, seinen Geist mit positiven Suggestionen füttert und anschließend mit einem entspannten körperlichen Wohlgefühl die Augen wieder öffnet. Dies sollte die Grundlage für meine weitere Beschäftigung mit Hypnose werden.
Doch das Wunderbare bei meinen Besuchen war, dass ich in einem verstaubten Regal vererbte Bücher seines verstorbenen Vaters fand, die sich mit den Phänomenen der wissenschaftlich überprüften und bestätigten Materialisation von Gegenständen und sogar von verstorbenen Personen befassten. In diesen Büchern waren Fotographien abgebildet, die jene materialisierten Geistwesen oft in voller Gestalt zeigten. Die Autoren waren Wissenschaftler und Ärzte, allen voran Professor Schrenck-Notzing, der in München für dem Mystischen zugetane Kreise Séancen mit verschiedenen Medien durchführte. Zu diesen eingeweihten Gästen gehörte auch Thomas Mann der im Zauberberg aufgrund seiner dortigen Erfahrungen und Überzeugungen auch ein Kapitel über Materialisationsphänomene einbaute, in welchem sich der im Krieg gefallene Joachim Ziemßen seinem Freund Hans Castorp in voller Gestalt zeigte. Mein hochverehrter Thomas Mann war also ebenfalls ein Eingeweihter solcherlei Geistererscheinungen. Er bedurfte noch dieser Séancen, um Geister wahrnehmen zu können, während Goethe, wie ich später nachlesen konnte, nicht nur mit Geistern sprach, sondern sie selbst an helllichten Tage manchmal zu sehen vermochte. Ich durfte mir aus diesem reichhaltigen Regal immer wieder Bücher mit nach Hause nehmen, die ich nun mit brennender Neugier verschlang, ohne dabei die Vorbereitungen für meine mündliche Examensprüfung im Januar zu vernachlässigen. Nun hatte sich der skeptische Nihilist in mir zu einem werdenden Spiritisten gewandelt, der immer mehr über Geisterkommunikation und Jenseits erfahren wollte. Noch war mir nicht bewusst, welche Bedeutung dieser Paradigmenwechsel für meine Afrikareise haben sollte, denn viele Stämme befanden sich mit ihren verstorbenen Ahnen durch Trancemedien in ständigem Kontakt.
Ich las auch in einem dieser ausgeliehenen und verstaubten Bücher über Medizinmänner Afrikas, die oft in ihrer Ausübung Rat und Hilfe von Verstorbenen ihres Faches erfuhren. Ich nahm mir vor, solche Medizinmänner aufzusuchen, um von ihnen mehr über ihre wunderartigen Heilweisen und Jenseitskontakte zu erfahren. Doch sicherlich würden sie einem Europäer, der sie als Neugieriger aufsuchte, nicht ohne weiteres ihre Geheimnisse anvertrauen. Ich musste ihnen selbst etwas bieten, sodass wir Geheimnisse mit einander austauschen konnten. Ich verfiel auf den Gedanken, Zaubertricks zu lernen, weshalb ich mich in der Neuköllner Hermannstraße zum „Zauberkönig“ begab. In diesem Laden, der mit Zauberzubehör behangen war, wurde ich von einer älteren Frau bedient, der ich mein Anliegen vorbrachte, einige Gegenstände zum Zaubern zu erwerben, mit denen ich Afrikaner in Staunen versetzen könnte. Sie fragte mich, wie viel ich auszugeben gedächte, und ich nannte die Summe 100 bis 150 Mark. Sie führte mir mit kleineren Gerätschaften einige Tricks vor und nannte mir den jeweiligen Preis. Nachdem ich mich für diesen und jenen Trick samt Zubehör entschieden hatte, lud sie mich hinter die Ladentheke zu sich und zeigte mir, wie man diese Tricks durchzuführen hatte. Ich war erstaunt über die Leichtigkeit dieser Handhabungen, sodass ich sie zu Hause gleich einübte, zum Beispiel, wie man den an einem dünnen Faden befindlichen chinesischen Würfel langsam nach unten bewegt, wie man ein Taschentuch oder eine Zigarette verschwinden lässt oder ein Seil durchschneidet, um dieses anschließend wieder als ganzes Stück zu präsentieren.
Mitte Februar, nachdem ich Maria jenen Abschiedsbrief geschrieben hatte, quittierte ich meinen Dienst an der Schule, besorgte mir Reiseschecks und Medikamente zur Krankheitsprophylaxe, packte meinen Rucksack, schnürte meinen Schlafsack darauf und stellte meine übrigen Sachen bei der Großmutter meines Freundes Jochen unter. Alsdann verließ ich als frisch gebackener Referendar Berlin, um mit dem Zug über Salzburg nach Athen zu gelangen. Ich hatte mir anders als auf meiner Weltumrundung nun vorgenommen, in Notizbüchern mir die wichtigsten Begebenheiten nebst Orten und jeweiligem Datum einzutragen. Doch wie es sich im Laufe der Reise fügte, notierte ich mir ebenfalls darin die vielen Gedanken zu meinem bei der Rückkehr zu schreibenden Molar-Roman, skizzierte Ideen zu einer Novelle über Richard Wagner, schrieb weiterhin nebst meinen eigenen entwickelten Gedanken die wichtigsten Stellen aus den verschiedenen spirituellen Büchern auf, die mir unterwegs in die Hand fallen sollten, sodass ich nach meiner Rückkehr über genügend schriftliche Unterlagen verfügen sollte, die nebst meinen Erinnerungen in dieses Ihnen vorliegende Buch nun eingeflossen sind.
3. Auf Umwegen nach Afrika
In dem mir schon von zwei Aufenthalten her bekannten Athen angekommen, nahm ich den Vorortzug nach seiner Hafenstadt Piräus, wo ich selbigen Abends das Fährschiff nach Kreta bestieg, das mich am Morgen des 18. März nach Heraklion brachte. Hier nahm ich den Bus, sodass ich schon zur Mittagszeit in meinem geliebten Aghia Galini, jenem Fischerdorf an der Südküste, ankam und in dem mir schon vertrauten Hotel Selena oberhalb des Hafens wieder mein Zimmer Nr. 8 bezog, in welchem ich vor zwei Jahren meinen Roman T & F geschrieben hatte und in welches ich in späteren Jahren immer wieder zurückkehren sollte, um hier sieben Winter hindurch meinen Farbroman zu Papier zu bringen.
Und hier war es wohl, dass ich mich entschloss, irgendwann nach meiner Afrikareise einen Roman über meinen Dichtervater Molar zu schreiben. Mein kriegsversehrter Vater mit dem bürgerlichen Namen Dr. Karl Ernst Hockemeyer war als Wittwer mit seinen vier Kindern gleich nach Kriegsende noch vor dem Einmarsch der Russen von Thüringen nach Hessen geflüchtet. In den nächsten Jahren brachte er seine beiden Söhne und die jüngeren Töchter bei fremden Familien und in Internaten unter, während er durch den Verkauf von Medikamenten und Opiaten, die er aus einem geheimen, bei Kriegsende eingebunkerten Versteck besorgte, den Unterhalt für sich und die Kinder bestritt. Da jedoch der Handel ohne Lizenz mit Opiaten, selbst wenn diese nur an Apotheken und Ärzte von ihm veräußert wurden, verboten war, wurde er von der Polizei erst in der britischen, dann in der amerikanischen und schließlich in der französischen Zone gesucht und nach seiner Ehe mit der Flüchtlingsfrau Dita Petersen, mit der er und seine Kinder in Meersburg am Bodensee in einer Flüchtlingsbaracke wohnte, in Konstanz inhaftiert. Vor seiner Festnahme fuhr er in den Zügen durch Westdeutschland und verkaufte die von seiner Frau und angestellten Mitarbeiterinnen gefertigten Bastschuhe, während er nach seiner Inhaftierung sich ganz auf den Verkauf seiner eigenen Lyrik beschränkte, die er auf gefaltetem Büttenpapier den Leuten in Zügen und in Bahnhofsgaststätten anbot. Ich hatte in der Baracke diese gefalteten Gedichtbögen nach seinen Angaben ineinander zu legen und sie manchmal am Rande zu lochen und sie durch ein buntes Band präsentabel zu gestalten. Dann zog er mit neuen Stapeln seiner „Festlichen Gaben“, in dicken Tragetaschen verstaut, wieder in die Weite und kehrte in immer größeren Abständen zum Verdruss seiner auf ihn wartenden Ehefrau in die Barackenidylle zurück, um sich wieder mit neuen Stapeln seiner Gedichte zu versehen. Und da Dita bald den Grund für seine jeweils verzögerte Heimkehr herausgefunden hatte, kam es mit großem Erschrecken für uns Kinder zur Scheidung, worauf unser Vater nach München zog, um seiner neuen Geliebten nahe zu sein und um ihre Hand für seine dritte Eheschließung anzuhalten, während wir Kinder wieder bei fremden Familien oder in Internaten unterkamen. Über meinen Vater und sein spannendes Leben als Dichter wollte ich einen Roman schreiben von etwa 300 bis 500 Seiten. Und ich nahm mir vor, mir während meiner Afrikareise Gedanken über Inhalt und Aufbau zu machen.
Und immer wieder dachte ich an Maria, die, obwohl sie eindeutig ihr Desinteresse für mich schriftlich bekundet hatte, nicht aus meinen Gedanken weichen wollte. Ich nahm mir vor, bei meiner Rückkehr nach Deutschland einen erneuten Annäherungsversuch zu machen. Immer wenn ich an sie dachte, schlug mein Herz schneller. Einerseits fühlte ich Wehmut, andererseits war ich froh, diesem Liebesbann vorerst entkommen zu sein. Aber hatte sich dieser wirklich von mir gelöst? War mein Vater ebenfalls von einem Liebesbann gefangen gehalten worden, dass er für seine neue Geliebte seine Ehe aufgab und sich von seinen Kindern entfernte?
Die Wiesen und die Berghänge waren zu dieser Zeit auf Kreta, jener Geburtsstätte des Zeus, übersäht mit farbenprächtigen Anemonen und anderen Blumen. Und während dieser vielen Spaziergänge in die Natur und zu jenem großen Felsblock, von dem man oben stehend einen großartigen Überblick über das vor sich ausgebreitete Tal und das dahinter sich anschließende Meer genießen konnte, dachte ich immer wieder an Maria und an den zu konzipierenden Roman. In einem Restaurant kündigte ich an, dass ich an einem Nachmittag Zauberkunststücke vorführen würde, denn ich wollte ausprobieren, ob ich nun auch die erlernten Zaubertricks vor einem Publikum wirkungsvoll zu demonstrieren vermochte. Und nicht nur die versammelten Kinder, sondern auch Erwachsene zeigten sich von den Darbietungen verblüfft. Dies war sozusagen meine Generalprobe für derlei Demonstrationen für Afrika.
Ich lernte in Aghia Galini einen jungen Ägypter griechischer Herkunft aus Alexandria kennen, der aus Hufeisennägeln Hals- und Armgeschmeide herstellte und sie an Touristen und Einheimische verkaufte, sodass er neben seinem heimlichen Handel mit Haschisch gut davon lebte. Er fertigte für mich aus jenen Nägeln ein armausbreitendes Männchen, das, wie er mir erklärte, mich auf meiner Afrikareise als notwendiges Schutzamulett von allem Bösen fernhalten würde. Dieses um den Hals zu hängende und auf der Brust zu liegende Amulett würde von den Afrikanern als mächtiger Schutzzauber angesehen werden, und zugleich könne dieses auch als Pendel benutzt werden, um von meinen mich begleitenden Geistern Rat einzuholen, wann immer ich diesen benötigte. Er zeigte mir, wie ich dieses Pendel zu gebrauchen hatte, und tatsächlich bewegte es sich auf meine Fragen hin in die gemäß eines Kodes abgemachte Richtung. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich einmal selbst Pendelkurse geben würde. Bevor ich diesen griechischen Ägypter, der bald wegen seines Haschischhandels ins Gefängnis kommen sollte, kennen lernte, hatte ich mit meinem mitgebrachten Kassettenrekorder mit Geisterstimmen experimentiert, deren Anleitung ich einem Buch über Tonbandstimmen entnommen hatte. Man hat bei eingestellter Aufnahme das Mikrophon vor sich in den Raum zu halten und hörbar Fragen zu stellen, auf welche die Geister, wenn auch mühselig zu hören und oft schwer zu entziffern, antworten würden. Nachdem alle Fragen mit genügend Pausenabstand zwischen ihnen gestellt sind, spult man die Kassette zurück und beginnt mit dem Abhören. Doch so oft ich auch diese Versuche wiederholte, konnte ich keine raunenden oder flüsternden Geisterstimmen vernehmen. Schließlich bat ich sie, nach den an sie gerichteten Fragen bei einem Ja einmal zu klopfen und bei einem Nein zweimal. Und wie erstaunt war ich, die jeweiligen Antworten durch deutliches Klopfen auf der Kassette hören zu können. Doch nachdem ich mein Amulett als Pendel zu gebrauchen verstand, unterließ ich weitere Versuche mit dem Aufnahmegerät, das ich sowieso nicht in meinem Rucksack nach Afrika mitnehmen wollte.
Ich bereiste bei diesem Kreta-Aufenthalt die Südküste bis zum westlichen Paleohora und die Nordküste von Chania bis Aghios Nikolaios, und nahm in Heraklion das nächtliche Fährboot, das mich nach Piräus brachte, von wo aus ich über Athen per Anhalter nach Delphi gelangte. Wie erstaunt war ich über diese prachtvoll auf einer Berghangterrasse gelegene und nach der Athener Akropolis berühmteste Tempelanlage des griechischen Altertums. Nach Süden blickt man auf die sich herrlich ausbreitende Bucht am Golf von Korinth, und nach Norden hin erhebt sich der Parnass, den ich gleich am nächsten Tag besteigen musste, waren der Sage nach doch hier die Musen zu Hause. Calliope war die Muse der epischen Dichtung. Ob sie mich wohl beim Schreiben des Molar-Romans inspirieren würde? In Delphi befand sich einst das bedeutsamste Orakel. Ich entdeckte am Boden nahe dem Apollotempel eine Felsspalte, an der noch gelbliche Schwefelreste zu erkennen waren. Denn hier mussten vor vielen Jahrhunderten, noch bevor sich das klassische Altertum etablierte, Dämpfe aus einer schwefelhaltigen warmen Quelle aufgestiegen sein, wobei man von unten kommende Geräusche vernommen haben mochte. Diese, so interpretierte ich, wurden von Priestern als Stimme der Erdgöttin Gea ausgegeben, die sich durch diese röchelnden Laute aus der Tiefe den Menschen verkündete und ihnen auf Fragen hin Antworten erteilte. Schließlich, nachdem dieser Ort als Orakelstätte bekannt geworden war, erbaute man dort die ersten Tempel. Jener unter diesen bekannteste und mächtigste wurde dem Apollo geweiht. Hier bildete man Orakelpriesterinnen aus, durch die der Gott sich den sogar aus weiten Entfernungen herbeiströmenden Antwortsuchenden verkündete. Und da Delphi als heiligste Orakelstätte vor allem von Apollo beschützt war, errichtete man dort tempelartige Gebäude, die als Schatzdeponien dienten, denn kein Grieche würde es gewagt haben, in diese Schatzhäuser einzubrechen, da er dann mit dem Zorn des Gottes hätte rechnen müssen und, wo immer er auch hin entfliehen wollte, von dem erzürnten Gott aufgefunden und bestraft worden wäre. Bevor ein griechischer Herrscher einen Krieg zu beginnen trachtete oder andere wichtige Entscheidungen zu treffen hatte, kam er selbst oder schickte Boten zu einer Orakelstätte, und zwar vornehmlich nach Delphi, um sich über den Ausgang seines Vorhabens zu informieren. Da die Durchgaben der jeweils in Trance befindlichen Phythia meist doppel- oder mehrdeutig zu verstehen waren, wurden solche Antworten aus Götterhöhe oft falsch ausgelegt. Im Alten Griechenland lebten die Menschen, „als ob die Gottheit nahe wär“. Und sicherlich ließen sich Geister durch den Mund jener jungfräulichen Medien vernehmen, die sich als einen der Götter oder eine der Göttinnen ausgaben, um somit hilfreichen, aber auch manchmal zerstörerischen Einfluss auf die Menschen nehmen zu können. Vieles ist von den Resten der Tempelanlagen wieder errichtet worden, denn so manches Erdbeben vergangener Jahrhunderte hatte seinen Tribut gefordert. Doch auch gewalttätige Barbaren aus dem Norden scheuten sich nicht, Tempelanlagen zu verwüsten und den steinernen Abbildungen von Göttern die Nase abzuschlagen. Ich habe wohl alle bedeutenden Tempelanlagen des griechischen Altertums in späteren Jahren aufgesucht, die in Kleinasien, auf den griechischen Inseln, auf dem Peloponnes, auf dem griechischen Festland oder in Süditalien und auf Sizilien als Ruinen zu bewundern sind. Doch keine von all diesen hat mich derart nachhaltig beeindruckt wie Delphi.
Am dritten April betrat ich, von Igomenitza mit dem Fährschiff kommend, in Brindisi italienischen Boden und stellte mich gleich anderen Tags an die Straße in der Absicht, so schnell wie möglich nach Sizilien zu gelangen, um vor dort das Fährschiff nach Tunis zu besteigen. Im westlichen Süditalien an der Ausgangsstraße eines Ortes stehend, traf ich einen Studenten, der in Rom Jura und Psychologie studierte und nun ebenfalls wie ich per Anhalter nach Sizilien, wo er in Catania zu Hause war, reisen wollte. Da mein Italienisch trotz einiger Trampreisen in Italien zu wünschen übrig ließ, war ich froh, dass Eduardo fließend English sprach, da seine Großmutter Engländerin war. Wir freundeten uns schnell an, und er lud mich ein, bei ihm in Catania nach meiner Ankunft zu übernachten. Da das Trampen allein leichter als zu zweit war, trennten wir uns aufs Erste. Er erreichte sein Zuhause vor mir. Ich war nun vier Tage lang sein Gast. Von hier aus unternahm ich Tagestouren. Eine führte mich dem am östlichen Fuße des Monte Tauro hoch gelegenen Taormina, das schon zur Römerzeit ein Erholungszentrum für reiche Römer gewesen sein musste, die in dem noch heute nahezu erhaltenen Amphitheater bei Theateraufführungen und sicherlich bei den beliebten Gladiatorenkämpfen, bei welchen man seinen Wettleidenschaften nachkommen konnte, ihre Zeit vertrieben. Ein anderer Ausflug führte mich bis fast ganz hinauf auf den Ätna, diesen oft noch Lava ausspuckenden und mit 3.200 Metern höchsten Vulkan Europas. Hier begegnete ich einem älteren englischen Ehepaar, das ihre hochbetagte Mutter und Schwiegermutter unter den Armen eingeharkt hielt, um die Weinende zu stützen und zu trösten. Ich fragte das Ehepaar, warum diese Frau weine, ob sie sich verletzt habe und ob ich einen Arzt holen solle. Doch dann brüllte diese Frau zu mir gewandt heraus: „Dies ist der erste Berg in meinem Leben, den ich nicht mehr bis obenhin besteigen kann.“ Und als ich nach ihrem Alter fragte, antwortete sie, dass sie bald 90 Jahre zähle, aber gemäß ihrer Lebensmaxime jedes Ziel, das sie sich im Leben vorgenommen habe, auch erreichen wolle. Nun aber wisse sie, dass sie alt geworden sei und auf weitere Bergtouren verzichten müsse. Von ihrem Sohn erfuhr ich, dass sie vor wenigen Jahren mit ihm auf seiner kleinen Yacht von England nach Neuseeland gesegelt sei. „What a tough woman“, dachte ich.
Am vierten Tag meines Aufenthaltes bei Eduardo setzte ich meine Reise über Syracus, wo es wieder griechische und römische Altertümer zu bestaunen gab, nach Agrigento fort. Ich musste meinem neuen Freund beim Abschied versprechen, ihm hin und wieder zu schreiben und bei meiner Rückkehr nach Europa ihn nach Möglichkeit zu besuchen.
1 (so nannten mich nun meine Freunde)
2. Kapitel
Durch die Sahara nach Westafrika
1. Auf Karl Mays Spuren über den Chott El-Djerid
Und dann vom Schiff aus erblickte ich die Nordküste des afrikanischen Kontinents. Ich hatte bisher auf meinen Semestertrampreisen nur Ägypten, Libyen und Marokko kennengelernt. Jetzt wollte ich aber Tunesien und dann Teile von Algerien aufsuchen. Was wusste ich eigentlich bisher über Tunesien? Die Phönizier, von den Küsten des östlichen Mittelmeeres stammend, hatten sich an diesen Gestaden schon vor über 3.000 Jahren niedergelassen und als Handel treibendes Volk eine Stadt erbaut, die späterhin als Karthago Zentrum eines Punischen Reiches werden sollte, deren Anführer jener geschichtsbekannte Hannibal sogar Rom belagerte. Doch wurde dieses Reich nach dem Dritten Punischen Krieg 146 v.Chr. von den Römern erobert. Und das damals zerstörte und wieder aufgebaute und mit prächtigen Bauten versehene Karthago war unter Augustus bereits die Hauptstadt der Provinz Afrika. Doch gelangten schon um 439 n. Chr. die germanischen Wandalen unter Geiserich über Spanien kommend nach Karthago. Sie vertrieben die Römer und errichteten ein Gewaltreich, das erst 533 von Belisar, dem Heerführer des Kaisers Justinian, erobert und somit dem Oströmischen Reich eingegliedert werden konnte. Doch schon 705 drangen muslimische Heere aus dem Osten in dieses Land ein, zwangen nach und nach die Bevölkerung, sich zum Islam zu bekehren, und setzten ihren Siegeszug fort und eroberten sogar den größten Teil des heutigen Spaniens. Im 16. Jahrhundert wurde Tunesien Teil des Osmanischen Reiches. Der Sultan setzte dort als Vizekönig einen Bey ein, der, selbst als die Franzosen 1881 die Oberhoheit über dieses Land einnahmen, weiterhin als deren Marionette regierte, bis 1956 Tunesien die Unabhängigkeit erhielt und Habib Bourguiba zum ersten Staatspräsidenten ernannt wurde, der dann sein Land bis 1987 regierte.
Tunesien ist etwas weniger als halb so groß wie Deutschland und mochte zu meiner Zeit damals etwa eine Bevölkerung von sieben Millionen zumeist muslimischen Einwohnern aufweisen, deren Abstammung vornehmlich auf eine Mischung von Berbern und Arabern zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu den arabischen Kernländern tragen die Frauen hier keine Verschleierung, denn der französische Einfluss war überall zu spüren, hatten doch die meisten jungen Leute in der Schule Französisch als Zweitsprache, sodass ich, der am 11. April in der Hauptstadt Tunis ankam, mich überall verständigen konnte und bald auch eine kostengünstige Herberge fand. Heute ist diese Stadt zu einer Millionenmetropole angewachsen, während sie bei meiner Ankunft weniger als eine halbe Millionen Einwohner zählen mochte.
In einem Vorort besuchte ich die Ruinen der einstigen Römerstadt Karthago, wo es dank französischer Archäologen viel Beeindruckendes und teils wieder rekonstruiertes Mauerwerk zu sehen gab, wie zum Beispiel die großen Bäder, das Kolosseum, ein Theater, das Odeon nebst den Tempeln der Juno, des Jupiter, der Minerva und des Äskulap sowie auch Grundmauern von einem Aquädukt. All diese Prachtbauten waren einst mit Hilfe von Heeren von Sklaven erbaut, die sich späterhin mit der Bevölkerung vermischten. Auf dem belebten Markt der Innenstadt fand ich ein einziges Buch in deutscher Sprache. Es war Der Stille Don von Scholochow, ein Roman, der mir als Freund der russischen Literatur bisher entgangen war und welchen ich sogleich erstand. Und während ich in den nächsten Tagen per Anhalter dieses Land, das im Norden zumeist aus Olivenbäumen bestand, im Süden aber vielfach durch nicht zu bewirtschaftende Böden bis hin zu Wüstenlandschaften durchzogen war, las ich nun in diesem Kosakenroman. Und da ich in Gedanken den Molar-Roman konzipierte, hatte ich nun den Schlüssel für die Kapitelgestaltung durch diese Lektüre gefunden. Denn meisterhaft hatte Michail Scholochow es verstanden, nicht wie sonst üblich die Erzählung von einem Ereignis ins nächste fließen zu lassen, sondern Sprünge einzuflechten, indem er im jeweils neuen Kapitel kurz das inzwischen Geschehene zusammenfasste, um dann zu einem neuen Hauptereignis überzugehen, sodass sich dieses jeweils wie eine in sich geschlossene Kurzgeschichte darbot. Ebenso wollte ich es nun auch in meinem Roman halten. Wie großartig, dass zufällig gerade mir dieser Roman in die Hände fallen musste, oder war ich, wie Goethe sagen würde, zu jenem Buchstand von unsichtbaren Begleitern „geschoben“ worden?
In der algerischen Botschaft, in der ich um ein Visum nachkommen wollte, erhielt ich die Mitteilung, dass man Deutschen kein Visum ausstelle, da sie bei den Olympischen Spielen letztes Jahr in München auf Geheiß der Israelis die palästinensischen Kidnapper ermordet hatten. Gott sei Dank hatte ich für derart unerwartete Fälle den Bericht einer amerikanischen Zeitung über meine erstaunliche Weltreise mitgenommen. Der davon beeindruckte Botschaftsangestellte wolle erst an oberer Stelle nachfragen, ob man in meinem Falle eine Ausnahme machen könne, weshalb ich erst in einer Woche wieder kommen möge. Somit stellte ich mich an die südliche Ausgangsstraße, von wo ich mit verschiedenen Autos und Lastwagen nach Sousse und schließlich nach Sfax gelangte. In beiden Städten mit ihren überdachten Basaren hielt ich mich zwei Tage auf. Doch mein erstes Ziel waren die in einem runden Steinkessel eingemeißelten Berberbehausungen in Matmata. Nur wenige dieser künstlichen Höhlenbehausungen, die ihre Bewohner vor der Hitze schützen, waren noch bezogen, da die Regierung für sie ein nur wenige Kilometer entferntes neues Dorf errichtete, in welchem es Strom und Wasser gab.
Mädchen vor ihrer Höhlenwohnung
Doch mein Hauptziel dieser Rundreise in den Süden war das Chott El-Djerid. Dieser ist ein gewaltiger Salzsee mit einer Breite und Länge von über 100 Kilometern. Während der heißesten Jahreszeit ist die Oberfläche ganz trocken, doch sobald mal Regen gefallen ist, was häufiger in den Wintermonaten vorkommen kann, verwandelt sich diese getrocknete Oberfläche in eine wässrige Lache, sodass , wenn man auf unfesten Boden gelangt, darin einsinken und zu Tode kommen kann. Nun in der Mitte des Monats April sollten es, wie ich mir sagen ließ, noch viele gefährliche Stellen geben, sodass man mir riet, wie man riet, einen kundigen Führer für die Überquerung zu mieten. Doch vertraute ich auf mein Glück, hatte es mich doch auf meinen bisherigen Reisen in manchen Situationen vor Widerwärtigem bewahrt. Hinter Kebili ragt noch eine feste Landzunge in diesen Salzsee hinein. Als pubertierender Pennäler hatte ich die Bücher von Karl May gelesen. Und der fiktive Roman Durch die Wüste beginnt bei der Überquerung eben dieses Salzsees mit dem Wort des Hadji Halef Omars, das da lautet „Sidhi“. Komisch, was sich in einem Gehirn an Nebensächlichkeiten alles einprägt, während oft sehr wichtige Dinge der Vergessenheit anheimfallen.
Nun wollte ich allein zu Fuß diesen gefährlichen See überqueren, gab es doch damals anders als heute noch keine Straße, die sich durch die grauweiß schillernde Fläche bahnte. Also machte ich mich zur frühsten Stunde auf den Weg, und zwar an der engsten Stelle, sodass an jenem Tag gut 50 Kilometer zurückzulegen sein mochten. Ich folgte den Spuren von Pferdewagen, die besonders gefährliche Stellen umfuhren, gab es doch sonst keine Hinweis- oder Warnschilder. Ein sehr heftiger Ostwind gab mir zusätzliche Schubkraft von hinten. Ich wollte diesen ausnützen und spannte meinen mich immer begleitenden langen Regenschirm auf, der mir meist als Sonnenschirm diente, um mich nun, diesen vor mich hinhaltend, vom Wind ziehen zu lassen und damit mein Gehen zu beschleunigen. Doch schon bald kam ein heftiger Windstoß von hinten und drehte das Schirmgestänge nach vorne, sodass dieses zerbrach. Nun war mein ständiger Reisebegleiter nicht mehr zu gebrauchen. Ich begradigte ihn wieder und steckte ihn aufrecht neben dem Pfad in den Boden. In Tunis würde ich mir wieder einen neuen dieser für mich unentbehrlichen Schattenspender und Regennassverschoner besorgen. Und als ich nach ein, zwei Kilometern pausierte und mich umdrehte, sah ich trotz der Entfernung meinen Regenschirm deutlich erkennbar an jener Stelle stehen, als ob ich mich keine 50 Meter von diesem entfernt hätte. Der Chott El-Djerid ist wie manche Wüstengegenden bekannt für seine Luftspiegelungen, sodass weit entfernt liegende Orte und Oasen einem ganz nah erscheinen, während sie sich oft noch 100 Kilometer weit entfernt befinden. War auch meine Liebe zu Maria, an die ich immer wieder denken musste, nur eine Fatamorgana? War überhaupt jede große Liebe zu einem Menschen nicht nur eine Spiegelung der Liebe, die wir im Jenseits schon zu dieser Seele gespürt hatten? Weit und breit begegnete ich keinem Menschen auf diesem langen, schweißtreibenden, von Windböen begleiteten Marsch. Nur einmal kam mir ein kleines Fuhrwerk entgegen, gezogen von zwei Pferden. Der viel Sand mit sich führende Wind hatte die Augen der Vierbeiner zum Tränen gebracht. In diesem Tränennass verklebten sich die Sandkörner, sodass diese armen Tiere wie Pferdegespenster aussahen.
Bei Dämmerung entdeckte ich eine Oase mit Palmen vor mir. Ich hatte es also geschafft. Humpelnd, da sich Blasen in meinem Schuhwerk gebildet hatten, betrat ich dieses Dorf. Ich war es schon von anderen fernen Ländern gewöhnt, manchmal wie ein Außerirdischer betrachtet zu werden, denn auch hier hatte man doch wohl noch nie einen Europäer gesehen, der allein über diesen gefährlichen Salzsee marschierte. Ich fragte einige Männer, die bei ihrem gesüßten Tee vor einer kleinen Kaschemme saßen, wo ich übernachten könne. Und einer der Männer etwa in meinem Alter erhob sich und gab mir im gebrochenen Französisch zu verstehen, dass ich in seinem Hause übernachten könne. Also folgte ich ihm. Er teilte mir einen Raum zu, und ich war froh, mich meiner Schuhe entledigen zu können und später die Blasen mit einer Nadel aufzustechen. Dann kehrte er in das Zimmer zurück und bedeutete mir durch Handzeichen, zum Essen zu kommen. Wir saßen auf dem Boden, und seine Frau, von einem Kopftuch umhüllt, servierte uns das Essen. Dann zauberte er von irgendwo eine Flasche mit starkem Alkoholgehalt hervor, und ich musste mit ihm anstoßen. Alkohol ist für einen gläubigen Muslim strengsten verboten, doch schien er in seinen eigenen vier Wänden zu hoffen, dass Allah ihn dort nicht sehen würde. Während er munter darauf los trank, nippte ich nur verhalten an jenem Getränk. Er hatte anscheinend den Narren an mir gefressen, wie man so sagt, lobte die Deutschen, die während des letzten Krieges einige Monate lang sein Land beherrscht hatten, schimpfte auf die Franzosen, und war bald stock betrunken. Und dann, als ich mich todmüde erheben wollte, um meine Matratze aufzusuchen, gab er mir zu verstehen, dass er seine Frau über Nacht zu mir schicken wolle. Ich war verblüfft. Ich dachte, dass diese Gastfreundlichkeit heute nur noch bei den Eskimos zu finden sei. Und obwohl ich seine Frau als solche nicht abgelehnt haben würde – war ich doch sonst auf meinen Reisen immer bereit, mich mit einer Landesschönen einzulassen –, lehnte ich dennoch sein großzügiges Angebot ab, nicht nur, weil ich vom langen Marsch erschöpft war, sondern weil ich auch dachte, dass ihm nur in diesem Trunkenheitszustand die Idee kam, seine Frau bei mir nächtigen zu lassen, könne er doch bei Nüchternheit am Morgen über das Vorgefallene verärgert sein, sodass sein Zorn nicht nur über mich, sondern auch über seine Frau gekommen wäre. Die orientalische Frau hat ihrem Mann bedingungslos zu gehorchen. Und sicherlich hätte sie ohne zu Murren mit einem fremden Mann das Bett teilen müssen, wenn ihr Mann das so bestimmt haben würde.
Am nächsten Morgen suchte ich eine der warmen Quellen auf, nahm ein Bad darin und stellte mich dann an die Straße. Ich, der ich immer noch humpelte, war froh, alsbald einen Lastwagen gefunden zu haben, der mich nach Gafsa mitnahm. Am folgenden Abend gelangte ich nach Hammamet, das sich seines schönen Strandes wegen schon zu einem Touristenort emporgeschwungen hatte. Ich sprach in einem Restaurant zwei junge Schweizerinnen an und lud sie zu einem Getränk ein, war der 23. April doch mein 37. Geburtstag. Und da ich eigentlich daran gedacht hatte, am Strand in irgendeiner verborgenen Ecke beziehungsweise hinter oder in einem Fischerboot zu nächtigen, kam mir nun eine bessere Idee. Deshalb fragte ich die Beiden, ob ich in ihrem Zimmer auf meinem Schlafsack liegend übernachten könne. Sie waren einverstanden, befand sich doch noch ein Extrabett in ihrem Strandbungalow. Als ich in dem mir zugewiesenen Bett lag und das Licht erloschen war, dachte ich, wie schön es wäre, als Geburtstagsgeschenk mit einer dieser Adretten das Bett zu teilen. Deshalb fragte ich leise in die Dunkelheit hinein, wer von ihnen unter meine Bettdecke schlüpfen möchte. Und obwohl ich vorher gehört hatte,