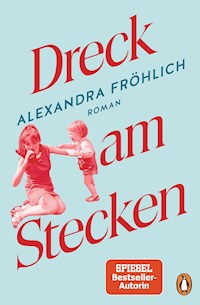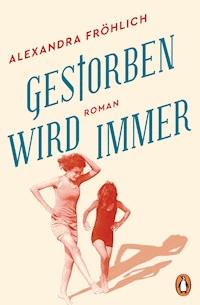4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Versöhnungsurlaub? Das hat sich Paula irgendwie anders vorgestellt. Nur sie und ihr Mann. Ohne Kind, ohne Verpflichtungen und vor allem OHNE SEINE MUTTER. Doch nun ist Artjom seit 36 Stunden spurlos verschwunden, und Paula sitzt allein in Kiew, einer Stadt, wo sie nicht mal die Straßenschilder lesen kann. Ausgerechnet Darya, ihre russische Schwiegermutter, ist nun ihre einzige Hoffnung. Diese reist an, glamourös und durchgeknallt wie immer, mit Paulas Mutter Luise im Schlepptau und der zweijährigen Tochter Johanna im Gepäck. Als die drei Frauen einen Hinweis erhalten, Artjom halte sich geschäftlich in Donezk auf, reisen sie ihm nach – der Beginn einer wilden Odyssee quer durch das Land!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Alexandra Fröhlich
Reisen mit Russen
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Die Liebe ist blind, aber sie hat einen trefflichen Augenarzt – die Ehe.
Den Teufel kann man mit dem Kreuz bannen, aber den Russen wird man nie los.
ukrainische Sprichwörter
Prolog
Mai 2011, bei Kutschurhan, Ukraine
Schto wy chatitje?«
Ratlos starre ich den transnistrischen Grenzbeamten an. Ich habe keine Ahnung, was er sagt und will. Deshalb zucke ich einfach mit den Schultern. Er starrt genauso ratlos zurück, dann wandert sein Blick angestrengt zwischen den Pässen in seiner Hand und unserem Mini-Konvoi hin und her. Seine Stirn legt sich in krause Falten, was er sieht, missfällt ihm.
Während er vorsichtig in der Dunkelheit unseren ersten Wagen umkreist, einen schneeweißen Landrover, auf dessen Vordertüren beidseitig das Logo der Europäischen Union prangt, ziehe ich hektisch an meiner Zigarette und bekomme einen Hustenanfall. Ich rauche erst seit kurzem und muss noch üben.
Der Beamte leuchtet mit seiner Taschenlampe ins Wageninnere. Ihr Strahl trifft zuerst Mutter, die am Steuer sitzt, dann meine Schwiegermutter Darya direkt neben ihr. Beide kneifen ihre Augen zusammen und versuchen dennoch, möglichst unschuldig zu gucken. Das Licht wandert zur Rückbank. Dort schläft Johanna, meine Tochter, tief und traumlos, der Blender stört sie nicht.
Der Grenzer kratzt sich im Nacken, schüttelt den Kopf und nähert sich vorsichtig unserem zerbeulten, schmutzig braunen Ford Transit. Er rüttelt an den Hecktüren, die knarrend aufschwingen. Mein Herz macht einen kurzen, panischen Hüpfer. Wenn er die Paletten mit dem chinesischen Rohtabak entdeckt, sind wir geliefert. Dasswidanja, Freiheit! Ich habe keine Ahnung, wie ein transnistrischer Knast von innen aussieht, kann mir aber vorstellen, dass sich der deutsche Strafvollzug im Vergleich wie ein Kur-Aufenthalt ausnimmt.
Doch das Glück ist uns hold. Der Beamte stochert nur lustlos in unserem Gepäck, das inszenierte Chaos aus Kisten und Koffern im Laderaum hat tatsächlich eine abschreckende Wirkung. Schnell schließt er die Türen und trottet nach vorn zur Fahrerseite. Im Schein seiner Lampe sieht man nur das Lenkrad, auf dem zwei tätowierte Hände einen schnellen Takt trommeln. Tam-ta-tam, tam-ta-tam. Eine dieser Hände kurbelt jetzt das Fenster herunter, die andere greift nach einem Umschlag, der oben auf der Konsole liegt. Der Umschlag wird aus dem Fenster gereicht und wechselt den Besitzer.
Der Milizionär wirft einen kurzen Blick hinein, grinst zufrieden und gibt mir mit einer leichten Verbeugung unsere Pässe zurück. Nun ist es an mir, zufrieden zu grinsen. Mensch, Matthes, denke ich, das läuft ja wie geschmiert. Ich setze mich in den Transporter neben den Mann mit den tätowierten Händen.
»Dawai, dawai«, rufe ich fröhlich, »auf geht’s!«
Der Mann schweigt, das tut er fast immer, er ist kein Freund großer Worte, und startet den Motor. Er rollt am Landrover vorbei und hupt kurz als Zeichen, dass Mutter ihm folgen soll. Nur noch fünfzig Kilometer, dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann kann ich, so Gott will, meinen Mann in die Arme schließen. Aber vorher haue ich dem Mistkerl ein paar rein. Bei der Vorstellung wird mir ganz warm ums Herz.
1.
April 2011, Kiew, Ukraine
Stöhnend schlage ich die Bettdecke beiseite und richte mich ruckartig auf. Das ist ein Fehler. Mein Schädel wummert und dröhnt, vor meinen Augen tanzen kleine Lichtblitze. Es dauert ein paar Sekunden, bis ich weiß, wo und wer ich bin und wem ich diese abartigen Kopfschmerzen zu verdanken habe. Der Nebel in meinem Hirn lichtet sich: Ich bin in Kiew, ich heiße Paula Matthes, und gestern Abend habe ich mich in die Arme von Towaritsch Wodka geflüchtet.
Vorsichtig stehe ich auf, wanke zum Fenster und schiebe die zerschlissenen Vorhänge beiseite. Es wird gerade erst hell, der Platz vor meinem Hotel ist noch menschenleer. Nur Thomas Anders lächelt mich von seinem Plakat aus an.
Ich habe etwas gebraucht, um zu begreifen, dass der alternde Schönling mit dem gebleckten Gebiss tatsächlich Thomas Anders ist. Darauf kommt man nicht ad hoc – Thomas Anders in Kiew? Aber er ist da, Julio Iglesias und Depeche Mode werden ihm folgen. Ganze Straßenzüge sind mit den Ankündigungen ihrer Konzerte plakatiert. Man fragt sich ab und an, was aus den Helden der eigenen Jugend geworden ist. Ich weiß jetzt die Antwort: Sie sind alle im Osten, dem großen Popstar-Recyclinghof.
Auch ich bin in Kiew, um etwas zu recyceln. Meine Ehe. Sie lief in letzter Zeit nicht so richtig rund, euphemistisch ausgedrückt. Man könnte auch sagen: Sie ist komplett im Arsch. Deshalb sind mein russischer Mann und ich in die Ukraine gefahren, eine Art zweiter Honeymoon, wie er es nennt. Dabei hatten wir nicht mal einen ersten.
»Schatz, was hältst du davon, wenn wir uns eine Auszeit nehmen? Nur wir beide. Mal raus hier, weg von dem ganzen Stress«, sagte Artjom auf dem Höhepunkt unserer Krise und wedelte euphorisch mit den Flugtickets.
Malediven, Mauritius, von mir aus auch Mallorca, hoffte ich.
»Ukraine!«, frohlockte mein Mann. Als er meine Gesichtsentgleisung bemerkte, fügte er schnell hinzu: »Kiew, Paula, Kiew! Shoppen, schick essen gehen, Nightlife, ausschlafen – es wird dir gefallen, versprochen! Und dann machen wir noch einen Abstecher auf die Krim, ans Schwarze Meer. Anfang Mai können wir bestimmt schon baden.«
»Anfang Mai? Wann fliegen wir denn?«
»Übermorgen.«
»Bitte? Wie soll das denn gehen? Wer kümmert sich um Johanna? Und ich kann meine Kanzlei nicht einfach dichtmachen.«
»Wofür hast du eigentlich eine Sekretärin und eine Mitarbeiterin? Irina und Heike organisieren das schon alles irgendwie. Um Johanna kümmern sich die Großmütter, überhaupt kein Problem, ich habe schon mit den beiden gesprochen.«
»Artjom, das ist viel zu kurzfristig.«
»Ach, Paula, sei doch einmal in deinem Leben spontan!«
»Ich bin nicht spontan, ich bin Norddeutsche.«
»Dann flieg ich eben allein.«
»Mach doch. Viel Spaß!«
Ich zog mich in meine Schmollecke zurück, schimpfte und zeterte ein wenig, fand aber, dass Artjoms Idee gar nicht schlecht war.
Eine Auszeit.
Nur wir zwei.
Ohne Kind.
Ohne den Rest der Familie.
Und ohne seine Mutter.
Das klang zu gut, um das Angebot nicht anzunehmen. Und war es nicht wirklich reizend von meinem Gatten, mich mit dieser Reise zu überraschen?
Erst als wir im Flieger saßen, erfuhr ich, dass wir nicht nur zu ehetherapeutischen Zwecken gen Kiew aufbrachen.
»Ach«, sagte Artjom beiläufig, »wenn wir sowieso schon in Kiew sind, können wir auch noch schnell was für Alexej erledigen.«
»Für deinen Großvater? Was denn?«, fragte ich irritiert.
Wie sich herausstellte, besaß Deduschka Alexej dort noch eine Datscha. Denn in den Wirren nach dem Großen Vaterländischen Krieg hatte es den alten Haudegen aus dem russischen Belgorod ins ukrainische Kiew verschlagen, wo er sich als Zahnarzt niederließ. Mit weit über achtzig Jahren ließ Alexej sich auf ein neues Abenteuer ein und zog zu uns nach Hamburg. Vorgeblich kam er nur zu Besuch, tatsächlich fuhr er einfach nicht mehr nach Hause, sondern heiratete meine Nachbarin Frau Hinrichs, eine ältere alleinstehende Dame, mit der ihn die gemeinsame Leidenschaft für Rosamunde-Pilcher-Filme verband. Seine Gartenlaube in Kiew nebst Grundstück brauchte er nun nicht mehr. Also galt es, diese Immobilie zu veräußern.
»Wie praktisch«, sagte ich und versuchte, ironisch und nicht bitter zu klingen, »da können wir ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.«
»Genau«, Artjom blätterte abwesend im Bordmagazin, »so wird’s gemacht.«
Die ersten Tage in Kiew verliefen tatsächlich überaus angenehm. Sonnenschein, Tausende blühender Kastanien, eine aufregende Stadt – und ein Mann, der zu einer großen Charmeoffensive ansetzte. Artjom schleppte mich in die schicksten Boutiquen der City und drückte mir wohlwollend seine Kreditkarte in die Hand.
»Such dir doch was Schönes aus, Schatz! Du hast es dir verdient.«
Das fand ich auch und verkniff mir die Frage, wem oder was er seinen plötzlichen Reichtum zu verdanken hatte. Zu Hause war schließlich ich diejenige, die hauptsächlich für das Familieneinkommen zuständig war – und genau diese Tatsache ein ständiger Stolperstein auf unserem Weg zu einem friedlichen Miteinander. Aber ich wollte unseren Urlaub nicht gleich schon zu Anfang durch kleinliche Streitereien verderben.
Stattdessen übte ich mich in der Leichtigkeit des Seins und stürzte mich in die funkelnde Stadt. Wir flanierten den Kreschtschatik-Boulevard rauf und runter, standen ehrfürchtig am Majdan, dem Platz der Unabhängigkeit, und verloren uns in dem unterirdischen Tunnelsystem, das zu den U-Bahn-Stationen führte und in dessen unübersichtlichen Gassen sich Laden an Laden reihte – ein Gewirr von Geschäften, die allesamt improvisiert wirkten, so als könnten sie im nächsten Augenblick abgerissen werden, um an anderer Stelle sofort wieder zu öffnen.
Es gelang mir sogar, Artjom zu einer Stadtrundfahrt zu überreden. Er maulte zwar – russisches Dolce Vita traf auf deutsches Bildungsbürgertum –, quetschte sich aber dennoch an meiner Seite in einen der Sightseeing-Busse. Der englischsprachige Guide hetzte drei Stunden mit uns durch Kiew und etliche hundert Jahre ukrainischer Geschichte. Ich konnte ihn kaum verstehen, da seine Aussprache kryptisch war und Artjom die ganze Zeit lauthals telefonierte – »’tschuldigung, Paula, ein Interessent für die Datscha«. Also schaute ich einfach still aus dem Fenster und betrachtete Kirchen mit Zwiebeltürmen und vergoldeten Kuppeln neben heruntergekommenen Plattenbauten, an denen schiefe, hölzerne Balkone und Wintergärten wie Bienenwaben klebten, die stalinistischen Monumentalbauten und das Meer von modernen Hochhäusern, deren obere Stockwerke mit Erkern und Türmchen verziert waren. Und immer wieder staunte ich über den Dnipro, den wir auf ungezählten Brücken überquerten und neben dem sich meine Hamburger Elbe wie ein trauriges Rinnsal ausnahm.
»Guck mal da!«
»Hast du das gesehen?«
»Oh, wie schön!«
»Artjom, jetzt schau doch!«
Mein Mann quittierte meine aufgeregten Ausrufe mit einem milden Lächeln, tätschelte beruhigend meine Hand, so als begleite er ein Kind bei seinem ersten Jahrmarktbesuch, und dröhnte unverdrossen weiter in sein Handy. Nicht mal das machte mir schlechte Laune, ich war viel zu fasziniert von der fremden Umgebung.
Artjom war nicht zum ersten Mal in der ukrainischen Hauptstadt, als Junge hatte er etliche Sommer bei seinen Großeltern auf der Datscha verbracht. Deshalb fühlte er sich auch befähigt, den Fremdenführer zu mimen, obwohl das Kiew seiner Kindheit nur noch wenig mit der jetzigen Metropole zu tun hatte. Auf unseren Streifzügen verirrten wir uns also des Öfteren, landeten auf schmutzigen Hinterhöfen oder in stillen Seitenstraßen, die von Bauruinen gesäumt wurden. Artjom tat jedes Mal so, als hätte er genau dorthin gewollt, um mir auch einen Blick hinter die glitzernde Fassade und auf das echte Leben im Postsozialismus zu gewähren. Auch wenn ich diese unfreiwilligen Abstecher etwas ermüdend fand, spielte ich um des lieben Friedens willen sein Spiel mit und untermalte seine Ausführungen mit interessiertem Ah und Oh und Ach, was! Gibt’s ja gar nicht. Entspann dich, Matthes, mahnte ich mich, Problemgespräche kannst du immer noch führen. Später. Jetzt haben wir erst einmal ein bisschen Spaß.
Nach den Shopping- und Sightseeing-Exzessen zogen wir uns nur kurz in unsere Unterkunft, das Hotel Dnipro, direkt am Kreschtschatik, zurück.
»Vier Sterne, Paula. Vier Sterne!«, hatte Artjom vor dem Abflug geschwärmt, und ich wähnte mich in wenigen Stunden in einer Wellnessoase de luxe. Unsere Euphorie wich der Ernüchterung, als das Taxi uns vom Flughafen zu einem tristen zwölfstöckigen Hochhaus fuhr. Die riesige Eingangshalle beeindruckte zwar mit viel Marmor, Mahagoni und opulenten Lüstern, das Personal allerdings glänzte nur durch freundliches Desinteresse und beobachtete uns gelangweilt, als wir unsere Koffer in den knarzenden Fahrstuhl wuchteten. Unser Zimmer war klein und muffig, das Mobiliar alt und schäbig, die Tapeten fleckig, die Fenster undicht.
»Oh«, sagte ich erschrocken.
»Ach was«, meinte Artjom und ließ sich aufs Bett plumpsen, das bei diesem Akt unheimliche Geräusche von sich gab, »die Laken sind sauber.«
An andere Akte war in diesem Ambiente nicht zu denken, auch wenn Artjom begehrlich die Arme nach mir ausstreckte. So statteten wir unserer Herberge nur kurze Stippvisiten ab, um zu duschen, zu schlafen und zu frühstücken. Immerhin war das Frühstück wirklich gut – es ähnelte allerdings eher einem deftigen deutschen Mittagessen. Von Omeletts über gebratenes Fleisch, Pilzen in Sahnesoße, Mayonnaisesalate und Würstchen bis hin zu diversen Kuchen ließ das Angebot nichts zu wünschen übrig.
Nur die Kellner waren nach meinem Geschmack etwas zu streng. Als wir am ersten Morgen um neun Uhr neunundfünfzig hastig das Restaurant betraten, bedeuteten sie uns mit großen Gesten, dass fürs Essen noch eine Minute bliebe, und stellten sich in einer Fünfergruppe unweit unseres Tisches auf, um uns missbilligend zu betrachten. Etwas irritierend fand ich auch, dass die Decke des Speisesaals verspiegelt war, dadurch verstärkte sich noch der Eindruck, unter Beobachtung zu stehen. Zudem haute schon in aller Herrgottsfrühe ein Pianospieler im weißen Frack in die Tasten, als spielte er um sein Leben. Eine Unterhaltung erübrigte sich.
So nahmen wir alle sonstigen Mahlzeiten lieber außerhalb des Hotels zu uns. Artjom, ganz Mann von Welt, versprach, mich in die ersten Häuser am Platz zu führen. Nach der Erfahrung mit unserer Unterkunft machte ich mich auf alles gefasst. Doch mittags lotste er mich in lauschige Gartenrestaurants, gelegen in stillen Parks, am ersten Abend hatte er einen Tisch im Hyatt Regency reserviert, den zweiten verbrachten wir in einem Lokal hoch oben auf einem der zahlreichen Hügel mit grandiosem Blick über die illuminierte Stadt.
Vielleicht lag es an der frischen Luft oder der ungewohnten Bewegung, jedenfalls hatte ich Hunger wie ein Wolf auf Wanderschaft und aß mich die Speisekarten rauf und runter. Fleisch, Fisch, Gemüse und wieder Fleisch – alles schmeckte so großartig, dass mich nicht einmal die dröhnende Musik in der örtlichen Gastronomie störte. Ich kaute zufrieden vor mich hin und betrachtete fasziniert die Szenerie um mich herum. An den anderen Tischen residierten überwiegend hünenhafte, etwas grobschlächtige Kerle in gutsitzenden Anzügen, allesamt mit Bürstenhaarschnitt, in der einen Hand die Gabel, in der anderen das Handy, ab und zu einen Blick auf die Rolex werfend.
»Was sind denn das für Typen?«, rief ich Artjom über den Sound-Teppich zu.
»Bissnessmen.«
»Aha.«
Flankiert wurden die Bissnessmen von umwerfend schönen, grazilen und langbeinigen weiblichen Geschöpfen in Gucci, Chanel und Prada, die in ihren Salaten stocherten und zwischen ihren Telefonaten gelangweilt die manikürten Hände betrachteten. Zum wiederholten Male ertappte ich mich dabei, dass ich fremden Frauen aufs Dekolleté starrte – die C- und D-Körbchen bestimmten hier eindeutig das Straßenbild. Mich als bescheidenes A erfüllte das mit Neid.
»Sag mal, sind die alle echt?«, wollte ich etwas spitz von Artjom wissen.
»Natürlich sind die echt. Was glaubst du denn?«
»Silikon?«
»Paula, das kann sich hier kaum jemand leisten.«
»Aber fast alle Frauen haben so einen großen Busen. Das kann doch gar nicht sein!«
»Das liegt am Klima, Paula. Die gute Luft, das gute Essen, die vielen Sonnenstunden.«
»Interessante Theorie.«
Vor lauter Staunen und Gucken vergaß ich fast den eigentlichen Grund unserer Reise. Und immer wenn ich kurz dachte, dass wir nun langsam über unsere Probleme sprechen sollten, schob ich den Gedanken schnell beiseite. Morgen ist auch noch ein Tag, sagte ich mir, heute lassen wir uns die gute Laune nicht verderben.
Ich kam auch kaum dazu, meine Tochter zu vermissen. Dabei war es das erste Mal, dass ich ohne Johanna in den Urlaub fuhr, sie war erst zwei Jahre alt. Das mütterliche Gewissen zupfte latent an meinem Unterbewusstsein, und deshalb zwang ich meinen Mann, alle paar Stunden in der Heimat anzurufen.
Jedes Mal schlief Johanna gerade, oder sie war auf dem Spielplatz beschäftigt, oder es passte aus anderen Gründen nicht. Aber Babuschka Darya ließ ausrichten, es ginge ihr gut, natürlich ginge es ihr gut, was sonst, die Kleine sei schließlich in den besten Händen. Ihren. Und ob der Telefonterror langsam mal aufhören könne? Ich merkte, wie meine Halsschlagader bei jedem vergeblichen Versuch ein wenig mehr anschwoll.
»Wo steckt eigentlich meine Mutter?«, platzte es irgendwann aus mir heraus. »Die wollten sich doch gemeinsam um die Kleine kümmern.«
»Keine Ahnung, vielleicht ist sie einkaufen?«
»Das glaubst du doch selbst nicht! Deine Mutter hat sich Johanna unter den Nagel gerissen, kaum dass wir weg waren!«
»Was soll das denn heißen?«
»Das weißt du ganz genau! Deine Mutter lässt doch keine Sekunde ungenutzt, um …«
In diesem Moment klingelte Artjoms Handy, und er erstickte die Diskussion mit den Worten: »Oh, ein potentieller Käufer. Da muss ich ran.«
Ich verbiss mich ins Dessert. Erziehungsfragen waren ein ständiger Anlass zum Streit zwischen uns. Wie lange Johanna zu schlafen habe, welche Ernährung die beste sei und ob eine Zweijährige schon selbständig einen weichen Plastiklöffel halten könne, ohne sich dabei lebensgefährlich zu verletzen. Artjom war grundsätzlich anderer Ansicht. Ich hatte ihn im Verdacht, dass er lediglich die Meinung seiner Mutter wiedergab, da er sich sonst aus allen familiären Angelegenheiten heraushielt und alles mir überließ.
Matthes, komm mal wieder runter und versau dir nicht den schönen Ausflug!, beschwichtigte ich mich. Wir haben noch genug Zeit, um darüber zu sprechen. Später.
Eigentlich war mir völlig klar, dass Johanna bei ihrer russischen Großmutter nichts passieren konnte. Sie wurde behandelt wie ein rohes Ei, auf Händen getragen, auf Rosenblättern gebettet, umgeben von einem Wall unerbittlicher Liebe, an dem alle schädlichen Einflüsse abprallten. Immerhin wähnte sich meine Schwiegermutter seit zwei Jahren im Wettstreit um den Titel Beste Oma der Welt, und sie war entschlossen, ihn ohne Rücksicht auf andere Familienmitglieder zu gewinnen.
Um den fragilen Kiewer Frieden nicht zu gefährden, klammerten Artjom und ich in stillschweigender Übereinkunft fortan alle Problemthemen aus. Unsere Gespräche bewegten sich nur an der Oberfläche, mit großem Geschick umkreisten wir Konfliktbeladenes wie unsere Tochter,deine Mutter,meine Kanzlei und dein merkwürdiger Job gleich afghanischen Minenfeldern. Unsere Deeskalationsstrategie zeigte Wirkung. Nach zwei Tagen fand zumindest ich, dass mein Mann doch nicht so ein übler Bursche war, und mir dämmerte langsam wieder, warum ich mich jemals in ihn verliebt hatte.
Ob es Artjom ähnlich ging? Ich hatte keine Ahnung, wir redeten ja nicht. Ich nahm mir vor, auch diesen Tag in größtmöglicher Harmonie verstreichen zu lassen, um am dritten endlich Unausgesprochenes anzusprechen. Noch ein paar weitere Stunden voller Harmonie und ohne Streit sollten uns vergönnt sein.
Meine Erwartungen wurden übertroffen. Die Nacht war so mild und lauschig, der georgische Rotwein aus dem Restaurant so süffig und schwer, dass wir gar nicht anders konnten, als uns zu vorgerückter Stunde wild zu küssen und, engumschlungen, mit leichter Schlagseite zum Hotel zurückzutaumeln. Kichernd wankten wir durch die elend langen, dunklen Flure des Dnipro, warfen uns auf unser quietschendes Bett und hatten nach Monaten der Askese endlich einmal wieder Sex.
»Ach Paula«, seufzte Artjom nach seinem gelungenen Einsatz zufrieden und zündete sich eine Zigarette an, »unser Leben könnte so schön sein. Wir sollten aufhören, uns ständig zu streiten.«
»Wir streiten ja nicht ohne Grund«, erwiderte ich.
»Wir streiten nicht. Du streitest. An allem, was ich mache, hast du was auszusetzen. Immer musst du alles zerreden. Und dann dein Kleinkrieg mit Mam! Mach dich doch einfach mal locker!«
Einfach mal locker machen? Burschi, bei dir ist eine Schraube locker!, dachte ich und sagte: »Lass uns morgen in Ruhe reden, okay? Nicht jetzt.«
»Von mir aus müssen wir gar nicht reden. Ist doch alles prima. Aber wenn es unbedingt sein muss.«
»Es muss. Deshalb sind wir hier«, sagte ich und hoffte, nicht allzu streng zu klingen.
Mitten in der Nacht klingelte Artjoms Handy. »Wieder jemand, der sich für Deduschkas Datscha interessiert. Bin gleich wieder da«, flüsterte er, stand auf und verließ das Zimmer.
»Komische Zeit für Immobiliengeschäfte«, murmelte ich schläfrig und dämmerte sofort weiter.
Das war vor sechsunddreißig Stunden. Seitdem ist Artjom weg. Einfach weg. Spurlos verschwunden.
Als ich gestern nach dem Aufstehen feststellte, dass etwas Wesentliches fehlte, mein Gatte nämlich, sagte ich mir, er sei schon ohne mich frühstücken. Im Restaurant fand ich ihn nicht und bildete mir deshalb ein, dass er vielleicht Besorgungen oder die Datscha käuferfein mache. Nachdem der halbe Tag unbemannt verstrichen war und ich ihn nicht auf dem Handy erreichen konnte, wurde ich langsam sauer. Dieser Mistkerl, dachte ich, will sich vor der Aussprache drücken. Feigheit vor dem Feind, das sieht ihm ähnlich. Konfliktscheuer Waschlappen! Wahrscheinlich trifft er sich mit irgendeinem Kumpel, um über sein schweres Schicksal zu klagen. Dem erzähle ich was, wenn er wieder auftaucht!
Letzte Nacht gesellte sich zu meiner mittlerweile rotglühenden Wut eine leichte Sorge. Aus Den mach ich fertig! wurde nach und nach Dem wird doch nichts passiert sein?. Um einen klaren Kopf zu behalten, musste ich die Minibar plündern, die leider nicht allzu viel hergab. Auf der Suche nach Alkohol verließ ich noch einmal das Zimmer.
Im Restaurant warteten nur ein paar mürrische Kellner auf ihren Feierabend und deckten schon die Tische fürs Frühstück ein, in einer Ecke klimperte der befrackte Klavierspieler vor sich hin.
Er heißt Wladimir und ist wirklich sehr nett. Erst hat er mich zu Wodka, Speck und Brot eingeladen, dann haben wir Brüderschaft getrunken, das nehme ich zumindest an, er versteht weder Deutsch noch Englisch und ich immer noch kein Russisch. Dann habe ich ihm die ganze leidvolle Geschichte meiner Ehe erzählt. Und dann waren wir stockbesoffen.
2.
Nachdem ich meinen Kater erfolgreich mit einer Kopfschmerztablette bekämpft und meine Gedanken sortiert habe, beschließe ich, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun. Nicht kopflos werden, Matthes!, ermahne ich mich, systematisch vorgehen! So schnell geht kein Mann verloren. Ich glaube zwar nicht ernsthaft, dass dem Hallodri etwas zugestoßen ist, aber falls ich mich irren sollte, möchte ich mir später nicht anhören, dass ich nichts unternommen hätte.
Zuerst erkundige ich mich an der Rezeption des Dnipro, ob irgendjemand etwas über den Verbleib meines Gatten wisse. Nach den bisherigen Erfahrungen in diesem Etablissement rechne ich nicht ernsthaft mit Unterstützung und werde nicht enttäuscht. Die Reaktion der Empfangsdame ist eine Art beflissene Ignoranz. Bedauerndes Lächeln, beruhigende Gesten und die entschiedene Beteuerung, dass der sich schon wieder einfände.
Also verlange ich nach der Adresse des nächstgelegenen Polizeireviers. Offenkundig ein unerhörtes Anliegen, denn die Dame schüttelt wie wild den Kopf und sagt sehr energisch: »No police, no police!« Mit der Kiewer Exekutive will sie nichts zu tun haben. Verstehen kann ich sie, ich eigentlich auch nicht.
Mit der Faszination des Grauens lauschte ich vor dem Beginn unserer Reise Deduschkas Geschichten über ukrainische Beamte, die eine Form der modernen Wegelagerei betrieben. An jeder Ecke ständen sie und knöpften unschuldigen Bürgern Geld ab, Diskussion zwecklos, der Staatsmacht habe man sich zu fügen, sonst lande man schneller im Arrest, als man Chodorkowski sagen könne. Ich glaube zwar, dass Großvater Alexej übertreibt, sicher bin ich mir jedoch nicht.
Aber es nützt nichts, Artjom ist verschwunden, ich bin mutterseelenallein in einer Fünf-Millionen-Stadt, in der ich mich nicht auskenne. Meine Kenntnisse der Landessprache tendieren gegen null – die üblichen Begrüßungs- und Höflichkeitsfloskeln beherrsche ich, aber wenn ich mich verirrte, könnte ich nicht nach dem Weg fragen, nicht auf Russisch, geschweige denn auf Ukrainisch. Also brauche ich Hilfe.
Als gute Deutsche im Allgemeinen und als Anwältin im Besonderen habe ich unbedingtes Vertrauen in die Staatsmacht und rede mir die nächsten fünf Minuten ein, dass trotz Deduschkas Schilderungen auch in der Ukraine in Notfällen Verlass auf die Behörden ist. Immerhin bin ich mitten in Europa und nicht im Kongo. Deshalb lasse ich die empörte Rezeptionistin stehen, schnappe mir im Zimmer Jacke und Handtasche und marschiere zur Straße vorm Hotel. Dort stand nämlich in den letzten beiden Tagen immer ein Polizeiwagen mit einem Beamten, der den Verkehr kontrollierte.
Und er ist auch heute da, zumindest der Wagen, der Polizist ist nicht zu sehen. Ich stelle mich einfach neben das Fahrzeug und warte. Der wird schon wieder auftauchen, sage ich mir, vielleicht macht er nur eine kleine Pipipause.
Ich warte und warte.
Kein Polizist.
Endlich entdecke ich ihn, er steht auf der anderen Straßenseite, halb im Gebüsch und betrachtet eine Kastanie. Ich rudere mit den Armen und brülle: »Huhu!«
Keine Reaktion, wahrscheinlich hört er mich nicht.
Unter Einsatz meines Lebens laufe ich über die Straße, sie ist mindestens vierspurig, genau kann man das nicht sagen, denn es gibt keine Fahrbahnmarkierungen, keinen Fußgängerüberweg, keine Ampeln. Autos schießen hupend kreuz und quer an mir vorbei. Mit einem riesigen Satz lande ich neben dem Beamten und keuche: »Dobryj den!«
Der Mann legt einen Finger an seine Lippen, macht: »Schscht«, und deutet in den Baum. Dort sitzt eine Amsel und verspeist einen Regenwurm. Der Naturfreund gibt sich wieder seinen ornithologischen Betrachtungen hin und ignoriert mich. Ich räuspere mich vorsichtig. Ohne seinen Blick von der Kastanie zu wenden, entfernt sich der Polizist ein paar Schritte von mir. Ich rücke auf und tippe zaghaft auf seine Schulter. Er knurrt etwas und dreht mir seinen Rücken zu.
Es reicht mir. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Und ich brauche die örtliche Obrigkeit. Jetzt. Deshalb schreite ich zum Äußersten und klatsche laut in die Hände. Die Amsel fliegt weg. So, mein Freund, denke ich, nun kannst du dich ja um mich kümmern.
Das macht er auch. Ein Schwall ukrainischer Worte ergießt sich über mich, ich gehe davon aus, dass es keine Komplimente sind.
»Iswiniti«, unterbreche ich ihn wagemutig, »sprechen Sie vielleicht Deutsch?«
Der Redeschwall verstummt abrupt. »Schto?«, fragt er und schaut mich aus großen Augen an.
Also kein Deutsch. »Do you speak English?«, nehme ich einen neuen Anlauf. Noch größere Augen und vehementes Kopfschütteln. Also Englisch. »I need your help«, insistiere ich und stelle mich sehr dicht neben ihn, damit klarwird, dass ich nicht vorhabe, ihn wegen unzureichender Sprachkenntnisse aus seiner Pflicht zu entlassen. Sein Kopf wackelt weiter. »Polizia«, sage ich und: »Help, SOS!« Das ist meines Wissens ein gängiges internationales Notrufsignal, das kann ihn nicht kaltlassen. Dazu versuche ich, möglichst bittend, hilfebedürftig und unterwürfig zu gucken.
Es wirkt. Er spricht etwas in sein Funkgerät, es knarzt, es knackt, es spuckt die Antwort aus. Nun bedeutet mir der Polizist, ihm zu folgen, und geleitet mich durch die hupenden Autos zu seinem Fahrzeug. Ich darf auf der Rückbank Platz nehmen, und los geht die wilde Fahrt. Zufrieden registriere ich, dass er sogar seine Sirene anschmeißt. Endlich versteht er die Dringlichkeit meines Falls.
Wir rasen durch die Stadt, nach einer Minute habe ich komplett die Orientierung verloren.
»Kiew is a beautiful city«, starte ich die Konversation. Der Polizist beäugt mich misstrauisch im Rückspiegel und antwortet nicht. Also schweige auch ich. Zehn Minuten später hält er vor einem sehr imposanten, sehr wichtig aussehenden Gebäude, geleitet mich hinein und führt mich in einen schmucklosen Raum, in dem lediglich ein nackter Tisch, ein Rollcontainer und vier Stühle stehen.
»Wait!«, sagt er noch, dann verlässt er mich grußlos.
Nervös rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her und schaue mit wachsendem Unbehagen durch das vergitterte Fenster. Zehn Minuten später kracht die Tür auf, und herein rollt ein kleiner, dicker Mann in einer beigen Uniform. Er watschelt zu dem Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtischs, schaut mich streng an und schnarrt: »Passporrrt!«
Schnell reiche ich ihm meinen Reisepass. Nachdem er sich davon überzeugt hat, dass ich bin, wer ich bin, wird sein Gesichtsausdruck etwas freundlicher. »Frrau Matthes, was ist sich Ihr Problämm?«
Er spricht Deutsch! Ich strahle ihn an und antworte artig: »Mein Mann ist verschwunden, seit vorgestern Nacht. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
»Ah, Mann verschwundän. Hatten Sie Strrait?«
»Nein, hatten wir nicht.«
»Und warrrum verschwundän?«
»Das weiß ich nicht. Deswegen bin ich ja hier, ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert sein könnte.«
»Kain Strrait?«
»Nein, kein Streit.« Jedenfalls nicht mehr als sonst, denke ich und füge hinzu: »Artjom wollte nur kurz telefonieren, und seitdem ist er weg.«
»Wärr ist Artjom?«
»Mein Mann, wer sonst?«
»Haißt Artjom?«
»Ja, Artjom Polyakow.«
»Oh, russkij?«
»Ja, mein Mann hat die russische Staatsangehörigkeit.«
»Ah.« Schweigen. Der Dicke kratzt sich am Kopf und wirft erneut einen Blick in meinen Pass. »Aber läben in Germanija?«
»Genau, wir leben in Hamburg.«
»Hmm.« Schweigen. Kratzen. »War Mann betrrunkänn?«
»Nein, war er nicht. Mein Mann trinkt nicht.« Jedenfalls nicht übermäßig viel, denke ich.
»Kain Strrait, kein betrrunkänn. Hmm. Was Sie machen in Kiew?«
»Wir machen Urlaub.« Dass wir auch hier sind, um Deduschkas Datscha zu verkaufen, verschweige ich an dieser Stelle besser. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass dieser Umstand den Vorgang nur unnötig komplizieren würde.
»Urrrlaub, hmm. Kain Bissness?«
»Nein, kein Bissness.«
»Hmm.« Der Dicke schnauft und denkt angestrengt nach. »Bin ich sichärrr, Mann kommt wiedärr.«
»Ihr Optimismus in Ehren, aber wie können Sie da so sicher sein?«
»Ist sich russkij Mann. Verrschwindät. Und kommt wiedärr. Norrmal. Kaine Sorrge.«
»Hören Sie, mein Mann verschwindet nicht einfach. Und natürlich mache ich mir Sorgen. Deswegen möchte ich eine Vermisstenanzeige aufgeben, und ich will, dass Sie ihn suchen. Ich bestehe darauf!«
Der Dicke schnauft wieder, etwas empört diesmal. »Na gutt, mussen Sie Forrmularr ausfullen.« Er greift in eine Containerschublade und schiebt mir drei Din-A4-Blätter zu. Ich werfe einen Blick darauf, schiebe sie zurück und hüstele verlegen. »Gibt es dieses Formular auch auf Deutsch? Oder auf Englisch?«
»Bittä?«
»Ich, äh, kann leider kein Russisch.«
»Sie chaben russkij Mann und können kain Sprrach?«
»Nein, kann ich nicht. Mein Mann spricht fließend Deutsch, und wir leben, wie gesagt, in Hamburg. Da brauche ich nicht so oft Russisch. Ich würde es gern lernen, aber mir fehlt die Zeit dafür, ich bin beruflich und familiär sehr eingespannt.« Ich seufze, er seufzt. Wir legen eine kleine Schweigeminute ein, eingedenk meines schweren Schicksals. »Aber Ihr Deutsch ist wirklich fantastisch«, nehme ich den Faden wieder auf. »Haben Sie das in der Schule gelernt?«
»Militärr. Hunderrtfunftä Jagdbombenfliegärrdivision Grroßenhain.«
»Bitte was?«
»Warr ich stationierrt in Dä-Dä-Ärr, lange Zait.«
»Ach, daher. Sind Sie denn so nett und helfen mir beim Ausfüllen?«
Er ist so nett. Nach einer halben Stunde haben wir die Formalitäten erledigt, ich muss jedes einzelne Blatt signieren, beidseitig. Als Anwältin ist es mir ein wenig unheimlich, meine verbindliche Unterschrift unter etwas zu setzen, das ich nicht verstehe.
»Na, habe ich jetzt eine Waschmaschine gekauft?«, bemühe ich den alten Scherz.
»Waschmaschine? Brrauchen Sie Waschmaschine? Chabe ich guttä Kontakt, Nachbärr von maine Onkäl chat Waschmaschine!«
»Nein, nein, ich brauche keine Waschmaschine«, versichere ich hastig, »aber brauchen Sie nicht ein Foto von Artjom?«
»Foto? Warrum?«
»Na, für Ihre Suche.«
»Nain, nain, gäht ohne.«
Warum nur glaube ich, dass dieser Kerl alles vorhat, aber bestimmt nicht, nach meinem Mann zu suchen?
»Kann ich Sie telefonisch erreichen?«
»Warrum?«
»Um mich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen.«
»Mann kommt wiedärr, kaine Sorrge.«
»Trotzdem hätte ich gern Ihre Telefonnummer.«
Er seufzt erneut, holt einen Zettel aus dem Container und kritzelt etwas darauf. Dann steht er auf, schüttelt meine Hand und will sich von mir verabschieden: »Dasswidanja, Frrau Matthes.«
»Äh, eins noch …«
»Wasss?« Langsam verliert er die Geduld mit mir.
»Wie komme ich denn zum Hotel zurück? Könnten Sie mir ein Taxi rufen?«
»Ah, kain Prroblämm, Kollägä warrtet.«
Und tatsächlich, draußen vor der Tür steht noch immer der Beamte, der mich hergebracht hat. Jetzt bringt er mich zurück. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser Ausflug völlig umsonst war.
3.
Zurück im Dnipro, marschiere ich erst einmal zum Empfang, um zu hören, ob mittlerweile eine Nachricht meines Mannes eingetroffen ist. Die Rezeptionistin rollt genervt mit den Augen, nein, keine Nachricht. Ich atme tief durch, nicke ihr möglichst arrogant zu und wanke auf mein Zimmer.
Mein Kopf rotiert. Wo ist Artjom? Ich starre an die Decke und versuche, meine Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Vater! Ich werde Vater anrufen, der weiß immer, was zu tun ist. Sagt er jedenfalls. Bisher habe ich davon abgesehen, Artjoms Verschwinden in der Heimat zu melden. Zum einen bin ich bis zur letzten Nacht davon ausgegangen, dass er in der nächsten Sekunde wieder auftaucht, zum anderen wollte ich mir dämliche Fragen ersparen. Doch nun denke ich langsam, dass ich etwas Unterstützung gebrauchen könnte. Wozu hat man schließlich eine Familie?
Mit feuchten Fingern wähle ich die Nummer meiner Eltern. Nach dreimaligem Tuten geht Mutter ran und freut sich außerordentlich, meine Stimme zu hören.
»Paula, wie schön, dass du dich mal meldest! Wie geht’s euch? Wie ist das Wetter?«
»Super, Mama, alles super. Sag mal, ist Papa da?«
»Wieso?«
»Weil ich mit ihm sprechen möchte.«
»Wieso? Ist irgendwas?«
»Nein, Mama. Alles prima. Ich möchte nur mal kurz mit Papa plaudern.«
Natürlich ist sie misstrauisch. Ich rufe nie an, um einfach mit Vater zu plaudern. Unser Verhältnis ist eher ambivalent. Vater, Richter a.D. vom Hamburger Oberlandesgericht, findet, dass seine Tochter, Anwältin der kleinen Leute und einer überwiegend osteuropäischen Klientel, zu wenig aus ihrem Leben macht. Meine Heirat mit Artjom hielt er für eine Schnapsidee. Ein Russe! Wie kann man nur einen Russen heiraten? Alles Verbrecher!
Mittlerweile hat er seine Meinung ein wenig revidiert, mit dem angeheirateten Rest der Verwandtschaft versteht er sich sogar ausnehmend gut. Trotzdem findet unsere Kommunikation ausschließlich über Mutter als Botin statt. Aber da sie zur Hysterie neigt, habe ich beschlossen, erst mal nur ihm von Artjoms Verschwinden zu erzählen.
»Einen Moment, bitte«, näselt sie nun, »dein Vater ist mit Alexej im Garten und pflanzt Zypressen.«
»Zypressen? In Hamburg?«
»Ja, warum denn nicht?«
»Ist es nicht viel zu kalt bei uns?«
»Das sind sibirische Zypressen, sagt Alexej. Die können Frost ab.«
»Na, dann ist ja gut. Kannst du jetzt Papa holen?«
»Schon gut, schon gut, wenn du partout keine Zeit hast.« Beleidigt legt sie den Hörer beiseite. Sie könnte ihn auch mitnehmen in den Garten, schließlich funktioniert der Apparat schnurlos. Aber Mutter misstraut der Technik. Telefoniert wird da, wo das Kabel in die Wand geht, Punkt.
Es dauert eine Ewigkeit, bis Vater sich zum Telefon bequemt. »Paula, was gibt es denn?« Er klingt ein wenig ungehalten, so als hätte ich ihn bei etwas Wichtigem gestört.
»Papa, Artjom ist weg.«
»Weg? Wie weg?«
»Na, weg eben. Verschwunden. Seit vorgestern Nacht.«
»Habt ihr euch mal wieder gestritten?«
»Nein, haben wir nicht.«
»Wenn du dich ständig mit deinem Mann streitest, musst du dich nicht wundern, dass er irgendwann die Flucht ergreift.«
»Wir haben uns nicht gestritten! Es war alles in allerbester Ordnung. Papa, hier stimmt was nicht.«
Schweigen und angestrengtes Nachdenken am nordwestlichen Ende der Leitung. Dann sagt Vater: »Also wenn er bis heute Abend nicht auftaucht, solltest du zur Polizei gehen.«
»Da komme ich gerade her. Ich habe versucht, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Aber die haben mich mehr oder weniger abgewimmelt und nehmen die Sache nicht so richtig ernst.«
Vater geht es offenbar ähnlich, denn er lacht kurz und dröhnt: »Na ja, was soll dem auch schon passiert sein? Wahrscheinlich ist er irgendwo versackt.«
»Papa!«
»Jaja, schon gut. Weißt du was? Geh doch zur Deutschen Botschaft. Die wissen mit Sicherheit, was in so einem Fall zu tun ist.«
»Okay, Papa. Das mach ich. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aber erzähl Mama nichts. Und Darya auch nicht! Die rastet sonst völlig aus. Wahrscheinlich taucht Artjom gleich auf und …«
»Natürlich taucht der wieder auf. Ein Russe geht so leicht nicht verloren.« Und mit diesen Worten legt Vater einfach auf, die Zypressen warten.
Die Botschaft! Dass ich nicht von allein darauf gekommen bin, wird meinen Erzeuger weiter in der Annahme bestätigen, dass sein einziges Kind zur Lebensuntüchtigkeit neigt. Soll er ruhig, seine Idee ist so genial wie simpel, dass ich ihm gerade nichts übelnehme. Die Botschaft muss mir helfen, ich bin eine Deutsche in Not! Doch zuerst sollte die Deutsche in Not unter die Dusche gehen, um die letzten Wodkaausdünstungen abzuspülen.
Das Bad des Hotelzimmers ist eng und scheußlich grün und hat seine besten Zeiten vor vierzig Jahren hinter sich gelassen. Immerhin ist das stark gechlorte Wasser heute heiß und reichlich vorhanden. Ich werte das als gutes Zeichen. Aus meinem Koffer fische ich eine nicht allzu zerknitterte weiße Bluse und einen dunkelblauen Bleistiftrock. Damit wirke ich seriös und fühle mich auch sofort so.
Unten in der Lobby okkupiere ich den Computer, der Gästen zur Verfügung steht, da ich nicht wirklich an einem erneuten Treffen mit meiner Empfangsdame interessiert bin. Im Nu habe ich die Adresse der Botschaft herausgefunden und nehme eine der Taxen, die draußen bereitstehen. Der Wagen bringt mich in die Altstadt. Inmitten der schönen, historischen Gemäuer steht wie ein Fremdkörper ein grauer, moderner Quader. Da will ich hin.
Entschlossen betrete ich das Gebäude und stehe in einem Atrium. In der Mitte des überdachten und verglasten Innenhofs wächst sogar ein Baum.
Die haben sichs hier aber schick gemacht, denke ich noch, da eilt auch schon ein Wachmann auf mich zu und herrscht mich an. Als er merkt, dass ich Deutsche bin, wechselt er von grob auf galant und führt mich in einen kleinen Besucherraum.
Kurz darauf steckt ein älterer Herr in kariertem Pullunder und Cordhose fragend seinen Kopf zur Tür herein.
»Guten Tag, Frau, äh … Haben Sie einen Termin?«
»Matthes. Paula Matthes. Aus Hamburg. Ich habe keinen Termin, aber mein Mann ist verschwunden.«
»Oh! Seit wann denn?« Interessiert schlüpft er ins Zimmer und setzt sich neben mich.
»Seit vorgestern Nacht. Ich war auch schon bei der Polizei, bin dort aber nicht so richtig weitergekommen.«
Er kichert leise. »Nun ja, die hiesigen Behörden funktionieren etwas anders als bei uns. Wo genau ist Ihr Mann denn verschwunden? Vielleicht hat er sich verlaufen.«
»Nein, hat er nicht.« Unwillig schüttle ich den Kopf. Wer verläuft sich denn schon zwei Tage lang? »Er ist aus dem Hotel verschwunden.«
»Aus dem Hotel?« Der Herr scheint ehrlich erschrocken. »Sie meinen, er ist entführt worden?«
Entführt? O Gott, an diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht. Mir wird schwarz vor Augen, und ich stöhne unwillkürlich auf.
»Na, na«, der Botschaftsangehörige nimmt mitfühlend meine Hand, »wir wollen nicht gleich das Schlimmste annehmen. Wahrscheinlich gibt es eine ganz harmlose Erklärung. Jetzt sind Sie ja hier, und gemeinsam werden wir den Herrn Matthes schon finden.«
»Polyakow«, verbessere ich ihn.
»Bitte?«
»Mein Mann heißt Polyakow. Artjom Polyakow.«
»Ihr Mann ist Ukrainer?«
»Nein, Russe.«
»Ach sooo«, er dehnt den Vokal übertrieben lange. »Ein Russe. Nun ja, das fällt allerdings nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Wir kümmern uns ausschließlich um die Belange deutscher Staatsangehöriger.«
»Prima. Ich bin Deutsche, und für mich ist das Verschwinden meines Mannes von erheblichem Belang.«
»Das verstehe ich natürlich, Frau Matthes«, er drückt meine Hand noch ein wenig fester. »Im Rahmen meiner Möglichkeiten helfe ich Ihnen natürlich. Was führt Sie denn eigentlich nach Kiew?«
»Urlaub.«
»Wirklich? Sie sind nicht geschäftlich hier?«
»Nein!«
»Entschuldigen Sie, aber die meisten Russen, die sich in Kiew aufhalten, verfolgen eher berufliche, äh, Projekte.«
»Wir nicht. Wir machen Urlaub. Erst Sightseeing in der Hauptstadt, dann Baden auf der Krim. Ach ja, und nebenbei wollen wir noch Alexejs Gartenhäuschen loswerden, weil er ja Frau Hinrichs geheiratet hat und in Deutschland bleibt.«
»Äh, wer sind jetzt Alexej und Frau Hinrichs?«
»Deduschka, also der Großvater meines Mannes, und meine Nachbarin.«
»Und die sind auch in Kiew?«
»Nahein, die sind natürlich zu Hause. Sonst müssten wir uns ja nicht um die Datscha kümmern.«
»Ach so. Nun gut, Sie wollen also eine Immobilie verkaufen. Dann sind Sie doch geschäftlich in Kiew.«
Bemüht ruhig erwidere ich: »Wenn Sie so wollen. Aber hauptsächlich machen wir hier Urlaub.«
»Nun gut, belassen wir es vorerst dabei. Haben Sie sich denn mit Ihrem Mann gestritten?«
»Nein, wir haben uns nicht gestritten.«
»Es kann also nicht sein, dass Ihr Mann Sie, äh, verlassen hat?«
»Nein! Warum sollte er?«
»Nun ja«, er hüstelt, »das kommt in den besten Ehen vor.«
»Bei uns aber nicht. Wir sind gerade nach Kiew gekommen, um endlich mal wieder Zeit füreinander zu haben und uns auszusprechen.«
»Aha! In Hamburg hatten Sie also Eheprobleme.«
Dir hau ich gleich ein paar rein!, denke ich und funkle ihn an. Als ahnte er meine Gedanken, rückt er etwas von mir ab und lässt auch endlich meine Hand los.
»Frau Matthes, entschuldigen Sie, dass ich so insistiere. Aber ich versuche nur, das Problem einzugrenzen und herauszufinden, warum Ihr Mann Sie verlassen hat.«
Es reicht. »Artjom hat mich nicht verlassen!«, brülle ich und springe auf. »Da stimmt was nicht! Er würde mich nicht einfach in einer fremden Stadt allein lassen.«
»Okay, okay.« Auch er ist vorsichtshalber aufgestanden, »Frau Matthes, beruhigen Sie sich doch bitte. Wissen Sie was? Ich bitte einen unserer ukrainischen Mitarbeiter, die Krankenhäuser abzutelefonieren. Vielleicht ist Ihr Mann in der Nacht noch etwas trinken gegangen und nur von einem Auto angefahren worden.«
Nur von einem Auto angefahren worden? Nur? Der hat sie doch nicht mehr alle, denke ich, finde aber, dass das der erste vernünftige Vorschlag ist. Er verspricht, sich bei mir zu melden. Ich gebe ihm meine Handynummer und erwähne, dass ich im Hotel Dnipro wohne.
»Ach, das Dnipro«, sagt er versonnen, »das war zu Sowjetzeiten ein doller Schuppen. Ist ziemlich runtergewirtschaftet und völlig überteuert, wenn Sie mich fragen.«
Darin zumindest stimmen wir völlig überein.
Als ich aus der Botschaft taumle, wird mir schwindlig. Ich schaue auf die Uhr, schon später Nachmittag, und ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Appetit verspüre ich keinen, lasse mich aber vom Taxi direkt am Kreschtschatik absetzen und betrete eines der zahlreichen Restaurants. Ich muss etwas essen, sonst lande ich im Krankenhaus.
Wahllos bestelle ich mir irgendwelche Gerichte von der Karte. Als die dampfenden Speisen vor mir stehen, merke ich, dass ich richtig ausgehungert bin. Abwechselnd schaufele ich mir frittierten Tintenfisch, Schaschlik, Pilze in Sahnesoße und gebackene Kartoffeln zwischen die Zähne. Kauen, schlucken, kauen, schlucken. Wahrscheinlich ist das Essen sehr gut, ich schmecke fast nichts, es ist, als würden unterschwellige Sorgen und Wut alle anderen Empfindungen blockieren. Trotzdem geht es mir nach der Mahlzeit bedeutend besser, zumindest körperlich.
Die plötzliche Energiezufuhr versorgt auch mein Gehirn mit den nötigen Nährstoffen, meine Gedanken flitzen erneut hin und her.
Was soll ich jetzt nur machen?
Was kann ich überhaupt machen?
Soll ich zur Datscha fahren? Schließlich ist Artjom verschwunden, als er mit einem möglichen Käufer telefonierte. Und vielleicht wollte der die Laube sofort sehen.
Mitten in der Nacht, im Stockdunkeln? Das macht keinen Sinn. Oder doch?
Vielleicht liegt Artjom dort mit eingeschlagenem Schädel? Matthes, reiß dich zusammen, was für ein Quatsch!
Ich bin ein analytischer Mensch und gehe Probleme planvoll an. Und normalerweise neige ich auch nicht zu emotionalen Überreaktionen. Doch meine momentane Lage ist so absurd, so unfassbar, dass ich kurz vorm Hyperventilieren bin. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die Datscha ist. Ich weiß nur, dass sie am Rand von Kiew in einem kleinen Waldstück liegt, zusammen mit Hunderten anderer Datschen. Die Adresse hat natürlich Artjom. Im Kopf, nicht aufgeschrieben. Mein Mann bildet sich viel ein auf sein gutes Gedächtnis.
Der Kellner, der meine Kurzatmigkeit als akute Verdauungsschwierigkeiten deutet, serviert unaufgefordert einen Wodka. Ich kippe den Klaren in einem Zug hinunter, und ein Ideenblitz erhellt meinen Kopf. Mensch, Matthes, du Volltrottel, denke ich, warum hast du eigentlich nicht schon längst Mischa angerufen? Es ist zwar unwahrscheinlich, dass er die Adresse hat, aber er ist Artjoms bester Freund, und er ist Russe. Wenn einer weiß, was hier los ist und wo mein Mann stecken könnte, dann Mischa.