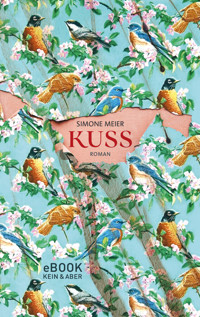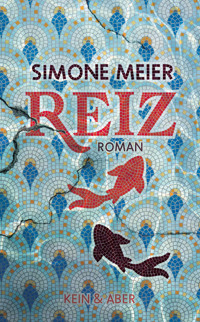
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Valerie hat ganz gut gelebt, und so langsam schaut sie den Wirren der Liebe gelassen entgegen. Ganz anders ihr jugendliches Spiegelbild Luca: Er hat noch alles vor sich, was sie schon hinter sich hat. Die Frage, wie Liebe und Sex ein Leben prägen, bringt die beiden in einem besonders dramatischen Moment zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Simone Meier, geboren 1970, ist Autorin und Journalistin. Nach einem Studium der Germanistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte arbeitet sie zunächst als Kulturredakteurin, erst bei der WochenZeitung, dann beim Tages-Anzeiger, seit 2014 bei watson. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Bei Kein & Aber erschienen ihre Romane Fleisch und Kuss. Zudem ist sie Mitherausgeberin von Hemingways sexy Beine, dem Buch zu #dichterdran, was in Windeseile um die Welt ging. Simone Meier lebt und schreibt in Zürich.
ÜBER DAS BUCH
Valerie ist Mitte fünfzig, Luca noch nicht zwanzig. Sie ist zunehmend gelangweilt von den Wiederholungen und Anstrengungen der Liebe, für ihn gibt es nur erste Male. Sie will von allem weniger, er will alles. Die lebenserfahrene Zynikerin trifft auf den fiebrigen Idealisten und für beide stellt sich die Frage, wie Liebe und Sex das Leben prägen.
natürlich für dj
1
früher
Dallas war nicht Dallas. Valerie entdeckte keine Ranch, keine Öltürme, nicht einmal Wolkenkratzer. Jedenfalls nicht hier, nicht vom Flughafen aus gesehen, der war wie jeder andere, aus Glas, aus Beton. Beim Anflug hatte sie sich den Airport aufregend vorgestellt, mit alerten Entscheidungsträgern auf dem Weg zu Millionengeschäften, stattdessen traf sie auf Menschen, die zu gebrechlich, dick oder müde waren und sich auf Karren durch die Gänge fahren ließen. Doch sie war das gewohnt: Dass sie eine genaue Idee hatte von der Welt und dass die Welt nicht daran dachte, sich danach zu richten.
Dallas zum Beispiel war für sie weit mehr als ein Transitbereich auf einem Flug zu einem alten Freund. Dallas war ein magisches Wort, das für sie auf ewig mit der Fernsehserie verschmolz, die sie in ihrer Jugend nie hatte sehen dürfen. All ihr Wissen darüber hatte sie damals aus den Schnipseln der Programmzeitschrift gesogen, es ging, so viel hatte sie begriffen, um Körper und Konzerne im Zeichen der Gier. Dallas lief immer dienstags. Und mittwochs redeten auf dem Schulhof alle darüber, nur sie nicht. Die Schmach der Ahnungslosigkeit saß tief, und sie schwor sich, in einer nicht mehr fernen Zukunft, wenn sie unabhängig und erwachsen wäre, so viele Dinge wie möglich als Erste zu wissen. Vor allen anderen. Sie wusste bloß noch nicht, wie.
»Ich finde, du gleichst Sue Ellen!«, hatte eine aus ihrer Klasse gesagt. Sue Ellen also. Die Gattin des Serien-Bösewichts. Verlebt, verbittert. Ständig betrunken. Valerie hielt die ausgerissene Seite der Programmzeitschrift mit Sue Ellen neben ihren Spiegel und suchte nach Ähnlichkeiten. Es mussten die Augen sein: zwei gefräßige Löcher. Und die Haare: gestuft und nach außen geföhnt.
Wenig später ließ sie sich eine Dauerwelle legen und glich einem explodierten Schaf. Die Prozedur dauerte mehrere Stunden, und sie blätterte sich unter der heißen Trockenhaube durch all die Magazine, die in ihrer ganzen Verwandtschaft nur eine einzige Tante zur Hand nahm. Die Tante las auch Bücher, in denen alles, besonders das Fleischliche, handfest benannt wurde, und wenn Valerie krank war, brachte sie ihr einen Stapel vorbei, und das war noch besser als die Cola, die sie literweise gegen Darmgrippe trinken durfte. Die Friseurinnen-Magazine hießen irgendwas mit Frau und Herz und Glück und waren wie die Bravo, bloß für Erwachsene, aber auch die Bravo durfte sie nicht nach Hause mitbringen. Keine ihrer Freundinnen durfte das. Gemeinsam verschlangen sie in der feuchten Heimlichkeit der Turnhallengarderobe Berichte über Nena oder Nino de Angelo und beugten sich über Starschnitte. Strichen sich stinkende Creme auf die Beine und lasen einander beim Warten auf seidenglatt enthaarte Haut die Doktor-Sommer-Kolumnen und den Fortsetzungsroman Die Rauschgift-Falle vor: Ein Boy namens Jochen und ein Girl namens Vanessa waren in die Fänge düsterer Dealer geraten und wenn Jochen sich nicht als Drogenkurier betätigte, würden sie Vanessas Gesicht mit Säure entstellen. Hatten Jochen, Vanessa und die Liebe eine Chance? Valerie dachte sich, dass es ein schlüpfriger Spaß sein müsse, so etwas zu schreiben. Sie träumte von einem Jungen, der aussah wie Jochen, in Mathe saßen sie nebeneinander, er wusste, dass sie auf ihn stand, und hatte ihr einen Zettel zugesteckt: »Vergiss es, ich geh nicht mit dir. Deine Haare sehen aus, als hättest du in die Steckdose gegriffen.« Die Dauerwelle blieb eine kurze Phase.
Als Nena ihre 99 Luftballons steigen ließ, war Valerie sechzehn, und die Tage zwischen Schule, Pizzeria und dem Irish Pub beim Bahnhof wurden ihr lang. Sie schluckte ein Abführmittel gegen ein paar in der Pizzeria angefutterte Pfunde, schlich sich nachts von Darmkrämpfen geplagt am Schlafzimmer der Eltern vorbei aufs Klo, nahm dennoch nicht ab. Beschloss, sich so zu akzeptieren, wie sie war, schließlich riet auch die Bravo dazu: In jedem Girl steckt ein Schwan! Es fiel ihr schwerer als gedacht, war jedoch ein Fortschritt im Vergleich zu den Krämpfen. Der amerikanische Präsident jener Jahre hieß Reagan und hatte eine beachtliche Karriere als Filmstar hinter sich. Manchmal fuhr die ältere Schwester einer Freundin ein paar Mädchen zur nächstgelegenen Autobahnraststätte. Ein futuristischer Schlauch auf Stelzen, der über die Breite der Autobahn gebaut war. Dort gab es einen McDonald’s. Valerie schaute auf die Autos runter, aß Burger und Apfeltaschen, betrachtete ihr Gesicht in der Fensterscheibe und fand sich das fadeste Mädchen weit und breit.
Als Madonna Like a Virgin sang, war Valerie noch Jungfrau und beschloss, ihrer eigenen Farblosigkeit ein Ende zu setzen. Sie verbrachte jetzt viel Zeit in der Stadt. Lernte ein paar Punks kennen, die ein Haus besetzten. Schaute zu, störte niemanden, war einfach da. Stellte sich an den Herd, wenn sich die Hausbesetzer mal wieder kollektiv nicht darüber einig werden konnten, wer denn nun die Fischstäbchen fürs Abendessen braten müsse. Holte Wundsalbe in der Apotheke, wenn sich einer im Suff eine Sicherheitsnadel durch die Lippe gebohrt hatte. Für die Stadt begann sie sich zu schminken. Umrandete die dunklen Augen mit schwarzem Kajal. Kaufte sich ihren ersten Lippenstift. Entschied sich für Brombeerrot. Staunte, wie viel Raum ihre Lippen jetzt in ihrem Gesicht einnahmen, obwohl dunkle Farben einen Mund doch optisch verkleinern sollten. Ihren nicht. Plötzlich war er vorhanden und dies so sehr, dass die Menschen meinten, sie würde mit ihnen reden, obwohl sie bloß zuhörte. Sie schauten ihr in die großen Augen und auf den großen Mund und nannten sie interessant und undurchschaubar. Valerie brauchte gar nichts zu tun, außer ihnen ihr Gesicht zuzuwenden, und schon verausgabten sich die anderen für sie und versuchten, sich selbst interessant zu machen. Ihr Haar trug sie jetzt lang und in wachsglänzenden Strähnen. Dass keiner sie schön nannte, störte sie nicht. Ihre Aufmerksamkeit wollten sie trotzdem. Wenn sie nach Hause ging, entfernte sie die Farbe aus ihrem Gesicht, verwandelte sich zurück in ein Mädchen, an dem nichts auffiel außer seinen Augen. Zu Hause nannte sie niemand interessant, und sie versprach sich, gleich nach dem Gymnasium in die Stadt zu ziehen und dort ihr eigentliches Leben zu führen.
Oft war sie bei ihrer Großmutter in einem kleinen Reihenhaus am Rande der Stadt, betrachtete Fotos von früher, aus der armseligen Kindheit und dem bescheidenen Frauenleben von einer, die sich nie beschwerte und der sich Valerie näher fühlte als jedem anderen Menschen. Blätterte mit ihr in einem Bildband über die Kennedys, von denen einer in Dallas erschossen worden war. Die Großmutter hatte die Bilder von Hand in den Band geklebt, sie hatte sie mit Marken erworben, die sie aus Waschmittel- und Schokoladenpackungen schnitt, das Buch war nicht nur ein Buch, sondern eine Errungenschaft, die Großmutter hatte Zeit und Liebe darauf verwendet. Valerie hätte ihr gerne ein paar der Erwachsenen-Bravos am Kiosk gekauft, aber die Großmutter sagte: »Hast du schon mal an denen gerochen? Mit denen stimmt was nicht! Wahrscheinlich Rauschgift. Ich glaube, die wollen die Leute süchtig machen!«
Rauschgift, dachte Valerie, was für ein großartiges Wort, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war voller Rauschgift, und Valeries Eltern fürchteten nichts so sehr wie eine mögliche Neigung ihres Kindes zu allerlei Opiaten. Doch das Kind verspürte seit dem Versuch mit dem Abführmittel keinerlei Neigung zu anderen Substanzen als zu Baileys, Rosé und Zigaretten. Zu ziemlich vielen Zigaretten. Aber nur in der Stadt und nicht, weil sie das besonders mochte, sondern weil sie ihre harmlose Stimme ruinieren wollte. In der Stadt fand sie eine beste Freundin, die nicht Claudia oder Nicole hieß, sondern Oona.
Als Madonna Papa Don’t Preach sang, war Valerie neunzehn und keine Jungfrau mehr, und eine schmale Strähne ihres Haars hatte sich über Nacht grau verfärbt.
Doch all das war lange her, die Mauer von Berlin und die Türme von New York waren inzwischen gefallen, der Kalte Krieg war endgültig vorbei, dafür hatte ein anderer gerade begonnen, der amerikanische Präsident hieß zum zweiten Mal Bush und Dallas war nicht wie im Fernsehen. Valerie war seit mehreren Jahren Journalistin. War auf dem Papier nicht zurückhaltend, sondern spitz, witzig und böse. Hatte tatsächlich einen winzigen Vorsprung auf das Wissen und damit das Leben der anderen, und dies erfüllte sie mit Zufriedenheit. Sie konnte andere bloßstellen, konnte sagen: »Ach, das weißt du noch gar nicht?«, oder: »Wie du morgen von mir wirst lesen können …« Dallas war an diesem zufälligen Tag zu Beginn des neuen Jahrtausends keine Serie mehr und schon gar kein Schulhofgespräch, Dallas war nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zu ihrem alten Freund. »Komm mich besuchen«, hatte er geschrieben, »so lange du willst, mein Haus ist klein, aber ein richtiges Haus, und sollten wir uns nicht vertragen, wohn ich bei meiner Liebsten, sie lebt auf einer Farm außerhalb der Stadt, für meinen Geschmack gibt es dort zu viele Tiere, ich finde ja, jedes Tier stinkt, nur das auf meinem Teller nicht. Einzig Streifenhörnchen sind auch lebendig entzückend.« »Komme«, hatte Valerie geantwortet, »passt ein Monat? Ein ganzer?«
Sie wäre dort eine Unbekannte auf einem anderen Kontinent, sie fragte sich, ob es ihr gelänge, neben ihrem Freund neue Leute kennenzulernen, ob überhaupt irgendwas an ihr interessant wäre, ihr Aussehen eher nicht und auch intellektuell fand sie sich für eine Universitätsstadt im mittleren Westen eher mittelmäßig. Sie musste dringend wieder mehr werden als nur ihre Arbeit. Vielleicht würde sie es schaffen. Nach Amerika wartete Rom, wartete Wien, jetzt war April, erst ab August wartete wieder der Job. Der Kaffee im Flughafen-Starbucks schmeckte wie zu Hause und kostete nicht einmal die Hälfte. Die Bechergröße Venti hatte sie noch nie gesehen.
Ihr Anschlussflug hatte Verspätung. »Ich reservier dir eine Limousine«, hatte ihr Freund geschrieben, »das ist lustig.« Genau, dachte sie, wie in Dallas, doch als sie endlich landete, war die Limousine längst weg. Eine Stunde wartete sie auf die nächste, der neue Flughafen war anders als die anderen, kleiner, nervöser, erschöpft ließ sie sich in den Wagen fallen, an der Decke bildeten winzige Lichter eine Milchstraße aus goldenen, rosa und bläulichen Punkten. Es erinnerte sie an den Discohimmel über einer deutschen Nacktbadelandschaft, Freunde hatten sie mitgenommen, Plastikpalmen ragten ins warme Wasser, es gab Römisches, Orientalisches und Fantastisches, sie hatte sich über die Begeisterung der Leute fürs Nacktsein gewundert, allgemein über die deutsche Neigung zur Freikörperkultur, die von den Deutschen auch mit Hingabe außerhalb von Deutschland ausgelebt wurde, nicht nur an der Ostsee, viel lieber noch auf Korsika oder Gomera, besonders auf Gomera, dessen Verhängnis ein schwarzer Strand war, von dem sich die weißen Leiber samt all ihren Ausstülpungen wie Engerlinge abhoben. Sie hatte also nackt auf sprudelnden Röhren gelegen, hatte die Paare neben sich studiert, die in aller Offenherzigkeit ihr Paarsein vollzogen, Brüste und Brühwürste, hatte sie denken müssen. Wozu machten sie das? Weil die Blicke der anderen ihre Erregung steigerten? Weil sie sich begehrt fühlten? Oder weil sie ihre nackten, in jedem Fall unvollkommenen Körper hier ungestraft allen aufdrängen durften? War es eine heimliche Sehnsucht nach dem biblischen Zustand der Unschuld? Ein kollektives Reinigungsritual, einer Taufe oder Beichte nicht unähnlich? Oder war das alles ironisch gemeint? Und wie reagierte eigentlich ihr eigener Körper auf die Blicke der anderen? Er reagierte nicht. Weder erregt noch gehemmt. Sie schwebte im warmen Wasser, verlor das Empfinden für die eigene Begrenztheit, stellte sich unsichtbar. Nahm sich zurück, war reine Beobachtung.
Der Berg an Interviews, Porträts, Kolumnen, Analysen und Essays, die Valeries Namen trugen, umfasste über tausend Stück, sie konnte sich nicht erinnern, die meisten davon überhaupt geschrieben zu haben, ungefähr seit Nummer achthundert fühlten sich alle an wie Kopfschüsse. Eines Abends war sie nach Hause gekommen, war noch im Flur zusammengesackt, hatte sich gegen die Wand fallen lassen und geweint. Bis sie leer war und zitterte. Danach hatte sie sich mit Whisky wieder aufgefüllt. War eine schwache Loser-Pussy mit einem Nervenzusammenbruch, dabei hatte sie sich für unendlich belastbar gehalten, im Job, im Leben, eine Stahlfeder, hatte genau das zelebriert, was die Chefs von ihr erwarteten, kannte die geheimen Schlupflöcher der Stadt, die illegalen Bars und Backstagebereiche, die besetzten Häuser, die Playboylofts, wo manche Party irgendwann im Schaumbad mit Panoramablick auf die Stadt endete, und über den Hügeln aus warmen weißen Flocken stieg die Sonne auf. Sie hatte sich aufs Rad gesetzt, war in die alte Arbeitersiedlung am Stadtrand gefahren, hatte bei ihrer Großmutter geklingelt und war ihr wortlos in die Arme gefallen. Die Wolljacke der alten Frau roch leicht nach Bratfett, ihr Haar nach Talg, ich hätte sie vorher anrufen müssen, dachte Valerie, dann hätte sie sich die Haare gewaschen, es wäre ihr gewiss lieber so, aber die Großmutter ließ sich nichts anmerken, setzte ihre Enkelin aufs Sofa, schob ihr eine Wärmeflasche in den Rücken und kochte Milchreis.
Am nächsten Tag war Valerie zum Chef gegangen, hatte ihm mitgeteilt, dass sie jetzt, mit sechsunddreißig, keine blutjunge Frau mehr sei und es für sich und die Zeitung begrüßen würde, wenn sich andere um den dreckigen Glanz der Nächte kümmern würden, und dass sie sich eine Auszeit wünsche. Danach würde sie ihrer Verpflichtung zu Provokation und Pointen wieder nachkommen, allerdings eher im Einsatzbereich vor Mitternacht. »Ist gut«, hatte der Chef geantwortet, »mach dich bloß nicht verzichtbar.«
Erst neulich war ihr der Brief wieder in die Hände gefallen, in dem sich zu Beginn ihrer Karriere ein Schauspieler beim Chefredakteur über sie beschwerte hatte.
Sehr verehrter Herr K, ich erlaube mir, Sie auf das unverfrorene Verhalten aufmerksam zu machen, das Ihre Mitarbeiterin Valerie T. mir und meinem Team gegenüber an den Tag gelegt hat. In ihren Worten war unsere Adaption von Camus’ Die Pest ungenießbar, ein ranziges Sahnebaiser, das vom hässlichsten aller Tiere, nennen wir es ruhig Nacktmull, wieder ausgeschissen wurde. Ich frage Sie: Verdient eine Frau, die sich auf den Seiten Ihrer Zeitung austobt wie ein durchgeknallter Teenager, tatsächlich die Bezeichnung ›Kritikerin‹? Hochachtungsvoll, Ihr F.
Der Schauspieler war nur einer von Dutzenden, mit denen sie sich in den letzten Jahren herumgeschlagen hatte, die sich an ihr abgearbeitet, sie kleinzumachen versucht hatten. Sie hatte allen getrotzt, sie war noch da. Und wünschte sich doch dringend jenen Zustand zurück, in dem ihre Arbeitswelt noch nicht existiert hatte, in dem das Nichts lauer, langer Tage wieder überhandnahm und sich die gewöhnlichsten Erfahrungen wieder so stark und so genau in ihrem Gedächtnis festkrallen würden wie einst der Geruch von Enthaarungscreme. Sie hoffte, in Amerika etwas davon wiederzufinden. Nichts Großes, einen winzigen, vibrierenden Fetzen Leben vielleicht. Etwas, das in ihr liegen blieb.
Das gemächliche Tempo der Limousine überraschte sie, Amerika hatte sie sich schneller vorgestellt, am Rande der Landstraße leuchteten Schilder, Support our troops, Pray for our soldiers, Fight for peace. Und dann hielt der Wagen zwischen eingeschossigen Holzhäusern mit Veranden und Bäumen davor, die kleine Milchstraße erlosch, dafür war da jetzt die große, darunter Rasenstück um Rasenstück, einige hinter weißen Zäunen. Ihr Freund kam aus der Tür, es war eine gute Idee gewesen, zu ihm zu fahren, sie würden sich verstehen wie früher. »Na endlich!«, sagte er.
Am nächsten Morgen kämpfte sich das Tageslicht trüb durch die Fliegengitter vor den Fenstern, draußen rannten braune Kaninchen über den Rasen, ein Transparent hing aus einem Nachbarfenster, Stop this war. Naive Narren, dachte sie. Es geschah immer öfter, dass sie ungeduldig wurde mit Leuten, die Slogans wie diesen äußerten. Denn aus Slogans wurden Schlagzeilen und diese waren bloß der Sekundenkleber, mit dem sich Aufmerksamkeit und Emotionen binden ließen.
Ihr Gastgeber war schon bei der Arbeit, sie packte ihre Schwimmsachen, er hatte ihr geraten, in die Schwimmhalle auf dem Campus zu gehen, sie sei groß und angenehm prosaisch, hatte er gesagt, es würden dort vor allem Wettkämpfe durchgeführt. Am Eingang wurde sie von Studentinnen mit langen Haaren überholt, sie konnten nicht älter als einundzwanzig sein, sie ließ sich an der Kasse das Schloss für die Garderobenschränke erklären, dann stand sie da, inmitten der prallen, klarhäutigen Einundzwanzigjährigen, zog sich aus, musterte sich im Spiegel: definitiv europäisch, schon lang nicht mehr einundzwanzig, aber aufs Gefüge eines ganzen Lebens betrachtet wohl immer noch jung.
»Do you mind if I share this line with you?«, fragte sie ein Student.
»Not at all«, sagte sie, lächelte ihm zu und fragte sich sofort, ob er dies jetzt als Anmache deuten könnte, doch da hatte er bereits seine Schwimmbrille und seine Nasenklemme aufgesetzt und preschte an ihr vorbei. Sie zog weiter, das Becken war gut 70 Meter lang, sie wurde schneller, bis in ihrem Kopf die Endorphine knallten, kraulte bis zur Erschöpfung, schwamm noch eine Bahn in Ruhe und ging. Über den Campus, vorbei an roten Backsteingebäuden, durch einen kleinen Park samt Teich, Pavillon und Rabatten voll bunter Tulpen. Verließ das Gelände durch einen neogotischen Torbogen und stand vor dem Starbucks-Café. Ihr Gastgeber hatte davon erzählt, es hatte erst vor drei Monaten eröffnet, die Scheiben mussten schon zwei Mal ersetzt werden, der Protest war heftig. »Eine Straße weiter ist das Sana Java«, hatte er gesagt, »da gehst du hin, politisch korrekter Kaffee, kollektiv organisiert und organisch.«
Sie konnte sich genau vorstellen, wie der Kaffee dort schmeckte, organisch eben, bitter und ziemlich sauer, und gewiss wären auch im Sana Java nur Studierende, nicht teilnahmslose wie im Starbucks, wo alle mit zugestöpselten Ohren hinter ihren Laptops saßen, sondern engagierte, kommunikative, die versuchen würden, sie von irgendwas zu überzeugen. Neben der Tür des Starbucks stapelten sich Gratiszeitungen, die Titelgeschichte zeigte mehrere Studentinnen und erwachsene Männer im Bild, Mitarbeiter des Playboy hatten auf dem Campus nach Girls zum Thema Breasts and Brains gesucht, 163 junge Frauen aus allen Fakultäten waren zum Casting erschienen.
Sie ging hinein, bestellte einen Venti Latte, staunte, wie wenig frisch der Cheesecake wirkte, setzte sich in einen Ohrensessel und begann mit ihrer Auszeitlektüre, einem mehrbändigen russischen Klassiker mit ausführlichen Schlachtszenen, die sie höchstens querlesen würde. Als sie das nächste Mal aufschaute, waren drei Stunden vergangen, der Barista musterte sie amüsiert, doch vielleicht fiel sein Blick gar nicht auf sie, vielleicht ging draußen gerade eines der 163 Breasts-and-Brains-Girls vorbei. Er war sehr groß, gut gebaut, er hatte dunkles Haar und blaue Augen, kantig, dachte sie, kernig, er trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt und mochte ungefähr so alt sein wie sie, er wirkte resigniert und melancholisch, genau so einen brauchte sie, alles andere war langweilig.
Am nächsten Tag ging sie wieder schwimmen, wieder Kaffee trinken, beobachtete ihn, am Abend sagte sie zu ihrem Freund: »Den schnappe ich mir.«
»Ist der nicht unter deinem Niveau?«, fragte er.
»Ich hab Urlaub, ich will eine amerikanische Affäre.«
»Was erwartest du?«
»Glühende Gier«, lachte sie, »lodernde Leidenschaft, fantastisch ficken! Ich trau ihm das zu. Du nicht?«
Er hieß Ethan, das hatte sie auf seinem Namensschild gelesen. Und dann verließ sie der Mut. Das war ungewohnt. Drei Tage lang strahlte sie ihn hilflos an, wenn sie ihre Bestellung aufgab, und Ethan lächelte zunehmend ratlos zurück. Am vierten Tag kaufte sie sich im Biomarkt nach vergorenem Heu riechendes Hennapulver, setzte sich mit einer rot schimmernden Mähne ins Starbucks und schlug ihr Buch auf einer beliebigen Seite auf, da stand: »Sie hielt inne, wie ja Frauen, wenn sie sich als alt bezeichnen, immer eine Pause machen und auf etwas warten.« Das ist das Zeichen, dachte sie, ging zu ihm hinüber, fragte: »Magst du was mit mir trinken gehen?« Er sagte: »Heut Abend hab ich Zeit.« Er sagte nicht: »Wieso denn das?« Sie brauchte sich nicht zu erklären.
Es gab im Städtchen bloß eine Straße, auf der sich flanieren ließ, und auch dies nur wenige Hundert Meter weit, sie führte von der Universität zur einzigen Kirche, die aus Stein und nicht aus weißem Holz gebaut war, Kirschblüten leuchteten selbstherrlich im Licht der Laternen, in einem Schaufenster lagen Cheerleader-Uniformen aus, in einem anderen Schmuck aus Mondstein. Sie gingen essen, es schmeckte ihr nicht, zu fett, zu süßlich, als die Rechnung kam, zögerte er zu lange.
»Was machst du eigentlich, studierst du?«, fragte sie.
»Wozu, ich bin Kellner.«
Bist du nicht, dachte sie, du bedienst eine Kaffeemaschine und räumst abgepackte Kuchen in eine Vitrine.
»Und du?«, fragte er.
Sie beschloss, ihm irgendwas zu erzählen, sie hatte keine Lust darauf, die Journalistin zu sein. Alle hatten immer eine Geschichte, die sie in der Presse sehen wollten, oder kannten jemanden, der ein Opfer von irgendwas geworden war und Öffentlichkeit brauchte. Allgemein drängten die Menschen einander viel zu oft ungefragt ihre Geschichten auf.
»Ich arbeite im psychologischen Dienst«, sagte sie, »Missbrauch und so.«
»Wow, klingt hart«, sagte er.
»Sehr hart, ja«, bestätigte sie, und sehr sinnvoll, eben habe sie mit einer Neunzehnjährigen gearbeitet, deren erstes Mal überaus unglücklich gelaufen sei, ein etwas älterer Familienvater, mit dem sie eine Affäre hatte, habe sie genötigt, unter Druck gesetzt, physisch dermaßen geschwächt, dass sie keine Widerstandskraft mehr hatte, und hatte sie schließlich in seinem eigenen Haus vergewaltigt, während im Hintergrund ein Porno lief. Ihre Aufgabe sei es gewesen, die junge Frau, die noch zur Schule ginge, von der Last der Mitschuld zu befreien, der Mittäterschaft, die unweigerlich in Selbsthass gemündet hätte.
»Was für ein Arschloch«, sagte Ethan.
Sie gingen in den Pub neben der Kirche, tranken Bourbon mit viel Eis, eines der Hippie-Mädchen aus dem Ort stellte sich vor sie hin und demonstrierte den Gebrauch einer Kopfmassagekralle, »feels like an orgasm«, behauptete sie, gewiss trank sie ihren Kaffee organisch. Plötzlich stand Ethan viel zu nah vor ihr, plötzlich küsste sie ihn, er war überrascht, er küsste gut, der Kellner schmiss sie aus der Bar. Sie setzten sich auf eine Bank vor der Kirche und küssten weiter, das Hippiemädchen ging vorbei und sang: »But the stars we could reach were just starfish on the beach.«
»Ich mag dein Lächeln«, sagte er und zeichnete mit seinem Finger ihre Lippen nach, »es sieht aus wie das Nike-Logo.« Er deutete auf seine Sneaker, auf den aufgenähten weißen Bogen unter dem Schriftzug.
Seine Hände waren stark, sie griff nach seinem Bizeps, fragte: »Trainierst du viel?«
»Ja«, sagte er, »ich war Soldat, ich brauch das.«
Ein Kriegsveteran also. Sie wusste, dass sie sich beeindruckt zeigen sollte, doch nichts war ihr fremder als Kriege, irgendwo weit weg kämpften und starben Männer. Sie wollte wissen, was er im Krieg gemacht hatte.
»Küsten rekognosziert. Unterwassersprengsätze installiert vor Kuwait, als Ablenkungsmanöver. So was halt. Ich war zwei Jahre auf dem Schiff«, erklärte er.
»Und danach?«
»Bin ich abgestürzt.«
Natürlich, dachte sie, die Erklärung, die unter Männern alles rechtfertigte, Alkohol, Drogen, Depressionen, Gewalt, Therapien, Tabletten, Amok, Suizid. Ob sein Schiff von innen den Raumschiffen aus Hollywoodfilmen geglichen habe, wollte sie wissen, sie hatte gehört, dass diese kaputte Industrie-Ästhetik der Science-Fiction-Maschinen auf den Eingeweiden riesiger Kriegsschiffe beruhe. »Ja«, sagte er, »genau so, eng, trostlos, voller Metall.«
Eine Stunde lang gingen sie eine Straße namens Maple Drive entlang, Autowerkstätten, Liquor Shops und Striplokale wechselten einander ab, dazwischen ein Tierheim und ein Bestattungsinstitut, sonst gab es da nichts, nicht einmal eine Bushaltestelle. Sie dachte, dass dieser Maple Drive das Deprimierendste war, was sie je gesehen hatte, und dabei derart amerikanisch, dass es sie elektrisierte, und natürlich wohnte Ethan über einer Tankstelle, wohnte in einer niedrigen, überall abgeschrägten Dachgeschosswohnung. Sie wollte wissen, wieso er sich keine Wohnung gesucht habe, in der er aufrecht stehen könne.
»Nach zwei Jahren auf dem Schiff willst du genau das.«
Im Badezimmer regnete es rein und Dutzende riesiger schwarzer Käfer hatten sich zum Sterben aus den Dachbalken auf den Boden fallen lassen. Ethan schlief in Star Wars-Bettwäsche, ein Alienkopf aus grün fluoreszierendem Gummi stand auf einem Regal, neben dem Bett lag ein Block, den er vollgezeichnet hatte, mit seinem Kriegsschiff, seiner Einsamkeit und dem Disney-Schloss von Sleeping Beauty, das von Dornen überwuchert schlief.
»Und? Was meint die Psychologin dazu?«, fragte er.
»Was bist du? Sleeping Beauty? Der Prinz? Ist das Schloss dein Schiff?« Sie versuchte irgendwas. »Tut mir leid, das ist nicht so einfach. Und ich bin im Urlaub.«
Am nächsten Morgen musste er um 6 Uhr im Café sein, an der Tankstelle kaufte er sich einen Cheeseburger, sie fuhren mit dem Taxi durch die Dunkelheit, bevor er ausstieg, wischte sie ihm eine Brotkrume vom Kinn, danach ließ sie sich nach Hause fahren, duschte und schlief in neutraler Bettwäsche weiter.
Sie sahen einander oft, der Sex war belanglos, doch sie liebte die schiere Kraft, mit der er sie festhielt und sicher in der Dachkammer durch die Nacht trug. Sie versuchte, sich die Facetten einer Affäre einzuprägen, die Textur seiner Haut, den Geruch seines Haars, welchen Schatten seine Wimpern auf seine Wangen warfen, wenn er die Augen im Sonnenlicht zukniff, doch das Hauptglück jener Tage, das wusste sie schon nach ein paar Nächten, waren die mit Kokosraspeln gerösteten und karamellisierten Haferflocken aus dem Biomarkt, die zu Hause auf sie warteten.
Die Taxifahrerin war jeden Morgen die gleiche, sie sagte: »Wow, he’s a good catch, you must be very happy.«
»I am«, gab sie zur Antwort, »I am«, und fragte sich, wie Ethan wohl aus der Sicht der Taxifahrerin wirken mochte, sicher hielt sie ihn für verliebt, vielleicht war er das auch?
»Erzähl mir vom schönsten Tag deines Lebens«, sagte sie an einem ihrer Abende über der Tankstelle.
»Das ist einfach«, sagte Ethan, »es war ein ungewöhnlich heftiger Regentag, ich zeigs dir.« Er kramte eine alte Zeitungsseite hervor, auf einem Bild waren er und ein kleiner Hund zu sehen, die beiden gingen zufrieden nebeneinander durch den Regen.
»Dein Hund?«
»Er war mir zugelaufen. Einer aus dem Starbucks machte das Foto, wir setzten es in die Zeitung, der Besitzer meldete sich, der Hund ging nach Hause. Ich mochte ihn gern.«
»Na?«, fragte ihr Gastgeber. »Zufrieden?«
»Na ja, es ist schwer, jemanden ernst zu nehmen, der verlangt, dass ich meinen Kopf auf ein Darth-Vader-Kissen lege und mich mit Prinzessin Leia zudecke«, sagte sie, »aber ich lerne. Über Amerika.«
»Wie ist der Sex?«
»Gibt es Sex in Star Wars?«
Sie bezahlte Taxis, Essen, ein Motel ohne knirschende Käferleichen im Bad, die Einrichtung war von einem blaustichigen Lila, das Licht des Colaautomaten auf dem Flur frostig. Am Empfang bat ein Pappschild um Spenden für die heimkehrenden Soldaten. Im Zimmer schloss er sie in die Arme, sie wand sich raus, streifte Pullover und Hose ab, ließ sich auf das Bett fallen.
»Ich hab Kopfschmerzen«, sagte sie, »besorgst du mir was?«
»Bis zum nächsten Drugstore sind es zwanzig Minuten, so schlimm?«
»Ja. Ich geb dir Geld.«
Sie schaltete den Fernseher auf MTV, eine Rockband spielte auf einem auslaufenden Flugzeugträger, er sah aus wie auf Ethans Zeichnungen, Liebespaare trennten sich unter Tränen, Soldaten salutierten an Bord. Auf einem Nachrichtenkanal erklärte ein Professor, dass amerikanische Truppen an der Zerstörung irakischer Kulturschätze in Bagdad beteiligt gewesen waren. Das lila gefilterte Licht tilgte die durchscheinenden Adern auf ihren Armen und Beinen, sie sah sich auf einem anderen Bett, mit neunzehn Jahren, nackt und unterzuckert. Bald kommt er zurück und will mit mir schlafen, dachte sie, eine Szene wie diese war im Film besser. Sie kannte sie, die Geschichten von Männern, die ihre Menschlichkeit oder ein Bein in Vietnam verloren hatten und die heimkehrten zu Frauen wie Jane Fonda, und immer war alles groß vor Trauer und Trauma.
Sie fragte sich, was ihre Großmutter darüber denken würde. Über Jane Fonda und die Kriege, aber vor allem über ihre Enkelin, die hier lag und schon anderswo gelegen hatte. Ob die Großmutter fähig wäre, Worte für ihre Missbilligung zu finden. Beinah ein halbes Jahrhundert lag zwischen ihnen, das ließ sich nicht in allem überbrücken. Es gab Dinge, über die konnten sie sich nicht unterhalten. Die zeitgemäßen Formen von Liebe gehörten dazu. Trotzdem hatte Valerie das Gefühl, in einen Spiegel zu blicken, wenn sie einander im Häuschen am Stadtrand gegenübersaßen, Tee aus Tassen mit Goldrand tranken, hauchdünne Kekse mit Mandelsplittern aßen und alte Fotos anschauten. Die Fotos waren Valeries Kartografie durch die Zeit, die ihr aus dem Leben der Großmutter fehlte. Der schöne Großvater, der jung bei einem Arbeitsunfall in der Fabrik ums Leben gekommen war. Die Witwe mit ihren drei Kindern hinter der Primelrabatte vor dem kleinen Haus, wo auch Valerie in ihren ersten Sommern auf einer Decke gelegen und nach dem immer gleichen Plüschhasen gegriffen hatte, den die Großmutter heimlich alle paar Monate mit Stoff von einem alten Mantel ausbesserte. Und wenige Bilder von viel früher, als sie gestrahlt hatte, weil sie für kurze Zeit glaubte, dass das Schicksal sie mitten in eine große Stadt und in ein anderes Leben hinein katapultieren könnte. Eines, in dem sie nicht mehr alle Kleider selbst nähen und alle Strümpfe selbst stricken müsste, eines, das keine Heimarbeit bis tief in die Nacht hinein verlangen würde und in dem eine Flasche Öl nicht nur tröpfchenweise verbraucht werden dürfte. Ein Leben mit Reisen, Restaurants, Kinobesuchen und Kurkonzerten in den Pavillons an der Seepromenade. Ein Leben, dachte Valerie, wie meins. Vielleicht sogar mit Amerika. Aber sicher nicht mit einem Lover ohne Liebe in einem lila Motelzimmer.
Sie flog zurück, flog über Chicago, von dem sie keine Vorstellung hatte. Sie freute sich auf Rom und Wien. Amerika begann zu verblassen.
»Schick mir ein Bild von dir«, sagte Ethan am Handy, »ich hab keins und vergesse zu schnell. Kenne ich dich eigentlich?«
Nein, dachte sie, tust du nicht. In Rom setzte sie sich in einen Passfotoautomaten, machte ein Einzelporträt, Rom steht mir, dachte sie und schickte das Bild per Luftpost in die kleine Stadt am anderen Ende der Welt. Noch eins würde er von ihr nicht mehr bekommen. Neun Tage später rief er sie wieder an, sie ließ ihn lange klingeln.
»Hast du schon einen Neuen?«, fragte er. »Ich hab ein Geschenk für dich! Gib mir eine Adresse!«
Sie dachte an Mondsteinschmuck und war gerührt.
Als sie zum vierten Mal in der amerikanischen Bar an der Via Veneto saß, fragte der Kellner: »Bist du im Urlaub?«
»Nein«, sagte sie, »ich bin Schriftstellerin.«
Hochstaplerin, dachte sie, wäre auch ein Beruf.
Als sie zwei Wochen später nach Wien kam, wartete in der Wohnung ihrer Gastgeberin ein Umschlag aus Pappkarton auf sie, darin lag ein Bild. Ethan hatte ihr römisches Automatenporträt abgezeichnet. Die Gastgeberin sagte: »Ist das von einem Kind? Hast du inzwischen eins, von dem ich nichts weiß?«
»Wo gibt es hier einen Starbucks?«, fragte sie zurück.
»Vis-à-vis vom Sacher. Da geht man aber nicht hin.«
Bereits in Rom hatte sich angekündigt, dass dieser Sommer wärmer werden würde als andere, jetzt war ein ungewöhnlich heißer Junitag, der Wind, der sonst durch Wien zog, hatte sich gelegt, die Gloriette hinter Schönbrunn ragte wie vergilbte Knochen in den Himmel. Sie fuhr mit der Straßenbahn bis zur Oper, bog in die Kärntner Straße ein, betrat das Café unter dem Logo der Meerjungfrau, bestellte sich einen doppelten Espresso auf Eis, der Barista war groß, blond, hatte grüne Augen, einen australischen Akzent und strahlte voll goldener Zuversicht. Gern hätte sie gefragt, wo kommst du her, wieso bist du hier, eine plötzliche Sentimentalität zwang sie zum Rückzug. Sie setzte sich unter den Deckenventilator und wählte Ethans Nummer.
»Hey«, sagte sie, »danke, ein schönes Bild.«
Sie blickte auf ihre Knie, sie waren nicht mehr bleich wie im April, ihr Kleid war hellblau.
»Ich werde bald meinen Job kündigen«, sagte er, »ich will endlich studieren und alles vergessen, was ich bisher gemacht habe, vielleicht eine europäische Sprache, wieso nicht Türkisch oder Portugiesisch? Dann könnte ich …«
»Eine schöne Idee«, sagte sie.