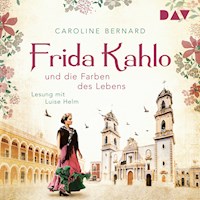9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebenden von Montparnasse.
Paris, 1928: Vianne träumt davon, Botanikerin zu werden – im renommierten Jardin des Plantes. Als sie sich in den aufstrebenden Maler David verliebt und mit ihm in das schillernde Bohème-Leben der französischen Avantgarde eintaucht, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann nimmt ihr Leben eine tragische Wendung.
Jahrzehnte später steht Marlène im Musée d´Orsay vor dem Bild einer Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Fasziniert von der Ausstrahlung der Fremden, begibt sich Marlène auf die Suche, bei der sich nach und nach ihr Leben verändern wird ...
Bewegend, sinnlich und très français – die Geschichte zweier starker Frauen vor der Kulisse einer atemberaubenden Metropole.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Über Caroline Bernard
Caroline Bernard ist Literaturwissenschaftlerin und wurde 1961 in Hamburg geboren. Noch vor dem Abitur machte sie ihre erste Reise nach Paris und verlor ihr Herz an die Stadt. Es folgten längere Aufenthalte als Au-pair, als Sprachschülerin und Stipendiatin. Heute sind Reisen nach Paris, in die Provence oder in die Normandie aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Caroline Bernard lebt als freie Autorin in der Nähe von Hamburg. »Rendezvous im Café de Flore« ist nicht ihr erster Roman.
Informationen zum Buch
Die Liebenden von Montparnasse
Paris, 1928: Vianne träumt davon, Botanikerin zu werden – im renommierten Jardin des Plantes. Als sie sich in den aufstrebenden Maler David verliebt und mit ihm in das schillernde Bohème-Leben der französischen Avantgarde eintaucht, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann nimmt ihr Leben eine tragische Wendung … Jahrzehnte später steht Marlène im Musée d´Orsay vor dem Bild einer Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Fasziniert von der Ausstrahlung der Fremden, begibt sich Marlène auf die Suche, bei der sie nach und nach ihr Leben verändern wird.
Bewegend, sinnlich und très français – die Geschichte zweier starker Frauen vor der Kulisse einer atemberaubenden Metropole.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Caroline Bernard
Rendezvous im Café de Flore
Roman
Inhaltsübersicht
Über Caroline Bernard
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Epilog
Historische Hintergründe
Impressum
Prolog
Viannes Kindheit endete an einem sonnigen Nachmittag im Sommer 1926. Sie war mit ihren Brüdern und den Nachbarjungen wie so oft am Waldrand gewesen und um die Wette auf Bäume geklettert. Als sie verschwitzt und mit zerzausten Haaren nach Hause kam, nahm ihre Mutter sie mit ernster Miene beiseite. »Wie siehst du denn aus, Vianne? Es gehört sich für ein Mädchen in deinem Alter nicht, so herumzutoben. Deine Brüder haben gesagt, alle hätten deine Unterhose sehen können, als du vom Baum geklettert bist. Schäm dich! So etwas tut ein Mädchen nicht. Du bleibst in Zukunft in der Nähe des Hauses.«
Vianne lief in ihr Zimmer unter dem Dach und ließ sich weinend auf ihr Bett fallen. Sie war fast fünfzehn Jahre alt, und sie hatte das Gefühl, ihr Leben sei vorüber.
Denn seit sie in der Bibliothek von Alès eine Pflanzenkunde entdeckt hatte, hatte Vianne eine Leidenschaft: die Botanik. Dieses dicke Buch, in dem Pflanzen mit feinem Strich und in wunderschönen Farben abgebildet waren, hatte sie in seinen Bann gezogen. Blüten, Knospen, Blätter, Wurzeln, alles war in allen Einzelheiten, bis in die kleinsten Härchen und Verästelungen dargestellt. Sie hatte sich das Buch ausgeliehen und versuchte nun, auf endlosen Streifzügen die dargestellten Pflanzen in den Wäldern und Wiesen rund um Saint Florent wiederzufinden. Von ihren Streifzügen kam sie jedes Mal mit einer anderen Pflanze zurück, die sie vorsichtig auf ihr Fensterbrett legte, um sie zu trocknen und später abzuzeichnen. Eines Tages hatte sie eine ihrer Zeichnungen stolz mit in die Schule genommen, und Mademoiselle Grimaud, ihre Lehrerin, hatte ihr gezeigt, wie man Blumen- und Pflanzenteile presste, um sie zu konservieren. Sie legte sie zwischen zwei Holzplatten, bedeckte sie mit einem Löschblatt und presste die Platten mit zwei großen Flügelschrauben zusammen. Zwei Tage später war die Schlüsselblume tatsächlich getrocknet. Sie hatte ein wenig von ihrer Farbe verloren, und einzelne Teile fielen ab, als sie das Blatt anhoben, aber sie war eindeutig zu erkennen.
»Aber warum macht man das?«, fragte Vianne.
»Um die verschiedenen Pflanzen miteinander zu vergleichen. Um festzustellen, ob sie zur selben Familie gehören. Um Pflanzen zu konservieren, von denen es nur sehr wenige Exemplare gibt …«
Vianne nickte.
»Es gibt ein Gebäude, in dem alle Pflanzen der ganzen Welt, auch die Algen, die Pilze, die Moose, die Wüstenpflanzen, einfach alle gesammelt werden.«
»Wo ist dieses Gebäude?«
»Es ist das Botanische Institut im Muséum national d’Histoire naturelle in Paris. Aber eigentlich nennen es die meisten Jardin des Plantes.«
»Der Jardin des Plantes in Paris«, flüsterte Vianne ehrfürchtig. »Den würde ich gern sehen.«
Aber ihre Mutter erlaubte ihr ja nicht einmal mehr, mit der Botanisiertrommel durch die Gegend zu streifen. Nur, weil sie ein Mädchen war!
Viannes Eltern, Arno und Clothilde Renard, betrieben ein kleines Geschäft in Saint Florent, einem Dorf mit fünfhundert Einwohnern in den Hügeln der Cevennen. Es gab dort einen Frisierstuhl und auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes einen großen Verkaufstresen für Drogeriewaren und Kräuter.
Vianne war schon als Kind oft mit im Geschäft, sie fegte aus und polierte die Spiegel. Dadurch kannte sie jeden aus der Gegend und aus den mitgehörten Gesprächen erfuhr sie auch vieles, was die Kunden im Vertrauen ihrem Vater erzählten. Arno war bei den Sozialisten und hielt mit seiner politischen Meinung nicht hinter dem Berg, weshalb einige Leute seinen Salon mieden.
Sein treuester Kunde war L’Espagnol, wie er von allen genannt wurde, ein Spanier, der mit seiner Familie ein Stück den Berg hinauf lebte und Ziegenkäse herstellte. Vianne bewunderte seine üppigen Töchter, die mit ihren dunklen Haaren und den fast schwarzen Augen ganz anders aussahen als sie selbst. Sie war sehnig und blass und hatte hellgraue Augen. Es gab praktisch keine Farben in ihrem Gesicht. Wenn die Töchter von L’Espagnol knallroter Klatschmohn mit riesigen Blüten waren, dann war sie eine Pusteblume, durchscheinend und gewöhnlich.
Mit vierzehn verließ Vianne die Schule und half nun jeden Tag im Geschäft ihrer Eltern. Die Arbeit langweilte sie. Die Haare der Kundschaft auffegen, Regale einräumen, nett auch zu den unangenehmsten Kunden sein: Sollte sie das für den Rest ihres Lebens tun? Sie hatte immer ein Buch, meistens ein botanisches, unter dem Tresen liegen und vertiefte sich darin, wenn keine Kunden im Laden waren. Seit ihrer ersten Begegnung mit dem Herbarium wusste sie, dass sie Botanikerin werden wollte. Aber dazu müsste sie studieren, und das würde ihr Vater nie zulassen. Er schimpfte ja schon, wenn er sie lesend antraf. Als eine ihrer Klassenkameradinnen mit ihrer älteren Schwester nach Paris ging, um dort eine Ausbildung zur Weißnäherin zu machen, beneidete Vianne sie aus tiefstem Herzen. Sie wollte auch nach Paris! Sie wollte im Botanischen Institut lernen und arbeiten!
Gierig las sie jeden Artikel, den sie in den Magazinen, die sich die Frauen im Dorf herumreichten, über Paris finden konnte. Theaterpremieren, Kunstausstellungen und ganzseitige Abbildungen der neuesten Modeschöpfungen, aber vor allem interessierte sie sich für die Berichte über Frauen, die in der Hauptstadt als Tänzerinnen, Schriftstellerinnen, Unternehmerinnen, Mäzeninnen, manchmal auch als Verbrecherinnen Furore machten. Es gab sogar Frauen, die auf die Straße gingen, um zu demonstrieren! Abends lag Vianne dann in ihrem Bett und stellte sich vor, wie ihr Leben in Paris aussehen würde. Dort würde sie richtig leben und nicht verkümmern wie in Saint Florent! Aber wie sollte sie in die Stadt ihrer Träume kommen? Ihre Eltern hatten ihr ja nur nach wiederholten Besuchen von Mademoiselle Grimaud überhaupt den Besuch der Höheren Schule für Mädchen in Alès erlaubt. Klug genug dafür war sie in jedem Fall gewesen. Immerhin hatte sie als Klassenbeste die Rede bei der Abschlussfeier gehalten. Aber danach ließ ihr Vater nicht mehr mit sich verhandeln.
»Niemand aus unserer Familie hat eine höhere Bildung. Außerdem heiratest du doch sowieso.« Damit war das Thema für ihn erledigt.
Vianne mochte den Landstrich, in dem sie aufgewachsen war, die dunklen Wälder, die sich die Hügel der Cevennen hinaufzogen und in denen es im Herbst Pilze, Esskastanien und Trüffel gab. Sie mochte auch die wilden Flüsse, die sich tief in die Felsen gegraben hatten, die Ardèche und den Duzon. Sie waren voller Fische, bei Trockenheit konnte man stundenlang von einem Stein zum nächsten balancieren und im Frühsommer, wenn sie viel Wasser trugen, sprangen die Kinder von den Straßenbrücken aus hinein. Aber ihr ganzes Leben hier zu verbringen, das konnte sie sich nicht vorstellen. Sie wollte anders leben als ihre Freundinnen und ihre Mutter, die sich von morgens bis abends abmühte, kochte, schrubbte, den Garten bestellte und nur bei ganz seltenen Gelegenheiten mal lustig war.
Eine der wenigen Erwerbsquellen, die Frauen in der Gegend hatten, war die Tätigkeit als Amme. Viele Pariserinnen brachten ihre Kinder hierher. Uneheliche oder ungeliebte Kinder von wohlhabenden Frauen wurden hier von Ammen versorgt und erzogen. Aber als Amme musste man verheiratet sein und selbst Kinder haben, und dafür fühlte sich Vianne zu jung.
Sie saß in der Küche, auf dem großen Holztisch vor ihr lag ein Haufen Nüsse, in einem Sack neben dem Tisch waren weitere. Vianne und ihre Mutter waren dabei, sie zu knacken und für den Winter einzulagern. Gedankenverloren drehte Vianne die Früchte in ihrer Hand. Wissenschaftlicher Name Juglans, beschrieben von Linné, Blätter wechselständig, gefiedert … In stundenlanger Arbeit hatte sie die Pflanze wie so viele andere in ihr Heft abgezeichnet. Darin war sie inzwischen eine Meisterin. Mit feinem Strich und Sinn für Details konnte sie die Pflanzen fast fotografisch wiedergeben. Sie hatte lange geübt und sich immer wieder die Zeichnungen in den botanischen Büchern angesehen, die sie in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Inzwischen kannte sie sie alle, zumindest die aus der Bücherei in Alès.
Ihre Mutter stieß sie an. »Denk dran, die schönsten kommen hier hinein«, sagte sie und fischte eine perfekte Walnusshälfte aus Viannes Schüssel, um sie in eine blaue Keramikschale zu legen. Diese Nüsse wurden später in Honig eingelegt und dann zu Weihnachten gegessen, der Rest wurde zu Nussöl gepresst.
Vianne seufzte. Ihre Fingerkuppen waren dunkelbraun verfärbt, der Schmutz unter den Nägeln würde tagelang nicht rausgehen. Und vom Pilzeputzen wurden sie dann gleich wieder schmutzig, und dann mussten die Pflaumen entsteint werden und dann die Kartoffeln aus der Erde geholt … Im Herbst gab es immer so viel zu tun, um die Ernte einzubringen und die Vorratsräume für den Winter zu füllen.
Bald würde sie sechzehn werden. Inzwischen verbrachte sie jede freie Minute mit ihren botanischen Studien, die sie immer mehr faszinierten, je mehr Einblick sie in diese Wissenschaft bekam. Da, wo andere nur Unkraut oder eine Nutzpflanze sahen, entdeckte sie Formen, Farben, zarte Verästelungen und Maserungen. Sie hatte schon vor langer Zeit von ihrem Ersparten eine Pflanzenpresse gekauft und archivierte die schönsten Blüten und Blätter, die sie fand. Sie hatte längst gelernt, wie man Pflanzen klassifizierte und bestimmten Arten zuordnete. Außerdem begann sie, sämtliche Pflanzen, die in den Büchern beschrieben waren, gezielt an den beschriebenen Standorten in der Natur zu suchen. Sie liebte diese Beschäftigung, und füllte mit ihr die vielen einsamen Stunden.
Gerade war sie in einem Artikel auf die Heilpflanzen gestoßen. Sie war überrascht, viele von ihnen auch in den großen Regalen im Geschäft ihrer Eltern zu finden. Sie begann, wilden Rosmarin und Minze zu sammeln, zu trocknen und zu verkaufen. Ihr Lieblingsbuch war und blieb jedoch ein Werk über den Jardin des Plantes in Paris.
»Eines Tages fahre ich dorthin«, nahm sie sich vor, »und bis dahin werde ich so viel wie möglich über Botanik lernen.«
»Was sagst du?«, fragte ihre Mutter.
Vianne war sich nicht bewusst gewesen, dass sie laut gedacht hatte. »Ach, nichts«, antwortete sie rasch.
Auch in diesem Sommer kam ihr Vetter Auguste wieder in den Ferien. Seine Familie lebte in Bordeaux. Er war ein Angeber und prahlte vor ihren Brüdern mit seinen Frauengeschichten. Vianne hasste ihn, weil er ihre Brüder gegen sie aufstachelte und keine Gelegenheit ausließ, um sie zu demütigen.
»Frauen können nicht wissenschaftlich denken«, sagte Auguste, als sie morgens in der Küche saßen. »Außerdem kriegen Frauen, die alles besser wissen, keinen Mann.«
»Soll ja auch Männer geben, die keine Frau will«, gab sie zurück und sah ihn dabei provozierend an. »Zum Beispiel Männer, die Angst vor klugen Frauen haben.«
»Vianne!« Das war die scharfe Stimme ihres Bruders Christophe.
»Darf mich hier eigentlich jeder zurechtweisen, bloß, weil ich ein Mädchen bin?«, rief sie und stapfte wütend davon.
Als sie später in ihr Zimmer kam, sah sie das Zerstörungswerk sofort: Ihre Bücher waren aus den Regalen gerissen und auf den Boden geworfen worden. Zwischen ihnen lagen auch ihre sorgfältig angelegten Herbarien, jemand hatte die Seiten herausgerissen und zerfetzt. Ihre Botanisiertrommel aus Blech mit den aufgedruckten Zikaden und Schmetterlingen war zertreten und zerbeult. Sogar die Pflanzenteile, die noch in der Presse zum Trocknen lagen, waren herausgenommen worden und lagen im Zimmer verstreut.
Vianne ließ sich auf den Boden sinken. Ihre Finger ertasteten die zarten Blüten von Blauer Glockenblume und Zitronensalbei und zerrieben sie. Es knisterte leise, als sie zu Staub zerfielen.
Was sie auch tat, es war nicht richtig. Wenn sie in der Schule den Vorlesewettbewerb gewonnen hatte, hieß es, ein Mädchen solle sich nicht in den Vordergrund drängen. Eine höhere Bildung erlaubte ihr Vater ihr nicht. Mit den Jungen spielen durfte sie auch nicht. Dass sie durch die Wälder lief und nach Pflanzen suchte, eine hart erkämpfte, seltene Freiheit, die ihre Eltern ihr zugestanden hatten, hatten schon mehrere Kunden kritisch im Friseursalon angemerkt. Ob sie nichts Besseres zu tun habe, als Frau im heiratsfähigen Alter?
Manchmal hatte sie sogar gedacht, eine Ehe sei vielleicht das kleinere Übel. Aber wo sollte sie denn in Saint Florent einen Mann finden? Hier kannte sie doch jeden, und keiner von denen kam in Frage. Sie spürte wohl die begehrlichen Blicke von Monsieur Berger. Seine Frau war im letzten Jahr gestorben, und seitdem kam er jeden zweiten Tag in den Friseursalon und ließ die Augen nicht von ihr. Und das Schlimmste war, dass ihre Eltern immer wieder beim Abendessen seinen Namen erwähnten. Vianne befürchtete, dass sie sich insgeheim schon mit ihm geeinigt hätten. In Saint Florent war es nichts Ungewöhnliches, wenn ein junges Mädchen ohne Mitgift an einen älteren Mann verheiratet wurde. Aber sie würde nie, niemals einen Mann heiraten, der fast doppelt so alt war wie sie!
Sie erhob sich mühsam, ihre Beine wollten ihr nicht gehorchen. Mechanisch strich sie über ihre Röcke, um die staubigen Pflanzenteile abzuwischen. Sie drehte sich langsam um sich selbst und betrachtete das Chaos zu ihren Füßen. In diesem Augenblick, vor den zerrupften Pflanzen und den zerrissenen Seiten, wurde ihr endgültig klar, dass sie in Saint Florent keine Zukunft hatte. Sie hatte sich Mühe gegeben, den Erwartungen zu entsprechen, die in sie gesetzt wurden, aber jetzt konnte sie nicht mehr. In Saint Florent würde sie unglücklich werden, sie würde ein Leben führen, das sie nicht wollte. Sie würde als verbitterte alte Frau enden. Sie holte Besen und Kehrblech, fegte die Fetzen zusammen und warf alles in der Küche in den Mülleimer. Es fühlte sich an, als würde sie ihr altes Leben gleich mit entsorgen.
Langsam stieg sie die Treppe wieder hinauf, und mit jeder Stufe wurde ihr Tritt fester. Es war an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, über die sie in letzter Zeit immer wieder nachgedacht hatte, zu der sie aber bisher nicht den Mut gehabt hatte.
Wenn sie ein eigenes Leben führen wollte, dann musste sie Saint Florent und ihre Familie verlassen. Es war keine Frage, wohin sie gehen würde: nach Paris, in die Stadt, von der sie schon so lange träumte.
Eins
»Jean-Louis, guck mal! Da hinten ist der Eiffelturm!« Das Wahrzeichen von Paris erhob sich kühn und elegant über dem Häusermeer. Wir befanden uns auf einer Anhöhe vor der Stadt und die Blechdächer glänzten im leicht diffusen Abendlicht silbern vor uns. Am Morgen waren wir in Sète losgefahren und kamen jetzt von Süden her auf der Autobahn in die Stadt. Und endlich bot sich mir der Anblick, den ich so lange vermisst hatte. Paris!
»Da drüben links, siehst du ihn? Oh, wie schön! Ich habe es noch nie gesehen, wenn er so im Abendlicht leuchtet! Schau mal, er ist richtig kitschig-rosa!«
»Ich kann jetzt nicht gucken«, entgegnete Jean-Louis. Er wollte sich rechts einordnen, um einen hupenden Fahrer hinter ihm vorbeizulassen, was angesichts des dichten Verkehrs auf drei Spuren und der wild zwischen den Autos überholenden Motorräder seine ganze Aufmerksamkeit erforderte. Also überließ ich mich meiner Wiedersehensfreude. Nur noch ein paar Minuten, und ich wäre wieder in der Stadt meiner Träume. Hier, direkt neben der Autobahn, befanden sich die Industrieparks und Wohnsilos, aber ich wusste, dass sich hinter den eher nüchternen Bauten rechts und links der Autobahn die Boulevards mit ihren prächtigen, von Balkonen und Erkern geschmückten Häusern befanden. Und davor die breiten Trottoirs, wo die Tische und Stühle der Cafés unter den Markisen standen. Ich ahnte den Verlauf der Seine und ging in meinem Kopf spazieren. Ich kannte mich immer noch gut in der Stadt aus. Im Norden erhob sich vor uns der Hügel von Montmartre, und gerade jetzt konnte ich über den Dächern die blendend weiße Kuppel von Sacré Cœur erkennen. Wie oft war ich durch die engen, immer ein bisschen schmutzigen Gassen unterhalb der Kirche geschlendert, wo Paris noch so aussah wie vor hundert Jahren, als hier die Künstler und Halbweltdamen lebten, liebten und tanzten!
Ein letzter Sonnenstrahl traf eine Fensterfront im oberen Stockwerk eines Bürogebäudes und ließ die umliegenden Fassaden golden aufleuchten. Ich holte tief Luft. Dies war für mich Paris: das Licht, das sich frühmorgens oder wie jetzt, in der Abendsonne, golden auf den Zinkdächern brach und die Sandsteinfassaden wie Samt leuchten ließ. Und wenn die Sonne untergegangen war, wechselte die Stadt ihr Kleid von Gold zu Silber. Was vorher in flimmerndem Licht gelegen hatte, bekam dann scharf umrissene Konturen.
Ich erinnerte mich an die vielen Abende, an denen ich mich in den Strom der Menschen eingereiht hatte, die aus den Metrostationen kamen und auf dem Heimweg in den Crèmeries und Boulangeries für das Abendessen einkauften oder müßig in einem Café saßen, um nach Feierabend noch einen kleinen Roten zu trinken. Wie oft hatte ich selbst einen unverbindlichen Plausch mit der Bäckerin oder dem Zeitungsmann in seinem Kiosk gehalten – niemand versteht die Kunst dieser kleinen Plaudereien besser als die Pariser Ladeninhaber, ein paar Worte, die nicht viel sagen und doch dafür sorgen, dass man sich gut und aufgehoben fühlt.
Und dann die Gerüche, die für diese Stadt so typisch waren. Der leicht metallische, unverwechselbare Geruch in den Metroschächten, der Duft nach Parfum und Lindenblüten im Frühjahr, nach heißen, leicht angebrannten Maroni im Herbst, nach den süßen Crêpes, die die Straßenverkäufer an vielen Ecken feilboten.
Mit glänzenden Augen schaute ich zu Jean-Louis: »Weißt du, für mich ist Paris mehr als eine Ansammlung von berühmten Bauwerken und Plätzen. Der Louvre, der Obelisk auf der Place de la Concorde, der Triumphbogen, auch der Eiffelturm, das ist zwar alles sehr schön, aber für mich bedeutet Paris eine bestimmte Art zu leben, die Schönheit im Detail …«
»Pass doch auf, du Blödmann!«, schimpfte Jean-Louis und hupte den Autofahrer vor uns an, der ihm die Vorfahrt genommen hatte. »Entschuldigung, aber ich kann jetzt nicht richtig zuhören«, sagte er dann in meine Richtung.
Ich zuckte mit den Schultern und verdrehte mir den Hals, um den Eiffelturm, der langsam hinter den Häusern verschwand, so lange wie möglich im Blick zu haben. Die Sonne war hinter dem Horizont verschwunden und der Turm hatte jetzt eine silbrig-gleißende Färbung angenommen. Wie eine kolorierte Schwarz-Weiß-Fotografie.
Wir fuhren in einen Tunnel, und ich schloss die Augen. Ich konnte nichts dagegen tun, eine ganze Flut von Erinnerungen und Gefühlen brach über mich herein. Ich war auf einmal wieder dreiundzwanzig, eine strahlende junge Frau mit einem Stipendium für zwei Semester Kunstgeschichte an der Sorbonne und einem Koffer voller Träume. Als ich an der Gare de Lyon aus dem Zug stieg, hielt ich es für selbstverständlich, dass Paris mir ab sofort zu Füßen liegen würde. Und genau aus dem Grund geschah es auch. Ich fand eine kleine Wohnung in der Rue de la Roquette unweit der Bastille. Wobei Wohnung fast zu viel gesagt war. Es war ein ehemaliges Dienstbotenzimmer unter dem Dach, die Treppen waren steil und hoch, und im Sommer konnte es dort ziemlich heiß werden. Es gab nur einen Raum, der mir als Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer diente, und eine winzige Küchenzeile sowie ein ebenso winziges Bad unterhalb der Dachschräge, wo ich beim Duschen den Kopf einziehen musste. Aber nie wieder habe ich mich so wohl gefühlt wie in dieser winzigen Behausung, die ganz mir gehörte. Jeden Morgen überquerte ich die Seine und ging an die Universität. Ich studierte Kunstgeschichte im dritten Semester. Wenn ich mich in die Menge der anderen Studenten einreihte, die sich in den Gängen der Sorbonne drängelten, dann fürchtete ich manchmal, mein Herz würde vor Glück zerspringen. Mein Lieblingskurs wurde an der altehrwürdigen École des Beaux Arts mitten in Saint-Germain mit seinen Galerien gegeben. Schon Monet, Renoir, Delacroix und Matisse hatten hier Malerei studiert. Und ich durfte hier eine Vorlesung über Ikonographie besuchen! Jeden Dienstagnachmittag standen wir vor den Bildern ehemaliger Schüler des Instituts, die bis unter die Decken an den Wänden hingen, und lauschten den Ausführungen von Monsieur Paraffin zur Bedeutung bestimmter Motive in der Malerei.
Als ich damals in Paris ankam, war es auch Anfang Mai gewesen, genau wie jetzt. Die Rosskastanien explodierten, in den Parks blühte es in allen Farben, die Frauen trugen kurze Röcke und leuchtende Farben. Nach den Vorlesungen setzte ich mich an das Wasserbassin im Jardin du Luxembourg, um zu lesen und zu lernen. Nie wieder in meinem Leben war ich so wissbegierig und so aufnahmebereit wie in jenem Sommer.
In meiner freien Zeit streifte ich durch die Straßen, besuchte jeden Tag ein anderes Museum und sog den unnachahmlichen Zauber der Stadt in mich ein. Ich lebte aus dem Vollen, ich konnte von allem nicht genug bekommen, ich hätte den ganzen Tag tanzen können. Ich schlief kaum, aus lauter Angst, etwas zu verpassen. Ich wollte alles mitnehmen, was möglich war.
Und dann begegnete ich Julien. Er ließ sich eines Tages in der Cafeteria der Uni einfach mir gegenüber auf einen der roten Plastikstühle fallen, ohne zu fragen. »Salut«, sagte er. »Ich bin Julien. Du bist mir schon ein paar Mal aufgefallen.« Mir blieb der Mund offen stehen, als ich ihn anstarrte. Er sah unverschämt gut aus, dunkle Locken, ein blendend weißes T-Shirt mit der Rolling-Stones-Zunge, schlaksige Figur, die Haut in einem sanften Bronzeton. Am Handgelenk trug er ein paar Stoffarmbänder. Ein echter Hippie, dachte ich fasziniert. Mit seiner ansteckenden Lebensfreude und der unschuldigen Lässigkeit faszinierte er mich von der ersten Sekunde an. Ich verliebte mich auf der Stelle und unsterblich. Ab jetzt zog ich abends mit ihm durch die Clubs und Bars rund um die Bastille. Unsere Lieblingskneipe war das Baragouin in der Rue Tiquetonne in der Nähe der ehemaligen Hallen. Ich mochte den Laden allein schon wegen seines Namens und der Adresse. Dort tranken wir billiges Bier, dann gingen wir Arm in Arm in seine schäbige Wohnung in Belleville und liebten uns die ganze Nacht. Julien war ein phantastischer Liebhaber. Seine Berührungen haben meinem Körper einen Stempel aufgedrückt, ich habe sie nie vergessen und kann ihren Nachhall immer noch in mir hervorrufen.
»Müssen wir hier jetzt raus oder nicht?« Jean-Louis’ Stimme holte mich ein weiteres Mal in die Gegenwart zurück. Wir hatten den Tunnel hinter uns gelassen, und das Tageslicht blendete mich.
»Was?«, fragte ich, noch ganz gefangen in meinen Erinnerungen.
»Ob wir hier raus müssen.«
Ich orientierte mich schnell, dann sagte ich: »Ja, Porte d’Italie, da vorne.« Jean-Louis nahm die Ausfahrt, dann fuhren wir auf der Avenue d’Italie in Richtung Zentrum. Mein Herz schlug schneller, als ich ein Verkehrsschild sah, das nach Saint-Germain wies. Am liebsten hätte ich einen kleinen Umweg gemacht, nur um am Jardin du Luxembourg vorbeizufahren. Aber Jean-Louis wollte erst mal in unser Hotel. Und ich war schließlich nicht allein in Paris, sondern mit meinem Mann. Ich war auch keine verliebte Studentin mehr, sondern eine verheiratete Frau.
Jean-Louis hatte mir diese Paris-Reise zu unserem Hochzeitstag geschenkt. Nach meinem Aufenthalt als Studentin war es das erste Mal, dass ich wieder hier war. Dazwischen lagen unglaublich lange fünfzehn Jahre, und wenn er an diesem Abend vor zwei Wochen nicht mit der Einladung gewunken hätte, wäre wohl noch mehr Zeit vergangen.
Die Reste des sonntäglichen Abendessens hatten noch zwischen uns auf dem Tisch gestanden. Zufrieden hatte ich ein Stück Baguette abgebrochen und es in die rote Soße der Rouille de seiche à la sétoise getaucht. Ein langer Name für ein im Grunde relativ einfaches Gericht. Die Rouille ist typisch für Sète, die Stadt am Mittelmeer, in der meine Eltern leben: Tintenfisch in einer Gemüse-Tomatensoße, am Schluss wird eine Knoblauchmayonnaise, die eigentliche Rouille, untergerührt. An diesem Tag war sie mir außergewöhnlich gut gelungen, cremig und mit einer leichten Schärfe, weil ich immer eine Prise Cayennepfeffer in die Mayonnaise gebe, obwohl im Rezept Safran steht.
Jean-Louis schenkte uns beiden Wein nach und nahm einen Schluck. Auf seinem glatten Gesicht lag das rötliche Licht der Abendsonne. Er wischte sich den Mund ab, dann lehnte er sich zurück. Ich brachte die Teller in die Küche und stellte das Geschirr in die Spülmaschine. Als ich zurück ins Zimmer kam, lag auf meinem Platz eine Postkarte, auf der der Eiffelturm bei Nacht zu sehen war.
»Am 2. haben wir Hochzeitstag. Ich gebe dir mein Geschenk jetzt schon. Wenn du es siehst, weißt du, warum«, sagte Jean-Louis.
Ich nahm die Karte und las den Text. Ich muss ziemlich überrascht geguckt haben. Einladung zu einer Paris-Reise, stand dort. »Du willst mit mir nach Paris?« jubelte ich. Oh, Jean-Louis, ich will schon so lange dorthin. Dass du daran gedacht hast!«
Jean-Louis sah mich mit diesem ganz besonderen Lächeln an, mit leicht schief gelegtem Kopf und jungenhaft, voller Nachsicht und Liebe, das mir am Anfang unserer Beziehung weiche Knie beschert hatte. Seine Stimme war ganz weich, als er sagte: »Ich kenne doch deine Schwärmerei für Paris.«
»Etwas Schöneres hättest du mir nicht schenken können, vielen Dank!«, rief ich und umarmte ihn stürmisch.
»Dann kann ich auch endlich mal den Wagen richtig ausfahren«, sagte er und strahlte mich dabei an. »Wir machen es uns so richtig nett. Ich habe alles organisiert, ein Hotel ist auch schon gebucht. Im Quartier Latin. Die Sorbonne ist gar nicht weit entfernt.«
In meinem Kopf tauchten sofort Bilder von Hotelsuiten im Belle-Epoque-Stil auf, Blumenbouquets und Pralinenschachteln, hohe Betten mit vielen Kissen, von denen aus ich auf den Eiffelturm gucken konnte, und ein riesiges Badezimmer mit Whirlpool. Nun, so nobel musste es ja nicht werden, aber immerhin hatte er daran gedacht, dass ich an der Sorbonne studiert hatte und ein Hotel in der Nähe ausgesucht. Ich war gerührt.
»Wir fahren am Mittwoch nächster Woche los, am Sonnabend feiern wir unseren Hochzeitstag in Paris, und am Montag kommen wir wieder. Freust du dich?«
»Und wie«, gab ich zurück. «Ich kann es kaum erwarten.«
Jean-Louis kam auf mich zu, zog mich vom Stuhl hoch und küsste mich. Seine Hand legte sich auf meine Brust. Ich roch den Duft seines Parfüms und darunter einen anderen Geruch, seinen eigenen, herben, den ich so sehr mochte. Ich zog ihn an mich.
Und jetzt war ich also wieder hier. Nach fünfzehn Jahren wieder in der Stadt, in der ich so glücklich gewesen war. Aber in meine Vorfreude mischte sich ein bisschen Wehmut, und wenn ich ganz ehrlich war, auch ein bisschen Angst. Wie würde die Stadt mir begegnen? Ich war schließlich nicht mehr die Frau, die ich mit dreiundzwanzig gewesen war. Ich war inzwischen verheiratet und arbeitete in der Stadtverwaltung von Sète. Und mein Abschied von Paris war unglücklich gewesen.
Ich wollte damals nur für ein paar Tage, höchstens Wochen zurück nach Sète. Meine Mutter musste ins Krankenhaus, um sich operieren zu lassen, und ich wollte in der Zeit bei ihr sein und mich um meinen Vater kümmern, der absolut unfähig ist, allein für sich zu sorgen. Aber ich glaubte fest daran, nach spätestens vier Wochen zurück zu sein, um meine Magisterarbeit zu Ende zu schreiben. Ich hatte mit Professor Paraffin ein Thema abgesprochen und mich schon zur Prüfung eingeschrieben. Ich freute mich unbändig auf die Arbeit in den Archiven der École des Beaux Arts, wo ich inzwischen als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete und mir Hoffnungen auf eine spätere Anstellung machte. Ich glaubte an eine strahlende Zukunft.
Aber dann gab es Komplikationen bei Mamans Operation, weitere OPs folgten, danach ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Ich konnte meine Eltern unmöglich allein lassen.
»Du musst dich nicht um uns kümmern«, sagte sie mit schwacher Stimme zu mir, aber in ihrem Blick las ich, dass sie sich genau das erhoffte.
Und mein Vater war der Meinung, dass ein Vordiplom in Kunstgeschichte doch völlig ausreichend sei, warum noch weiterstudieren? Zumal niemand aus meiner Familie vorher studiert hatte. Ganz abgesehen davon, dass meine Eltern Mühe hatten, mein Studium zu finanzieren. Und dann rief mich Julien an, um mir mitzuteilen, dass er eine andere Frau getroffen hatte. »War schön mit dir«, sagte er noch. »Pass auf dich auf.« Er verließ mich ebenso beiläufig, wie er mich erobert hatte.
Die Vorstellung, durch Paris zu laufen, ohne ihn an meiner Seite zu haben, war so schrecklich für mich, dass ich ganz froh war, Professor Paraffin schreiben zu können, ich müsse mich vorerst um meine Eltern kümmern und würde das kommende Semester aussetzen.
Kurz nach Silvester lernte ich dann Jean-Louis kennen. Er war der erste Mann, der mich nach Julien interessierte, und nach Monaten der intensiven Trauer um meine verlorene Liebe gelang es ihm, mich zum Lachen zu bringen. Er machte es sich zur Aufgabe, schöne Momente für mich zu zaubern und mich aus meinem Unglück zu befreien. Er kannte sich sehr gut in der Gegend um Sète aus und wir machten lange Wanderungen. Er zeigte mir die schönsten Flecken der Gegend, und anschließend aßen wir in kleinen Landgasthöfen, die nur er kannte. Bevor er mein Mann wurde, war er mein bester Freund. Jemand, auf den ich mich absolut verlassen konnte und der sich für mich hätte in Stücke reißen lassen. Dafür verliebte ich mich in ihn. Als er mich ein Jahr später fragte, ob ich ihn heiraten würde, sagte ich sofort ja.
Leider haben wir keine Kinder bekommen, und mit unserer Ehe stand es schon seit einiger Zeit nicht zum Besten. Unsere Beziehung war buchstäblich in die Jahre gekommen, immerhin waren wir jetzt dreizehn Jahre verheiratet, und sie erfüllte mich nicht mehr richtig. Ich war mir nicht sicher, ob nur ich so fühlte, und ob für Jean-Louis alles in Ordnung war. Wenn ich das Gespräch mit ihm suchte, um ein paar Dinge zu klären, dann wich er aus.
Jetzt hielten wir an einer roten Ampel, ich sah zu ihm hinüber und fing sein Lächeln auf. Sanft streichelte ich über seinen Handrücken. Ich war ihm dankbar, weil er mit mir diese Reise machte, obwohl er Paris nicht besonders mochte. Jean-Louis war nur einmal während seiner Militärzeit dort gewesen und hatte keine besonders guten Erinnerungen. Ich nahm es als ernst gemeinten Versuch von seiner Seite, unserer Ehe neuen Schwung zu geben. Und ich würde mir Mühe geben.
Zwei
Wir fuhren immer noch in Richtung der Seine, und ab und zu boten sich uns grandiose Ausblicke durch die Straßenschluchten auf die Stadt. Seit Baron Haussmann vor einhundertfünfzig Jahren die breiten Achsen durch Paris schlagen ließ, weitet sich der Blick immer wieder auf die Plätze mit ihren großen Brunnen oder Standbildern. Es gibt extra Stadtpläne mit den Grands Axes, auf denen man sehr gut sieht, wie diese Grands Boulevards die Stadt wie Arterien durchziehen.
»Da vorn kommt die Place d’Italie. Du fährst gerade rüber und in die Avenue des Gobelins.« Der Platz war so groß wie ein Fußballfeld. Während Jean-Louis ihn zur Hälfte umrundete, bestaunte ich die riesige Brunnenanlage, die in der Mitte prangte. Rund herum lagen kleine Grünflächen und dahinter erhoben sich die Siebziger-Jahre-Wolkenkratzer des 13. Arrondissements. Ich erinnerte mich, dass dieses Viertel auch Chinatown genannt wurde. Neben den modernen Bauten entdeckte ich zum Glück einige traditionsreiche Relikte: eine grüne Litfaßsäule mit dem typischen Zwiebeldach und eine Metrostation im Art-Déco-Stil.
Wir hatten inzwischen die Place Monge erreicht. Hier und in den umliegenden Straßen entdeckte ich mein altes Paris wieder: schöne Bürgerhäuser, breite Trottoirs mit Zeitungskiosken, vor denen die Menschen anstanden, Cafés und kleine Geschäfte.
»Da vorn muss irgendwo das Hotel sein«, sagte ich zu Jean-Louis. Er hatte die Adresse ins Navi eingegeben, aber ich fand es viel schöner, ihn ohne durch die Stadt zu leiten. Ich weigerte mich, auf den kleinen Bildschirm zu sehen, und ein bisschen kränkte es mich, dass er mir nicht vertraute. Schließlich kannte ich mich aus.
Je näher wir dem Quartier Latin kamen, wo unser Hotel lag, umso schöner wurden die Häuser. Ständig wies ich Jean-Louis auf etwas Sehenswertes hin. »Guck mal, da drüben, die Metrostation. Und direkt daneben die Brasserie mit der roten Markise. Das ist doch ganz in der Nähe unseres Hotels. Wollen wir da nicht heute Abend hingehen? Hast du die Balkone gesehen? Und die runden Dächer über den Erkern? Und die Schornsteine, die so schmal sind, dass sie wie Orgelpfeifen aussehen?« Ich redete ununterbrochen und ließ meiner Begeisterung freien Lauf. »Vor uns liegt die Seine, auch wenn wir sie nicht sehen. Das sind höchstens fünf Minuten zu Fuß! Oh, und in dieser Straße gab es ein Café, in dem Juliette Gréco aufgetreten ist …«
Jean-Louis atmete erleichtert aus, als wir die angegebene Adresse erreichten. Ich musste zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass das Hôtel des Grandes Écoles am Ende einer Passage lag, die von der Straße durch ein Tor getrennt war.
»Jean-Louis, was für ein schönes Hotel! Wie hast du das gefunden? Ein Garten mitten in Paris. Wie romantisch!«
»Sieht wirklich ganz nett aus«, sagte er und parkte das Auto geschickt in eine enge Parklücke.
»In Paris zieht keiner die Handbremse an«, sagte ich zu ihm, nachdem er den Motor abgestellt hatte.
»Warum denn nicht?«
»Damit man die Autos vor- oder zurückschieben kann, um besser in die Parklücke zu kommen!«
»Die spinnen, die Pariser«, sagte Jean-Louis.
Wir nahmen unser Gepäck aus dem Kofferraum und gingen durch das Tor in den Garten. Der Weg war mit Kopfstein gepflastert. In Töpfen und Beeten blühten Rhododendren und Azaleen. Der Eingang des Hotels lag am Ende des Gartens, davor standen Stühle und Tische, an denen man frühstücken oder abends einen Wein trinken konnte, dahinter erhob sich eine uralte Mauer aus großen Feldsteinen. Was für ein schöner Ort! Und wie ruhig es hier war!
Wir bekamen ein Zimmer im ersten Stock mit Blick auf den Garten. An den Wänden hingen Vintage-Tapeten, die rot auf weißem Grund Jagdszenen zeigten. Auch die Tür zum Bad war mit diesen Tapeten beklebt. Ein weißgelackter Kleiderschrank und eine kleine Sitzgruppe vervollständigten das Mobiliar. Man hätte sich wie in einem Laura-Ashley-Katalog fühlen können. Ich fand das charmant, und als ich mich auf das Bett fallen ließ und feststellte, dass es breit und bequem war, war ich rundum zufrieden.
»Das ist romantisch hier«, sagte ich zu Jean-Louis und umarmte ihn.
»Das Bad ist auch okay, große Badewanne«, sagte er und zwinkerte mir zu. »Ich fahre den Wagen schnell in eine Garage. Sonst bekomme ich noch ein Ticket.«
»Soll ich mitkommen?«, fragte ich und hoffte, er würde nein sagen.
»Nein. Bleib du mal hier. Ich bin gleich zurück.« Er küsste mich auf die Wange. »Gefällt es dir?«
Ich nickte.
Als ich allein im Zimmer war, öffnete ich die Fenster, die bis zum Boden gingen. Die Gardinen wehten leicht in der Frühlingsluft. Ich legte mich auf das Bett und atmete tief ein. Ich war wieder in Paris!
Die Stadt hatte in all den Jahren für mich nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Immer, wenn ich mich schlecht fühlte, träumte ich mich nach Paris und zurück zu dem Lebensgefühl, das ich damals dort gehabt hatte. Ich suchte nach den Erinnerungen an besonders schöne Orte oder Momente, die ich in dieser Stadt erlebt hatte. An einen magischen Abend an den Quais der Seine, als der Mond sich im Wasser gespiegelt hatte und Fledermäuse aus dem Gemäuer des Palais de Justice geschossen waren. An den Besitzer des winzigen Kinos, der mir meine Eintrittskarte mit den Worten: »Was für ein schönes Lächeln Sie haben!« zurückgegeben hatte. Nie hatte ich mich schöner und unwiderstehlicher gefühlt als damals in Paris. Nie hatte ich mehr Komplimente bekommen. Und Julien an meiner Seite hatte mein Glück vollkommen gemacht. Wenn ich an all die Hauseingänge dachte, vor denen wir uns leidenschaftlich geküsst hatten, bevor wir endlich bei ihm angekommen und ungestört waren. Einmal waren wir mitten auf einer der kleinen Brücken, die über den Canal Saint-Martin führen, in einen heftigen Sommerregen geraten. Ich wollte mich irgendwo unterstellen, aber er hielt mich einfach fest, zog mich an sich und küsste mich so stürmisch, dass ich den prasselnden Regen nicht mehr spürte. Noch heute wurde mir warm bei der Erinnerung an diese ungestüme Zärtlichkeit.
Ich lag auf dem Hotelbett und dachte nach. Wo war das alles nur geblieben? Das pure Lebensglück, das Gefühl der Allmacht? Letztlich auch die abgrundtiefe Trauer um Julien? Diese mächtigen Gefühle, die man nur haben kann, wenn man jung ist, und nach denen man sich zeit seines Lebens zurücksehnt?
Als ich auf dem Gang vor der Tür Schritte hörte, setzte ich mich auf, weil ich glaubte, Jean-Louis sei zurück. Aber die Schritte entfernten sich und am Ende des Flurs schlug eine Tür zu, es war wieder still.
Ich musste daran denken, wie Jean-Louis und ich uns kennengelernt hatten. An dem Tag ging über Sète gerade ein Sommergewitter nieder. Die können bei uns richtig heftig werden. Der Mistral bläst dazu, auf einmal ist es furchtbar kalt und ungemütlich. Ich wollte gerade Feierabend machen, als das Unwetter kam. Es goss wirklich in Strömen, und Caro, meine Freundin, rettete mich, indem sie mich anrief und anbot, mich mit dem Auto mitzunehmen. »Ich bin schon da und parke direkt vor dem Eingang«, sagte sie. Ich schnappte mir einen vergessenen Regenschirm, der allerdings sofort den Geist aufgab, als ich in den tobenden Wind hinaustrat. Hektisch sah ich rechts und links die Straße hinunter, dann entdeckte ich das kleine schwarze Auto von Caro. Ich lief die paar Schritte, was ausreichte, um klatschnass zu werden, riss die Autotür auf und warf mich auf den Beifahrersitz. »So ein Mistwetter. Jetzt guck dir meine Bluse an!«, schimpfte ich und sah an meiner weißen Bluse hinunter, die durch den Regen durchsichtig geworden war und mir am Körper klebte. Ich musste lachen. »Gut, dass mich so keiner sieht. Was ist? Willst du nicht losfahren?« Jetzt erst sah ich zur Seite. Neben mir saß ein völlig Unbekannter und grinste mich an, wobei sein Blick an meinem Dekolletee hängenblieb.
»Was machen Sie in Caros Auto?«, blaffte ich ihn an und hielt mir die Handtasche vor die Brust.
»Wer ist Caro?«, fragte er. Er stellte diese Frage ganz ernst, aber in seinen Augen konnte ich lesen, dass er sich gerade sehr amüsierte.
Ich sah mich um und stellte fest, dass ich definitiv nicht in Caros Auto saß. Sie hätte niemals einen Minifußball vom Rückspiegel baumeln lassen, außerdem würde ihr Aschenbecher überquellen.
Ich überlegte noch, was ich als nächstes tun sollte, als die Beifahrertür aufgerissen wurde.
»Ich denke, ich soll dich mitnehmen.« Das war Caro. Aus ihrem Haar tropfte es auf meinen Rock.
»Wollen Sie auch einsteigen?«, fragte der Unbekannte am Steuer. »Kommen da noch mehr?« Er konnte sich vor Lachen kaum noch beherrschen.
Ich war immer noch zu verdattert, um die Situation zu verstehen. Caro rettete mich.
»Das ist ja wohl ein Versehen. Jetzt komm schon, ich steh direkt dahinter.« Damit zog sie mich aus dem Wagen.
Am nächsten Tag kam Jean-Louis zu mir in die Tourismus-Zentrale und schenkte mir einen Regenschirm, den ich immer noch habe. Wenn ich die Geschichte erzähle, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, lachen meistens alle. Aber je häufiger ich sie erzähle, umso deutlicher wird mir, dass bereits bei unserer ersten Begegnung die Rollen zwischen Jean-Louis und mir verteilt waren.
Jean-Louis stammte aus einem wohlhabenderen Elternhaus als ich, seine Mutter arbeitete nicht, der Kühlschrank war immer voll, es gab anderes Essen, nicht nur das, was der eigene Garten hergab. Seit ich aus Paris zurück war und wieder bei meinen Eltern lebte, waren meine hochfliegenden Pläne in sich zusammengefallen. Die Sorgen um meine kranke Mutter und die Hilflosigkeit meines Vaters stutzten mich schnell wieder auf Normalmaß zurecht. Aber Jean-Louis nahm mich sozusagen an die Hand und zeigte mir erneut eine Art zu leben, die viel sorgloser und freudvoller war als das, was ich von zu Hause kannte, wo Geld immer knapp war, die drohende Arbeitslosigkeit meines Vaters immer über uns schwebte und meine Mutter immer vom schlechtesten ausging. Jean-Louis half mir, mich davon freizumachen.
Ich hatte fast ein Jahr gebraucht, um über Julien hinwegzukommen, aber ich war sicher, dass ein anderer Mann kommen würde. Mit Jean-Louis begann eine Zeit unbeschwerter Verliebtheit voller kleiner Verrücktheiten, die wir uns leisteten. Wenn wir Geld hatten, dann gaben wir es sorglos aus, wir kauften Champagner und tranken ihn am Strand, er machte mir Geschenke, er sorgte für mich. Er trug mich auf Händen, und ich war bis über beide Ohren verliebt.
Wann hatte das aufgehört? Die Ungeduld, endlich miteinander allein zu sein und Liebe zu machen? Aber auch Jean-Louis’ Großzügigkeit, seine mitreißende Lust, das Leben leicht zu nehmen und den Augenblick zu genießen?
Die Momente, in denen ich so für Jean-Louis fühlte, waren über die Jahre immer seltener geworden. Seit ich vor vier Jahren einen Posten in der Stadtverwaltung von Sète angenommen hatte, wo ich inzwischen für Kultur und Tourismus zuständig war, musste ich häufiger abends auf Veranstaltungen gehen. Ich machte Überstunden und ich verdiente genauso viel Geld wie Jean-Louis. Ich fürchtete, er hatte mich lieber gemocht, als er das Gefühl haben konnte, mein Beschützer zu sein.
Ich gab mir Mühe, den alten Jean-Louis in ihm zu sehen, aber es fiel mir zunehmend schwer. Und ihm ging es ähnlich, das spürte ich genau. Ich wusste, dass ich ihm manchmal auf den Wecker ging, und er hatte in der letzten Zeit mehr Interesse an seinem Auto und an den Fußballergebnissen als an mir. So richtig fröhlich waren wir beide eigentlich nur getrennt voneinander, wenn wir mit unseren Freunden zusammen waren. Da stimmte doch was nicht.
Ich seufzte tief, stand auf und trat an das Fenster, um hinauszusehen. Jean-Louis kam den Weg zum Hotel hinauf. Mit der einen Hand hielt er das Handy ans Ohr, mit der anderen winkte er mir zu. Er sieht immer noch gut aus, dachte ich mit einem Lächeln, und ich mag seine lässige Art zu gehen. Und dass er mir diese Reise schenkt und sogar ein Hotel in meinem Pariser Lieblingsviertel bucht, rührt mich immer noch.
Ich nahm mir vor, an diesem Wochenende alles richtig zu machen und einen Weg zurück zu Jean-Louis zu finden. Ich wollte die Gefühle unserer ersten Jahre wiederfinden, an die ich gerade so intensiv gedacht hatte. Den Gedanken an Julien schob ich zur Seite. Ich hatte Jean-Louis nie von Julien erzählt. Er hätte sofort bemerkt, wie unterschiedlich meine Gefühle für ihn und für Julien waren. Die erste große Liebe ist eine Macht, neben der ein Ehemann sehr klein aussehen kann. Ich wollte Jean-Louis nicht unnötig kränken, also erzählte ich ihm nie von diesem Teil meiner Zeit in Paris.
Ich sah wieder zu Jean-Louis, der sich umsah und dann rasch eine der großköpfigen roten Tulpen pflückte, die farblich zu der Tapete in unserem Zimmer passten, und sie hinter seinem Rücken verbarg, als er die Rezeption betrat. Ich lächelte und stellte mich vor den Spiegel, um meine Lippen nachzuziehen. Ich fing an zu hoffen, dass alles gut werden würde.
Drei
Als wir unsere Sachen ausgepackt hatten, war es schon nach acht und wir hatten Hunger. Also beschlossen wir, in der Nähe noch etwas essen zu gehen. Eine Straße weiter lag ein kleiner Platz, die mittelalterlich anmutende Place de la Contrescarpe, und an einer ihrer Ecken die Brasserie Delmas. Auf der Terrasse standen die üblichen winzigen Tische, aber die Stühle hier hatten ein buntes Geflecht in Rot und Blau. Im Inneren war der Fußboden mit alten Holzdielen belegt, und man saß in roten Plüschsesseln. Mit den Kellnern, die die vollen Tabletts über ihren Köpfen balancierten, als seien sie im Zirkus, sah das Delmas aus wie eine Werbung für ein Pariser Bistro. »Das wird mein Lieblingslokal an diesem Wochenende«, sagte ich zu Jean-Louis und steuerte einen Tisch auf der Terrasse an. Wir saßen kaum, als schon ein Kellner in einer perfekt gebundenen langen Schürze vor uns stand. »Wenn Sie sich schnell entscheiden, gilt noch die Happy Hour«, sagte er. Wir bestellten Cocktails und ich musste kichern, weil es mir so gut ging und ich viel zu schnell trank. Danach orderten wir eiskalten Crémant von der Loire, dazu gegrilltes Brot mit geschmolzenem Käse und frischem schwarzem Pfeffer. Wir genossen und beobachteten das Leben auf dem Platz vor uns. Auch auf der Place de la Contrescarpe gab es einen Springbrunnen, dieser war von Judasbäumen umstanden. Ein Clochard hatte sich dort eingerichtet, neben sich seinen Hund, mit dem er sich ein Abendessen teilte, und rundherum blühten Geranien in üppigen Kugeln vor den über die ganze Etage laufenden Balkonen. Die Häuser rund um den Platz waren alt, im ersten Stock über einem kleinen Lebensmittelladen hing ein echtes Gemälde zwischen zwei Fenstern an der Fassade. Au Nègre joyeux, stand darüber, Zum glücklichen Neger. »Ach, ist Paris schön«, seufzte ich glücklich.
Am nächsten Morgen schlug ich vor, als erstes an die Seine zu gehen. Dort, auf den beiden Inseln Cité und Saint-Louis, lagen schließlich die Anfänge der Stadt.
»Und dann erobern wir uns den Rest von Paris, indem wir die Kreise immer größer ziehen. Du wirst sehen, Paris ist gar nicht so groß. Der Weg von Sacré Cœur bis an die Seine hinunter ist nicht viel mehr als ein längerer Spaziergang.«
»An die Seine? Oh, gern. Da wollte ich sowieso hin. Ist ja ein Muss für jedes Liebespaar. Ich meine diese Brücke.«
»Welche Brücke? Meinst du den Pont Neuf? Wegen des Films?«
Jean-Louis sah mich verständnislos über den kleinen Frühstückstisch hinweg an. Wir saßen tatsächlich in der Sonne vor dem Hotel. Wir hatten die Frau, die uns bediente, gefragt, ob sie uns das Frühstück nach draußen bringen würde. Jean-Louis strich sich Erdbeermarmelade auf sein Buttercroissant, bevor er sagte: »Ich meine diesen Pont des Arts. Wo die ganzen Schlösser hängen.«
Ich erinnerte mich, darüber gelesen zu haben. Die Eisengeländer dieser Brücke waren mit Abertausenden von Vorhängeschlössern behängt, auf die Liebespaare ihre Namen geschrieben hatten. Die Schlüssel wurden dann in den Fluss geworfen. »Da willst du hin? Und ein Schloss aufhängen?«
Er sah mich mit hochgezogenen Brauen an. »Wir sind doch ein Liebespaar, sogar auf Hochzeitsreise.«
Das stimmte, das konnte ich nicht leugnen. Jean-Louis liebte solche Sachen, die gerade alle machten. Er hatte mit seinen Kollegen auch die Ice Bucket Challenge mitgemacht und hätte sich einen Selfie-Stick gekauft, wenn ich nicht protestiert hätte, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie ein x-beliebiger Tourist mit einem Selfie-Stick durch Paris zu laufen.
»Okay, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Bis dahin können wir laufen, es ist nur ein Katzensprung.«
»Ich überlege, ob ich vorher noch mal schnell nach dem Auto sehe. Nur um sicher zu sein, dass es noch dort steht …«
Das war mir ganz recht. »Gut, mach das. Ich bleib hier einfach in der Sonne sitzen, bis du wieder da bist.«
»Und schwelgst in Erinnerungen?«, fragte er mit einem Lächeln.
»Gute Idee«, gab ich zurück.
Ich trank meinen Kaffee und legte den Kopf in den Nacken, um die umliegenden Häuser zu betrachten. Auf einem Balkon im dritten Stock war eine Frau dabei, die Blumen zu gießen. Auf dem Nachbarbalkon las ein Mann die Zeitung, ein Radio dudelte leise vor sich hin. In einer Kastanie saß ein Schwarm Spatzen und zwitscherte. Die Vögel kamen angeflogen, als ich ein paar Brotkrümel neben meinen Stuhl fallen ließ.
Ich nahm meinen Stadtplan heraus, um nachzusehen, wie weit es von unserem Hotel bis zur Sorbonne war und stellte fest, dass ich nur ein paar Straßen von meinem früheren täglichen Weg entfernt war. Ich schluckte. Nur zwei Metrostationen entfernt war ich immer ausgestiegen. Und nach den Vorlesungen hatte ich oft mit Julien in der Bar an der Ecke einen Kaffee getrunken … Mir wurde plötzlich unbehaglich. Ich fragte mich, ob ich den Mut haben würde, neben Jean-Louis dort entlangzugehen, womöglich im selben Café zu sitzen, am selben Tisch. Und wäre es ihm gegenüber fair?
»So, wir können.« Jean-Louis stand plötzlich vor mir.
Wir verließen den Garten durch das schöne Tor und wandten uns nach rechts. Die Straße fiel hier steil zum Fluss hin ab, denn das 5. Pariser Arrondissement lag auf dem Hügel von Sainte Geneviève, der Schutzheiligen der Stadt. Gleich um die Ecke unseres Hotels hing an einem Wohnhaus eine Plakette, die besagte, dass Ernest Hemingway hier in den Jahren 1922 und 1923 mit seiner ersten Frau Hadley gewohnt hatte. Ein Stück weiter konnten wir links die Reste der ehemaligen Stadtmauer sehen. Dahinter erhob sich die riesige Kuppel des Panthéon, ein anderes Schild wies auf die Arenen von Lutetia hin. Viele Nebenstraßen hatten noch ein Kopfsteinpflaster.
»Ich hätte nicht gedacht, dass es in Paris noch derart ländliche Ecken gibt«, bemerkte Jean-Louis.
»Wir sind im ältesten Teil der Stadt. Hier gibt es die letzten erhaltenen Reste der römischen Zeit. Und bis hier sind die Baupläne von Baron Haussmann nicht vorgedrungen. Das Viertel gehörte lange Zeit nicht mal zu Paris.«
»Gefällt mir.«
»Warte, bis du die Seine siehst«, sagte ich.
Am Ende der Rue Cardinal Lemoine öffnete sich das Blickfeld und wir standen direkt gegenüber der Insel Saint-Louis. Hier schmiegten sich die gediegensten und elegantesten Häuser von Paris aneinander und erhoben sich über Trauerweiden und den Fluss. Die Kaimauern glänzten weiß in der Sonne, auf den Bänken saßen Menschen. Wir gingen bis zur Mitte der Brücke und lehnten uns an die Brüstung, um das Panorama zu genießen. Unter uns glitzerte das Wasser der Seine in der Sonne, darüber lag das frische Frühlingsgrün der Bäume, dann folgten die Sandsteinfassaden der Häuser mit ihren bodentiefen Fenstern, den geschmiedeten Balkongittern, darüber die Kupferdächer in Grün oder Grau und über allem ein strahlender Pariser Frühlingshimmel mit einzelnen Schönwetterwolken. Wir waren sprachlos angesichts der Schönheit, die sich uns bot.
Arm in Arm schlenderten wir weiter bis auf die Insel und nahmen an ihrem Ende eine kleine Brücke, um auf die Ile de la Cité zu gelangen. Seitlich vor uns erhob sich die Rückseite von Notre-Dame. Auf der Uferpromenade zeigten Artisten und Künstler den Touristen ihre Künste. Eine Gruppe von bunt gekleideten jungen Menschen produzierte auf Eimern und Kochtöpfen mitreißende Klänge. Um sie herum hatte sich eine kleine Menschentraube gebildet, einige machten Tanzbewegungen und wir mussten uns an ihnen vorbeidrängeln. Ein paar Meter weiter stand ein alter Mann und verkaufte Avocados, drei Stück für drei Euro. »Pass bloß auf deine Tasche auf«, flüsterte Jean-Louis mir zu. Aber ich fühlte mich so gut, dass ich keinen Gedanken daran verschwendete.
Wir gingen seitlich an Notre-Dame vorbei, bis wir auf einen kleinen Platz unter Bäumen gelangten. Hier standen einige lange gläserne Pavillons mit grünen Dächern nebeneinander, in denen Blumenhändler ihre Stände hatten. Wir gingen durch einen dieser Pavillons und waren von den Düften Tausender Blumen umgeben. Tulpen, Rosen, Hortensien, Maiglöckchen …, daneben Grünpflanzen und Kakteen. Es war ein wahres Farbenmeer, sogar die Rinnsteine quollen über von abgefallenen Blütenblättern. Vor den Ständen hingen altmodische Volièren, in denen Papageien und Singvögel saßen. Sie sangen und kreischten um die Wette, als wollten sie die Passanten überreden, sie zu kaufen. Ich kannte diesen Markt von früher. Ich war oft hier gewesen und manchmal hatte ich mir einen Strauß Blumen geleistet. Und da stand auch die Bank, auf der ich oft gesessen hatte, um dem bunten Treiben zuzusehen. Ich griff nach Jean-Louis’ Hand und drückte sie fest, weil ich so bewegt war.
»Wo ist denn jetzt diese Brücke?«, fragte er.
Zum Abschied steckte ich meine Nase in einen Fliederbusch, der seinen betörenden Duft über all den anderen Blüten verströmte, und zog Jean-Louis hinter mir her. Wir gingen bis zum spitzen Ende der Insel, bis zur Place Dauphine. Ich zeigte mit dem Finger nach vorn.
»Und das ist der Pont Neuf. Die nächste Brücke ist der Pont des Arts, die mit den Schlössern«, sagte ich.
Die Kulisse, die sich uns auf den breiten Trottoirs unter den Platanen bot, war atemberaubend. Dies war das Paris der Monumente und der architektonischen Wunder. Vor uns lag das Institut de France, auf der anderen Flussseite die hundert Meter lange Front des Louvre. Und davor saßen völlig unbeeindruckt von der Kulisse die Angler. Mir kamen die vielen Filmszenen in den Sinn, die hier spielten: Liebespaare, die sich eng umschlungen hielten, wilde Verfolgungsjagden, oder Selbstmörder, die aus verschmähter Liebe ins Wasser gingen.
Die ersten Bouquinisten waren dabei, ihre grün bemalten Kästen zu öffnen und ihre Bücher auszulegen. Während meiner Paris-Zeit waren sie eine Fundgrube für alte Stiche, Plakate, Kunstbücher und andere Trouvaillen gewesen, die ich nach zähen Verhandlungen kaufte. Ich hielt den Atem an, als ich fünfzig Meter vor uns den Stand des alten Monsieur Flandel sah. Ich hatte oft mit ihm geplaudert und ihm erzählt, dass ich Kunstgeschichte studierte. »Ah, voilà la petite Mademoiselle Renard«, hatte er mir immer zugerufen und dabei mit seinen langen Armen gewedelt. »Ich glaube, ich habe heute etwas ganz Besonderes für Sie.«
Ich beschleunigte meinen Schritt, weil ich mich so freute, ihn wiederzusehen. Aber neben den Auslagen saß zu meiner Enttäuschung ein Fremder. Als ich jedoch um den Stand herumging, entdeckte ich noch seinen Namen, klein mit gelber Farbe an der Seite gemalt: E. Flandel, bouquiniste. Ich stöberte durch die Auslagen und nahm einige der in Plastik eingeschlagenen Bücher aus dem Regal. Dabei sah ich den Verkäufer an und fragte mich, ob er den alten Monsieur Flandel wohl gekannt hatte. »Vous cherchez?«, fragte er mich nach meinen Wünschen. Ich schüttelte den Kopf, aber dann entdeckte ich eine zerlesene Ausgabe von Hemingways Paris-Roman: Paris – ein Fest fürs Leben und kaufte sie. Wegen Hemingway, der neben unserem Hotel gewohnt hatte, und wegen Monsieur Flandel.
Unten auf dem Fluss waren Hausboote und Ausflugsdampfer vertäut. Zwei Schwäne glitten über das Wasser und steckten die Schnäbel zusammen. Auf der anderen Seite kamen über den grünen Kronen der Bäume die verzinkten Dächer in den Blick, die in der Vormittagssonne leuchteten.
»Bleib mal stehen«, sagte Jean-Louis zu mir. »Das habe ich schon so oft in alten Filmen gesehen, jetzt will ich mal wissen, wie sich das anfühlt.« Er drehte sich zu mir herum und küsste mich. Jean-Louis konnte gut küssen, seine Lippen waren weich, und er saugte manchmal zärtlich an meiner Unterlippe, was mich zuverlässig erregte. Und dennoch musste ich in diesem Moment an Juliens Kuss im strömenden Regen denken. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und nahm Jean-Louis’ Hand, als wir weitergingen.
Der Pont des Arts war allerdings eine Enttäuschung, zumindest für mich. Vor lauter Vorhängeschlössern konnte man die Brücke gar nicht sehen, sie wuchsen sogar die Laternenpfähle hinauf und erinnerten mich an Geschwüre. Einzelne Teile der Brücke waren mit Sperrholzplatten verkleidet und verschandelten sie zusätzlich.
»Da sind Teile des Geländers ins Wasser gefallen, weil sie von den Schlössern zu schwer waren«, sagte Jean-Louis. Er kannte sich mit solchen Sachen aus, denn er war Ingenieur und arbeitete für die Stadtverwaltung in Sète in der Abteilung Schleusen und Brücken.
»Und das liegt jetzt alles im Wasser?«, fragte ich und beugte mich über das Geländer. Jean-Louis umarmte mich und zog mich ein Stück zurück.
»Ich will doch nicht, dass du reinfällst«, murmelte er an meinem Ohr. »Und jetzt bringen wir ein Schloss an.«
Das war offensichtlich das Stichwort für die fliegenden Händler, die uns schon länger umkreisten. Sie boten ihre Schlösser feil, die alle gleich aussahen und alle fünf Euro kosteten. Jean-Louis winkte ab und zog ein Schloss aus seiner Hosentasche. »Ich bezahle doch keine fünf Euro, wenn ich die bei Monsieur Bricolage für zwei kriegen kann«, sagte er und hielt es den Händlern unter die Nase.
Ich hätte mich ja leichter mit diesem Ritual getan, wenn ich damit wenigstens einem der Händler einen Umsatz beschert hätte. Irgendwie fühlte ich mich unwohl, die Romantik war mir vergangen.
»Ich habe auch schon unsere Namen draufgeschrieben, siehst du?«
Ich nickte. »Irgendwie ist das aber auch eine merkwürdige Auffassung von Liebe«, gab ich zu bedenken. »Man sperrt seine Liebe sozusagen ein und dann wirft man auch noch den Schlüssel weg. Und verschandelt nebenbei eine der schönsten Brücken von Paris. Und für die Umwelt …«
»Jetzt reicht es aber. Hör auf, immer zu moralisieren. Es ist einfach nur eine Geste, etwas, das Verliebte tun.«
Ich nickte noch einmal. Jean-Louis musste sich ziemlich strecken, um eine freie Stelle an dem Eisengeflecht zu finden, wo er das Schloss anbringen konnte.
Ich lehnte mich mit dem Rücken an das Geländer. Ich hatte schon die ganze Zeit über Blicke hinüber zur École des Beaux Arts geworfen, deren Fassade sich nur wenig entfernt zur Seine hin erhob. Wäre ich allein gewesen, wäre ich vielleicht hinüber gegangen und durch die vertrauten Gänge und Säle des Hauses gestreift. Ich sah die hohe Eingangshalle vor mir, unter einer Decke, die zum Teil aus hölzernen Kassetten gemacht, zum Teil mit Ornamenten bemalt war. Eine Haupttreppe führte geradeaus über die ganze Breite zwischen zwei Marmorsäulen auf eine dreiteilige Glasfront zu, die einen Einblick in den Hauptsaal gab. Unter dem gewölbten, über und über mit Fresken bemalten Tonnendach, dessen oberes Drittel aus Glas war, um Licht in das Atelier zu lassen, hingen die Bilder der ehemaligen Schüler in prunkvollen Goldrahmen.
Am meisten hatten mir neben den Decken die Türen gefallen. Sie hatten ein seltsames Format, sie waren breiter als normal und wirkten durch die armdicken, verzierten Rahmen noch breiter. Vielleicht hatte Professor Paraffin sogar noch sein Büro dort? Meine Freude schlug um in Ernüchterung. Und was sollte ich ihm sagen, wenn ich ihm begegnete? Was auf seine Frage antworten, warum ich nie auf seine Briefe geantwortet hatte. Warum kommen Sie nicht zurück nach Paris? Sie sind eine meiner besten Studentinnen.
Ich hatte auf seine freundlich-besorgten Fragen nicht einmal reagiert. Was hätte ich auch sagen sollen?
Dass mir die Kraft und der Mut gefehlt hatten, mich gegen meine Eltern durchzusetzen? Dass ich mich so wertlos gefühlt hatte, nachdem Julien mich verlassen hatte? Dass ich ganz froh gewesen war, als Jean-Louis mir ein umsorgtes Leben in emotionaler Sicherheit geboten hatte? Dass ich lieber den leichteren Weg gegangen war, meine Träume vergessen und geheiratet hatte? Und dass ich jetzt das Sommerprogramm für die Touristen in Sète gestaltete und mein vielversprechendes Forschungsvorhaben aufgegeben hatte?
»So, fertig. Da hängt jetzt der Beweis für unsere Liebe.« Jean-Louis wies mit dem Finger auf eines der Schlösser. »Was ist denn?«, fragte er dann. »Wieso bist du auf einmal so komisch? So schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Alle machen das.«
Ich sah noch einmal zur École hinüber. Wenigstens daran vorbeigehen wollte ich, deshalb schlug ich vor, durch Saint-Germain zu spazieren, den Stadtteil, der sich dahinter erstreckte. Die engen Straßen waren von teuren Boutiquen, Galerien und Lebensmittelgeschäften gesäumt. Einige der Eingänge waren richtig alt, die Schaufenster trugen noch schwer an ihren verwitterten Holzrahmen. Die Auslagen sahen aber in jedem Fall kostbar aus. Ich blieb vor fast jedem Geschäft stehen. In einem der vielen Antiquitätenläden gab es filigrane Reisenecessaires aus dem 18. Jahrhundert in mit Samt ausgeschlagenen Schatullen, die die Form von Pianos hatten. Jedes einzelne Messer mit dem Elfenbeingriff passte haargenau in die dafür vorgesehene Vertiefung. Und kein Stück fehlte.
Ein paar Häuser weiter hatte eine Blumenhändlerin ihre Ware rund um das Schaufenster in Körben aufgehängt. Die Blumen schienen aus der Wand zu wachsen. Im Inneren schwebten Mooskugeln von der Decke, aus denen weiße Callas und Lilien wuchsen. »Wo haben die Pariser all diese Ideen her?«, fragte ich Jean-Louis.
Spätestens, als wir links von uns in die unglaublich schmale Rue Saint-André-des-Arts mit ihren Buchhandlungen, winzigen Kinos und Bistros einbogen, hörte ich auf zu grübeln. Vor den mehrstöckigen Hôtels Particuliers, den jahrhundertealten Privatpalästen der Adligen, saßen Studenten und Angestellte beim späten Mittagessen. Ab und zu öffnete sich ein mächtiges zweiflügeliges Tor in diesen Häusern und gewährte uns einen neugierigen Blick in die grünen Innenhöfe. Vor einem winzigen russischen Restaurant fanden wir einen Tisch in der Sonne und bestellten Blinis mit Lachs.