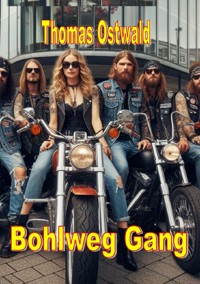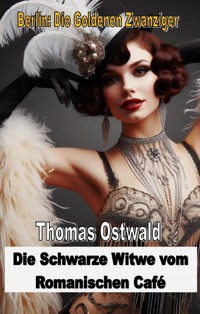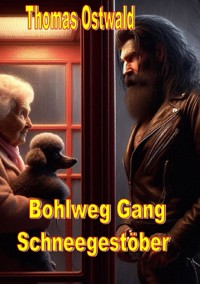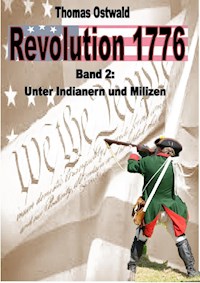
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Revolution in den nordamerikanischen Kolonien! Friedrich Oberbeck und seine Freunde, die sich in Deutschland als Scharfschützen der Jägerkompanie anwerben ließen, werden nach kurzer Winterpause wieder in gefährliche Kämpfe verwickelt. Indianergruppen der Mohawk unterstützen sie in diesem Krieg. Mitten im dichtesten Kampfgewühl müssen die Jäger miterleben, wie Friedrich von einer Kugel getroffen wird und im Wasser versinkt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Ostwald
Revolution 1776 – Krieg in den Kolonien
Band 2 – Unter Indianern und Milizen
Edition Corsar
Alle Rechte vorbehalten.
Überarbeitete und ergänzte Ausgabe des
Romans „Auf unsers Carls Befehl“
© Edition Corsar Dagmar und Thomas Ostwald 2021 Braunschweig
1.
„Indianer! Die Roten kommen!“
Dieser Ruf ging wie ein Lauffeuer von Zelt zu Zelt, durch das gesamte riesige Militärlager. Die Wachtposten hatten eine Gruppe Indianer gemeldet, und jetzt wollte sie jeder sehen. Es waren schließlich die ersten, die sie überhaupt zu Gesicht bekamen, und deshalb drängte sich alles, was dienstfrei hatte, vor den Stabszelten.
General Riedesel und seine Offiziere waren vor die Zelte getreten, um die indianischen Verbündeten zu begrüßen.
Es waren gut vierzig Mohawk-Krieger, die stolz und aufrecht durch die Zeltreihen schritten, ohne auch nur links oder rechts zu sehen. Sie wurden angeführt von einem großen, kräftigen Mann, der einen roten Uniformrock trug. Sein Kopf war bis auf einen kleinen Schopf kahlgeschoren, wie auch bei den anderen. Der breite, muskulöse Oberkörper zeichnete sich deutlich unter der weit geöffneten Uniform ab. Sonst trug er keinerlei Schmuck, keine Kette, kein Silberstück in den Ohren oder der Nase, wie sie viele seiner Begleiter aufwiesen. Schlichte, dunkelblaue Leggins und ein Lendenschurz bildeten den Rest seiner Kleidung. Im Arm hielt er eine britische Muskete, das Pulverhorn hing ihm von der Schulter, in einem geschlungenen Wollgürtel steckten Messer und Axt.
Er ging mit gemessenem Schritt auf die versammelten Offiziere zu, blieb direkt vor dem General stehen und sah ihm prüfend ins Gesicht. General Riedesel zögerte keinen Moment und streckte ihm die Hand entgegen.
„Herzlich willkommen, Chief. Eure Krieger wurden mir bereits angekündigt, ich bin erfreut, dass Ihr so schnell kommen konntet.“
Das Gesicht des Indianers verriet mit keiner Miene, was er von seinen neuen Verbündeten hielt. Seine dunklen Augen hatten blitzschnell die Offiziere gemustert, gleichzeitig streckte er dem General die Hand entgegen.
„Grauer Bär grüßt den General. Wir sind gekommen, mit euch zu kämpfen gegen die American.“
Mit kräftiger, kehliger Stimme hatte der Mohawk diese englischen Worte gesprochen. Auf ein Zeichen wurden von den Ordonanzen die klappbaren Feldstühle geholt, der General und sein Gast setzten sich. Die Offiziere standen um die beiden, die übrigen Indianer bildeten einen Halbkreis um die Gruppe und setzten sich einfach ins Gras.
General Riedesel hatte die Krieger prüfend betrachtet und sofort festgestellt, dass ihre Bewaffnung in sehr schlechtem Zustand war. Neben ihren traditionellen Messern und Äxten hatten nur wenige Gewehre. Dabei handelte es sich um alte Musketen, zum großen Teil in einem bedauernswerten Zustand.
Nach den ersten Worten musste ein Dolmetscher vermitteln. Die Indianer verstanden natürlich kein Deutsch, dafür aber recht gut englisch und französisch. Der Graue Bär erwies sich als überaus intelligenter Redner, pries die Vorzüge der Briten und Deutschen und verkündete, dass man gemeinsam gute Beute machen würde. Während der Reden saßen seine Krieger wie Statuen aus Bronze unbeweglich und lauschten. Die Offiziere musterten sie möglichst unauffällig, was die Indianer nicht weiter zu beachten schienen. Keiner der Mohawk konnte älter als Anfang Zwanzig sein, obwohl sich das schlecht einschätzen ließ. Die Männer waren gut genährt und wirkten, wenn sie sich bewegten, kraftvoll und geschmeidig.
Auf ein Zeichen des Generals trat jetzt eine Gruppe Musketiere heran, die in den Armen Bündel mit neuen Armeegewehren trugen. Sie wurden auf Decken abgelegt.
„Der Graue Bär ist ein mächtiger Krieger. Er wird noch mächtiger sein, wenn er diese Gewehre annimmt, die ihm der Herzog von Braunschweig schenkt!“, verkündete der General.
Jetzt zeigte sich erstmals eine Regung im Gesicht des Indianers. Seine Augen leuchteten, als die Gewehre vor ihm abgelegt wurden.
„Sag dem Herzog, dass wir Brüder sind. Mit diesen guten Waffen werden wir die Amerikaner nicht zur Ruhe kommen lassen. Eure Feinde sind unsere Feinde.“
Einer der Offiziere hatte ihm eine Jägerbüchse in die Hand gegeben, und mit geschickten Bewegungen untersuchte er das Schloss. Seine Finger zogen den Hahn auf, betätigten den Abzug und ließen den Hahn behutsam wieder auf die Pfanne zurück. Der Mohawk war sichtlich von dieser kurzen Waffe und ihrem gezogenen Lauf beeindruckt. Er sah in die Mündung, fuhr mit dem Finger hinein und nickte. Seine Krieger erhielten die gewöhnlichen Musketen mit glattem Lauf.
„Gutes Gewehr. Wir sind sehr zufrieden.“
Die erste Unterredung war beendet. Die Indianer schlugen ihr Lager in der Nähe auf. Sie sollten in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Jägern den Feind und seine Stellungen auskundschaften. Außerdem sollten einige von ihnen gemeinsam jagen, um etwas Abwechslung auf den Speiseplan der Soldaten zu bringen.
* * *
Sie hatten sich unter den Zweigen des Waldrandes geduckt und konnten von hier aus den Verlauf der unbefestigten Straße überblicken. Jetzt deutete der Mohawk auf einen entfernten Punkt.
Im gleißenden Sonnenlicht blinkten Waffen, die Umrisse eines Fuhrwerks wurden erkennbar, Reiter begleiteten ihn.
„Ein Versorgungszug“, sagte Eggeling halblaut und gab das ausgezogene Monocular an Friedrich. Die Jäger hatten sich zusammen mit den Indianern am Waldrand verteilt und geschickt jede natürliche Deckung genutzt.
„Worauf warten wir, Sergeant? Holen wir uns das Zeug!“
Arnold schob sich neben den Unteroffizier, aber der schüttelte den Kopf.
„Heute nicht. Wir beobachten und überwachen nur. Eine solche Gelegenheit wird es immer wieder geben. Noch wissen wir zu wenig über die Stärke der Amerikaner im Fort.“
Der kastenförmige Wagen war jetzt deutlich erkennbar. Sechs Maultiere zogen ihn und wurden von dem Kutscher immer wieder angetrieben. Der Weg stieg jetzt kräftig an und führte dann in einem Bogen vom Waldrand weg auf die leichten Hügel. Dort arbeiteten die Amerikaner verbissen am Wiederaufbau eines kleinen Forts. Die Jäger hatten den Platz aus der Ferne beobachtet. Aber zwischen Wald und Palisadenzaun lag eine zu große freie Fläche, um unbemerkt dichter heranzukommen.
Die Männer erkannten deutlich die Reiter, die offensichtlich erschöpft waren und unter der starken Hitze litten. Sie mussten schon einen langen Weg hinter sich haben, und hielten sich nur noch mit Mühe im Sattel.
Dann überschlugen sich die Ereignisse so schnell, dass keiner der Soldaten hinterher mehr sagen konnte, wie es eigentlich passiert war.
Ein Schuss krachte, und der Kutscher stürzte mit einem Aufschrei vom Bock. Pferde scheuten und bäumten sich plötzlich auf. Die Amerikaner versuchten, hinter dem Kastenwagen Deckung zu finden, als in rascher Folge weitere Schüsse vom Waldrand krachten.
Friedrich griff völlig gelassen in die mit einem Griff geöffnete Patronentasche vor seinem Bauch, zog eine Papierpatrone heraus, riss sie mit den Zähnen auf und schüttete das Pulver in den Lauf. Im nächsten Augenblick hatte er die Kugel hinuntergestoßen, das Pulver auf die Pfanne gegeben, erneut angelegt und geschossen. Der Reiter kippte lautlos nach hinten aus dem Sattel und krachte in den Staub. Friedrich schenkte ihm keine weitere Beachtung, sondern lud erneut. Er wusste, dass er den Mann direkt in den Kopf getroffen hatte.
Beißender Pulverrauch hatte sich am Waldrand ausgebreitet und nahm die Sicht. Die Jäger rückten bereits vor, Sergeant Eggeling erreichte den Kampfplatz zuerst, hinter ihm Friedrich und ein Mohawk.
Vorsichtig, mit schussbereiter Waffe, näherten sie sich dem Fahrzeug. Aber hier lebte niemand mehr, jede Kugel hatte tödlich getroffen. Die Maultiere zerrten ängstlich in ihrem Geschirr und ruckten mit dem Gespann trotz festgestellter Bremse immer ein Stück vor. Die reiterlosen Pferde standen neben den Toten, schnaubten leise, ihre Flanken bebten.
Als der Sergeant die Lage überblickt hatte, sicherten die Jäger bereits den Kampfplatz vorschriftsmäßig. Sie hatten eine auseinandergezogene Kette gebildet und beobachteten besonders den Weg zum Fort hinunter.
Friedrich Oberbeck warf einen scheuen Blick auf die Toten. Das waren die ersten Revolutionäre, die er so nah erlebte. Sie sahen kaum anders aus als sie, waren zwischen zwanzig und dreißig Jahren alt und hatten alle wettergebräunte Gesichter. Ihre unterschiedliche Uniformierung wies sie als Milizsoldaten aus. Zwei trugen blaue, drei braune Uniformröcke, die drei anderen hatten gefranste Baumwolljacken mit doppeltem Kragen an. Ein Mann war barfuß, einer hatte Lederschuhe, die anderen Holzpantinen. Grotesk verkrümmt lagen sie, wie sie getötet wurden. Einige auf dem Gesicht, die anderen auf dem Rücken, mit weit aufgerissenen Augen, offenem Mund. Der Jäger wandte sich ab und schluckte. Das unangenehme Gefühl, das in ihm seit dem Schusswechsel aufgestiegen war, versuchte er zu ignorieren.
Eggeling löste die Plane etwas und schlug sie zurück.
„Das lässt sich sehen, Leute. Scheint in erster Linie ein Waffentransport zu sein. Aber verdammt, Oberjäger, wie konnte das passieren? Wer hat geschossen?“
Friedrich zuckte die Schulter.
„Ich habe nach dem ersten Schuss sofort gefeuert. Aber ich kann nur sagen, dass dieser Schuss seitlich von mir abgegeben wurde.“
„Verdammt, da waren doch nur die Mohawk, wie kommen die dazu ...“
Er sah sich mit wildem Blick um und entdeckte einen der Indianer, der sich gerade mit einem Messer in der Hand über einen der Toten beugte.
„Was machst Du, Kanaille?“, schrie er den Mann an und sprang im selben Augenblick auf ihn zu. Der Mohawk hatte den Haarschopf des Toten gefasst und schwang eben sein Messer, als ihn der Sergeant anstieß. Erstaunt sah er ihn an.
„Die Toten werden nicht verstümmelt, verstanden?!“, bellte der Sergeant in seinem gewohnten Befehlston. Der Indianer verstand zwar seine Worte nicht, erkannte wohl aber die Bedeutung. Er zuckte nur mit der Schulter und wollte eben erneut das Messer ansetzen, als mit einem satten, klatschenden Geräusch eine Kugel zwischen ihm und dem Sergeanten in das Holz des Wagens einschlug.
„Amerikaner!“, kam der Alarmruf eines Jägers, im gleichen Augenblick wurde das Feuer erwidert. Offensichtlich war eine Gruppe aus dem Fort dem Transport entgegengeeilt. Die Schüsse mussten selbst auf diese Entfernung gehört worden sein.
Die Jäger verteilten sich um den Wagen und gaben zwei Salven auf den anrückenden Feind ab. Die Wirkung war auch hier verheerend. Die Gewehre der Amerikaner trugen kaum über eine so weite Entfernung, von sicheren Schüssen konnte überhaupt nicht die Rede sein. Umso sicherer jedoch waren die Salven der Jäger, und die Amerikaner zogen sich schleunigst wieder zurück.
„Klaus, Arnold, Erich, sofort auf den Wagen und weg hier!“, kommandierte Friedrich. Sergeant Eggeling hatte ihm nur kurz zugenickt und sich bereits auf die Ladefläche geschwungen, Friedrich folgte ihm.
Die Bremse wurde gelöst, die Peitsche knallte, und die durch die Schüsse erneut nervös gewordenen Mulis zogen an. Arnold hatte die Zügel genommen und lenkte in einem kleinen Bogen auf den Weg zurück, dann ließ er die Tiere galoppieren.
Niemand sah sich nach den Indianern um. Sie waren völlig frei in ihren Bewegungen und konnten sich den Soldaten anschließen oder getrennt von ihnen zum Lager zurückeilen.
In wilder Fahrt erreichten die Jäger mit ihrem Gefährt den Waldrand, fanden einen Einlass zwischen den Bäumen und jagten in atemberaubender Fahrt zwischen den oft dicht stehenden Bäumen und Büschen hindurch.
Arnold stand auf dem Bock, die Zügel in der einen Hand, die Peitsche in der anderen. Der Dreispitz war ihm vom Kopf gerissen, die langen braunen Haare lösten sich aus dem Zopf. Er war in seinem Element.
Prasselnd schlugen Zweige und Äste gegen die Plane, auf der die Jäger lagen und sich bemühten, nicht den Halt zu verlieren. Sie wurden hin- und her geschleudert, in wilder Fahrt trieb Arnold die Tiere immer wieder an. Endlich hatte er eine Lichtung erreicht und bremste das Fuhrwerk ab.
„Hohoo! So ist es recht, meine Guten, brav gelaufen!“
Er stellte die Bremse fest und wickelte die Leinen auf. Die Maultiere standen mit fliegenden Flanken, weit geblähten Nüstern und Schaum vor dem Maul.
„Donnerwetter, ich lebe noch!“, ließ sich Klaus vernehmen und rappelte sich aus dem Fuhrwerk hoch. Auch die anderen folgten ihm. Der Sergeant und sein Oberjäger standen schon auf dem weichen Waldboden und sahen sich um. Eggeling warf einen Blick auf den Kompass.
„Hier geht es weiter, in südwestlicher Richtung liegt das Camp. Wir werden wohl mit dem Fuhrwerk einen halben Tag benötigen. Alles absitzen, Zeit für eine Pause. Wir rasten eine halbe Stunde, die Tiere sind sonst am Ende und wir bringen das Fuhrwerk nicht mehr zurück. Alles in Ordnung, Oberbeck?“
Der Sergeant hatte beobachtet, wie der Oberjäger einmal prüfend um das Fuhrwerk gegangen war und auch an den Rädern rüttelte.
„Jawohl, Sergeant. Alles heil geblieben.“
„In Ordnung. Rundumsicherung einnehmen. Wir wollen vor Überraschungen sicher sein.“
Wortlos verteilten sich die Männer so über die Lichtung, wie sie es gelernt hatten. Jeder fand ausreichend Deckung unter den Bäumen und hatte freies Schussfeld vor sich. Die Jäger ließen auch in ihrer Aufmerksamkeit während ihres kargen Essens nicht nach. Alle hatten Brot und ein Stück Fleisch in ihrem Fellranzen.