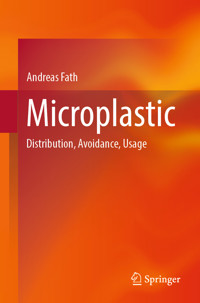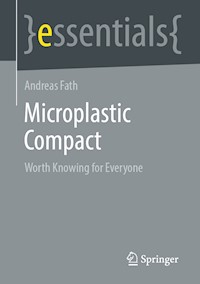Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sommer 2014: Ein Professor bezwingt Deutschlands mächtigsten Strom. Andreas Fath schwimmt die 1.231 Kilometer von der Quelle des Rheins bis zu dessen Mündung. Das Anliegen des Chemikers, der mit seinem Team unterwegs Wasserproben nimmt: für einen effektiven Schutz unserer Gewässer zu werben. Seine Analysen belegen eine bedenkliche Zunahme von Mikroplastik-Partikeln sowie Hinweise auf Medikamente und Drogen mit ungeklärten Auswirkungen auf unsere Umwelt. „Rheines Wasser“ ist die packende Erzählung eines großen Abenteuers – und ein Plädoyer für den sorgsameren Umgang mit dem kostbarsten Rohstoff der Welt. Damit wir die Gewässer effektiver schützen und verhindern, dass Antibiotika in unserem Trinkwasser landen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Professor bezwingt Deutschlands mächtigsten Strom. So schnell wie niemand zuvor schwimmt Andreas Fath in 25 Etappen die 1231 Kilometer von der Quelle des Rheins in den Alpen bis zur Mündung in die Nordsee. Das Anliegen des Chemikers, der mit seinem Team unterwegs Wasserproben nimmt: für einen effektiven Schutz unserer Flüsse und Gewässer zu werben. Seine wissenschaftlichen Analysen belegen eine bedenkliche Zunahme von Mikroplastikpartikeln und geben Hinweise auf Medikamente, Süßstoffe und Korrosionsschutzmittel mit ungeklärten Auswirkungen auf unser Ökosystem.
Rheines Wasser ist die packende Erzählung eines großen Abenteuers – und ein Plädoyer für den sorgsameren Umgang mit dem kostbarsten Rohstoff der Welt. Damit wir die Gewässer effektiver schützen, Wasser sparen, klügere Abwassersysteme installieren und verhindern, dass Antibiotika und Mikroplastik in unserer Nahrung und in unserem Trinkwasser landen.
Hanser E-Book
Andreas Fath
Rheines Wasser
1231 Kilometer mit dem Strom
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-44993-0
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich
© Mario Siebold
Satz: Greiner&Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
I. PROLOG – ICH UND DAS WASSER
II. MIT DEM STROM
1. Die Geburt einer Idee
2. Im Grand Canyon Europas – der Vorder- und Alpenrhein
Sonntag 27. 07. 2014 Haslach: Der Tag davor
Montag 28. 07. 2014 Tomasee – Ilanz (52km): Anthropogene Spuren in den Alpen
Dienstag 29. 07. 2014 Ilanz – Chur (26km): »Gegen die Natur machst du immer den Zweiten«
Mittwoch 30. 07. 2014 Chur–Ruggell (56km): Unter Schweizer Brücken
Donnerstag 31. 07. 2014 Ruggell – St. Margrethen (30km): Die verpasste Abzweigung
3. Im Bodensee
Freitag 01. 08. 2014 St. Margrethen – Uttwil (38 km): Magenprobleme bei Traumwetter
Samstag 02. 08. 2014 Uttwil – Konstanz (15 km): Gut gefettet und geölt
Sonntag 03. 08. 2014 Konstanz – Stein am Rhein (24 km): Abschied vom Bodensee
4. Hochgefühle im Hochrhein
Montag 04. 08. 2014 Stein am Rhein – Eglisau (50 km): Der Rhein ist eine riesige Plastikmühle, Teil 1
Dienstag 05. 08. 2014 Eglisau – Bad Säckingen (56 km): Wie ein Korken in der Waschmaschine
Mittwoch 06. 08. 2014 Bad Säckingen – Basel (37 km): Der Abbruch droht
5. Unter Frachtschiffen – im Oberrhein
Donnerstag 07. 08. 2014 Basel – Breisach (59 km): Tanzende Tropfen am Dreiländereck
Freitag 08. 08. 2014 Breisach – Kehl (69 km): Heimspiel in der Ortenau
Samstag 09. 08. 2014 Haslach (Ruhetag): Home, sweet home
Sonntag 10. 08. 2014 Kehl – Iffezheim (43 km): Gestoppt vom Hochwasser
Montag 11. 08. 2014 Iffezheim – Mannheim (88 km): Besuch in der Geburtsstadt
Dienstag 12. 08. 2014 Mannheim – Nierstein (58 km): Entzündeter Nacken und kühlendes Eis
6. Sagenhaft schön – im Mittelrhein
Mittwoch 13. 08. 2014 Nierstein – St. Goar / Loreley (72 km): Der Rhein–ein Chemiecocktail
Donnerstag 14. 08. 2014 St. Goar / Loreley – Neuwied (49 km): Durchs enge Tal
Freitag 15. 08. 2014 Neuwied – Bonn (49 km): Im Wasserschatten
7. Im Sog der Nordsee – der Niederrhein
Samstag 16. 08. 2014 Bonn – Köln (35 km): Dat Wasser vun Kölle
Sonntag 17. 08. 2014 Köln (Ruhetag): Familien-Sightseeing
Montag 18. 08. 2014 Köln – Düsseldorf (55 km): Der Rhein ist eine riesige Plastikmühle, Teil 2
Dienstag 19. 08. 2014 Düsseldorf – Götterswickerham (59 km): Regen im Pott
Mittwoch 20. 08. 2014 Götterswickerham – Emmerich (49 km): Vorbei am Kernkraftwunderland
Donnerstag 21. 08. 2014 Emmerich – Wageningen (51 km): Welkom in Nederland
Freitag 22. 08. 2014 Wageningen – Vresswijk (47 km): Im Einflussbereich der Tide
Samstag 23. 08. 2014 Vresswijk – Lekkerkerk (32 km): Zwischen großen Wellenbergen
Sonntag 24. 08. 2014 Lekkerkerk – Hoek van Holland (30 km): Im Meer
III. EPILOG – TAKE ME TO THE RIVER
IV. UND JETZT? WEGE ZU RHEINEREM WASSER
Danksagung
Anmerkungen
Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser,
denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.
Thales von Milet (um 625–um 547 v. Chr.),
griechischer Philosoph
I. PROLOG – ICH UND DAS WASSER
Meine erste Begegnung mit dem Wasser hatte ich, als ich mit meinem Vater auf dem Hausboot eines Freundes zu Besuch war. Was ich nicht wusste: Dort, in einem der malerischen Altrheinarme, wollte er mir das Schwimmen beibringen. Und zwar, indem er mich von der Reling ins kalte Wasser warf, verbunden mit der simplen Aufforderung: »Schwimm!« Das Erstaunliche: Ich ging nicht unter, und ich erinnere mich auch nicht an Panik oder wildes Gezappel. Nur an meinen Vater, dann irgendwann neben mir im Wasser, mit heftig rudernden Armen und der stetigen Anweisung: »Schwimm!« Offensichtlich tat ich das. Mit vier Jahren. Was zurückblieb, war die Erkenntnis, dass der Sprung ins kalte Wasser eine erfolgreiche Strategie sein kann. Auch in der Wissenschaft.
Mit acht Jahren trat ich dann in den Schwimmverein in meiner Geburtsstadt Speyer ein. Seitdem bin ich an das nasse Element verloren. Das Freibad lag direkt am Rhein. Damals traute ich mich noch nicht, in dem breiten Strom zu schwimmen. Viel mehr beeindruckten mich die riesigen Frachtschiffe, die sich nahe am Ufer stromaufwärts quälten, manchmal als Tandem im Schleppverband. Auch heute noch stehe ich gerne am »Alten Hammer« auf der Rheinpromenade und beobachte mit Enzo, meinem jüngsten Sohn, wie diese nicht enden wollenden Schiffsverbände sich durch die Mäander hindurchmanövrieren.
Auch in der Schule war es das Wasser, das mich am meisten faszinierte. Und zwar im Chemie-Unterricht, in dem sich für mich ganz neue Eigenschaften des Wassers auftaten. Dass Wasser etwa auch ein reaktives Medium sein kann, welches Metalle zum Glühen bringt, und dass eine Lampe auch unter Wasser brennen kann. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, mit Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen zu können und bei der Umkehrung wieder jene Energie zu gewinnen, die vorher hineingesteckt wurde. Wasser verdunstet freiwillig, obwohl es Energie kostet, es an anderer Stelle wieder zu kondensieren. Dort, wo es kondensiert, wird diese Energie wieder freigesetzt, und der Kreislauf beginnt erneut. Dieser lebenswichtige Kreislauf fasziniert mich heute noch.
Auf die Fragen, wieso und unter welchen Bedingungen das alles passiert und welche Einflüsse diesen Wasserkreislauf stören, wollte ich Antworten haben. Seither ließ mich diese Neugier nicht mehr los: Es war klar, dass ich Chemie studieren musste. Selbst der dem Studium vorgeschaltete Wehrdienst als Fluss-Pionier hielt für mich ein besonderes Wasser-Erlebnis parat, das mir im Verlauf meines Rhein-Marathons zugutekommen sollte. Bei einem nächtlichen Wintermanöver ging ich in voller Montur über Bord und stürzte in die reißende Strömung der eiskalten Donau. Nur mit viel Glück entging ich den rotierenden Schrauben des Amphibienfahrzeugs. Gerettet habe ich mich damals gewissermaßen selbst, indem ich stromabwärts zu einem absichernden Motorboot schwamm. Obwohl ich erstmals und völlig unfreiwillig in einem stark strömenden Fluss unter ungünstigsten äußeren Bedingungen als Schwimmer unterwegs war, fühlte ich mich im Wasser sicher und stets in der Lage, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Angst vor starken Strömungen im Freiwasser habe ich seither nicht mehr, wohl aber viel Respekt.
Das Schwimmen hat für mich mehrfach seine Funktion geändert. Als junger Mensch war das Wasser ein Medium, in dem ich mich möglichst schnell in allen vier Disziplinen fortbewegen wollte, um schneller als die gleichaltrige Konkurrenz zu sein. Das Schwimmen half mir auch dabei, Aggressionen abzubauen. Das Wasser nahm einen wütenden Pubertierenden in sich auf und spuckte einen entspannten Heranwachsenden wieder aus: ein toller Trick. Mit dem Freiwasserschwimmen wurde Wasser dann ein Element, das die Familie zusammenbrachte. Alle Faths lieben das kühle Nass, bei vielen Schwimmmeisterschaften rückten wir als Team an, meine Frau, unsere drei Söhne und ich.
Sobald ich mit einem Kopfsprung die Wasseroberfläche durchbrochen habe und die ersten Tauchzüge unter Wasser beginne, vergesse ich das »Draußen«. Nach der Abdruckphase sehe ich beim Dreier-Zug, wie das Wasser sich links und rechts von mir kräuselt, wie bei einem Boot, welches das Wasser in zwei Hälften schneidet. Noch ist das automatisierte Gleichgewicht zwischen Armzug, Gleitphase und Atmung nicht ganz hergestellt, erst etwa nach 1000 Metern habe ich das Gefühl, mit dem Wasser in Harmonie verbunden zu sein. Jetzt bin ich angekommen und kann die nächsten Kilometer abseits der Alltagshektik abspulen. Wenn ich danach aus dem Wasser steige, fühle ich mich wie neugeboren. Es gibt keine Schmerzen, der Kreislauf ist angeregt, und die Lungen füllen sich beim Atmen, als hätten sie plötzlich das dreifache Volumen.
Dieses Wohlgefühl während des Schwimmens und danach, verbunden mit der Erkenntnis, dass ich die Welt nach diesen intensiven Erlebnissen im Wasser wieder neu sehe, birgt natürlich Suchtpotential. Gestresst, geistig und körperlich erschöpft springe ich ins Wasser, zufrieden und euphorisiert steige ich heraus. Diese Gefühle will man immer wieder haben: Mit dem Sprung ins Wasser tritt gleichermaßen ein Phasenwechsel ein. In der Flüssigphase reduziert sich die Schwerkraft, man befindet sich in einem Raum, in dem die Bewegungen in alle Richtungen müheloser ablaufen als an Land. Und diese Mühelosigkeit überträgt sich auf das Leben an Land: Wenn ich weiß, dass ich im Laufe eines Tages noch die Möglichkeit haben werde, ins Wasser zu kommen, kann ich jegliche Zusatzaufgaben, aber auch berufliche Tiefschläge, Ärger und Stress besser bewältigen. Das Schwimmen ist ein ritualisierter Ausstieg aus dem Alltag, um danach mit neuer Kraft wieder ins Tagesgeschäft einzusteigen. Das Wasser als Trennmittel der beiden »Welten« ist zum Abschalten deshalb so gut geeignet, weil es eine kommunikationsfreie Zone ist. Niemand redet auf einen ein, solange man schwimmt und nicht an einer Wende stehen bleibt. Im Becken oder im See gibt es (noch) keine Handys, keine Computer, kein Internet, nur plätscherndes und gurgelndes Wasser, welches mit den eintauchenden Armen kommuniziert.
Das Schwimmen ist für mich also zu einem heilsamen Ritual geworden, das mich vor dem inneren wie äußeren Austrocknen, dem »Burn-out«, schützt. Und das Schwimmen wurde zusammen mit der Liebe zum Wasser zum Ausgangspunkt und Hauptdarsteller des großen Abenteuers, das ich im Sommer 2014 erleben sollte. Doch begeben wir uns zunächst ein Jahr weiter zurück, in den Juni des Jahres 2013.
II. MIT DEM STROM
1. DIE GEBURT EINER IDEE
Es war ein warmer sommerlicher Abend im Juni2013, meine Söhne hatten die Biertische in den Garten getragen, ich grillte Steaks und Würstchen, meine Frau kümmerte sich um die gesunden Zutaten, und wir aßen draußen zu Abend. Als später unser Untermieter und kurz danach auch der Nachbarssohn, beide um die 23 Jahre alt, auftauchten und wir sie zu einem Bier einluden, saßen wir alle gemeinsam um das Grillfeuer, das wir durch Holzauflegen in ein Lagerfeuer verwandelten.
Erst der vorwurfsvolle Blick meiner Frau teilte mir unmissverständlich mit, dass ich mich einige Zeit nicht an der Konversation beteiligt hatte und das als Desinteresse an den jungen Studenten interpretiert werden konnte.
Und tatsächlich: Ich war mit den Gedanken woanders. Der Wortlaut eines am Vormittag erhaltenen Briefes spukte mir noch im Kopf herum: »Sie haben einen Antrag im Programm des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ›Verbesserung der Geräteausstattung‹ gestellt, doch ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Antrag nicht zur Förderung kommen wird. … Dass Ihr Antrag bei denen, die zur Förderung empfohlen wurden, nicht dabei war, hat nichts mit einer Abwertung Ihrer Forschungsleistungen zu tun, sondern beruht einerseits auf den beschränkten Mitteln, andererseits darauf, dass anderen Anträgen größere Priorität eingeräumt wurde.« Mein Antrag hatte einem Analysegerät gegolten, mit dem man bei der Abwasserreinigung einen Vorher-Nachher-Vergleich durchführen und herausfinden kann, ob der Abbau einer Substanz, beispielsweise eines Antibiotikums, zu 95 oder zu 100 Prozent funktioniert hat. Das hört sich nach einem kleinen Unterschied an, bedeutet für den Schutz unserer Gewässer aber die Welt.
Dies war nun schon die zweite Absage, seit ich die Professur an der Hochschule Furtwangen im Oktober 2011 angenommen hatte. Im Leistungssport habe ich gelernt, mit Niederlagen umzugehen, und im Nachhinein hat sich das spanische Sprichwort »No hay mal que por bien no venga« (Alles Schlechte hat immer auch etwas Gutes) immer bewahrheitet. Es gibt kein Negativerlebnis, aus dem man nicht etwas Positives schöpfen könnte. Bevor sich diese Erkenntnis bei mir durchsetzt, werden aber meist drei Phasen durchlaufen: Am Anfang steht die Frustrationsphase. Es dauert etwa ein bis zwei Tage, bis sich meine Enttäuschung mit allem »wenn und aber« und »hätt ich doch« wieder legt.
Es folgt die Grübelphase, die – alle Umstände ignorierend – von mir Besitz ergreift, sogar während eines Grillabends. Es musste eine andere Möglichkeit geben, um meine Forschungsthemen mit dem notwendigen Equipment und Personal voranzutreiben, außer nochmals bis zur nächsten Ausschreibung einer Forschungsförderung zu warten, die wieder nur eine Erfolgsquote von 20 bis 30 Prozent verspricht. Ohne wieder zig Abende mit dem Schreiben von Anträgen zu verbringen. Schließlich war es nicht nur die Lehre, sondern auch die Möglichkeit, zu forschen, gewesen, die mich zu einem Wechsel an die Hochschule motiviert hatten.
Der Blick meiner Frau riss mich nicht nur aus meinen Gedanken, er ließ mich auch in die dritte Phase eintreten – die Phase, in der man einen Ausweg aus dem Dilemma findet, und sei er noch so verrückt. Denn urplötzlich hatte ich das Abenteuer vor Augen, das ich bestehen musste, um für meine Forschung zu werben und für den Gewässerschutz zu sensibilisieren. Die Idee, den Rhein in seiner vollen Länge von 1231 Kilometern, von seiner Quelle im Tomasee bis zu seiner Mündung in die Nordsee bei Hoek van Holland, zu durchschwimmen und ihn dabei zu beproben, war geboren.
Die Lösung liegt im Nachhinein betrachtet auf der Hand: Ich musste einfach nur meine drei Lieblingsthemen, Wasser, Chemie und Schwimmen, in einen sinnvollen Zusammenhang bringen.
In der gleichen Nacht war aufgrund der explodierenden Gedanken und des hohen Pulses an Schlaf nicht zu denken. Mir war klar, dass Organisation, Sponsorensuche, Training, Familie, Lehre und Beratertätigkeit unter einen Hut zu bringen waren und dass die eigentliche Schwimmphase nur in der vorlesungsfreien Zeit machbar war. Obwohl ich damals liebend gern noch im Sommer 2013 gestartet wäre, dauerte es ein Jahr, bis alle Vorbereitungen und Planungen abgeschlossen waren. Immer wieder stand das Vorhaben in dieser Zeit auf der Kippe. Weil die Sicherung der Finanzierung durch Sponsoren viel mehr Zeit in Anspruch nahm, als wir erwartet hatten. Weil gleich in vier Ländern behördliche Genehmigungen einzuholen und Auflagen zu erfüllen waren. Weil wir Wissenschafts- und Industriepartner, deren Unterstützung für die umfassenden Wasseranalysen vonnöten war, von der Sinnhaftigkeit und Machbarkeit unseres Abenteuers überzeugen mussten. Weil wir lange Zeit kein Motorboot mit der vorgeschriebenen Ausstattung zur Verfügung hatten. Und weil uns jemand fehlte, der willens und in der Lage war, das Boot fast vier Wochen lang vom Bodensee bis zur Nordsee zu schippern. Bis uns mein Hochschulkollege Bernhard Vondenbusch, der über die notwendigen Bootsführerscheine verfügte, mit seiner Zusage erlöste.
Die nötige Geduld und Energie aufzubringen war nur möglich, weil ich von Anbeginn die Rückendeckung meiner Familie und meines Arbeitgebers, der Hochschule Furtwangen, hatte. Und weil ich nicht nur dadurch motiviert war, meine Forschung und die wissenschaftliche Arbeit der Hochschule voranzubringen. Sondern auch durch meine über lange Jahre gewachsene Leidenschaft für das Wasser, die sich aus verschiedenen Quellen speist: Im Wasser lernte ich meine Ängste überwinden – und meine Frau kennen. Wenn es also etwas gab, für das ich im Wortsinn mein letztes Hemd geben würde, dann den Stoff, ohne den kein Leben existieren würde. Wie schon Thales von Milet vor circa 2600 Jahren erkannte. Der Mensch besteht zu drei Vierteln aus Wasser. Dass Wasser alles ist und alles ins Wasser zurückkehrt, wissen wir zwar, aber richtig verstanden haben wir es nicht, denn wir handeln vielfach ganz und gar nicht danach.
Unsere Trinkwassermenge wird immer kleiner, obwohl es eigentlich genug Wasser auf unserem blauen Planeten gibt. Mehr als zwei Drittel unseres Planeten, nämlich 71 Prozent der Erdoberfläche, sind mit Wasser bedeckt. Der mit 92,2 Prozent weitaus größte Anteil entfällt jedoch auf die Ozeane, ist damit Salzwasser und für den Menschen ungenießbar. 4 Prozent befinden sich als Wasserdampf in der Atmosphäre. Von den 3,5 Prozent des Wassers, das als Süßwasser vorliegt und damit theoretisch von den Menschen als Trinkwasser genutzt werden könnte, ist mehr als die Hälfte in Form von Eis gefangen – vor allem an den Polen, aber auch in Gletschern und Permafrostböden. Lediglich 0,6 Prozent der auf der Erde vorhandenen Wassermenge ist Süßwasser, das sich in Flüssen, Seen und dem Grundwasser befindet. Auf das Grundwasser als häufigste und sauberste Trinkwasserquelle entfallen dabei nur 0,02 Prozent der Gesamtwassermenge. Dieses wertvolle Wasser ist auf der Welt nicht gleich verteilt und erneuert sich infolge unseres hohen, immer noch wachsenden Wasserkonsums nicht schnell genug.
Dem Wasser kommt eine hohe kulturelle, ökologische und ökonomische Bedeutung zu. Mehr noch: Ohne Wasser wäre Leben, so wie wir es kennen, auf der Erde nicht möglich. Trotzdem gehen wir in den westlichen Industrieländern, aber auch in den aufstrebenden Nationen in Asien und Südamerika viel zu sorglos mit Wasser um. Zum einen wird zu viel sauberes Wasser verbraucht und mit unterschiedlichsten Schadstoffen belastet, zum anderen mangelt es in vielen Ländern an sauberem Wasser. Kriege werden in der Zukunft nicht um Öl, sondern um das lebensnotwendige H2O geführt werden.
Heute fließen 70 Prozent des gesamten Süßwassers in die Landwirtschaft, 20 Prozent in die Industrie und 10 Prozent in private Haushalte. Im Zuge des globalen Bevölkerungswachstums wird sich der Wasserverbrauch weiter erhöhen. Während zu Beginn unserer Zeitrechnung nur 300 Millionen Menschen lebten und sauberes Trinkwasser benötigten, sind es heute sieben Milliarden, die sich den kostbaren Rohstoff Süßwasser teilen müssen. Der Bedarf nimmt kontinuierlich zu, während unsere Süßwasserdepots durch abschmelzende Pole und Gletscher schrumpfen.
Da liegt es natürlich nahe, das größte Wasserreservoir der Erde anzuzapfen. Dazu müssten die Meere »nur« entsalzt werden. Die erste Meerwasserentsalzungsanlage der Menschheitsgeschichte ist aus der Antike überliefert. Der griechische Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles, der von 384 bis 322 vor Christus lebte, ließ ein mit einer Harzmembran präpariertes, dicht verschlossenes Tongefäß rund 500 Meter tief ins Meer hinab. In dieser Tiefe ist der Wasserdruck etwa 50 Mal so stark wie an der Oberfläche. Zieht man das Gefäß nach etwa 24 Stunden wieder an die Oberfläche, befindet sich darin Süßwasser. Durch solch hohe Drücke lässt sich die Osmose umkehren. Osmose ist ein Verfahren, bei dem Wasser mit wenigen gelösten Teilchen durch eine halbdurchlässige Membran in eine höher konzentrierte Lösung wandert, um den Konzentrationsunterschied auszugleichen. Das passiert so lange, bis die Konzentrationen auf beiden Seiten der Membran ausgeglichen sind. Aus diesem Grund trocknet jede Zelle aus und der Körper dehydriert, wenn man Salzwasser trinkt. Oder die Zellen platzen, wenn man destilliertes Wasser zu sich nimmt. Mit Umkehrosmoseverfahren wird Salzwasser durch eine semipermeable Membran gepresst, wobei das Kochsalz im Konzentrat zurückbleibt und auf der anderen Seite entsalztes Wasser gewonnen wird. Auch mit thermischen Verfahren lässt sich Salzwasser entsalzen. Entweder durch Verdampfen und Kondensieren der Flüssigkeit; oder indem man das Wasser ausfriert, abtrennt und wieder schmilzt. Mit einer Elektrodialyse, bei der Wasser und Salz durch den Einsatz von elektrischem Strom voneinander getrennt werden, ist ebenfalls Trinkwasser herstellbar. Alle aufgezählten Verfahren haben jedoch ein Problem gemeinsam. Sie kosten sehr viel Energie.
So faszinierend und wichtig der Forschungsdrang aber auch ist, neue Trinkwasserquellen zu entwickeln, so bedeutsam bleibt es aus meiner Sicht, die bestehenden Quellen zu schützen. Wasser ist nicht ersetzbar wie etwa Erdöl. Zu Wasser haben wir keine Alternative. Dass wir Energie sparen müssen, ist in unseren Breiten angekommen. Beim Wasser machen wir uns weniger Sorgen. Wir sind zwar global vernetzt, machen uns aber keine globalen Gedanken. Im Schwarzwald, wo ich lebe, wo es überall in Seen, Flüssen und Bächen, die sauberes Wasser führen, gurgelt und sprudelt, fehlt die Vorstellung, wie knapp das Wasser in Kalifornien oder Bolivien ist. Dabei sind wir durch unser Konsumverhalten mitverantwortlich für die Wassernot anderer Länder. Zum Beispiel weil wir inzwischen zu jeder Jahreszeit das komplette Nahrungsangebot in unseren Supermärkten vorfinden möchten, unabhängig davon, wie wasserverbrauchsintensiv die Kultivierung im Exportland ist. Produkte, in deren Entstehung viel Wasser fließt, entziehen dem Wasserkreislauf dort, wo sie wachsen oder hergestellt werden, das Wasser. Solch »virtuelles Wasser« steckt in zahllosen Produkten, ohne dass wir uns den mit deren Fertigung verbundenen Wasserverbrauch bewusst machen: 11.000 Liter etwa in einem Kilo Baumwollkleidung, 2200 Liter in einer Rindfleischbulette und 5000 Liter in einem Kilo Käse. Durch den Import wasserintensiver Produkte wird das Wasserverteilungsungleichgewicht immer größer. Bei einem solch lebenswichtigen Rohstoff wie Wasser stellt ein sich weiter verschlechterndes Ungleichgewicht eine Gefahr für den Weltfrieden dar.
Vor diesem Hintergrund fällt es mir schwer, auch in einer wasserreichen Region, ohne ein schlechtes Gewissen Trinkwasser zu verprassen. Schon gar nicht für so »niedere Zwecke« wie die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung, die Autowäsche oder das Wäschewaschen, denn es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man dafür Trinkwasser verwenden muss.
Auch darum ging es also schon im Juni2013, als die Idee geboren wurde, den Rhein zu beschwimmen. Nicht nur um das neue Analysegerät, sondern darum, Aufmerksamkeit zu wecken für die vielen Wege, die wir normalen Konsumenten beschreiten können, um unsere Gewässer zu schützen, Wasser zu sparen und – auch wenn es vielleicht etwas groß und vermessen klingen mag – damit sogar Kriege um Wasser wie in Bolivien zu verhindern. Nach einem Jahr intensivster Vorbereitung sollte sie dann beginnen, meine Reise mit dem Strom.
2. IM GRAND CANYON EUROPAS – DER VORDER- UND ALPENRHEIN
SONNTAG 27. 07. 2014
HASLACH
DER TAG DAVOR
Es war nur ein kurzer, wenig intensiver Schlaf. Um 5 Uhr wache ich nervös auf. Nervös, weil noch nicht alles gepackt war und ich ständig Panik verspürte, irgendetwas Wichtiges vergessen zu haben. Viele Dinge lassen sich zwar unterwegs besorgen, aber nicht eine Spezialausrüstung für eine Marathonschwimmstrecke durch den Rhein.
Ich gehe noch einmal die Materialliste durch und packe alles in den Vito. Mit meinem Sohn Leo hieve ich unser Kajak aufs Dach und sein Mountainbike auf den Radträger. Bevor wir Leos Freund und Klassenkameraden Tim Böhler abholen, fahre ich noch am Haslacher Freibad vorbei und verabschiede mich vom Bademeister Thomas Maier und dem gesamten Badepersonal, das mich in der Vorbereitungsphase so engagiert unterstützt hat.
Das große Wohnmobil und unser mit dem Streckenverlauf verziertes »Rheinmobil« kurz vor der Abfahrt im Innenhof der Hochschule Furtwangen ©braxart fotografie
Es geht los. In unserem »Rheinmobil«, auf dem eigens für unser Projekt »Rheines Wasser« der komplette Rheinverlauf farbenprächtig nachgezeichnet ist und alle markanten Sehenswürdigkeiten zu finden sind: ein echter Eye Catcher. Die Sitze wurden ausgebaut, sodass die Ladefläche bis unter das Dach mit Analytikmaterial vollgepackt werden konnte. Mit diesem Fahrzeug, das leicht mit einem fahrenden Drogenlabor verwechselt werden kann, den Grenzübergang in die Schweiz anzusteuern, bereitet mir ein mulmiges Gefühl. Zumal ich bisher noch nicht die Bekanntschaft von lockeren Grenzbeamten gemacht habe.
Die Sorge war unbegründet. Da meine Kollegen an der Hochschule wirklich alles einschließlich sämtlicher Reagenzgläser und Kanülen im Detail auf einer endlosen Liste aufgeführt und deklariert haben, müssen wir uns keiner langwierigen Kontrolle unterziehen. Wir tauschen den Rheines-Wasser-Aufkleber gegen die bei den Eidgenossen obligatorische Autobahn-Vignette, erklären den Grenzern unser Vorhaben – und verlassen unter verständnislosem Kopfschütteln der Beamten den Grenzbezirk.
Angekommen im Gasthof Glenner in Ilanz, gibt es für unsere 14-köpfige Gruppe ein Abendmenü. Das Kernteam, mit dem ich mich gemeinsam ins Abenteuer stürze, besteht aus: meiner engsten Mitarbeiterin und Praktikantenbetreuerin Helga Weinschrott, die für die Probennahme und -versorgung zuständig ist, meinem Professoren-Kollegen Bernhard Vondenbusch, der vom Bodensee bis zur Nordsee das motorisierte Begleitboot fahren wird, Frank Weinschrott, Helgas Sohn, verantwortlich für den Probentransport an das Hochschullabor, meinem Sohn Leo, der manchmal mitschwimmen und mich häufig motivieren wird (»Komm, Vadder, stell dich ned so an, des bissle Schwimme«), Tim Böhler, einem Schulkameraden von Leo, Hubert Braxmaier, der die Fotos schießen wird, Jonas Loritz, zuständig für die Mikroplastikuntersuchungen, Philipp W.Neek, verantwortlich für die analytischen Schnelltests, und schließlich Tim Bornschein, auch er eigentlich zuständig für die analytischen Schnelltests, später aber in erster Linie als mein »Lebensretter« und persönlicher Betreuer unermüdlich im Einsatz.
Dass meine Frau Nicola nicht von Anfang an dabei sein kann, ließ sich leider nicht vermeiden. Und wäre dem Vorhaben und mir in den ersten Tagen nach dem Start beinahe zum Verhängnis geworden. Mit Erreichen des Bodensees weicht sie nicht mehr von meiner Seite, sobald ich das Wasser verlasse. Sie sorgt dafür, dass die Regeneration zwischen den Etappen nicht zu kurz kommt, motiviert und ermutigt mich an schlechten Tagen, übernimmt kurzerhand die Projektorganisation vor Ort, hält als »gute Seele« das Team zusammen und kümmert sich auch noch um den Rest der Familie, angefangen bei Enzo, unserem jüngsten Sohn, bis hin zu Eltern und Schwiegereltern.
Als sich unsere Truppe am Sonntagabend bei Speis und Trank auf den Start des »Schwimm-Marathons im Dienst der Wissenschaft« in den Graubündner Alpen einstimmt, sind auch Max Bodendorf und Windy Asridya vom Medienteam dabei, das einen Dokumentarfilm von unserem Rheinabenteuer drehen wird, ebenso Martin Aichele, Professor an der Fakultät für Digitale Medien unserer Hochschule, der anfänglich die Dreharbeiten koordiniert und unser großes Wohnmobil steuert. In den kommenden vier Wochen werden weitere Helfer und Begleiter hinzukommen, andere wechseln sich zwischendurch untereinander ab. Insgesamt ein ordentlicher Tross, der da zusammengekommen ist, um gemeinsam mit mir meine »verrückte« Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, so viel Unterstützung zu erfahren. Ein gutes Gefühl! Schließlich würde es am folgenden Tag ernst werden.
MONTAG 28. 07. 2014
TOMASEE–ILANZ (52 KM)
ANTHROPOGENE SPUREN IN DEN ALPEN
7 Uhr. Kaffeeduft zieht durchs Haus. Beim Frühstück werden die letzten Details besprochen. Kamerateam und Analytikgruppe sollen vor 8 Uhr auf dem Oberalppass sein und alles Material, was am See gebraucht wird, den Helikopterpiloten übergeben. Der Helikopter bietet neben Torbogen und Marketingmaterial noch Platz, unsere Probengefäße, Filter und Pumpen sowie eine Taucherausrüstung einschließlich Bleigürtel und Sauerstoffflaschen mitzunehmen. Den Bleigürtel hatte Max vergessen mitzugeben, sodass er die 8 Kilogramm Blei zum See hochschleppen musste. Nachdem die Vorhut aufgebrochen ist, packe ich meine Schwimmutensilien (Kappe, Schwimmbrille mit fünf Dioptrien, Triathlonanzug, Schwimmneopren und noch ein großes Handtuch) in den Rucksack. Für den Aufstieg zu Fuß reicht das. Dann wecke ich Leo und Tim, wir frühstücken zusammen in aller Ruhe. Man erwartet uns gegen 11 Uhr am See.
Der Tomasee in den schweizerischen Alpen im Kanton Graubünden liegt auf 2345 Meter über dem Meeresspiegel. Er gilt als Quelle des Rheins. Der Alpensee speist sich aus dem Schmelzwasser von Gletschern und Schneefeldern. Mit etwa 200 Metern Länge ist es ein kleiner, aber sehr kalter See. Ich hatte mir vorgenommen, im Rhein überall dort zu schwimmen, wo es möglich und behördlich erlaubt ist. Im Tomasee ist beides der Fall. Außerdem bietet sich die Quelle des Rheins als Referenzprobe an, wenn man wie wir die Wasserqualität entlang des gesamten Stromlaufs untersuchen möchte.
In den Pfingstferien war ich zu einer Art Generalprobe schon einmal hier gewesen. Nach beschwerlicher Anfahrt war ich mit meinen Söhnen Moritz und Leo zuletzt über ein etwa 5 Meter breites und 30 Meter langes, schräg abfallendes Schneefeld gestapft. Irgendwo darunter floss der Tomasee ab und kam rauschend als Wasserfall unter dem Schneefeld herausgeschossen. Auf dem obersten Plateau angekommen, konnten wir einen Blick auf den See werfen. Der Anblick überraschte uns: Der See war außer an der Eintrittsstelle eines Rinnsals zugefroren. Würde dies Ende Juli noch immer so sein? Ganz ausschließen kann man es nicht, sagen uns Einheimische.
Jetzt, zwei Monate später, trennen uns nur noch wenige Schritte auf Felsblöcken über den Wasserfall hinweg, bis sich der Blick hinter der Abflusszunge auf das Bergpanorama und den Tomasee eröffnet. Der See ist, Gott sei Dank, frei von Eis. Ruhig und glatt wie ein Spiegel, in dem noch mehr Berge zu sehen sind, liegt er da. Am gegenüberliegenden Ende ist der See etwas breiter. Hier wird er begrenzt von ebenen Grünflächen, auf denen sich bereits einige Leute bewegen. Ein kleiner Wanderpfad führt rechts, mal näher, mal weiter, um den See herum. Vom Weg aus überblickt man den ganzen See. Auf der gegenüberliegenden, steileren und schroffen Bergseite liegen noch einige Schneefelder im Schatten, die dem See immer noch in kleinen Rinnsalen Schmelzwasser zuführen. Etwa in Höhe der Mitte des Sees kommen wir an einer Bronzetafel vorbei, die in den Fels unmittelbar neben dem Pfad eingelassen ist. Die Tafel bringt mich ins Grübeln, denn ihre Inschrift lautet »RHEINQUELLE – 1320 km bis zur Mündung«. Es sind doch nur 1231 Kilometer, das ist bei Wikipedia und in jedem Buch über den Rhein nachzulesen!
Mittlerweile weiß ich, dass ich die 90 Kilometer, die ich zwischen Basel und Karlsruhe weniger zu schwimmen hatte, Johann Gottfried Tulla zu verdanken habe, der zwischen 1817 und 1876 den Rhein auf dieser Strecke begradigte, um ihn bis zur Schweizer Grenze schiffbar zu machen. Dann müsste die Bronzetafel deutlich über hundert Jahre alt sein. Sie sieht aber nur wenig verwittert aus. Liegt das am Sauerstoffmangel in 2345 Höhenmetern? Nach kurzer Ratlosigkeit ziehen wir weiter zum Start. Der Wanderweg um den See ist deutlich länger als die Kurzstrecke durch den See. Egal, wie kalt er ist, mehr als drei Minuten werde ich für die Strecke im Kraulstil nicht benötigen, das müsste auszuhalten sein.
Auf der Startseite tummeln sich schon einige Fernsehleute und testen Bildeinstellungen, während Jonas, Philipp, Helga und Bernhard bereits die Pumpe in Betrieb nehmen, um 1000 Liter Wasser zu filtrieren. Mit dem 12-Volt-Batteriebetrieb wird dies ohne Verzögerung etwa zwei Stunden dauern. Das heißt, genau genommen sogar vier Stunden, weil eine Kontroll- bzw. Vergleichsprobe erstellt werden muss. Der Sand im Filter stellt selbst zusammen mit Holzstückchen, Algen, Krebstieren und Muscheln für die Untersuchung der Mikroplastikbelastung des Wassers, welche eine Hauptaufgabenstellung unseres Projektes ist, kein Problem dar. Er wird später während einer Dichteseparation von dem leichteren Kunststoff abgetrennt. Für alle anderen organischen Materialien, die im Filter landen, werden Enzyme und Wasserstoffperoxid eingesetzt, die diese Substanzen zersetzen, bis sie löslich werden. Zurück bleiben nur die resistenten Mikroplastikpartikel. Im Startbereich freue ich mich, Matthias Ruff vom führenden Schweizer Wasserforschungsinstitut EAWAG anzutreffen. Er hat sich bereit erklärt, die gesammelten Flüssigproben entlang des Rheins aufzuarbeiten und auf deren Inhaltstoffe zu analysieren: von Süßstoffen über Korrosions- und Pflanzenschutzmittel bis hin zu Pharmazeutika.
»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«: Die Quelle des Rheins, den Tomasee, zu betreten, dessen Wasser mich mehr als 1000 Kilometer begleiten wird, erfüllt mich mit Ehrfurcht und Respekt ©braxart fotografie
Ich ziehe mich fröstelnd aus und wate dann los: zunächst durch sumpfiges kaltes Gras, dann in knöcheltiefes Wasser. Der erste Kontakt mit »Vater Rhein« ist deutlich kälter als ein Kneippkurbecken. Die Blutversorgung in den Füßen zieht sich vor Schreck zurück. Philipp schreit mir zu: »7,4 Grad Celsius – am Ufer gemessen.« Ich denke an meinen Sohn Moritz, der an den Füßen extrem kälteempfindlich ist und schon an der Nordsee bei 14 bis 16 Grad vor Schmerz schreiend wieder aus dem Wasser gerannt kam. Ich muss ziemlich lange im steinigen Schlick laufen. Dann spüre ich nur noch Kälte und keine Steine mehr, obwohl sie noch da sind. Jetzt eine Glasscherbe, und das wäre es gewesen. Nach weiteren Schritten stumpft auch der Kälteschmerz ab, und nach etwa 20 Metern wird es so tief, dass ich mich nach vorne ins Wasser gleiten lassen kann. Die Kälte im Gesicht und an den Ohren ist ein Schock und Bewegung die Erlösung. Sofort beginne ich mit den Kraulzügen, rhythmisch, automatisiert. Das eiskalte Wasser steigt in meinen Neoprenanzug.
Es ist kaum auszuhalten. Meine Atmung wird schneller, da sich alle inneren Organe vor der Kälte zurückziehen. Ich schwimme über tiefblaues klares Wasser. Der Grund ist dennoch nicht mehr zu sehen. Der See muss hier tiefer als 20 Meter sein. Dreierzug ist aufgrund der Atemnot nicht möglich. Das Wasser schmerzt an den Schneidezähnen. Ich schiebe meine Oberlippe darüber und schmecke bewusst das Wasser. Kindheitserinnerungen werden wach: Es ist, als ob man an einem Schneeball lutscht. Das habe ich schon jahrzehntelang nicht mehr getan, doch die Erinnerung daran ist noch abgespeichert. Der See ist länger als gedacht, ich bekomme Zweifel. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Um mich selbst davon zu überzeugen, dass sie noch da sind, mache ich einen stärkeren Beinschlag und erhöhe die Armzugfrequenz. Ich sehe unter meiner rechten Achselhöhle, wie ich etwa fünf Meter an einem größeren Schneefeld vorbeischwimme. Was für ein Anblick: Schnee und Schwimmen hatte ich bisher noch nie in Einklang gebracht. Jetzt kann es nicht mehr weit sein, ich sehe wieder den Grund unter mir, Felsbrocken, auch scharfkantige, und das Wasser wird flacher. Trotz Kälte, die ich jetzt an den nackten Händen, Füßen und Gesicht nicht mehr spüre, schwimme ich so weit ans Ufer, wie es geht, um mich nicht an den Felskanten zu verletzen. Als ich mit den Händen den Grund ertasten kann, richte ich mich auf und steige auf eine glatte Felsplatte. Geschafft, erst einmal.