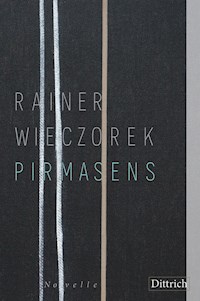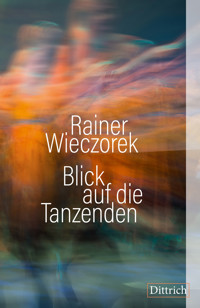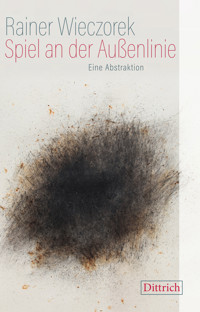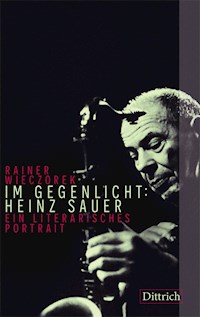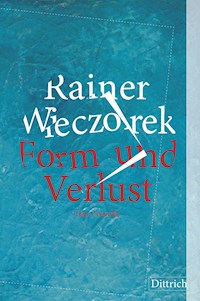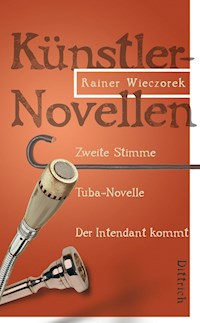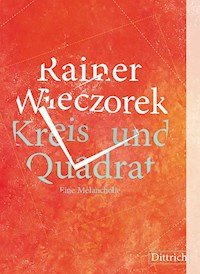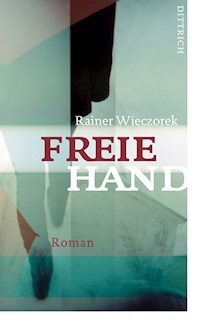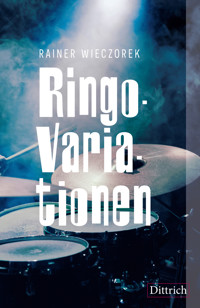
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Rainer Wieczorek, der Meister der Künstlernovelle, richtet seinen Blick diesmal auf einen Vierten – den Vierten der Beatles nämlich, Ringo Starr. Das Ergebnis ist so verblüfffend wie berührend.« Jochen Schimmang George Harrison meint, die Beatles seien zu allen Zeiten Johns Band gewesen, was immer auch Paul dazu sage. Sie waren aber auch Ringos Band, jedenfalls aus Sicht des Schlagzeugers. Rainer Wieczorek betrachtet die Geschichte der Beatles aus dessen Sicht, der Sicht eines Musikers, der die Kollegen beim Auftritt nur von hinten sieht. Als wolle er Ringo aus dieser Position heraushelfen, stellt ihm Wieczorek während einer USA-Tournee einen Plattenspieler ins Hotelzimmer und legt Bachs Goldberg-Variationen auf – mit ganz erstaunlicher Wirkung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Wieczorek
Ringo-Variationen
© Dittrich Verlag in der Velbrück GmbH Verlage, 2025
Meckenheimer Str. 47 · 53919 Weilerswist-Metternich
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch
Gesetzt aus der Whitman und der Quay sans
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-23-0
eISBN 978-3-910732-45-2
Rainer Wieczorek
Ringo-Variationen
Dittrich
Liner Notes
Aria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aria
Liner Notes
Mit einem Richard Starkey hatte ich nie zu tun. Als Ringo trat er in mein Leben – in das Leben nahezu aller Menschen meiner Generation.
Das folgende Werk stellt den Versuch dar, aus jenem Ringo, den man zu kennen glaubt, meinen eigenen Ringo zu formen, um zu hören, was er zu erzählen hat!
Rainer Wieczorek
Aria
Beat them drums!
Beat them cymbals and kick that bass.
Schlagzeuger wurde man in Liverpool, indem es einem gelang, eine Snare-Drum, ein, zwei Toms, die Bassdrum, zwei Becken, die Hi-Hat und eine schwarze Lederjacke aufzutreiben. Dann galt es, sich den Backbeat draufzuschaffen und die Time halten zu lernen; schon konnte es losgehen. 1,25 £ gab es pro Abend. In Hamburg. Für sechs bis sieben Stunden Musik sieben Mal die Woche. Wer dort an den Trommeln saß, hatte Zeit genug, dieses Instrument zu studieren. Es kommt dabei weniger auf die Töne an, die getrommelt werden als auf die Abstände zwischen den Tönen. Die Abstände sorgen für den Groove: das Nichtgetrommelte.
Bis Juni 62 spielte ich bei Rory Storm. Der hieß in Wirklichkeit Alan Caldwell. Ich nannte mich Ringo Starr, eine Variation meines bürgerlichen Namens, der für dieses Leben nicht taugte. Wir übernachteten hinter der Leinwand eines Pornokinos oder nahmen ähnliche Bequemlichkeiten in Anspruch. Meinen Kindern hätte ich solch ein Leben nicht erlaubt.
Rory stotterte, wenn er nicht gerade auf der Bühne stand. Vor jedem Auftritt bastelte er eine volle Stunde an seiner Frisur. »Toll«, musste ich dann sagen. »Wirklich toll.« War es Eigenwille, war es Maskerade? Ein unglücklicher Mensch.
Vom Glück lasse ich lieber die Finger. Heikle Sache.
Eine ganze Zeit hatte ich dieses braune Duroplastic-Schlagzeug gespielt, zunächst bei Rory Storm & the Hurricanes, später bei den Beatles. Wir hatten ja alle kein Geld und nahmen, was wir kriegen konnten. Im Mai 63 meinte ich, mir etwas Besseres gönnen zu dürfen. Schon lange schwebte mir ein schwarzes Drumkit vor, mit Trommeln aus Holz. In der Drum City, die sich auf der Shaftesbury Avenue in London befand, entschied ich mich für ein schwarz-grau meliertes Trommelset der Marke Ludwig.
In den folgenden Jahren entschieden sich Zehntausende von jungen Drummern für ein solches Ludwig-Set. Mein Instrument wurde das meistfotografierte Schlagzeug des 20. Jahrhunderts. 2015 wurde es für $2,1 Millionen versteigert. Auf der Bassdrum prangt das Beatles-Logo mit dem weit heruntergezogenen T-Stamm.
So sichtbar dieses Schlagzeug auch war, man betrachtete es stets von der falschen Seite. Auf der richtigen Seite sah man die sich allmählich dunkler färbenden Trommelfelle und die zum Rand hin immer matter glänzenden Becken: Auf der richtigen Seite saß ich!
1
Hamburg.
Wir spielten im Top Ten, im Kaiserkeller, ich weiß nicht mehr alles, – manchmal abwechselnd mit den Beatles, wenn feiertags bis in die frühen Morgenstunden gerockt werden musste. Gelegentlich sprang ich bei John, Paul und George ein, wenn sich Pete Best etwa irgendwo schlafen gelegt hatte. Man musste sehr trinkfest sein in diesen Tagen. – Die Bands halfen sich untereinander, wenn einer ausfiel. John sagte zu dieser Zeit, mit mir am Schlagzeug könne die Band freier spielen; das sagte er wirklich, ich habe es mir gemerkt. Die Beatles waren in unserer Ecke von Liverpool die angesehenste Band dieser Zeit, das war schon was, aber in Hamburg kamen wir, die Hurricanes, oft besser an – und verdienten auch etwas mehr als die Beatles, zumindest manchmal. Das Ansehen freilich, auf das es uns ankam, erwarb man sich in Liverpool.
Ich war damals keine zweiundzwanzig Jahre alt und froh, am Schlagzeug sitzend meinen Unterhalt bestreiten zu können. Die Beatles wollten hoch hinaus, das wusste ich. Einmal hatte ich sie nachts auf der Straße gesehen. Sie wirkten etwas angeschlagen, weswegen ich mich nicht bemerkbar machte. Plötzlich bildeten sie einen Kreis, wie ihn Fußballmannschaften vor dem Anpfiff formen. »Was wollen wir sein?«, rief einer. »The uppermost of the toppermost!«, antwortete die Gruppe, und dann bekamen alle einen Lachanfall, der nicht enden wollte. Vielleicht riefen sie auch »the toppermost of the uppermost«, ich weiß es nicht mehr, ich merke mir solchen Quatsch nicht.
Ich konnte mir zu dieser Zeit keine Zukunft im Big Business vorstellen. Im Radio brachten sie Cliff Richard oder ähnliche Schmalzdackel, wenn es mal was für junge Leute geben sollte. Für Jungs in Lederjacke schien es allgemein keinen Bedarf zu geben, außer im Indra, im Top Ten, im Kaiserkeller, im Cavern und vielleicht noch zehn weiteren Clubs, in denen Bands unsere Musik spielten. In diesen Kellern aber tat sich was, und wenn ich vom bevorstehenden Jahr etwas erwartete, dann konnte es nur darum gehen, weiter dort mitspielen zu dürfen.
2
Das Jahr 62
barg einige Überraschungen für die Beatles. Und einige weitere für mich.
Bei den Hurricanes hatte sich herumgesprochen, dass die Beatles von einem Manager unter Vertrag genommen worden waren und möglicherweise bei einer Plattenfirma vorspielen würden. Bei Decca hätten sie schon vorgespielt, sagte einer – »aber ohne Ergebnis.«
Was die Hurricanes nicht erfuhren, war, dass die Beatles Anfang Juni von einer EMI-Firma in die Abbey Road Studios eingeladen worden waren. Deren Chef, George Martin, konnten sie überzeugen; zumindest erhielten sie einen Vertrag, verbunden mit der dringenden Empfehlung, sich einen besseren Schlagzeuger zu besorgen.
Es war George Harrison, der John und Paul davon überzeugte, mich in die Band aufzunehmen. Bei mir brauchte er nicht lange zu betteln. – Dann erfuhren es auch die Hurricanes: Die Beatles haben einen Plattenvertrag und ich bin ihr Schlagzeuger.
Im August gaben wir unser erstes gemeinsames Konzert. In Birkenhead, gegenüber von Liverpool, auf der anderen Seite des Mersey Rivers.
Für einen Drummer war es sehr leicht, mit den drei Jungs aufzutreten, weil sie musikalisch so sicher, so eingespielt waren.
Wir hatten ähnliche Wurzeln.
Sie waren nett zu mir.
Den ersten Tiefschlag, den ich 62 zu verkraften hatte, kassierte ich vier Tage nach unserem ersten Auftritt. Wir spielten im Cavern Club – ein Heimspiel, dachte ich. Pfeifendeckel. Die Leute waren enttäuscht, dass nicht Pete Best, sondern Ringo an den Drums saß, und äußerten ihren Ärger lautstark: Wir wollen Pete Best!
Das wars wohl für mich, dachte ich, tapfer weitertrommelnd: Jetzt bin ich draußen und kann einpacken.
Die drei aber ließen sich nicht beeindrucken und munterten mich auf in der Pause: »Wer bei den Beatles trommelt, entscheiden wir!«
Der zweite Tiefschlag kam am 4. September. Ich hatte feine Klamotten angezogen und meine braune Duroplastic-Kiste abgestaubt, als ich das Studio an der Abbey Road betrat. Als ich es verließ, war eine weitere Aufnahme verabredet – mit einem Studioschlagzeuger. George Martin war auch mit mir nicht ganz zufrieden.
Sieben Tage später erfolgte eine weitere Aufnahme mit Andy White.
Ich bin auf der ersten Pressung der Single Love Me Do zu hören, White auf der später veröffentlichten LP: Möge sich jeder ein eigenes Urteil bilden.
Ich gebe zu Protokoll: Love Me Do war ein albernes, belangloses Liedchen, das keine Ansprüche an irgendeinen Schlagzeuger stellte. Ich hätte musikalisch gesehen keinen Penny dafür gegeben, hier mitzuspielen – aber ich lasse mich nicht gern ausgrenzen. O.K.?
Es gab noch weitere Probleme. George Martin hatte die Rechte am Song How Do You Do It? erworben und glaubte, in den Beatles die geeigneten Performer für den Titel gefunden zu haben. Das war der eigentliche Grund, warum die drei einen Vertrag bekamen: Es waren freche, humorvolle Jungs, die gut aussahen. Die aber wollten unbedingt etwas Eigenes bringen. Der Kompromiss lautete: Wenn ihr etwas Besseres habt als ich, bringen wirs. Beide Songs wurden aufgenommen. Love Me Do erschien.
Meine Existenz als Schlagzeuger aber stand auf der Kippe. Bei Rory Storm war ich ersetzt worden, bei den Beatles nicht fest im Sattel.
3
Es folgten bessere Tage.
In meiner Erinnerung sind es die besten.
Love Me Do erschien bereits im folgenden Monat – am Schlagzeug bin ich zu hören. Im Dezember, dem Monat des Weihnachtsgeschäfts, stieg der Titel auf Platz 17 der britischen Hitparade. George Martin ist begeistert.
Brian Epstein, unserem Manager, gelingt es immer leichter, Auftritte jenseits von Liverpool an Land zu ziehen. Er leiht uns Geld, mit dem wir einen alten Lieferwagen erwerben, in dem uns Neil Aspenall, Pauls alter Jugendfreund, und Mal Evans, ehemals Türsteher im Cavern Club, samt unserem Equipment von Gig zu Gig steuern.
Brian gab jetzt klare Direktiven aus, wie wir uns bei Auftritten zu benehmen hatten: Nach jedem Lied verbeugen sich alle vier. »Übertrieben«, dachten wir und verbeugten uns mit jedem Schlussakkord.
Brian sorgte dafür, dass wir nach oben kamen, und die Uppermost von den Toppermost wussten das zu schätzen. Brian wäre gern Modeschöpfer geworden, konnte sich aber gegen seinen Vater nicht durchsetzen. Er verstand sich gut mit Beno Dorn, einem Schneider aus Birkenhead. Der verpasste uns in den folgenden Jahren die abenteuerlichsten Bandkostüme. Warum zogen wir uns das an?, frage ich mich manchmal.
Unsere Frisur aber, das damals Aufsehenerregendste, stammte nicht aus dieser Ecke. Rund um die Bands, die von Liverpool an die Elbe kamen, sammelte sich eine kleine Gruppe von Hamburger Hipstern, mit denen wir uns befreundeten und die sich um uns kümmerten, wenn es mal traurig wurde. Es waren Leute, die zweifellos gebildeter waren als wir – ich sage besser: als ich. Die Sartre lasen, ich glaube, so hieß er. John sagte, es seien Existenzialisten und Rory widersprach ihm. Ich erinnere mich besonders an Astrid Kirchherr, weil sie so etwas Mütterliches, Fürsorgendes besaß. Das fehlte uns allen in Hamburg. Wir waren noch sehr jung, halbe Kinder. Astrid war auch nicht älter, aber sie tat uns gut mit ihrer Art. Sie hatte einen Freund, Klaus Voormann – die beiden trennten sich bald wieder. Auch Jürgen Vollmer gehörte zu dieser Gruppe. Der kämmte sich die Haare irgendwann als Pony in die Stirn. Das probierten wir ebenfalls. Mit dieser Frisur konnte man auf der Straße alle Arten von Schwierigkeiten bekommen. In Kombination mit Brians merkwürdigen Klamotten und dem ständigen Verbeugen bekamen wir etwas schwer Einzuordnendes, etwas Unverwechselbares.
Zurück zu George Martin. Dem war allmählich ein Licht aufgegangen: dass wir eine hervorragende Live-Band waren, mit der es landauf, landab keine andere Gruppe aufnehmen konnte, welche Klamotten auch immer sie trug. George Martin überlegte ein Live-Album mit uns zu machen, in Liverpool, im Cavern Club! Der Schreck fuhr mir in die Glieder: Was wäre, wenn die Rufe nach Pete Best auch noch auf Platte zu hören sein würden? Glücklicherweise erklärte ihm der Tontechniker, warum sich der Cavern Club aufnahmetechnisch nicht eigne. Vielleicht der Star-Club in Hamburg?
»Im Dezember spielen wir dort«, warf ich ein, und tatsächlich wurden dort Aufnahmen gemacht, die aber erst in späteren Jahren unter historischen Aspekten veröffentlicht wurden.
»Wir brauchen jetzt schnell eine weitere Single – was habt ihr zu bieten?«
»Please, Please Me. Auf der Rückseite: Ask Me Why.«
George Martin schaute auf seinen Kalender: »Könnt ihr am 26. November?«
Brian nickte für uns alle.
Ein Ersatzschlagzeuger war nicht vorgesehen.
Im Dezember ging es nach Hamburg. Silvester 62 spielten wir zum letzten Mal dort bis in die frühen Morgenstunden! Brian hatte uns nochmal Lederjacken erlaubt.
Von Hamburg ging es nach London, von dort weiter nach Südengland.
Für die Biografen: Es kann auch anders gewesen sein, mein Gedächtnis ist nicht mehr das beste. Neil und Mel bauten nun vor jedem Auftritt mein Schlagzeug auf. Ich brauchte nur noch zu trommeln. Ein deutlicher Fortschritt gegenüber den vergangenen Jahren. So fühlt sich Erfolg an!
Für die allzu Neugierigen: Ich werde alles, was das Privatleben der Beatles betrifft, Ehen, Kinder, Sex, Drogen im Folgenden beschweigen, auch weil es das Leben anderer betrifft, die – anders als wir – nicht die Öffentlichkeit suchten. Unter diesem Aspekt ist auch die Ausnahme, die ich machen werde – Yoko Ono – einleuchtend.
Die Single Please, Please Me kam im Januar 63 auf den Markt und stieg bald auf Platz 1 der britischen Charts. Es öffneten sich nun Türen, an die wir niemals zu klopfen gewagt hätten!
George Martin findet unter diesem Eindruck eine Lücke in der Belegung der Abbey Road Studios, den 11.2.63. »Schafft ihr es, an einem einzigen Aufnahmetag ein ganzes Album aufzunehmen?«
Brian schaute Paul an. Paul nickte.
John und Paul waren nicht bei Stimme, als sie das Studio betraten. Sie hatten mit uns in den vergangenen Wochen einen Auftritt nach dem anderen absolviert. Auf den Gitarrenverstärker Johns legten die Techniker eine Obstschüssel mit Hustenbonbons, nachdem sie die Mikros eingepegelt hatten. Dann begannen die Aufnahmen mit dem Zweispur-Tonbandgerät.