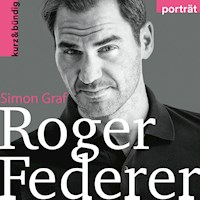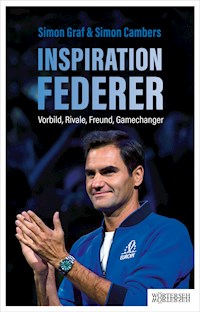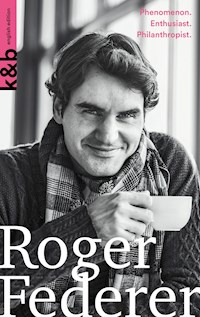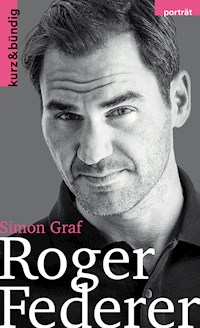
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: kurz & bündig Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Porträt
- Sprache: Deutsch
Roger Federer ist der Weltstar aus unserer Mitte. Als kleiner Junge verliebte er sich in die gelben Bälle, heute fasziniert er die Massen auf dem ganzen Globus. Nicht nur wegen seiner Virtuosität auf dem Court und seiner Erfolge, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit. Dieses Porträt zeigt den Menschen und Sportler in all seinen Facetten. Und obschon er sich in anderen Sphären bewegt, können wir aus seiner Biografie viel mitnehmen.Dies ist die um fünf zusätzliche Kapitel erweiterte Ausgabe des Bestsellers von 2018.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
porträt
Simon Graf
Roger Federer
kurz & bündig verlag | Frankfurt a. M. | Basel
Vorwort
«Jetzt musst du dein Federer-Buch überarbeiten», sagt mein portugiesischer Kollege Miguel Seabra und blickt schmunzelnd zu mir herüber. Wir sitzen auf der Pressetribüne des Centre Courts von Wimbledon nebeneinander, ich eine Spur unruhiger als er. Federer hat sich an jenem 14. Juli 2019 im Finale gegen Novak Djoković im fünften Satz nach zähem Ringen bei 8:7 und 40:15 zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag erspielt. Der Rest ist Geschichte. Zuerst eine leichtfertig verschlagene Vorhand Federers, dann ein überstürzter Netzangriff und zuletzt jubelt doch wieder Djoković. Den Rat meines Journalistenkollegen Miguel habe ich trotzdem beherzigt, und hier ist sie: die aktualisierte und um fünf Kapitel erweiterte Ausgabe meiner Federer-Biografie. Womit wir bei zwanzig Kapiteln angelangt sind, was der Anzahl der aktuell gewonnenen Grand-Slam-Titel des Racketkünstlers entspricht. Angereichert wird die Neuauflage durch kunstvolle Fotos des international renommierten Tennis-Fotografen Paul Zimmer.
Ein besonderer Leckerbissen ist das Interview mit Stanford-Professor und Sportenthusiast Hans Ulrich Gumbrecht über die Faszination Federer. Zudem schildern namhafte Journalisten aus Paris, London, Hamburg, Buenos Aires und Melbourne ihre Sicht auf den Schweizer. Außerdem wage ich einen Blick aufs Familienleben der Federers und gehe der Frage nach, wieso die Schweiz so viele erfolgreiche Tenniscracks hervorgebracht hat.
Die vorliegende Biografie ist nicht autorisiert. In den zwanzig Jahren, in denen ich Federer als Reporter für den Zürcher «Tages-Anzeiger» und die «SonntagsZeitung» bei vielen seiner Siegeszüge um die Tenniswelt begleiten durfte, habe ich ihn sehr gut kennengelernt. Auch in zahlreichen persönlichen Interviews und in Gesprächen mit Personen aus seinem familiären und sportlichen Umfeld. So glaube ich, ein treffendes Bild von ihm zeichnen zu können. Und zwar nicht nur vom Sportler, sondern auch vom Menschen, der wie wir seine Kämpfe auszutragen hatte – wenngleich sein Leben von außen betrachtet wie eine rasante Abfolge von Höhepunkten erscheinen mag.
In diesem Buch versuche ich, Federer in all seinen Facetten abzubilden. Als aufbrausenden Teenager, als Tennisgenie, als Sohn, Ehemann und Vater, als Inspiration, Stratege, Topmanager seines Talents, als Sieger und Verlierer, als Idol, Ausnahmeathlet, Wohltäter und vieles mehr. Das Porträt ist nicht streng chronologisch aufgebaut – vielmehr versammelt es zwanzig längere, thematisch geordnete Stücke. Sie können das Buch klassisch von vorne nach hinten lesen, dürfen aber auch eine beliebige Reihenfolge wählen. Die Kapitel stehen für sich, und wenn Sie alle gelesen haben, hat sich das Puzzle vervollständigt.
Kilchberg, im September 2020
1. Der König aus dem Volk
Es ist ein wunderschöner Tag im Paradies. Die Sonne strahlt, ein leichtes Lüftchen weht durch die Berglandschaft von Gstaad und macht die Sommerhitze erträglich. Es ist der 25. Juli 2013, und im Nobelort freut man sich auf den Auftritt von Roger Federer. Neun Jahre ist der Weltstar nicht mehr hier gewesen. Doch auf seiner verzweifelten Suche nach Spielpraxis macht er wieder einmal Station im Berner Oberland. Die Freude ist so groß, dass man ihm wieder eine Kuh geschenkt hat – wie 2003 nach seinem ersten Wimbledon-Sieg. Doch als ich zufällig sehe, wie sich Federer ein paar Stunden vor seinem Einsatz auf den Sandplätzen des Grand Hotel Palace einspielt, schwant mir Böses. Nichts ist zu sehen von der legendären Federer’schen Eleganz und Leichtigkeit, er wirkt steif wie ein Roboter. Sein Rücken macht ihm also immer noch zu schaffen. Ob es eine gute Idee ist, zum Spiel gegen den Deutschen Daniel Brands anzutreten? Nein, ist es nicht, wie sich einige Stunden später herausstellt. Federer spielt wie eine schlechte Kopie seiner selbst, wirkt gehemmt und bald resigniert. Nach 65 Minuten und einem 3:6, 4:6 verlässt er gesenkten Hauptes den Court.
Es sind quälende Monate für Federer. In Wimbledon ist er als Titelverteidiger in Runde 2 am ukrainischen Nobody Sergej Stachowski gescheitert, immer wieder haben sich im Laufe des Jahres 2013 seine chronischen Rückenbeschwerden gemeldet. Nach seinem blamablen Auftritt vor dem erwartungsfrohen Heimpublikum in Gstaad hat er bestimmt keine Lust, seine Innenwelt nach außen zu tragen. Doch natürlich erscheint er zur obligaten Medienkonferenz und stellt sich den quälenden Fragen – und davon gibt es einige. Niemand würde ihm übelnehmen, wenn er sich kurz fassen würde, doch er gibt eine halbe Stunde lang Auskunft. Obschon er selbst nicht genau weiß, wie es um ihn und seinen Rücken steht. Und dann nimmt er sich auch noch Zeit für einen Schwatz mit dem Sohn des früheren Schweizer Profis Claudio Mezzadri und anderen, die ihn erstmals treffen wollen. Seine Frustration, dass sein Körper nicht mehr mitspielt, schluckt er hinunter – er versetzt sich in jene hinein, die sich so sehr auf ihn gefreut haben. Auf dem Court hat er sie enttäuscht, daneben nimmt er sich umso mehr Zeit. Dabei hätte er sich wohl am liebsten davongemacht und um sich selber gekümmert anstatt um die anderen. Es ist eine kleine Geschichte am Rande, die viel über ihn aussagt.
Ich hätte auch mit der Beschreibung großartiger Siege Federers in dieses Porträt einsteigen können. Doch es ist einfach, im Erfolg zu glänzen. Der wahre Charakter offenbart sich erst in den schwierigen Momenten. Wie an jenem Tag im Berner Oberland, an einem Tiefpunkt seiner Karriere. Oft hat Federer die zwei Zeilen aus dem Gedicht «If» des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling gelesen, die über dem Eingang zum Centre Court Wimbledons prangen. Er hat sie verinnerlicht:
«Wenn du mit Triumph und Niederlage umgehenUnd diese beiden Blender gleich behandeln kannst»
Das Gedicht schließt mit den Worten:
«Dann ist die Erde dein, und alles, was auf ihr istUnd, was noch wichtiger ist: Du wirst ein Mann sein,mein Sohn!»
Kipling richtete das 1910 veröffentlichte Gedicht an seinen Sohn John, der einige Jahre später in den Ersten Weltkrieg ziehen (und da sterben) sollte. Es zählt noch heute zu den populärsten in Großbritannien. Federer verkörpert die Geisteshaltung, die in den Zeilen Kiplings beschworen wird. Zumindest in den beiden oben zitierten. Von all seinen Siegen und Titeln und seinem Leben als Rockstar, dem überall und jederzeit zugejubelt wird, hat er sich den Kopf nicht verdrehen lassen. Und er lässt sich auch nicht entmutigen von Niederlagen und Rückschlägen.
Federer hat viel von zu Hause mitbekommen, nicht nur sportlich. Doch der Baselbieter ist auch gewachsen an den Herausforderungen seines Lebens im Scheinwerferlicht, an seiner Rolle als Schlüsselfigur im globalen Profizirkus. Er realisiert schon früh, dass er als bewunderter Sportler nicht mehr nur sich selber gehört, sondern auch eine Verantwortung anderen gegenüber hat. Und er nimmt sie wahr, ohne sich untreu zu werden. Ob er möchte oder nicht, Federer prägt das Leben vieler anderer Menschen mit. Die Verehrung für ihn nimmt zuweilen fast religiöse Züge an. Seine treuesten Fans investieren all ihre Urlaubstage und fliegen um den Globus, um ihn zu sehen, sie basteln in stundenlanger Arbeit Federer-Devotionalien, schöpfen aus seinen Auftritten Inspiration für ihr eigenes Leben. Legendär ist die Tradition des roten Kuverts, die zurückreicht bis 2003, als er erstmals Wimbledon gewann. Der harte Kern von Federer-Anhängern überreicht ihm seitdem vor jedem Grand Slam und vor vielen weiteren Turnieren einen Umschlag mit Zettelchen, auf denen die Fans ihre Glückwünsche formuliert haben. Unter seinen Anhängern ist es ein Privileg, zum Kurier ausgewählt zu werden und ihn vor dem Turnier beim Training abzupassen, um ihm die hundert oder mehr Botschaften zu überreichen.
Wer den Puls der Tenniswelt spüren möchte, sollte sich einmal während der «All England Championships» im Juli mit dem Zelt in den Wimbledon Park begeben, um da zu übernachten und sich Tickets zu sichern. Und dann mit den Zeltnachbarn über Federer plaudern, um die Wartezeit zu überbrücken. Schnell merkt man: Nicht jeder, der eine Schweizer Flagge am Zelt befestigt hat, ein T-Shirt mit Schweizerkreuz oder eine Baseballkappe mit dem «RF»-Logo trägt, ist Schweizer. Die Federer-Aficionados kommen aus Kalkutta, Shanghai, Melbourne, Dubai, Tennessee, natürlich auch aus Basel und London, aus allen Ecken dieser Welt. Jeder kann erzählen, wann es bei ihm «Klick» gemacht hat. Es gibt wohl keinen Sportler, der bei seinen Anhängern ein solch ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis entfacht wie er. Über den so viele Bücher geschrieben wurden, in denen die Autoren darüber sinnieren, was der Tennisvirtuose bei ihnen ausgelöst hat.
Und gilt Sport in der Kulturszene sonst eher als uncool, zieht Federer auch da viele in seinen Bann. Die deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter etwa sagte 2017 im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»: «Ich kann gar nicht verstehen, wie man Fan von einem anderen lebenden Tennisspieler sein kann, wenn man Federer gesehen hat. Man muss doch dieser Ästhetik, dieser Eleganz, dieser ganz wunderbaren poetischen Spielweise einfach verfallen.» Sie erzählte, sie habe 2014 ihre Konzerte in Australien so gelegt, damit sie Federer im Endspiel der Australian Open in Melbourne hätte zuschauen können. Dummerweise scheiterte er im Halbfinale an Nadal.
So global der Appeal des fünffachen Weltsportlers ist, er trägt ausgeprägte Schweizer Züge. Bei Studien über Swissness stoße man immer wieder auf Attribute, die Federer charakterisieren würden, sagt Torsten Tomczak, Marketingprofessor an der renommierten Universität St. Gallen. Federer steht für Werte der modernen, aber auch der traditionellen Schweiz: Er ist weltoffen, aber geerdet, fleißig, kreativ, zielstrebig, familienorientiert, freundlich, aber hart in der Sache, zuverlässig und angemessen bescheiden geblieben. Er kultiviert nicht gerade das Understatement wie sein Rivale Rafael Nadal, überschreitet aber auch nie die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Und wie die Schweiz ist er neutral. Federer ist der perfekte Diplomat, exponiert sich in der Öffentlichkeit nie in heiklen Fragen. Das ist in einer Zeit, in der die Journalisten mehr denn je auf der Suche nach der reißerischen Schlagzeile sind und diese über die sozialen Medien tausendfach verbreitet wird, eine kluge Strategie.
Wahrscheinlich gibt es keinen Sportler, der so oft interviewt worden ist wie Federer. Allein nach seinen Matches hatte er schon über 1500 Pressekonferenzen zu absolvieren. Wer so oft im Fokus steht, kann sich nicht verstellen. Zumindest nicht dauerhaft. Dass er als Person kohärent ist, unterstrich eine Umfrage des amerikanischen «Reputation Institute» aus dem Jahr 2011. Dabei wurden 54 weltweit bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport von über 50000 Befragten danach bewertet, wie beliebt, respektiert und glaubwürdig sie seien. Der Schweizer landete auf Rang 2, nur hinter dem inzwischen verstorbenen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, aber vor Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama, Barack Obama oder Bill Gates. Seit November 2017 darf sich Federer auch Ehrendoktor nennen, die Medizinische Fakultät der Universität Basel verlieh ihm diesen Titel. Dafür, dass er weltweit den guten Ruf von Basel und der Schweiz fördere, mit seinem Auftreten als Sportler ein Vorbild sei und sich mit seiner Stiftung für Kinder im südlichen Afrika einsetze.
Zum Verblüffendsten zählt, dass ihn seine Konkurrenten so schätzen, obschon er sie fast immer schlägt. Von 2004 bis 2017 erhielt er dreizehn Mal den Stefan-Edberg-Award als fairster und integerster Spieler – gewählt von den Berufskollegen. Nur 2010 konnte ihm Nadal diese Auszeichnung abjagen. Der alljährliche Award ist auch als Dank der anderen Tenniscracks an Federer zu verstehen – dafür, dass er das Klima auf der Profitour nachhaltig verändert hat. Pflegten sich frühere Nummern 1 wie Pete Sampras oder Andre Agassi rar zu machen und die Konkurrenzsituation anzustacheln, mischt sich Federer stets unter die anderen – egal, wie alt oder jung, wie gut oder schlecht sie sind. Was auch auf seine Schweizer Prägung zurückzuführen sein dürfte. Obschon er immer wieder als (Tennis-)König bezeichnet wird, ist er einer aus dem Volk – in der Garderobe oder in der Player’s Lounge bleibt er einer der Jungs, ohne Berührungsängste und immer zu haben für einen Spaß. Mit seiner unkomplizierten Art hat er die Atmosphäre auf der Männertour entkrampft. «Ich fand immer, es sei das Beste, nett zu sein zu den neuen Generationen von Spielern, statt ihnen das Gefühl zu geben, hier sei es für sie die Hölle», sagte Federer einmal. «Ich denke, das färbte auf Nadal und die anderen Spieler ab. Natürlich ist Tennis ein harter Sport, aber es ist immer noch ein Sport. Es gibt viele Dinge, die wichtiger sind im Leben.»
Sein netter, menschlicher Umgang heißt aber nicht, dass er es allen recht machen will. Stets hat er konsequent seinen Weg verfolgt und harte Entscheidungen getroffen, wenn er sie für nötig hielt. Wie die Trennung von mehreren Coaches, den Verzicht auf Davis-Cup-Einsätze oder die komplette Sandsaison. Und auf dem Platz kennt er ohnehin kein Mitgefühl. Einer, der sportlich am meisten unter ihm gelitten hat, ist Andy Roddick. Achtmal trafen sie bei Grand Slams aufeinander, achtmal siegte Federer – viermal davon im Finale. Nach dem Wimbledon-Endspiel 2005 brachte es Roddick auf den Punkt, als er in Richtung Federer sagte: «Ich würde dich liebend gerne hassen. Aber du bist einfach zu nett.»
2. Der Apfel fällt (nicht) weit vom Stamm
Eine spontane Begegnung sagt zuweilen mehr aus über einen Menschen als eine wortreiche Charakterisierung. Dazu passt eine Episode mit Lynette Federer, der Mutter von Roger, erzählt vom früheren Doppelspezialisten Eric Butorac. Der Amerikaner, von 2014 bis 2016 Präsident des Spielerrats und damit Nachfolger des Schweizers, war als Spieler keine große Nummer. Erst recht noch nicht 2006, als er vorwiegend bei den Doppelkonkurrenzen der zweitklassigen Challenger-Tour herumtingelte. Im Oktober jenes Jahres macht er auch Station bei den Basler Swiss Indoors und nimmt seinen Coach mit. Nicht weil er sich in Basel große Chancen ausrechnet, sondern weil er Roger Federer einmal live spielen sehen möchte. Nachdem Butorac in Runde 2 ausgeschieden ist, eilt er zusammen mit seinem Coach in die Hauptarena, wo der Lokalmatador gegen David Ferrer spielt. Sie kommen mit ihren Spielerbadges zwar ins Stadion, doch auf den Rängen gibt es keine freien Plätze mehr. Eine Platzanweiserin schlägt ihnen vor, ihr Glück in den Sponsorenboxen zu versuchen. Da würden immer ein paar Stühle frei bleiben. Und tatsächlich: Sie erspähen zwei freie Plätze in einer Loge in der ersten Reihe und schleichen sich nach drei Games rein. Die anderen vier Leute in der Sechserbox scheinen nichts dagegen zu haben, die «ältere Frau», wie sie Butorac in seinem Blog bezeichnet, ist sogar extrem gastfreundlich. «Sie löcherte mich gleich mit Fragen über meine Tenniskarriere. Woher ich komme. Welchen Schläger ich benutze. Was mein Ranking sei. Und vieles mehr.»
Nach drei, vier Games des Gesprächs möchte sich Butorac endlich aufs Spiel konzentrieren. Schließlich ist er wegen Federer gekommen. Doch da er als Gast in einer Sponsorenbox sitzt, sieht er sich verpflichtet, selber noch etwas Konversation zu betreiben, ehe er sich guten Gewissens dem Wesentlichen zuwenden kann. Also fragt er die ältere Frau: «Ihre Firma ist Sponsor des Turniers?» Sie gibt zurück: «Das ist keine Sponsorenloge. Das ist eine private Loge.» Butorac ist verwirrt. «Eine private Loge?» Sie erklärt: «Ich bin Rogers Mutter. Das sind sein Vater, seine Schwester, sein Manager.» Dem Doppelspieler ist es unendlich peinlich, sich auf diese exklusiven Plätze geschlichen zu haben. Doch Lynette Federer plaudert weiter munter auf ihn ein. «Kennst du Roger? Seid ihr Freunde?» Auch Vater Robert mischt sich ins Gespräch, doch der verlegene Eindringling ist auf einmal ganz schüchtern und wortkarg. Er kann es kaum erwarten, dass das Spiel vorbei ist, so unangenehm ist ihm die Situation. «Es war Federers längster Zweisatzsieg, den ich je erlebt habe.» Er fühlt sich wie ein kleines Kind, das Süßigkeiten gestohlen hat. Nach dem Match stürmt er aus der Halle, um nicht auch noch Federer persönlich zu begegnen. Jener Abend bleibt ihm in Erinnerung. Obschon er ein Wildfremder war, wurde er in der Federer-Loge behandelt wie ein alter Bekannter.
Zwei Jahre später bei den US Open, als er gerade im gemischten Doppel verloren hat und seine Sachen packt, fragt ihn Federers damaliger Coach José Higueras, ob er schon abreise. Er nickt. «Schade, ich suche einen Linkshänder, der morgen mit Roger trainieren kann.» Diese Chance will sich Butorac natürlich nicht entgehen lassen: «Hatte ich gesagt, ich würde heute abreisen? Sorry, ich meinte natürlich morgen.» Und so lernt er Federer persönlich kennen, ehe er sich später als sein Vizepräsident im Spielerrat mit ihm anfreundet. Er sagt über den Schweizer: «Selbst den aufdringlichsten, unfreundlichsten Anfragen von Sponsoren oder Fans begegnet er mit einer unerschütterlichen Demut. Einige denken vielleicht, er mache eine Show für die Öffentlichkeit, doch er ist einfach so.» Er sei schon unzählige Male gefragt worden, ob Federer wirklich so nett sei. Er antworte jeweils: Nein, noch netter! Und er wisse auch, woher er dies habe. Von seinen Eltern. In der Tat lassen sich viele Charakterzüge Federers auf seine Eltern zurückführen. Seine bodenständige, aber weltoffene Art. Seine Konsequenz. Seine Fairness. Sein ausgeprägter Familiensinn. Sein Humor. Oder seine soziale Ader.
Lynette und Robert Federer wachsen über 12000 Kilometer voneinander entfernt auf: sie in Kempton Park, einer Großstadt Südafrikas in der Nähe von Johannesburg, er in Berneck im St. Gallischen Rheintal. Am Rathaus der idyllischen Gemeinde, die heute knapp 4000 Einwohner zählt, hängt eine Büste Federers – von Heinrich Federer. Wie der Weltsportler hatte auch der Dichter (1866–1928) Berneck zum Heimatort, lebte aber nie dort. Wer die Büste am Rathaus von der Seite betrachtet und die markante Nase sieht, könnte vermuten, dass die beiden Persönlichkeiten über viele Ecken verwandt sein müssten. Robert Federer wächst in einem der ältesten Häuser Bernecks auf, hilft in einem ländlichen Umfeld auf den Feldern aus. Im nahe gelegenen Widnau in der (inzwischen stillgelegten) Fabrik der Kunstfaserproduzentin Viscosuisse, wo sein Vater im Schichtbetrieb arbeitet, macht er eine Lehre als Chemielaborant. Doch schon früh zieht es ihn fort. Zuerst nach Basel, wo er bei der Ciba anheuert, mit 24 Jahren in die weite Welt nach Südafrika, um dort für dasselbe Schweizer Chemie-Unternehmen zu arbeiten. In der Ciba-Firmenkantine in Kempton Park trifft er 1970 die 18-jährige Sachbearbeiterin Lynette Durand. Sie verlieben sich ineinander und werden ein Paar. Eigentlich hatte sie als jüngstes von vier Kindern davon geträumt, nach England auszuwandern. Stattdessen zieht sie 1973 zusammen mit Robert nach Basel, wo sie heiraten und wieder beide fürs gleiche Unternehmen tätig sind, das nun Ciba-Geigy heißt. 1979 kommt Tochter Diana zur Welt, am 8. August 1981 Roger.
Lynette Federer wächst in einer kosmopolitischen Familie auf – sie trägt einen französischen Vor- und Nachnamen (Durand), hat aber auch deutsche und holländische Wurzeln. Zu Hause wird Afrikaans gesprochen, sie besucht jedoch auf Initiative ihres Vaters eine englische Schule und spricht ein gepflegtes britisches Englisch. In Basel lernt sie dann schnell Schweizerdeutsch, was ihre Integration erleichtert. Vielsprachigkeit wird später auch zu einem Markenzeichen Roger Federers. Vater Robert ist die Herkunft aus dem St. Gallischen Rheintal in seinem Dialekt noch heute gut anzuhören, obschon er seit über fünfzig Jahren aus Berneck weggezogen ist. Dass wie Federer viele erfolgreiche Sportler einem Mix von Kulturen entstammen, ist wohl kein Zufall. Hätte man einen Ausnahmeathleten auf dem Reißbrett entworfen, wäre man aber kaum auf Lynette und Robert Federer als Eltern gekommen. Denn beide sind von eher kleiner Statur und keine Ausnahmesportler. Ihnen fällt jedoch schon früh auf, dass ihr Sohn koordinativ sehr stark ist. Bereits mit elf Monaten habe er alleine laufen können, erzählt Lynette im Interview mit der «Basler Zeitung» zu seinem 30. Geburtstag. Vielleicht auch wegen der «Riesenfüße», die er bereits bei der Geburt gehabt hatte. «Er konnte bald Fußball spielen und Bälle fangen», berichtet Robert. «Wir haben immer mit Roger gespielt, Fußball, Tischtennis, später Squash. Es gibt auch schöne Fotos, wie er beim Tischtennisspielen nur knapp über die Kante schauen kann.» Und Lynette ergänzt: «Wir hatten auf dem Spielplatz immer einen Ball dabei. Man konnte ihm den Ball zuspielen, und er kam sofort zurück, während die anderen Kinder die Bälle in alle Richtungen verstreuten.»
Auf die Frage, welche erblichen Voraussetzungen er von seinen Eltern bekommen habe, sagt Federer: «Was das Tennis betrifft, ist das schwer zu sagen, denn beide haben es relativ spät gelernt. Und das sieht man. Vielleicht das Athletische. Meine Mutter spielte früher Feldhockey und machte Ballett. Und mein Vater? Er wanderte im Appenzellerland. Ich denke, ich hatte recht normale Voraussetzungen.» Lynette ist die sportlich Aktivere. Sie schafft es in Südafrika als Teenagerin bis in eine Regionalauswahl im Feldhockey – doch wegen der vielen Schläge gegen ihre Beine hört sie auf. Robert hat in seiner Jugend wenig Zeit, Sport zu treiben. Er spielt gelegentlich Fußball und stößt mit 17 oder 18 zum FC Widnau, ehe er in die große Welt hinauszieht. Zum Tennis kommt er erst mit 24. Als er Lynette kennenlernt, wird dieser Sport zu ihrem gemeinsamen Hobby. Zuerst im Schweizer Club in Johannesburg, nach ihrem Umzug in die Schweiz auf der Firmenanlage von Ciba-Geigy in Allschwil.
Obschon sie erst spät mit dem Tennis beginnen, erreichen beide noch ein beachtliches Niveau. Lynette wird sogar, obschon sie erst mit 19 Jahren erstmals einen Schläger in die Hand genommen hat, noch Schweizer Meisterin – 1995 mit den Jungseniorinnen (ab 30) des TC Old Boys. Sie habe «einen giftigen Slice» gehabt, heißt es. Dieser Schlag scheint also in den Genen zu liegen. Apropos Gene: «Den Spieltrieb hat Roger wohl von mir», mutmaßt die Mutter. «Ich war sehr ehrgeizig im Sport, hatte schon immer diesen Siegesdrang. Ich ließ ihn als kleinen Bub nie gewinnen. Nicht einmal bei den Fußballmatches, die wir nach dem Mittagessen im Korridor der Küche gegeneinander austrugen, als er in die Primarschule ging. Da ging es immer hart auf hart. Das war jeden Tag ein Kampf, bei dem wir uns nichts schenkten.» Bei allem Ehrgeiz sei sie aber immer fair geblieben – was ebenfalls auf ihn abgefärbt habe.
Etwas überspitzt könnte man sagen: Das Spielerische hat Roger von seiner Mutter, das Geerdete von seinem Vater. Was aber nicht heißt, dass Robert nicht emotional werden kann. Auch nach all den Jahren und Siegen kann er sich innerlich immer noch fürchterlich aufregen, wenn sein Sohn eine Vorhand verschlägt. Deshalb sitzen Robert und Lynette auf der Tribüne vorzugsweise nicht nebeneinander, wenn Roger spielt. Nur in der Royal Box auf dem Centre Court von Wimbledon lässt sich das nicht immer vermeiden. «Meine Frau will nicht neben mir sitzen», sagt er schmunzelnd. «Es ist einfach angenehmer so», erklärt sie. Die Kommentare ihres Mannes in kritischen Situationen, wenn auch sie angespannt sei, seien nur schwer zu ertragen. Federer sagt über seine Eltern: «Mein Vater hat eine harte Schale und einen weichen Kern. Meine Mutter ist ausbalancierter.»
Die Eltern als Inspiration: Roger Federer posiert nach dem Wimbledon-Triumph 2006 mit Robert und Lynette.
Anfangs ist es Lynette, die Roger auf den Tenniscourt mitnimmt, später ist Robert der aktivere Förderer der Tenniskarriere des Sohnes. Obschon Lynette beim TC Ciba Juniorentrainings leitet, sieht sie davon ab, Klein-Roger zu unterrichten. Die Eltern setzen schon früh auf erfahrene Trainer und reden ihnen auch nicht hinein. Sie legen aber Wert darauf, dass er sein Hobby mit der nötigen Hingabe betreibt. Federer erzählt: «Mein Vater sagte oft zu mir: ‹Ich finde es gut, wenn du Tennis spielst und daran Spaß hast. Aber bitte, wenn du trainierst, mach es ernsthaft. Denn es kostet viel Geld.› Meine Mutter fand das auch, aber sie sagte es nicht so bestimmt wie er.» Zwischen seinem 13. und 17. Lebensjahr müssen die Eltern jährlich rund 30000 Franken für die Tenniskarriere ihres Sohnes aufwenden. Eine stolze Summe. Um das Geld zusammenzubringen, stockt Lynette ihr Arbeitspensum von 50 auf 80 Prozent auf. Als Robert Federer 1995 eine verlockende Offerte für einen Job in Australien bekommt, entscheidet sich die Familie auch wegen der guten Trainingsmöglichkeiten für Roger in der Schweiz gegen das Auswandern.
Trotz all der Opfer, die die Eltern bringen, setzen sie ihren Sohn nicht unter Erfolgsdruck. Die Entscheidung, mit 14 Jahren ins nationale Leistungszentrum in Ecublens zu ziehen, fernab vom wohligen Zuhause und seinen Freunden in einer fremden Sprachregion, fällt er selber. Es zahlt sich ohnehin aus, dass die Eltern ihre Kinder schon früh zur Selbstständigkeit erzogen haben. Es sei ihnen gar nichts anderes übriggeblieben, sagt Lynette. Denn Robert weilt wegen des Jobs oft im Ausland, seine Eltern wohnen in der Ostschweiz und die Familie von Lynette lebt weit weg in Südafrika. So üben die Kinder schon früh, allein mit dem Fahrrad zur Schule oder ins Training zu fahren. Dieses hohe Maß an Eigenverantwortung prägt Roger und färbt auf den späteren Tennisprofi Federer ab. Er ist keiner, der vor Entscheidungen zurückschreckt – weder auf noch neben dem Platz. Nie sieht man ihn sehnsüchtig in seine Box blicken, in der Hoffnung auf rettende Signale seiner Coaches. Er sucht selber nach Lösungen.
Federer gelingt früh die Ablösung von den Eltern, ihr Verhältnis bleibt aber eng. Sie nehmen aktiv teil an seiner Profikarriere. Nachdem er 2003 seine Zusammenarbeit mit dem US-Vermarktungsriesen IMG zum ersten Mal beendet, entscheidet er sich sogar temporär für ein innerfamiliäres Management. Lynette verlässt die Ciba nach 33 Jahren, um sich beruflich ihrem Sohn zu widmen. Im Herbst 2005 kehrt dieser dann zu IMG zurück – als inzwischen sechsfacher Grand-Slam-Champion. Noch heute sind seine Eltern stark involviert bei den Aktivitäten ihres Sohnes – sei es als Stiftungsräte bei der «Roger Federer Foundation», beim Beantworten der Fanpost und vielem mehr. Dass er sie so oft wie möglich bei den Turnieren dabeihaben will, zeigt, dass sie sehr vieles richtig gemacht haben. «Es treibt mich an, dass meine Eltern so stolz sind auf mich», sagt er. «Und es macht mich glücklich, dass sie es genießen, zu den Turnieren zu kommen.» Vater Robert sagt: «Das größte Kompliment ist für uns, wie er in den Stadien empfangen wird. Selbst wenn er in Frankreich gegen Gaël Monfils oder in England gegen Andy Murray spielt. Deshalb gehe ich meistens fünf Minuten vor ihm ins Stadion.»
Der Vater fiebert immer noch mit wie eh und je, aber er hat den Aberglauben überwinden können, er bringe Roger Unglück. Nachdem er in Wimbledon 2002 bei der vernichtenden Auftaktniederlage gegen Mario Ančić auf der Tribüne gesessen hat, bleibt er dem «All England Club» in den beiden folgenden Jahren fern. Und verpasst so 2003 den ersten Wimbledon-Sieg seines Sohnes. Gegenüber der Boulevardzeitung «The Sun» erklärt er am Telefon, er habe zu Hause die Katze füttern müssen. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie der Schalk über sein markantes Gesicht gehuscht ist, als er dem verdutzten Reporter diese kleine Notlüge auftischte.
3. Die Geburt eines Champions
Dunkle Wolken hängen an diesem Montag, dem 30. Juni 2003, über dem «All England Lawn Tennis and Croquet Club». Sie stehen symbolhaft für das Ungemach, das Roger Federer im Achtelfinale von Wimbledon gegen Feliciano López droht. Der Baselbieter, der im Südwesten Londons endlich das Versprechen einlösen will, das er mit seinem immensen Talent und seinem Coup gegen Pete Sampras von 2001 abgegeben hat, schießt beim Einspielen ein stechender Schmerz in den Rücken. Wer schon einmal einen Tennisschläger geschwungen hat, weiß, es gibt in diesem Sport, in dem man sich ständig dreht und streckt, nichts Unangenehmeres als einen blockierten Rücken. Wenn es doch wieder zu regnen begänne, denkt sich Federer. Dann könnte er zurück in die Garderobe, sich pflegen lassen, eine Schmerztablette einwerfen und warten, bis sie wirkt. Doch nicht einmal aufs britische Wetter ist Verlass an diesem grauen Tag. Es bleibt trocken.
Das sportliche Drama spielt sich auf Court 2 ab, auch bekannt als «Friedhof der Champions». Schon manch großer Spieler hat die kleine, intime Arena mit feuchten Augen verlassen. Im Jahr zuvor endete hier die Wimbledon-Karriere von Sampras. Gegen George Bastl, den Collegespieler aus dem Schweizer Kurort Villars-sur-Ollon, der in der Qualifikation gescheitert, aber dank einer Absage ins Turnierfeld gerutscht war – um dort den siebenfachen Champion zu schlagen. Diesen Abgang an der Stätte seiner größten Erfolge hätte Sampras niemand gewünscht. In den Spielpausen las er auf seinem Stuhl immer wieder in einem Brief seiner Frau Bridgette, die aufbauende Worte an ihn gerichtet hatte. Es nützte nichts. Und nun scheint der «Friedhof» also sein nächstes prominentes Opfer zu fordern.
So viele würden dem jungen Schweizer mit dem eleganten Spiel und dem Pferdeschwanz den Durchbruch auf der großen Tennisbühne gönnen. Der Sport dürstet nach dem Ende der Ära von Pete Sampras und Andre Agassi nach neuen Stars. Nicht umsonst hat die Männertour eine Kampagne lanciert mit dem Titel: «New Balls Please!» Federer schaut vom Plakat mit finster entschlossener Miene auf einen herab – neben anderen aufstrebenden Spielern wie Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Marat Safin oder Juan Carlos Ferrero. Doch bei den Grand Slams scheint es der Tennisvirtuose einfach nicht auf die Reihe zu kriegen. Bei drei seiner letzten fünf Starts ist er in Runde 1 gescheitert. Ein paar Wochen zuvor in Paris am Peruaner Luis Horna, der Nummer 88 der Weltrangliste. Wie gelähmt wirkte Federer da. Die französische Sportzeitung «L ’Equipe» schrieb: «Man wäre am liebsten auf den Platz hinuntergegangen und hätte den Mann aus seiner Traumwelt geschüttelt.»
Ob er in diesen bangen Momenten auf Court 2 in Wimbledon an jene Enttäuschung denkt? Als er gegen López nach zwei Games den Physiotherapeuten herbeirufen und sich auf dem Rasen behandeln lässt, geht ein Raunen durch die Ränge. Spielt er weiter oder nicht? Während der fünfminütigen Pause denkt der 21-Jährige ans Aufgeben. Doch dann besinnt er sich eines Besseren. Ihm hilft, dass sein Gegner, der mit seiner kräftigen Statur und den langen Haaren aussieht wie ein römischer Gladiator, mit deutlich weniger Spielintelligenz gesegnet ist als er. Der spanische Linkshänder kann von Federers Einschränkung nicht ausreichend profitieren, spielt zu überhastet, statt seinen angeschlagenen Widersacher in längere Ballwechsel zu verwickeln. Und obschon Federer beim Aufschlag sein Tempo um rund zehn Stundenkilometer drosseln muss, um den Rücken zu schonen, gerät er bei seinem Service kaum in Bedrängnis. Er gewinnt zwar nur drei Punkte mehr, kommt aber in drei knappen Sätzen weiter. Sein schwedischer Coach Peter Lundgren atmet tief durch. Erst sechs Tage später, als strahlender Wimbledon-Sieger, erzählt Federer, wie er sich wirklich fühlte gegen López: «Ich hatte große Schmerzen, konnte kaum mehr aufschlagen oder retournieren. Es tat so weh, dass ich auch nicht mehr absitzen konnte. Als ich den Physio herbeirief, gab er mir Schmerzmittel und rieb mir eine wärmende Salbe ein. Ich sagte mir: Wenn es noch ein paar Games so weitergeht und er [López] mir den Hintern versohlt, hat es keinen Sinn mehr zu spielen. Doch irgendwie blieb ich im Match, und es wurde ein bisschen besser.»
Sein Sieg ist an diesem turbulenten Achtelfinaltag an der Church Road nicht viel mehr als eine Randnotiz. Doch für ihn ist er ein großer Schritt. Das britische Wetter meldet sich am Mittwoch zurück und erzwingt die Verlegung seines Viertelfinales auf Donnerstag, was nicht nur Federers Rücken, sondern auch seinen Gegner freut. Denn Sjeng Schalken musste sich einen Bluterguss am linken Fuß operativ entfernen lassen und kann kaum gehen. Auch zwei Tage Pause und eine schmerzstillende Spritze reichen dem Holländer nicht: Er ist gegen Federer immer noch eingeschränkt und chancenlos. So trennen diesen plötzlich nur noch zwei Siege von seinem ersten Triumph bei einem Grand Slam. Jahre später gesteht Federer, dass ihn bei den vier großen Turnierstationen in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York lange die Aussicht gehemmt habe, für diese prestigeträchtigen Titel sieben Matches auf drei Gewinnsätze für sich entscheiden zu müssen. Er habe immer diesen Mount Everest vor sich gesehen, den er erklimmen müsse, dabei sei ihm schwindlig geworden.
Doch nun ist der Gipfel plötzlich nah. Federers Rückenschmerzen sind wie weggeblasen, ebenso seine Zweifel. Vor dem Halbfinale gegen Andy Roddick macht er sich keine Sorgen über den Aufschlag des Amerikaners, der die Bälle regelmäßig mit über 200 Stundenkilometern ins Feld donnert. «Er wird schon nicht 200 Asse schlagen», sagt er. Im Duell der Jungstars erwischt er einen Sahnetag. Roddick staunt über seinen Gegner, dem einfach alles gelingt, hadert mit seinem Schicksal, beginnt an sich zu zweifeln – und flüchtet sich zuletzt in Galgenhumor. Federer setzt seine Volleys zentimetergenau ins Eck, ist gedanklich immer einen Zug voraus und erahnt bei Roddicks Aufschlägen meist die richtige Ecke. Die vernichtendste Statistik für den ein Jahr jüngeren Herausforderer aus Omaha, Nebraska: Federer schlägt in drei Sätzen siebzehn Asse, er gerade mal vier. Auch Ballwechsel, in denen er richtig gut gespielt habe, habe er verloren, sagt Roddick kopfschüttelnd.