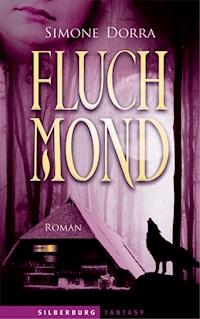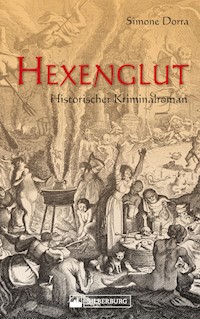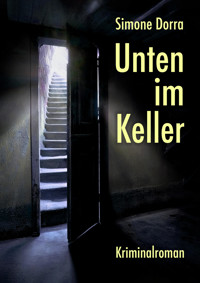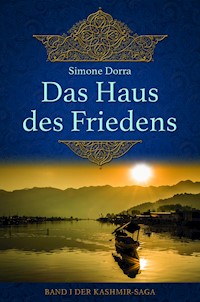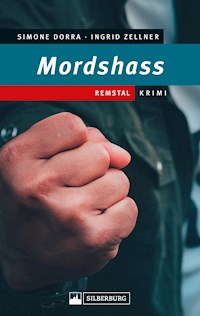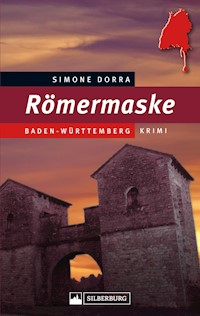
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Kommissar Malte Jacobsen das römische Ostkastell in Welzheim besichtigt, stolpert er geradewegs in seinen nächsten Mordfall: Im Kastellbrunnen wurde eine Leiche vergraben. Jacobsen und seine Kollegin bekommen es mit zwei Römervereinen zu tun, die sich nicht grün sind, und mit einem Sensationsfund, einer römischen Helmmaske. Es stellt sich heraus, dass der Tote der Experte war, der die Echtheit des Fundes bestätigt hatte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Dorra erblickte 1963 in Wuppertal das Licht der Welt und ist seit 1983 in Baden-Württemberg zu Hause. Die gelernte Buchhändlerin arbeitete zunächst in einem Stuttgarter Verlag und gestaltete dann als Sprecherin und Journalistin Radioprogramme für den Privatrundfunk. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Welzheim, wo sie heute als Lokaljournalistin für die örtliche Tageszeitung arbeitet.
SIMONE DORRA
Römermaske
Baden-Württemberg-Krimi
1. Auflage 2018
© 2018 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schweickhardtstraße 5a, D-72072 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.
Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen.
Coverfoto: © Magnus Dorra, Welzheim.
Druck: Gulde-Druck, Tübingen.
Printed in Germany.
ISBN 978-3-8425-2087-5
eISBN 978-3-8425-1796-7
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Morituri te salutant.(Die Todgeweihten grüßen dich.)
Antiker Salut der römischen Gladiatoren in der Arena anden Kaiser
INHALT
EIN ANRUF
DER BRUNNEN
GEFUNDEN
AUFGESPIESST
ENTDECKUNGEN
SCHILDE HOCH
VEREINSMEIER
SUCHEN UND FINDEN
TIEFER GESCHÜRFT
UNTER DEM DECKEL
NEUE FAKTEN
ABSCHIED
NEUE FRAGEN
DETEKTIVSPIEL
VERMISST
ZWEI OPFER
GESTÄNDNISSE
STREITHÄHNE
ERKENNTNISSE
KATZ UND MAUS
EPILOG
Anmerkungen und Dank
EIN ANRUF
Kommissar Malte Jacobsen saß auf dem Teppichboden mitten in dem Raum, in dem er ab heute schlafen würde. Er musterte übellaunig die Einzelteile des Bettes, die vor ihm aufgereiht lagen (mitsamt einer erschreckenden Vielfalt unterschiedlicher Schrauben), und wünschte sich für einen langen, peinlichen Moment verzweifelt in das gemütliche Gästezimmer seiner Schwester Heike zurück.
Umzüge waren eine Katastrophe. Und komplett überflüssig. Anstrengend waren sie obendrein, sie kosteten viel zu viel Geld, und sie gehörten abgeschafft.
Er hatte das Gästezimmer in dem schmucken Reihenhaus von Heikes Familie eigentlich schon vor einem Jahr räumen wollen, aber das, was seine Kollegin Melanie Brendel einmal scherzhaft »Nestwärme« genannt hatte, hielt ihn dort fest, mit angenehm weichen und erstaunlich reißfesten Fäden. Weder Kurt noch Heike und genauso wenig sein Neffe Paul gaben ihm das Gefühl, dass er ihnen als Dauergast auf die Nerven ging, ganz im Gegenteil. Er selbst war es gewesen, der schon im Herbst nach seinem ersten Fall in Schwaben damit anfing, sich auf dem Wohnungsmarkt umzuschauen. Zuerst wollte er nach Waiblingen ziehen; das Präsidium lag näher, und er würde nicht mehr jeden Tag mit der S-Bahn zwanzig Minuten zur Arbeit fahren müssen.
Aber die richtige Bleibe zu finden, erwies sich als weitaus schwieriger, als er erwartet hatte. Die freien Wohnungen, die er sich ansehen konnte, waren entweder viel zu groß und kostspielig, oder sie waren auch für seine relativ bescheidenen Ansprüche zu klein (und selbst dann noch häufig zu teuer). Der Wohnungsmarkt in Backnang schien beinahe ebenso abgegrast zu sein wie der in Waiblingen, und für eine Weile schob er den Gedanken an einen Umzug wieder weit von sich; es gab genügend anderes zu tun.
Verbrechen wurden in Schwaben genauso begangen wie in Hamburg. Jacobsen hatte in den letzten zwölf Monaten Einbrüche, Raubüberfälle und zwei Morde aufgeklärt; seine Arbeit bot Ablenkung, um die leidige Frage, wo er in Zukunft seine Zelte aufschlagen sollte, erst einmal zu verdrängen.
Aber im vergangenen April war Heike es gewesen, die ihm den Tipp gab, einen Vermieter anzurufen, der kurzfristig nur zwei Querstraßen weiter drei Zimmer mit Keller, Autostellplatz und Balkon anzubieten hatte. »Bloß für den Fall, dass du was suchst«, hatte sie gesagt. »Nicht etwa, weil wir dich loswerden wollen.« Er glaubte es ihr, ergriff die Gelegenheit aber trotzdem dankbar beim Schopf.
Die Wohnung war hell, freundlich, obendrein vollständig frisch renoviert und hatte genau die richtige Größe. Der Vermieter entpuppte sich als ein gemütlicher alter Schwabe namens Eugen Fromm; er war von Jacobsen ebenso angetan wie von dessen Gehaltsnachweis und Beamtenstatus. Die Miete erwies sich als erfreulich tragbar, der Balkon blickte hinaus auf einen von Bäumen umstandenen Spielplatz, und nach einem halbstündigen Gespräch wurden Jacobsen und Eugen Fromm sich handelseinig. Zwei Tage später lag der Mietvertrag in Heikes Briefkasten.
Und jetzt saß Jacobsen auf dem Boden in besagter Wohnung, betrachtete missmutig den Bretterhaufen, in den sein Bett vor dem Transport aus dem Lager in Hamburg zerlegt worden war, und fragte sich, wie zum Teufel er auf die Idee gekommen war, seine Möbel allein zusammenbauen zu wollen.
Plötzlich klingelte es an der Tür. Jacobsen stemmte sich hoch, unterdrückte einen Seufzer, ging in den Flur und öffnete. Er erwartete, Heike auf der Schwelle vorzufinden, womöglich bewaffnet mit Brot und Salz. Stattdessen stand dort sein Vermieter, in Popelinehosen, sauber gebügeltem Polohemd und Strickweste, eine Weinflasche unter dem Arm.
»Grüß Gott«, sagte Jacobsen matt; ihm war ganz und gar nicht nach Smalltalk zumute.
»Grüß Gott«, erwiderte Eugen Fromm munter. »I han bloß mal schaue welle, ob Sie au zurechtkommet. Ko mer Ihna mit äbbes helfa?«
Jacobsen machte eine vage Geste in Richtung Schlafzimmer.
»Ich wollte gerade das Bett aufbauen, aber ich bin weniger geschickt, als ich dachte«, gestand er.
Eugen Fromm nickte, als hätte er etwas Ähnliches bereits erwartet, und schob sich behutsam an dem hohen Kartonstapel vorbei, der sich an der gesamten Flurwand entlangzog. Im Schlafzimmer angekommen, betrachtete er die Bescherung und gab ein mitfühlendes Zungenschnalzen von sich.
»Des isch aber au en Haufa Arbeit für oin Mo alloi«, meinte er diplomatisch. »I sag Ihna äbbes – mein Hubert kommt glei aus dr Werkschtatt. I sag em, er soll sein Werkzeigkaschte mitbrenga … und dr Lehrbua glei au no.«
Jacobsen sah vor seinem inneren Auge zwei wackere Schwaben, die sich gemeinsam mit seinem Vermieter mit Feuereifer auf sein Bretter- und Schraubenchaos stürzten, und empfand eine Mischung aus Verlegenheit und schuldbewusster Erleichterung. Eugen Fromms Hubert und dieser Lehrbub (wer immer die beiden auch sein mochten) verstanden mit Sicherheit mehr von der Sache als er. Vielleicht würde er heute Nacht doch nicht auf einer Luftmatratze schlafen müssen.
Eugen Fromm verabschiedete sich wenige Minuten später, ein entschiedenes Leuchten der Vorfreude in den Augen, und er ließ die Weinflasche als kleines Begrüßungsgeschenk zurück. Wie Jacobsen feststellte, handelte es sich um einen ordentlichen Trollinger aus der Heilbronner Gegend, und seine Stimmung hob sich noch weiter. Er stellte die Flasche auf ein Regal in der weißen Schrankwand, die bereits ihren Platz im Wohnzimmer gefunden hatte, und beschloss, die Tatsache, dass ihm so unerwartet Hilfe zuteil geworden war, mit einer Zigarette auf dem Balkon zu feiern.
Während er am Balkongeländer stand und in der Tasche seiner Jeans nach dem Feuerzeug fahndete, hörte er irgendwo aus der Wohnung sein Handy klingeln. Er ging wieder hinein und folgte dem Signalton, bis er das gesuchte Gerät in der Tasche seiner Lederjacke entdeckte, die über der Lehne des Wohnzimmersofas lag (wenigstens das musste nicht mehr aufgebaut werden).
Er drückte den Knopf und hob das Handy ans Ohr.
»Jacobsen, hallo?«
Am anderen Ende blieb alles still.
»Hallo? Wer ist denn da?«
Ein unterdrückter Laut, der wie ein Räuspern klang.
»Hallo? Melden Sie sich bitte, oder ich lege jetzt auf.«
Wieder dieses Räuspern. Dann, endlich, eine leise, junge Stimme: »Hallo. Hier … hier ist Lukas.«
Für ein paar Sekunden blieb Jacobsen die Luft weg. Jetzt war er es, der sich räuspern musste, bevor er seine Stimme wiederfand.
»Lukas?«, sagte er leise. »Lukas von Weyen?«
»Genau der. Hallo, Herr Jacobsen. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich?«
»Sicher, Lukas.« Malte Jacobsen schloss die Augen. »Klar hab ich Zeit. So viel du willst.«
Herr im Himmel.
Vier Tage später steuerte Malte Jacobsen seinen Wagen auf den nördlichen Rand von Backnang zu. Er war fast zwei Jahre nicht mehr dort gewesen, wo er jetzt hinwollte, aber während seines ersten Mordfalles in Schwaben war er diese Strecke oft genug gefahren.
Der Mord an Peter von Weyen. Lukas’ Vater.
Monatelang hatte dieser Fall die Schlagzeilen in Backnang beherrscht. Kein Wunder, er hatte alles geboten, was die Sensationslust von Journalisten und Lesern gleichermaßen befeuerte. Ein Pfadfinderführer, Schwiegersohn einer der angesehensten Familien der Stadt … ein Mann ohne Fehl und Tadel, der während eines Pfadfinderlagers in der Nähe erhängt an einem Baum gefunden worden war. Die Ermittlungen waren schwierig und kompliziert gewesen, und als Jacobsen und seine Kollegin Melanie Brendel das Gewirr aus Lügen und Missverständnissen endlich entwirrt hatten, blieben Lukas von Weyen und seine Großmutter Klara allein in der großzügigen Villa zurück, in der auch Peter von Weyen bis zu seinem Tod gelebt hatte – beide auf tragische Weise Hinterbliebene und gleichzeitig Opfer eines Verbrechens, an dem keiner von ihnen auch nur die geringste Schuld trug.
Jacobsen hatte Lukas während der Ermittlungen kennen und schätzen gelernt – nein, eigentlich schon vorher, als Lukas und sein Freund aus Versehen die Terrassentür von Heikes Wochenendhaus eingeworfen hatten, in dem Jacobsen nach seinem Umzug aus Hamburg und vor seinem Dienstbeginn ein paar dringend nötige Urlaubstage verbracht hatte. Da war Peter von Weyen noch am Leben gewesen.
Nach der Aufklärung des Mordes folgte im Spätherbst der Prozess. Malte musste als leitender Ermittler in der Sache aussagen. Er sah, dass Klara von Weyen jeden Tag anwesend war, sprach aber nicht mit ihr; er hätte auch nicht gewusst, was er ihr sagen sollte. Lukas kam kein einziges Mal in den Gerichtssaal, und noch heute war Jacobsen sehr dankbar dafür. Die Beweise waren lückenlos, die Indizien erdrückend. Es dauerte nicht lange, bis der Richter zu einer abschließenden Entscheidung kam; auch das war etwas, wofür man dankbar sein musste, denn die Presse brachte täglich sehr detaillierte Berichte mit Auszügen der Aussagen und immer neuen Zusammenfassungen und Analysen der schockierenden Geschichte. Malte Jacobsen las sie alle, obwohl er ganz genau wusste, dass sie seine Schuldgefühle Lukas und seiner Großmutter gegenüber nur noch verstärkten.
Als Anfang Dezember das Urteil gesprochen wurde, kam Melanie Brendel ins Büro und warf einen kurzen, scharfen Blick auf die Titelseite der »Backnanger Kreiszeitung«, hinter der sich Jacobsen – wie so häufig in den letzten Wochen – vergraben hatte. Dann streckte sie die Hand aus und nahm ihm das Blatt weg.
»Jetzt reicht’s, Malte«, sagte sie sanft, aber nachdrücklich. »Du weißt doch ganz genau, dass du nichts für die Sache kannst. Du hast nur die Wahrheit herausgefunden, und das ist dein Job, oder?«
»Klar«, gab Jacobsen zurück. »Und trotzdem sitzen die beiden jetzt auf einem fürchterlichen Scherbenhaufen.«
»Für den du nicht verantwortlich bist.« Melanie schüttelte den Kopf. »Genauso wenig wie ich, übrigens, und ich hab schließlich gemeinsam mit dir ermittelt. Wir haben keine Schuld an diesem Desaster … und wenn sich die Dinge etwas beruhigt haben, wird der Junge das bestimmt begreifen. Genauso wie seine Großmutter.«
Jacobsen hatte Lukas unmittelbar nach der Aufklärung des Mordes an dessen Vater eine Visitenkarte zugesteckt – als Angebot, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Junge jemals wieder Lust verspüren würde, auch nur ein Wort mit ihm zu reden. Deswegen machte er von sich aus keinen Versuch, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Allerdings erkundigte er sich regelmäßig nach ihm bei seinem Neffen Paul, der mit Lukas auf dieselbe Schule ging. Der hatte sich bei der ersten vorsichtigen Anfrage seines Onkels zwar ein wenig gewundert, aber gottlob nicht viele Fragen gestellt, und versorgte ihn seitdem zuverlässig mit Informationen. Deswegen wusste Jacobsen, dass Lukas sein Abitur ein Jahr später machen würde als normalerweise.
»Der Direx hat ihm angeboten, die Klasse zu wiederholen«, hatte Paul ihm Ende April erklärt. »Deswegen ist er auch erst übernächstes Jahr mit dem Abi durch.«
Er hatte Jacobsen unter seinem schräg geschnittenen, blauschwarzen Pony einen vorsichtigen Blick zugeworfen.
»Lukas hat das Angebot angenommen«, hatte er hinzugefügt. »Fand ich vernünftig. Sein letztes Schuljahr war nach dem ganzen Theater ziemlich für die Tonne, weißt du?«
»Kann ich mir vorstellen.« Mehr hatte Jacobsen nicht dazu gesagt, aber er wusste, dass Paul klug genug war, um die richtigen Schlüsse zu ziehen.
An dem Abend, bevor Jacobsen das Gästezimmer im Haus seiner Schwester und seines Schwagers räumte, um in seine erste eigene Wohnung in Backnang zu ziehen, saßen er und sein Neffe allein im frühsommerlichen Garten. Es war spät; Heike und Kurt schliefen schon seit fast einer Stunde.
Sie redeten nicht viel; Jacobsen rauchte eine Zigarette und gönnte sich ein letztes Glas von Kurts weichem Samtrot, und Paul drehte sein Glas mit Orangensaft langsam und unablässig zwischen den Händen. Die Eiswürfel darin klirrten leise.
»Ich finde es ziemlich blöd, dass du ausziehst, Onkel Malte«, sagte er unvermittelt. »Hat es dich genervt, immer mit uns zusammenzuhocken, oder wieso willst du jetzt auf einmal weg?«
Jacobsen betrachtete ihn ein wenig überrascht von der Seite; er wusste, dass Paul ihn mochte, hatte aber offenbar unterschätzt, wie sehr.
»Ich bin ein bisschen zu erwachsen, um ewig bei der Familie zu wohnen«, erklärte er. »Auch, wenn ich mich bei euch total wohlgefühlt habe, ehrlich. Aber es wird höchste Zeit für meine eigenen vier Wände. Und außerdem bin ich ja bloß ein paar Straßen weiter. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du willst.«
»Okay. Mach ich bestimmt.«
Paul lächelte, nippte an seinem Glas und schwieg erneut. Jacobsen warf ihm einen weiteren Seitenblick zu; langsam beschlich ihn das Gefühl, dass der Junge noch etwas anderes auf dem Herzen hatte, sich aber nicht traute, damit herauszurücken. Er beschloss, nicht nachzubohren. Schließlich war er nicht im Dienst und das hier wahrlich nicht der richtige Ort für ein Verhör. Er leerte das Glas, drückte seine Zigarette aus und stand auf.
»Ich geh langsam mal wieder rein«, meinte er beiläufig. »Morgen wird es anstrengend, fürchte ich.«
Paul blickte hoch und sah ihm geradewegs in die Augen.
»Lukas hat nach dir gefragt, Onkel Malte«, sagte er leise.
Jacobsen setzte sich wieder hin, behutsam, als könnte der robuste Gartensessel unter ihm zusammenbrechen.
»Lukas?«, erwiderte er, ebenso leise. »Wann?«
»Gestern«, sagte Paul. »Ich meine … er weiß schließlich, dass du mein Onkel bist, oder? Und wir machen ab und zu mal was zusammen. Ich hab dir ja erzählt, dass er ziemlich cool ist. Seine Oma übrigens auch. Finde ich jedenfalls.«
»Finde ich auch.« Jacobsen atmete tief durch. »Soll das heißen, du warst bei den beiden in der Villa?«
»Immer wieder mal. Ziemlich oft sogar, eigentlich.« Paul strich sich den Pony aus der Stirn. »Lukas wollte nicht herkommen, weil … na, du weißt schon.«
Jacobsen zuckte leicht zusammen. Natürlich. Weil er nicht dem Kommissar über den Weg laufen wollte, der durch seine Ermittlungen seine heile Welt auf den Kopf gestellt hatte.
»Ich hab mit ihm abgehangen, wenn er Lust dazu hatte«, fuhr Paul fort, spürbar erleichtert darüber, dass er seine Information endlich losgeworden war. »Er war eine ganze Weile mies drauf … nach dem Prozess und allem. Wir haben immer wieder mal ein paar Games gespielt oder zusammen gelernt. Er ist ein echtes Ass in seinem Geschichts-Leistungskurs. Die nehmen gerade die Römer am Limes durch, und Lukas findet das total spannend.«
»Und wieso hat er nach mir gefragt?«
»Hat er mir nicht gesagt.« Sein Neffe stand auf. »Ich glaub, ich geh jetzt ins Bett.«
»Mach das. Gute Nacht, Paul.«
Er war noch eine ganze Weile im Garten sitzengeblieben und hatte sich den Kopf darüber zerbrochen, wieso Lukas jetzt plötzlich wieder etwas über ihn wissen wollte. Und wann er sich wohl melden würde. In der Nacht darauf hatte er sehr schlecht geschlafen.
Er bog in die Einfahrt der Villa ein; die Räder seines Wagens rollten knirschend über den gekiesten Vorplatz. Alles war noch so, wie er es in Erinnerung hatte – der elegante Eingang mit dem Jugendstildekor aus weißem Stuck darüber, die tiefen, schön geschwungenen Fenster, die schmiedeeisernen Balkone und die blühenden Blumenrabatten. Unwillkürlich wanderte sein Blick hinüber zu dem Seitenflügel, in dem sich das kleine Museum des Pfadfinderbundes Impeesa befand, das Klara von Weyen vor vielen Jahren so liebevoll eingerichtet hatte. Und er erinnerte sich jäh an den Moment, als die Puppe mit dem Hemd von Klaras verstorbenem Mann Konrad umgekippt auf dem Boden gelegen hatte, von einem wütenden Schlag mit einem Golfschläger getroffen. An den typischen Pfadfinderhut, der über den Boden rollte, und das Klirren von zersplitterndem Glas …
Er riss sich zusammen und schaute stattdessen in Richtung Haustür. Genau in diesem Moment öffnete sie sich, und Lukas kam heraus.
Er hatte ihn fast ein Jahr lang nicht mehr gesehen, und trotzdem konnte es keinen Zweifel geben, wen er vor sich hatte. Der Junge war ungefähr noch einen Kopf gewachsen; früher hatte er das Haar fast schulterlang getragen, jetzt ähnelte seine Frisur seltsamerweise der von Paul – am Hinterkopf und den Seiten präzise kurz geschnitten, mit einem dichten, glatten Schopf darüber, der ihm weich in die Stirn fiel. Allerdings färbte Paul sein braunes Haar blauschwarz, und das von Lukas hatte noch genau das gleiche, helle Goldblond, an das Jacobsen sich erinnerte. Der Babyspeck in seinem Gesicht, der schon vor zwei Jahren auf dem Rückzug gewesen war, hatte klar gezeichnete, fast harte Linien und Flächen zurückgelassen. Der sechzehnjährige Lukas war meilenweit von dem heiteren Jungen entfernt, der er einmal gewesen war, und Jacobsen verspürte einen schmerzhaften Stich, als ihm klarwurde, wie viel die Katastrophe um Lukas’ Vater dazu beigetragen hatte, ihn frühzeitig erwachsen werden zu lassen.
Er öffnete die Fahrertür und stieg aus.
»Grüß dich, Lukas«, sagte er. »Bin ich zu spät?«
Lukas warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Nein, genau pünktlich. Danke, dass Sie gekommen sind.«
Er trug keine Pfadfinderkluft – natürlich nicht –, sondern die übliche Uniform der Teens in seinem Alter zur Sommerzeit: ausgebleichte Jeansbermudas, ein weites, rotes Shirt mit irgendeinem Markenlabel auf der Brust, das Jacobsen nicht kannte, und dazu passende rote Chucks. Außerdem hielt er etwas unter den Arm geklemmt, das wie ein Schreibblock aussah.
»Wie geht es deiner Großmutter?«
Lukas hatte Jacobsen bei ihrem Telefongespräch vor vier Tagen erzählt, dass Klara von Weyen krank war – eine kleine Herzschwäche, wenn auch nichts Ernstes – und dass der Arzt ihr geraten hatte, sich zu schonen. Was den Jungen erstaunlicherweise dazu gebracht hatte, ihn anzurufen, um ihn zu bitten, ihm bei einer wichtigen Exkursion für seinen Geschichts-Leistungskurs behilflich zu sein und den Chauffeur für ihn zu spielen, weil er selbst noch keinen Führerschein besaß. Ausgerechnet.
»Einigermaßen«, sagte der Junge. »Aber Dr. Trauenhofer verbietet ihr immer noch, Auto zu fahren. Er denkt, sie regt sich zu sehr auf, wenn sie am Steuer sitzt.«
Ein winzig kleines Lächeln, das das vertraut-unvertraute Gesicht für ein paar Sekunden weicher machte.
»Wie lange brauchen wir, was meinen Sie?«
»Nicht lange«, antwortete Jacobsen. »Weniger als eine halbe Stunde, würde ich sagen. Es ist noch früh und Samstag obendrein, da sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Und dieses Museumsgelände in Welzheim ist bestimmt nicht gerade überlaufen. Was hast du doch gleich gesagt, wie sich das nennt?«
»Das Ostkastell«, erwiderte Lukas. »Es war ein Teil der römischen Garnison in Welzheim. Damals hatte die Stadt noch keinen richtigen Namen. Später hieß sie Valentia; jedenfalls nimmt man das an.«
»Aha.«
Eigentlich interessierte sich Jacobsen kein Stück für die römische Geschichte am Limes, und seine Lateinkenntnisse entstammten hauptsächlich der Lektüre von Asterixheften … aber wenn Lukas von Weyen sich die Römer als Mittel dazu auserkor, um Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen, würde er an seiner Seite geduldig sämtliche Museen in hundert Kilometern Umkreis abklappern.
»Wollen wir?«
Er setzte sich wieder hinter das Steuer, Lukas stieg neben ihm ein, ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder und schnallte sich an. Jacobsen drehte den Zündschlüssel um und fuhr los.
DER BRUNNEN
Wahrscheinlich hätte Jacobsen – der noch nie in Welzheim gewesen war – die Adresse des Ostkastells besser ins Navi eingeben sollen. Allerdings war er der Ansicht, dass diese technische Errungenschaft, so praktisch sie auch sein mochte, zur allgemeinen Verblödung der motorisierten Menschheit beitrug, also hatte er sich die Strecke vorher auf der Karte angesehen (ganz altmodisch aus Papier, nicht online) und war sicher, dass er den Weg auch so finden würde.
Die Fahrt führte durch dichten Wald eine kurvenreiche Straße hinauf und dann nach Welzheim hinein. Dummerweise übersah er das erste Hinweisschild und landete in der Welzheimer Innenstadt. Er gondelte gleich mehrmals eine durch mächtige Blumenkübel künstlich verengte Straße auf und ab, ohne in die richtige Richtung abbiegen zu können, immer wieder vorbei an denselben Geschäften und derselben Kirche. Es war Lukas, der schließlich das rettende Hinweisschild entdeckte und ihn durch eine schmale Seitenstraße, an einem Schulzentrum und einer großen Halle vorbei zum Ziel dirigierte.
Vor ihm lag plötzlich ein kleiner, kiesbestreuter Parkplatz (eigentlich nicht viel mehr als eine Wendeplatte), gekrönt von einem seltsamen, würfelförmigen Gerüst aus Metallstreben. Zu seiner Rechten sah er eine unregelmäßig auf- und absteigende graue Mauer und zwei Türme, zwischen denen ein Tor hindurchführte auf etwas, das aussah wie eine große Wiese.
Er stellte sein Auto ab, stieg aus und merkte erst jetzt, wie warm es geworden war. Der Junihimmel strahlte blitzblau und fast wolkenlos, und nur ein paar übriggebliebene Pfützen auf dem Kiesweg, der hinunter zum Museumsgelände führte – denn genau das war die Wiese –, legten noch Zeugnis davon ab, dass es in der vergangenen Nacht kräftig geregnet haben musste.
Lukas war ihm ein paar Schritte voraus; er strebte eilig auf das Bronzemodell zu, das sich unter dem Metallgerüst befand. Jacobsen ließ sich mehr Zeit. Er verspürte wenig Lust auf eine römische Geschichtsstunde, genoss stattdessen die Sonne auf seinem Gesicht und war es zufrieden, dem Jungen dabei zuzusehen, wie er das Modell und jede der aufgestellten Informationstafeln mit dem Handy abfotografierte und sich auf seinem Block eifrig Notizen machte.
Der »Archäologische Park Ostkastell« (wie die Anlage auf einer der Tafeln genannt wurde, die Jacobsen immerhin flüchtig überflog) wurde vom Parkplatz durch einen tiefen, grasbewachsenen Graben getrennt, in dem genauso wie auf dem Kiesweg noch vereinzelte Wasserpfützen glänzten. Die beiden Türme waren offenbar eine Rekonstruktion des Eingangs zu dem ehemaligen Soldatenlager.
»Die sind 1980 wieder aufgebaut worden«, dozierte Lukas, der unvermittelt wieder neben ihm auftauchte. »An genau derselben Stelle, wo sie früher schon gestanden haben … aber da müssen sie noch höher gewesen sein.«
»Woher weißt du das?«, fragte Jacobsen, wider Willen interessiert.
»Aus einer Infobroschüre«, meinte Lukas. »Hat uns Frau Dr. Schweizer mitgebracht, unsere Geschichtslehrerin. Bis Ende der 1970er Jahre dachte man nämlich, diese Höhe stimmt … aber seitdem sind noch mehr historische Darstellungen gefunden worden, die was anderes beweisen. Da stand dieser Nachbau aber wohl schon. Krass, oder?«
Aus Lukas’ Mund klangen die 1970er Jahre so antik, als lägen sie ebenfalls mitten in der Römerzeit. Jacobsen – selbst Jahrgang 1974 – fühlte sich plötzlich erschreckend alt.
Er gab sich Mühe, angemessen beeindruckt dreinzuschauen, nickte wohlwollend und tauchte in den kühlen Schatten der Türme ein. Als er auf der anderen Seite herauskam und sich umdrehte, sah er den Wehrgang zwischen den Türmen, durch ein Holzgeländer gesichert und wahrscheinlich über eine Treppe zu erreichen – die Lukas offenbar bereits hinaufgeflitzt war, ohne dass er es mitbekommen hatte, denn er stand oben und winkte zu ihm herunter.
»Kommen Sie her!«, rief er. »Von hier oben hat man eine megatolle Aussicht über das ganze Gelände!«
Gegen so viel Enthusiasmus war kein Kraut gewachsen. Jacobsen seufzte in sich hinein, machte kehrt und ging an der Toranlage vorbei, bis er die Treppe gefunden hatte – rissige Holzstufen, die steil nach oben führten. Jacobsen machte sich an den Aufstieg, stellte fest, dass er schon nach wenigen Schritten leicht außer Atem geriet, und nahm sich – wie schon so häufig – wieder einmal vor, weniger zu rauchen.
Aber der Junge hatte recht, die Mühe lohnte sich. Als Jacobsen sich oben an das stabile Geländer lehnte, konnte er die gesamte Anlage überblicken. Zwei Kieswege führten über das kurzgemähte Grün und überkreuzten einander in der Mitte. Vom Westtor aus (auf dessen Wehrgang er stand) zog sich eine Mauer schnurgerade an dem Graben entlang zu den Überresten eines Turmes, vorbei an etwas, das aussah wie ein überdachter Brunnen. An dem Turmfundament beschrieb die Mauer einen rechtwinkligen Knick und führte an einer dicht belaubten Baumgruppe vorbei bis zu einer Hecke, die die hinterste Begrenzung des Museumsgeländes bildete und es auch auf der linken Seite abschloss.
Lukas ließ seinen Blick über das ehemalige Ostkastell schweifen wie ein Befehlshaber über die vor ihm versammelten Truppen und blickte dann eine Weile mit zusammengekniffenen Augen auf sein Handydisplay. Schließlich murmelte er einen Satz, aus dem Jacobsen die Worte »Mars« und »Victoria« heraushörte, und machte sich im Laufschritt wieder auf den Weg nach unten. Offenbar kam er – wenn es nicht gerade um den Transport von Backnang nach Welzheim ging – hervorragend alleine zurecht.
Jacobsen folgte ihm in weit gemächlicherem Tempo die Treppe hinunter und auf das Gelände. Die Sonne stand jetzt fast im Zenit, und es war nicht mehr nur frühsommerlich warm, sondern heiß. Er gratulierte sich dazu, dass er seine Lederjacke im Auto gelassen hatte, und überlegte einen waghalsigen Moment lang, ob er sein Hemd ausziehen sollte; allerdings würde er dann etwaige Besucher mit dem fischbauchweißen Oberkörper eines nicht gerade optimal trainierten Kommissars schockieren. In diesem Moment näherten sich hinter ihm gleich mehrere Schritte. Er trat rasch beiseite und wurde von einer Besuchergruppe überholt, die zu seiner Verblüffung von einem Legionär mit Helm, Kettenhemd und einem über die Schultern zurückgeworfenen Wollmantel angeführt wurde. Jacobsen erhaschte noch einen kurzen Blick auf ein junges, erhitztes Gesicht, umrahmt von messingglänzendem Metall, bevor das ganze Rudel an ihm vorüberzog. Bloß gut, dass er das Hemd angelassen hatte.
Er schlenderte vom Westtor aus nach rechts – mochte Lukas sich in Ruhe umschauen, während er selbst den Archäologischen Park gemütlich einmal umrundete. Das Grüppchen Geschichtsbeflissener hatte es eindeutig eiliger als er; es strebte mit seinem römischen Fremdenführer raschen Schrittes auf die Ruine des Eckturms zu und hatte für den Brunnen keinen Blick übrig.
Jacobsen ging weiter. Als er sich dem Brunnen näherte, hörte er ein leises Geräusch, das er zuerst nicht ganz einordnen konnte – ein Summen, das lauter wurde, als er auf der Höhe des Brunnens war, und wieder leiser, als der Brunnen hinter ihm zurückblieb. Er hielt an, runzelte die Stirn und ließ den Blick einmal in die Runde schweifen. Außer ihm, der Besuchergruppe und Lukas, der dicht an der Wegkreuzung in der Mitte des Areals auf dem Boden hockte und anscheinend irgendetwas fotografierte, war niemand zu sehen. Und das Summen war verstummt.
Er hätte später nie genau sagen können, was ihn dazu brachte, zu tun, was er als Nächstes tat. Aber was auch immer es war – irgendeine Vorahnung oder ein jahrelang antrainierter Instinkt, der mit seinem wachen Verstand überhaupt nichts zu tun hatte: Er ging langsam zurück in Richtung Brunnen und lauschte dabei aufmerksam.
Das Summen wurde wieder lauter.
Jetzt stand er direkt vor dem Brunnen. Es war offenbar ein nachgebautes Modell, ein Viereck aus jeweils drei miteinander vernuteten Holzbrettern auf jeder Seite und vier hölzernen Säulen, die das Dach trugen. Das Summen war jetzt sehr laut, und Jacobsen beugte sich über die Brunnenöffnung.
Der Schacht war mit einem grauen Metallgitter bedeckt, das aus zwei Hälften bestand. Jacobsen sah mehrere sehr solide wirkende Muttern, mit denen sie anscheinend am Platz gehalten wurden. Der Brunnenschacht darunter war bis dicht an das Gitter mit Kies und Erde gefüllt, dunkelbraun und krümelig, und diese Erde war irgendwie lebendig. Nein, nicht die Erde. Es waren Fliegen … ein gelbgrün schillerndes Gewimmel aus unzähligen Fliegen, die über die Erde und die kleinen, weißen Steinchen krabbelten. Schmeißfliegen.
Jacobsen beugte sich noch tiefer über das Gitter. Noch etwas anderes war merkwürdig. Die Erde sah nicht so aus, als befände sie sich schon lange in dem Brunnen. Sie sah aus, als hätte man sie erst vor kürzester Zeit hineingeschaufelt und dann das Gitter wieder verschlossen. Jacobsen schlug nach einem der Biester, das ihm träge ins Gesicht schwirrte; seine andere Hand rutschte dabei von der Holzeinfassung des Brunnens ab und prallte mit der Handfläche auf das Metall. Im nächsten Moment war er von einer aufgeregt summenden Wolke aus Schmeißfliegen umgeben, und mit ihnen kam der Geruch. Ein Geruch nach modriger Feuchtigkeit, nach abgerissenen, halb verrotteten Wurzeln … und nach Verwesung.
Jacobsen wich zwei Schritte zurück und schnappte nach Luft, während der Fliegenschwarm sich geruhsam wieder auf der Erde unter dem Gitter niederließ.
Er kannte diesen speziellen Geruch viel zu genau, um sich zu irren. Das erste Mal war er ihm als junger Beamter begegnet, damals noch in Hamburg. Er war in eine Wohnung gerufen worden, deren Bewohner – ein alter, im Haus sehr beliebter Herr – seit Tagen nicht mehr aufgetaucht war. Die Nachbarn hatten angefangen, sich Sorgen zu machen, als er nach einem heftigen, bis auf den Flur hinaus hörbaren Streit mit seinem chronisch klammen Enkel plötzlich weder auf Anrufe reagiert noch ihnen die Tür geöffnet hatte. Der überquellende Briefkasten war ein weiteres Indiz dafür gewesen, dass irgendetwas nicht stimmte. Also rief man die Polizei, die mit einem Streifenbeamten vorfuhr, begleitet von Jacobsen und dem Schlüsseldienst. Es war ein ausgesprochen heißer Tag im August, nach einer ebenso heißen Hochsommerwoche. Als die Tür endlich geöffnet war, war der Gestank nach Verwesung über sie hereingebrochen wie ein klebriger Schwall verseuchtes Wasser. Im Badezimmer der Wohnung hatten sie den vermissten Mann gefunden, eingeklemmt zwischen Wanne und Waschbecken und mit einer trotz aller Zersetzung noch deutlich erkennbaren, tiefen Kopfwunde. Später sollte sich herausstellen, dass der Enkel ihn mit einem schweren Kerzenleuchter aus dem Wohnzimmer bis ins Bad verfolgt und dort erschlagen hatte.
Der Mann war schon fast eine Woche tot gewesen, und es dauerte mehrere weitere Wochen, bis Jacobsen den jämmerlich zusammengesunkenen, entstellten Körper im Schlafanzug nicht mehr ständig vor seinem inneren Auge sah, bis er nicht mehr an das Gesumm der zahllosen Fliegen und an die Maden dachte, die auf dem dunkel verfärbten Fleisch wimmelten … und an den Geruch. Diesen furchtbaren Geruch nach Tod.
Und hier war er wieder, deutlich schwächer zwar und halb verborgen unter dem kräftigen Dunst von Erde und Regennässe, aber unverkennbar. Irgendetwas musste unter diesem Gitter, unter dieser Schicht aus Erde und Kies gestorben sein. Oder womöglich schon früher. Bevor es im Brunnen verschwunden war.
Jacobsen schaute sich um. Die Besuchergruppe stand immer noch um die Überreste des Turms versammelt, setzte sich aber gerade in Bewegung, gottlob auf das entgegengesetzte Ende des Museumsareals zu. Und Lukas? Es dauerte einen Moment, bis Jacobsen das rote Shirt mit dem blonden, in der Sonne glänzenden Haarschopf darüber ausgemacht hatte. Der Junge saß ganz hinten an der Hecke auf einer Bank, das Smartphone in der Hand. Für Jacobsen hatte er keinen Blick übrig, und in diesem Moment war der dafür ausgesprochen dankbar.
Er überlegte fieberhaft.
Vielleicht machte er besser nicht die Pferde scheu – ausgerechnet jetzt, wo Lukas von Weyen bei ihm war. Vielleicht hatten ja bloß ein paar verantwortungslose Jugendliche mit einer streunenden Katze ihren brutalen Unfug getrieben und das Tier anschließend der Einfachheit halber im Brunnen verscharrt. Das war schlimm genug, aber nicht so schlimm, um sofort an Ort und Stelle nachzuforschen. Er konnte warten, bis Lukas genügend Informationen für sein Limesprojekt gesammelt hatte. Er konnte ihn ganz harmlos nach Hause bringen und dann zurückkommen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Aber wieso sollte jemand eine Katze in diesen Brunnen stecken? Die konnte man hier doch überall verbuddeln, ganz ohne sich vorher die Mühe machen zu müssen, erst sechs Muttern mit einem Schraubenschlüssel aufzudrehen und zwei Gitter durch die Gegend zu wuchten.
Jacobsen hätte seinem inneren Spürhund liebend gerne einen Tritt dahin versetzt, wo es am meisten wehtat. Aber dummerweise hatte er sich schon zu sehr daran gewöhnt, auf das blöde Vieh zu hören … weil es meistens recht hatte, verdammt noch mal.
Er beschloss, wenigstens einen Versuch zu riskieren. Wenn das Gitter noch fest verschraubt war, dann würde er Lukas zuerst in aller Ruhe nach Backnang zurückbringen. Wenn es aber nur locker auf dem Schacht lag …
Er fasste rechts und links in die beiden Gitterhälften, spannte die Muskeln an und zog.
Mit einem lauten Quietschen hoben sie sich; sie waren sehr offensichtlich nicht festgeschraubt. Dafür waren sie um einiges schwerer, als er gedacht hatte, und bei dem Versuch, sie aus der Brunnenöffnung zu heben, versetzte er obendrein die Fliegen erneut in Aufruhr. Sie umschwärmten wütend sein Gesicht und verfingen sich in seinen Haaren, während er zwei mühsame Schritte rückwärts machte und die Gitter ihm aus den Händen rutschten, bevor er sie ganz über die Bretterumrandung gehievt hatte. Für ein, zwei Sekunden blieben sie auf der Holzkante in der Schwebe, dann kippten sie nach unten auf den Boden, und eines von beiden schlug ihm dabei schmerzhaft gegen das Schienbein. Jacobsen fluchte herzhaft.
»He, Sie! Was machet Sie denn da? Des derfet Sie fei net, gell?«
Jacobsen wandte den Kopf und sah den römischen Soldaten im Laufschritt auf sich zustürmen. Sein Gesicht war noch stärker gerötet als vorhin, diesmal nicht nur vor Hitze, sondern in rechtschaffener Empörung. In der Hand hielt er einen langen Speer, dessen Spitze grell in der Sonne glänzte. Jacobsen ertappte sich bei dem Gedanken, ob das Ding wohl so scharf war, wie es aussah … aber zum Glück machte der falsche Legionär keinerlei Anstalten, ihn damit aufzuspießen. Er pflanzte sich nur vor ihm auf und musterte ihn ärgerlich von oben bis unten. Jacobsen hielt es für angeraten, seinen Dienstausweis, den er stets bei sich trug, aus der Hosentasche zu fingern.
»Malte Jacobsen, Kripo Waiblingen«, sagte er und bemühte sich dabei um den höflichsten Tonfall, den er zustande brachte. »Ist das normal, dass das Gitter über diesem Brunnen nicht festgeschraubt ist?«
Der Legionär stutzte und nahm statt Jacobsen jetzt das amtliche Dokument gründlich in Augenschein.
»Sie … Sie sen von dr Kripo?«
»Ganz genau«, erwiderte Jacobsen geduldig. »Und ich hab das Gitter nur deswegen angefasst, weil ich wissen wollte, ob es lose sitzt. Also: Ist das normal, dass es nicht festgeschraubt wird?«
»Noi, ganz gwieß net.« Der Legionär schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Des Gitter isch dafür da, dass d’ Leit net dauernd ihrn Müll da neischmeißet. Jetzt sen des emmerhin bloß no Zigarettekippe ond Bombobabierle, aber nix Größeres meh.«
Er betrachtete die jetzt freiliegende Erde und das schillernde Fliegengewirr und rümpfte die Nase.
»Bah – was isch’n des?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden«, entgegnete Jacobsen, der sich verzweifelt ein paar Gummihandschuhe herbeiwünschte; er hatte gestern nicht daran gedacht, seinen Notvorrat im Handschuhfach zu erneuern. Da konnte man nichts machen. Er riskierte einen weiteren, vorsichtigen Blick Richtung Hecke und stellte erleichtert fest, dass Lukas immer noch auf der Bank saß. »Wenn sich so viele Schmeißfliegen an einer Stelle versammeln, dann wittern sie Futter. Und ich möchte zu gern wissen, was für eine Art Futter das sein könnte.«
»Vielleicht isch des ja bloß a Katz oder irgenda anders Tierle.«
Während der schwäbische Römer genau den Gedanken äußerte, der Jacobsen auch schon durch den Kopf gegangen war, hielt er den Blick so unverwandt wie misstrauisch auf das Brunneninnere gerichtet. Seine von ihrem Führer jäh und unerwartet im Stich gelassene Besuchergruppe stand in einiger Entfernung und tuschelte, die Köpfe zusammengesteckt. Und Lukas stand genau in diesem Moment auf und kam langsam den Kiesweg entlang auf Jacobsen zu.
»Nichts anfassen, okay?«, sagte Jacobsen hastig und etwas schärfer als beabsichtigt. »Und lassen Sie die Leute nicht an den Brunnen – wenn das da drin bloß eine tote Katze ist, können Sie sich hinterher immer noch lange genug über meine Polizisten-Paranoia lustig machen.«
Verblüffenderweise nickte der Legionär und nahm neben dem Brunnen Aufstellung, den Speer grimmig neben sich aufgepflanzt. Offenbar zeigte die Stimme der amtlichen Autorität Wirkung. Jacobsen setzte sich erleichtert in Marsch und ging Lukas rasch entgegen.
Als er ihn erreicht hatte, spähte der Junge über seine Schulter hinweg, die Stirn gerunzelt.
»Herr Jacobsen – was ist denn da los?«
»Das weiß ich noch nicht ganz genau«, sagte Jacobsen ehrlich. »Aber es könnte sein, dass ich nachher meine Kollegen verständigen muss. Und bis ich sicher bin, würde ich dich bitten, dass du auf dem Parkplatz am Auto auf mich wartest. Machst du das?«
Lukas antwortete nicht, aber seine Augen wurden dunkel und sein Gesicht unter der leichten Sonnenbräune blass.
»Das heißt, Sie …« Ohne nachzudenken, legte Jacobsen ihm eine Hand auf die Schulter und war vage erstaunt, dass der Junge sie nicht abschüttelte.
»Wie gesagt, ich weiß es noch nicht«, wiederholte er. »Aber sobald ich es weiß, komme ich zu dir und erkläre dir, worum es geht. Versprochen. Und anschließend fahr ich dich sofort nach Hause.«
Lukas musterte ihn, die Augen schmal. Dann nickte er knapp. »Okay.«
Er ging auf die beiden Westtürme zu, ohne sich noch einmal umzudrehen. Als er in dem Durchgang verschwunden war, machte sich Jacobsen wieder auf den Weg zum Brunnen; noch nie hatte er sich so inständig gewünscht, dass er sich irrte. Um Lukas dieses neuerliche Trauma zu ersparen, würde er sich liebend gern zum Narren machen, ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken.
Der Legionär stand noch genauso da, wie er ihn zurückgelassen hatte. Jacobsen überlegte einen Moment, dann krempelte er sich die Hemdsärmel hoch, beugte sich ein drittes Mal über den Brunnen und tat sein Bestes, die Fliegen zu ignorieren, während er behutsam anfing, die Erde mit den Händen beiseite zu schaufeln.
Es dauerte keine Minute, bis er auf ein Hindernis stieß. Es war groß und stabil … und er ertastete etwas, das sich anfühlte wie Stoff. Als er die letzte, dünne Schicht, die ihn noch davon trennte, wegstrich, sah er, was es war – ein Ärmel. Höchstwahrscheinlich von einem Anzug. Und als er vorsichtig an diesem Ärmel zog, kam aus der dunklen Erde eine menschliche Hand zum Vorschein … die Finger weiß, kalt und schlaff.
»Lieber Herrgott!«
Der Speer des Legionärs polterte zu Boden; der junge Mann sah aus, als müsste er sich jeden Moment übergeben. Jacobsen biss die Zähne zusammen und schloss kurz die Augen.
»Eindeutig keine Katze«, sagte er müde. »Tut mir wirklich leid. Würden Sie die Leute dahinten wegschicken, während ich meine Kollegen verständige?«
GEFUNDEN
Es dauerte eine knappe Dreiviertelstunde, bis die Spurensicherung eintraf. Der schwäbische Römer erwies sich bis dahin als nützlicher Helfer, indem er zuerst seine Besuchergruppe energisch vom Gelände scheuchte und dann so lange den Brunnen bewachte, bis Jacobsen nicht nur in Waiblingen, sondern auch in der lokalen Polizeiwache angerufen hatte.
Die zwei Beamten, die dort Dienst hatten, erschienen prompt und sperrten das Areal rings um den Brunnen großräumig mit Flatterband ab. Einer der beiden nahm die Aussage des Legionärs auf, der mit bürgerlichem Namen Peter Schäuble hieß und so wortreich wie dramatisch von seiner Begegnung mit dem fremden Kommissar berichtete (»… i denk, i guck net recht, da reißt der oifach des Gitter ronder, ond i han denkt, des isch doch Sachbeschädigung, da muss i derzwischaganga!«). Trotz des erlittenen Schreckens schien er seine Beteiligung an dem Drama inzwischen ausgesprochen zu genießen.
Jacobsen – der diese Prozedur schon viel zu oft hinter sich hatte, um sie noch aufregend zu finden – stellte fest, dass sich die Zeit auf beinahe unerträgliche Weise in die Länge zog. Neben der unliebsamen Überraschung, dass er ausgerechnet bei einem vollkommen harmlosen Wochenendausflug unversehens auf eine Leiche gestoßen war, bereitete ihm die Tatsache, dass er mit Lukas von Weyen unterwegs war, zunehmend Kopfzerbrechen. Er hatte dem Jungen ganz wie versprochen Bericht erstattet und sich bei ihm dafür entschuldigt, dass er noch eine Weile würde warten müssen, bis seine Ablösung eintraf. Lukas hatte sich die Geschichte mit seltsam unbewegtem Gesicht angehört, sich höflich bedankt und war sofort damit einverstanden gewesen, sich in den Wagen zu setzen, bis Jacobsen endlich die Gelegenheit hatte, sich um ihn zu kümmern. Trotzdem hatte der ein schlechtes Gewissen. Ihre erste Begegnung nach einem Jahr hätte kaum unglückseliger enden können.
Und dennoch: Es war gewiss nicht so, dass er der lokalen Polizei misstraute, aber er betrachtete das hier bereits ohne jeden Zweifel als »seinen« Fall, und den wollte er in bewährte Hände legen, bevor er den Tatort verließ. Also tigerte er auf dem Kiesweg in der Nähe des Brunnens nervös auf und ab, schaute wiederholt auf die Uhr und war so tief in seine unbehaglichen Grübeleien versunken, dass er den Welzheimer Kollegen erst bemerkte, als der sich dicht neben ihm vernehmlich räusperte.
»Herr … äh … Jacobsen?«
Er betrachtete den Mann. Mittelgroß, rundlich, ein freundliches Gesicht unter einem kurzgeschorenen, grau gesprenkelten Haarkranz. Genau der Typ Polizist, der so ausgelassene wie angetrunkene Jugendliche väterlich dazu bewegte, sich nach Mitternacht ohne fahrbaren Untersatz heimwärts zu trollen, oder der netten, alten Damen die Katze vom Garagendach holte.
»Wie lange wird des Gelände gschperrt sei, was moinet Sie?«
»Kann ich Ihnen unmöglich sagen.« Jacobsen zuckte die Achseln. »Die Leiche muss zuerst einmal aus dem Brunnen geborgen werden, und dann wird man alles nach Spuren von Opfer oder Täter absuchen müssen. Das kann eine ganze Weile dauern.«
Der Kollege sah aus, als senkte sich ein schweres Gewicht auf seine Schultern.
»I moin ja bloß … nächschte Woch fanget hier die Römertäg a, ond da muss vorher nadierlich uffbaut werda. Ond wenn hier die ganze Zeit d’ Kripo zugange isch, na wird’s vielleicht bissle knapp.« Er kratzte sich unglücklich im Nacken und seufzte. »I fürcht, des gibt Ärger.«
»Ärger?« Jacobsen blinzelte verwirrt. »Mit wem?«
Dem Beamten schien aufzugehen, dass weitere Erklärungen vonnöten waren.
»Wege dene Römertäg, nadierlich«, meinte er. »Die hen mir hier älle drei Johr, a richtig große Sach isch des. Da kommet hischtorische Gruppe aus ganz Deitschland und vo woanderscht, die bevölkeret hier drei Täg lang des ganze Areal. Dann isch hier älles voll. Bloß, wenn die wege dem Verbreche net uff dr Platz derfet …«
»Ach so.« Jacobsen warf einen weiteren Blick auf seine Uhr. »Das werden Sie mit den Kollegen klären müssen, fürchte ich. Die können ja dann auch den Veranstalter und die städtischen Behörden informieren, wenn das die Sache für Sie einfacher macht, Herr …«
»Gottlieb. Franz Gottlieb.« Es sah tatsächlich so aus, als wäre der Welzheimer Beamte erleichtert, dass der Kelch möglicherweise an ihm vorüberging. »Saget Sie mir dann bitte, wer da zuschtändig isch?«
»Mach ich. Versprochen.«
Der Kollege ging davon, und Jacobsen fragte sich, ob seine Uhr wohl stehengeblieben war. Verdammt noch mal, wo blieben die denn bloß?
Als hätte das Schicksal ein Einsehen, entdeckte er plötzlich mehrere Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz unterhalb des Museumsgeländes vorfuhren. Gleich darauf kamen ein Dutzend Männer in weißen Plastikanzügen den Pfad zum Eingang hinauf, und ihnen voraus marschierte raschen Schrittes eine Gestalt, die er auf Anhieb erkannte. Er stellte fest, dass sich sein Gesicht unwillkürlich zu einem Lächeln verzog. Melanie.
Er ging ihr entgegen.
»Hallo, Malte!«, sagte sie, als sie aufeinandertrafen. »Danke, dass du mir meinen freien Samstag ruinierst, mein Lieber. Wenn man dich alleine auf die Straße lässt, muss man doch wirklich mit allem rechnen.«
»Weil ich sogar am Wochenende über Leichen stolpere, oder was?« Er lächelte wieder; zum Glück sah sie nicht wirklich so aus, als wäre sie verärgert. »Glaub mir, das war nicht meine Absicht. Und außerdem war ich gar nicht allein unterwegs.«
»Echt jetzt?« Ihre haselnussbraunen Augen funkelten belustigt. »Du wirst dir doch nicht heimlich eine Freundin angelacht haben? Die musst du mir aber unbedingt vorstellen!«
Er schüttelte den Kopf; seine gute Laune verflüchtigte sich so schnell, wie sie gekommen war. »Nein, tut mir leid. Ich hab Lukas von Weyen hierhergefahren, für ein Projekt in seiner Schule. Er wollte sich im Ostkastell umsehen. Und während er noch dabei war, bin ich unerwartet … auf die Leiche im Brunnen gestoßen.«
»Lukas?« Ihre Augenbrauen stiegen in die Höhe. »Ihr habt wieder Kontakt? Seit wann denn das?«
»Er hat mich angerufen, vor vier Tagen«, erwiderte Jacobsen. »Ehrlich gesagt hab ich immer noch nicht so ganz begriffen, wieso. Aber er bat mich, für ihn den Chauffeur zu spielen, und ich hab ihm den Gefallen wirklich gern getan. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ausgerechnet ein mutmaßlicher Mordfall dabei herauskommt.«
»Nein, das konntest du wohl nicht.« Melanie betrachtete ihn nachdenklich. »Ich gebe zu, das ist in Anbetracht der Umstände ein bisschen … unglücklich.«
»Milde ausgedrückt.« Jacobsen schnaubte leise in sich hinein, dann straffte er den Rücken. »Und weil Lukas jetzt schon seit einer Stunde da oben auf dem Parkplatz in meinem Wagen sitzt, würde ich dich bitten, hier erst einmal die Leitung zu übernehmen, damit ich ihn endlich nach Hause bringen kann.«
»Können das nicht die Welzheimer Kollegen erledigen?« Melanie hielt inne, biss sich auf die Lippen und beantwortete ihre Frage selbst, noch bevor Jacobsen es tun musste. »Nein. Blöde Idee. Du möchtest nicht, dass der Junge vor der Villa aus einem Polizeiwagen steigen muss, oder?«
»Wohl wahr.« Jacobsen nickte ihr dankbar zu. »Lukas meint, seine Großmutter hat seit einiger Zeit ein paar Herzprobleme. Ich bin nicht scharf darauf, ihr schon wieder einen Schock zu versetzen – sie hat genug mitgemacht.«