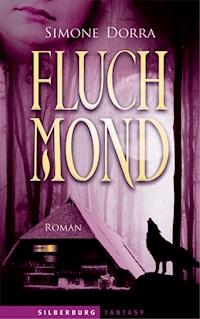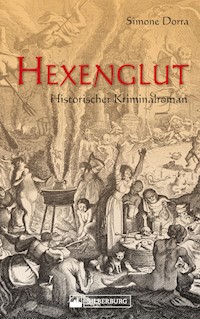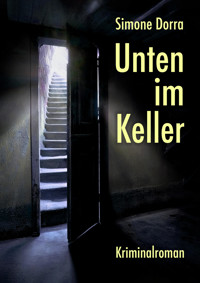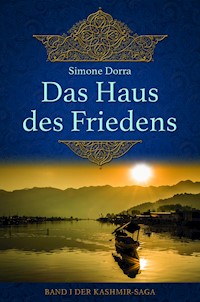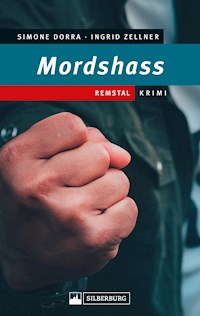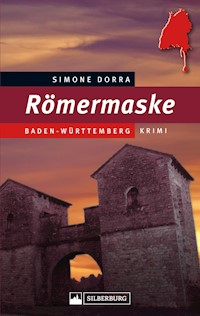Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
1550 – Gräfin Johanna von Eberstein hat sich von Gernsbach nach Cannstatt aufgemacht, um dort ihren Lieblingssohn Bruno zu treffen. Sie will ihn möglichst lukrativ verheiraten und hat bereits eine adlige junge Frau für ihn gefunden. Bruno aber verweigert sich und plant, heimlich abzureisen. Doch dazu kommt es nicht mehr: Am nächsten Morgen wird Bruno bewusstlos aufgefunden und stirbt kurz darauf. Als die kräuterkundige Schwester Fidelitas aus dem Kloster Frauenalb, die als Pflegerin der Gräfin mit nach Cannstatt gekommen ist, die Leiche sieht, keimt in ihr ein schrecklicher Verdacht: Bruno ist ermordet worden, mit dem hochgiftigen Wasserschierling, den sie für die Umschläge der Gräfin benutzt. Um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden, bittet Brunos Bruder Otto seinen Tübinger Professor Valentin Schmieder um diskrete Hilfe bei der Aufklärung des Mordes. Valentin stößt mit seinen Fragen auf heftigen Widerstand der Familie, zudem muss er sich als protestantischer Theologe mit der streitbaren Nonne Fidelitas in Glaubensfragen auseinandersetzen. Eine heikle Situation mitten in den Reformationswirren. Hat der Tod Brunos darin seinen Ursprung? Denn keiner kann sich vorstellen, dass jemand dem sympathischen jungen Adligen Böses wollte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Simone Dorra
Schierlingstod
Ein Reformations-Krimi
Simone Dorra erblickte 1963 in Wuppertal das Licht der Welt und ist seit 1983 in Baden-Württemberg zu Hause. Die gelernte Buchhändlerin arbeitete zunächst in einem Stuttgarter Verlag und gestaltete dann als Sprecherin und Journalistin Radioprogramme für den Privatrundfunk. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Welzheim, wo sie heute als Lokaljournalistin für die örtliche Tageszeitung arbeitet.
1. Auflage 2017
© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,
unter Verwendung des Gemäldes
»Junger Mann mit Schädel« von Frans Hals.
Druck: Gulde-Druck, Tübingen.
Printed in Germany.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1758-5
E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1759-2
Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2023-3
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Für meinen Vater, der zu früh gestorben ist, umjemals ein Buch von mir zu lesen.Ich hoffe, dieses hier hätte ihm gefallen.
Inhalt
Vorspiel
I. Ich hör die Hahnen krähen …
II. Gift und Galle
III. Wie die Blume auf dem Feld
IV. Tränke und Beschwörungen
V. Eine Gräfin und zwei Söhne
VI. Ich hört ein Mägdlein klagen …
VII. Abgeschoben
VIII. Freund oder Feind?
IX. Eine Jungfer in Nöten
X. Stelldichein im Stall
XI. Der älteste Sohn
XII. Verdächtig
XIII. Aufruhr in der Nacht
XIV. Eine Nonne verschwindet
XV. Verschleppt
XVI. Auf Messers Schneide
XVII. Widersprüche und Rätsel
XVIII. Tod und Teufel
XIX. Fragen und Antworten
XX. Wiedersehen und Abschiede
XXI. Schrecken in der Nacht
XXII. Fingerhut
Nachspiel
Anhang
Glossar
Dank
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
(Psalm 121,3)
Vorspiel
Der Morgen war noch sehr jung, als Fidelitas ins Freie trat und die Tür leise zuzog. Sie atmete tief durch, froh, die stickige Luft des Hauses hinter sich gelassen zu haben. Nach dem reifen Dunst aus vollen Nachttöpfen, kalter Asche und den Resten der Kohlsuppe für das Gesinde vom Vorabend war die frische, kühle Luft der pure Balsam.
Vor ihr lag ein kleiner Innenhof, zur Gasse hin abgeschlossen durch eine hohe, mit Efeu überwachsene Mauer. Ein hölzernes, mit Eisenriegeln gesichertes Tor bot, wenn beide Flügel offenstanden, genügend Raum, um Kutsche und Reiter durchzulassen. Wenn Fidelitas sich nach links wandte, konnte sie das Stallgebäude sehen, in dem der Reitknecht bei den Pferden des Grafen schlief. Das Wasser zum Kochen, zum Baden und für die Wäsche musste aus einem Brunnen geholt werden, über dessen kreisrunder Einfassung der Eimer an einer Kette baumelte. Als Fidelitas daran vorbeikam, flatterte ein Spatz vom Rand des Eimers hoch, schoss ungnädig zwitschernd dicht über ihren Kopf hinweg und landete auf dem Hausdach. Unwillkürlich hob sie die Hand zum Schleier; er saß genauso fest an der richtigen Stelle wie die sauber gebundene, weiße Haube, die ihr Haar verdeckte, und wie das sorgsam drapierte Skapulier, der Überwurf, der glatt über das zu einem festen Knoten gebundene Zingulum, die Gürtelschnur, fiel.
Streng genommen befand sie sich auf feindlichem Gebiet; die Mutter Oberin hatte bei ihrer letzten Begegnung keinen Zweifel daran gelassen. Zwar besaß das Geschlecht der Grafen von Eberstein noch immer einen Teil der Vogtshoheit über das Kloster Frauenalb, aber der Gernsbacher Zweig der Familie hatte sich von den dogmatisch festgelegten Glaubensweisheiten vieler Jahrhunderte abgewandt und neigte immer mehr den revolutionären Ideen von Martinus Luther zu, der selbst einen Teil seines Lebens im Kloster verbracht hatte. Es hatte ihn nicht daran gehindert, an den Grundfesten der Kirche zu rütteln … und jetzt, vier Jahre nach seinem Tod, war die ganze Welt ins Schwanken geraten.
Aber die Ebersteiner Grafen machten – obwohl Wilhelm IV. den Ideen Luthers gegenüber ausgesprochen offen war – keinen Versuch, die Nonnen von der neuen Lehre zu überzeugen oder sie gar zu vertreiben. Seine Frau Johanna, die immerhin dem Durlacher Familienzweig der solide katholischen Markgrafen von Baden entstammte, unterstützte das Kloster Frauenalb immer noch nach Kräften, und wann immer sie es besuchte, war sie in den Kräutergärten zu finden, wo Fidelitas Tag für Tag Dienst tat. Sie interessierte sich aufrichtig für die Wirkung der Pflanzen, ließ die junge Nonne aber stets spüren, dass sie für jedes Gespräch so dankbar zu sein hatte wie für eine vollkommen unverdiente Gnade. Fidelitas nahm ihre schmallippige Arroganz mit Humor, betrachtete die Begegnungen mit der Gräfin als eine Übung in Demut und reagierte mit gleichbleibender, gelassener Freundlichkeit.
Das musste ebenso Eindruck auf Johanna gemacht haben wie die fundierten Kenntnisse der jungen Nonne in der Kräuter- und Heilkunde. Als sie die Reise nach Cannstatt vorbereitete, um sich dort mit ihrem jüngsten Sohn Bruno zu treffen, wurde Fidelitas angewiesen, sie zu begleiten. Die Gräfin litt seit Jahren unter entzündeten Gelenken, die regelmäßig anschwollen und sie mit heftigen Schmerzen und fiebriger Hitze quälten. Fidelitas hatte ihr bei der letzten Begegnung im Februar salzarme Kost empfohlen und ihr einen Tiegel mit einer Salbe aus der Klosterapotheke mitgegeben, die Weidenrindenextrakt, Wermut und Goldrute enthielt. Die Salbe linderte Johannas Beschwerden zwar nur vorübergehend, aber doch deutlich, und sie war der Hauptgrund, dass die Äbtissin Fidelitas vor zwei Wochen zu sich gerufen und ihr mitgeteilt hatte, dass sie die Gräfin nach Cannstatt zu begleiten hatte, um sich dort weiterhin um ihr persönliches Wohlergehen zu kümmern.
Die Mutter Oberin war eine geborene Catharina von Remchingen und stand seit fast dreizehn Jahren an der Spitze des Klosters. Ihre Gesundheit hatte in den letzten Monaten bedenklich nachgelassen, aber das hinderte sie nicht daran, die Zügel nach wie vor mit fester Hand zu führen. Wenn sie Fidelitas sozusagen in die Dienste der Ebersteins »auslieh«, dann sicherte ihr das gleichzeitig das Wohlwollen der Gräfin – und vermutlich auch eine ordentliche Geldsumme, von der Fidelitas nicht wirklich glaubte, dass sie dem Kloster zugutekam. Erst kürzlich hatte sie die Priorin mit der Novizenmeisterin darüber tuscheln hören, dass manche Einnahmen in die Privatschatulle der Mutter Oberin flossen und in den sorgsam geführten Rechnungsbüchern gar nicht erst auftauchten.
Fidelitas war mehr als einmal mit der Äbtissin aneinandergeraten, hütete sich aber klugerweise, ihr offen Vorteilsnahme oder gar persönliche Geldgier vorzuwerfen. Es war mehr als genug, dass sie für die hochwohlgeborene Dame zuweilen einen »Stolperstein und einen spitzen Dorn im Fleisch« darstellte, wie sich Catharina einmal der Priorin gegenüber beklagt hatte, ohne zu wissen, dass Fidelitas in der Nähe war und es mitbekam.
Also nahm sie den Reisesegen der Ehrwürdigen Mutter demütig entgegen und küsste die Hand, deren Zeigefinger von einem kostbar in Gold gefassten Saphir geziert wurde. Die adeligen Damen, die in Frauenalb als Nonnen lebten, legten das Gelübde der Armut ebenso ab wie ihre nichtadeligen Ordensschwestern, aber in den Zellen fand sich doch das ein oder andere aufwendig gearbeitete Möbelstück, das beim Einzug von der jeweiligen Schwester mitgebracht worden war, es gab private Gebetbücher mit Einbänden aus Leder und Holz, die kostbar mit Edelsteinen geschmückt waren, und an hohen kirchlichen Feiertagen speisten die Nonnen nicht von Tellern aus Ton und Zinn, sondern aus fein ziseliertem Silber.
Fidelitas’ Zelle hingegen war schlicht und bis auf ein schön geschnitztes Kruzifix aus Lindenholz ziemlich kahl. Ihr Gepäck für die Reise nach Cannstatt war ebenso übersichtlich: zwei Hemden zum Wechseln und für die Nacht, ein zweites Paar Sandalen und vor allem ihre kleine Medikamententruhe, in der sie fertig destillierte und zusammengerührte Mittel in Fläschchen und Tiegeln mit sich führte. Sie verabschiedete sich an einem Aprilmorgen im regennassen Kräutergarten von Schwester Agatha, die dem Kloster als Infirmarin diente und Fidelitas alles beigebracht hatte, was sie wusste.
»Dominus tecum, Kind«, sagte die alte Frau und legte eine Hand auf die wollene Kapuze des Reisemantels, der Fidelitas’ Schleier vor den immer dichter fallenden Tropfen schützte. »Denk daran – auch die Glocken der Kirchen, in denen man die heilige Messe nicht mehr feiert, schlagen die Stunden … Du kannst alle Gebete dann sprechen, wenn wir es tun, und auf diese Weise bist du immer bei uns. Komm gesund wieder, ja?«
Fidelitas hatte sie umarmt und ein paar höchst unvernünftige Tränen hinuntergeschluckt, bevor sie sich rasch abwandte und den Klostergarten verließ. Auf dem Weg vor dem Klosterareal hatte ein mit festem Tuch überdachter Karren auf sie gewartet. Darin war zwischen Johannas Kleidertruhen und Körben voller Gemüse und Obst aus dem Kloster ein kleiner Sitzplatz für sie hergerichtet worden.
Als der Karren zwei Tage später am frühen Abend auf den Hof des Hauses nahe der Stadtmauer von Cannstatt rumpelte, war sie steifbeinig heruntergestiegen und hatte aus tiefstem Herzen ein Dankgebet dafür gesprochen, dass die Reise vorüber war. Sie fühlte sich so zerschlagen wie ein Strohbündel auf dem Heuboden nach der Begegnung mit dem Dreschflegel.
Das Kämmerchen, das man ihr zuwies, lag im Obergeschoss des Hauses, ziemlich genau über der großen Wohnstube, in der die Gräfin untergebracht war. Es war noch deutlich kleiner als ihre Zelle in Frauenalb; Fidelitas nahm diese Tatsache ebenso hin wie den Auftrag der Mutter Oberin. Immerhin passte ihre Medikamententruhe unter den Tisch, und der Stuhl davor war breit und mit einer erstaunlich bequemen Lehne versehen. Das Bett hatte einen stabilen Rahmen, eine großzügig ausgestopfte Strohmatratze und saubere Laken, Kissen und Decken.
Fidelitas schlief in der ersten Nacht so ruhig und tief wie ein Kind und wachte auch nicht auf, als es um Mitternacht Zeit zur Matutin war. Doch bevor sie am nächsten Morgen zum Frühstück in die kleine Gesindestube hinunterging, betete sie unter dem Kreuz, das sie aus ihrer Zelle mitgenommen und an der Wand neben dem Fenster aufgehängt hatte, mit hingebungsvoller Andacht die sieben Psalmen der Laudes.
Inzwischen hatte sich das Leben in dem Haus am Rand von Cannstatt eingespielt. An den Vormittagen knetete Fidelitas die empfindlichen Gelenke der Gräfin und rieb sie mit Salben ein, bevor die Edeldame ein frühes Mittagessen einnahm, das üblicherweise ausschließlich für sie zubereitet wurde, und sich von ihrer schüchternen Zofe frisieren und ankleiden ließ. Nachmittags empfing Johanna Besuche, machte in ihrer Kutsche Einkäufe bei den Händlern oder besuchte die Bäder der Stadt, weil sie sich davon Heilung versprach. Fidelitas war darüber ganz anderer Ansicht, hatte sich aber bereits damit abgefunden, dass die Gräfin Widerspruch nicht sehr schätzte. In diesen Stunden blieb Fidelitas mehr oder weniger sich selbst überlassen. Oft wanderte sie, mit dem Reitknecht oder dem Kutscher als schützendem »Schatten«, zum Stadttor hinaus und über die Wiesen am Neckarufer entlang, auf der Suche nach frischen Kräutern für Aufgüsse, Tränke und neue Salben. Wenn sie fündig wurde, merkte sie sich die Stellen, wo sie wuchsen, und kam ganz früh am nächsten Tag zurück, um sie zu pflücken, solange der Tau noch darauf lag.
An diesem Morgen hatte sie nicht wie üblich einen Stoffbeutel zum Sammeln der Kräuter dabei, sondern einen mit Tuch ausgeschlagenen Korb und eine kleine Gartenschaufel. Denn an einer schattigen Stelle mitten im Ufermorast wuchs Wasserschierling, und Fidelitas hatte beschlossen, zur Abwechslung kühlende Umschläge auszuprobieren, bestrichen mit einem Brei aus den Schierlingswurzeln. Nach den Erfahrungen, die Schwester Agatha schon vor Jahren in Frauenalb gemacht hatte, ließ der Wirkstoff darin die Gelenke abschwellen und die schmerzhafte Hitze schwinden, die die Kranken unbeweglich und elend machte. Außerdem half er nicht nur für ein paar Stunden, sondern tage- und manchmal sogar wochenlang. Also war es einen Versuch durchaus wert.
Beim Weg durch das hoch aufragende Tor nickte sie den Wächtern freundlich zu und wurde mit einem ebenso freundlichen Gruß belohnt. Das war nicht selbstverständlich – seit der Kaiser vor zwei Jahren das »Augsburger Interim« ausgerufen hatte, sollte Schwaben zwar zu den Lehren der allein seligmachenden Mutter Kirche zurückkehren, tat sich aber schwer damit. Der Protestantismus hatte im Volk bereits feste Wurzeln geschlagen, und die Geistlichen, die auf kaiserliche Anweisung hin wieder die katholische Messe lasen, wurden oft hinter vorgehaltener Hand oder ganz offen als »Baalspriester« beschimpft. Doch offensichtlich brachte man dem Habit einer Nonne nach wie vor Achtung entgegen.
Ein kleines Stück jenseits des Tores wandte sich Fidelitas von dem breiten Weg ab und folgte einem ausgetretenen Pfad nach links, der sich an der Mühle vorbei hinunter zum Fluss schlängelte. Heute wurde sie von Andres Häberlin begleitet, dem Sohn der Köchin. Seit er groß genug war, eine Mistgabel zu halten und ein Pferd zu striegeln und aufzuzäumen, arbeitete der lang aufgeschossene Junge mit dem gerstenblonden Haarschopf und dem fröhlichen Lächeln in den Ställen des Grafen Wilhelm von Eberstein.
Das Vermögen der adeligen Familie hatte sich in den letzten zwei Jahrhunderten deutlich vermindert, während gleichzeitig auch ihr Einfluss abnahm. Doch auf seine Pferde in Gernsbach legte der Graf nach wie vor großen Wert, und ihre Pflege überließ er keineswegs jedem. Andres allerdings vertraute er, und er mochte ihn – so sehr, dass er seinen jüngsten Sohn Bruno ermutigt hatte, sich mit ihm anzufreunden. Deswegen war Andres auch mit nach Cannstatt gekommen, um für die Kutschpferde zu sorgen und Bruno wiederzusehen, der jetzt jeden Tag eintreffen musste.
Fidelitas roch den Fluss, noch ehe sie ihn sah. Die Wiesen am Ufer waren ordentlich ins Kraut geschossen; lange, silbrig schimmernde Halme, Gänseblümchen, Löwenzahn und die runden Blütenköpfe von rotem Klee streiften den Saum ihrer Tunika, die jetzt schon nass und schwer war vom Tau. Kurzentschlossen bückte sie sich, schlüpfte aus den Ledersandalen und raffte den Stoff bis zu den Knien. Sie wandte den Kopf zu Andres, der ihr in ein paar Metern Abstand folgte.
»Nimmst du meine Schuhe? Ich hätte gern eine Hand frei.«
Andres’ Augenbrauen verschwanden angesichts ihrer entblößten Beine jäh unter den Strähnen, die ihm in die Stirn fielen.
Fidelitas lachte. »Hast du geglaubt, Nonnen haben keine Füße?«
Der junge Mann grinste; seine graublauen Augen funkelten. »Darüber hab ich noch nie so genau nachgedacht, Ehrwürdige Schwester«, sagte er. »Vielleicht hab ich mir ja vorgestellt, dass sie sich auf Rädern fortbewegen, so wie der Karren, in dem Ihr hergefahren seid.«
Fidelitas gab ein leises Prusten von sich.
»Erinnere mich bloß nicht an den Karren«, erwiderte sie. »Beim bloßen Gedanken tut mir die Kehrseite weh. Und es reicht vollkommen, wenn du mich ›Schwester‹ nennst. Ehrwürdig ist höchstens meine Mutter Oberin.«
Andres nickte. »Wofür habt Ihr die Schaufel mitgenommen, Ehrw… Schwester?«
»Ich zeig es dir.«
Sie hatten die schattige Stelle am Ufer erreicht. Die Wiese ging in einen schmalen Lehmstreifen über; genau am Saum zwischen taunassem Grün und flussfeuchtem Braun wuchsen die langen Stängel mit den lanzettförmigen Blättern in die Höhe, jetzt im Frühjahr noch ohne Frucht und Blüte. Fidelitas kauerte sich hin, nahm die Schaufel zur Hand und grub rasch vier Wurzeln aus. Sie befreite sie von den Stielen und spülte sie im Flusswasser sauber, bevor sie sie in den Korb legte und mit dem Tuch zudeckte. Anschließend wusch sie sich noch einmal gründlich die Hände.
»Was ist das?«, fragte Andres interessiert. »Und wozu ist es gut?«
»Wüterich«, sagte Fidelitas, »so nennt man die Pflanze jedenfalls hier in Schwaben. Eigentlich heißt sie Wasserschierling. Auf den Pferdeweiden bei Gernsbach wächst sie wohl nicht?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Hab ich dort noch nie gesehen. Aber durch die Wiesen dort fließt auch kein Wasser. Der Herr Graf hat extra Holztränken aufstellen lassen.«
Fidelitas rieb sich die nassen Finger am Skapulier trocken. »Wenn ich diese Wurzeln nachher klein schneide und zu einem Brei zerstampfe, kann ich für die Frau Gräfin Umschläge damit machen. Das lindert die Schmerzen in ihren Gelenken. Riech mal daran.«
Andres beugte sich über den Korb, schlug das Tuch zurück und schnupperte.
»Fein!« Wieder kletterten die beweglichen Augenbrauen in die Höhe. »Wie der Sellerie in unserem Küchengarten daheim. Kann meine Mutter nicht ein Gemüse daraus machen? Besser als die Kohlsuppe gestern Abend wäre es sicher allemal.«
Fidelitas’ Lippen zuckten. Sie konnte den dicken, grünen Köpfen genauso wenig abgewinnen wie der Sohn der Köchin; sie ließen sich dünsten, braten und sogar mit Fleisch füllen, und Bärbel Häberlin tat mit Kräutern und Salz ihr Bestes, doch … Kohl blieb Kohl.
»Die Suppe ist trotzdem gesünder«, erklärte sie. »Diese Wurzeln sind zwar angenehm für deine Nase und obendrein heilsam für die Gicht von Gräfin Johanna, aber essen solltest du sie unter gar keinen Umständen.«
»Wieso?«
»Sie sind sehr giftig.« Sie deckte das Tuch wieder sorgsam über die Wurzeln und machte sich auf den Weg zurück über die Wiese. »Wer zu Mittag davon kostet, erlebt das Abendläuten nicht mehr.«
Andres ging neben ihr her und pfiff beeindruckt durch die Zähne.
»Habt Ihr Euch deshalb so gründlich die Hände gewaschen?«
»Ganz genau. Und deswegen steht das Gras auch so hoch, siehst du? Kein Bauer, der seine Sinne beisammen hat, treibt das Vieh hierher … es sei denn, er legt es darauf an, dass die Tiere den ›Kuhtod‹ fressen und verenden.«
Inzwischen beäugte Andres ihren Korb mit nervösem Respekt.
»Dann halt ich mich doch lieber an Mutters Brot«, meinte er. »Und an ihre Butter.«
Fidelitas hatte den schmalen Pfad erreicht, ließ den Saum ihrer Tunika fallen und schlüpfte wieder in die Sandalen, die der junge Mann ihr hinhielt.
»Ich auch«, sagte sie heiter. »Dabei fällt mir ein, dass in der Küche bestimmt schon das Frühstück auf uns wartet. Ora et labora ist die Grundregel meines Ordens, ›bete und arbeite‹. Und wer arbeitet, soll auch essen, nicht wahr?«
»Ganz bestimmt.« Andres’ Anspannung war so rasch fortgezogen wie die federzarten Wolken, die jetzt dem kraftvollen Licht der Morgensonne Platz machten. »Soll ich den Korb nehmen, Schwester?«
»Nein, den trage ich selbst. Aber du kannst deiner Mutter nachher vorschlagen, für die nächste Kohlsuppe ein wenig mehr Salz zu nehmen – die Frau Gräfin will zwar nicht, dass man es verschwendet, aber wenn das Essen mundet, ist man fleißiger. Das ist bei uns im Kloster nicht anders. Außerdem kannst du ihr sagen, dass frische Petersilie auch wunderbar hineinpasst.« Ihre Augen zwinkerten humorvoll. »Und ich bringe ihr, wenn die Gräfin versorgt ist, etwas von meinem Kümmelvorrat. Das macht die ganze Sache entschieden bekömmlicher, meinst du nicht?«
»Aber sicher.« Jetzt grinste Andres über das ganze Gesicht. »Mit den Trompetenstößen, die unser Kutscher heute Nacht nach drei Schalen Suppe unter seiner Decke ins Stroh geblasen hat, hat er nicht nur mich wachgehalten, sondern auch die Kutschpferde erschreckt!«
Fidelitas lachte.
Die beiden gingen einträchtig nebeneinander unter dem Schatten des Stadttores hindurch auf das Haus zu, das nur ein kleines Stück dahinter rechts in einer schmalen Seitengasse lag.
Bald, dachte Fidelitas ein wenig sehnsüchtig, ist Bruno von Eberstein hier, die Gräfin kann mit ihm klären, was sie mit ihm zu klären hat, und wieder abreisen.
Sie stellte fest, dass sie Heimweh hatte, und angesichts dieser allzu menschlichen Schwäche regte sich ihr Gewissen.
Bald. Der Gedanke ertönte erneut in ihrem Kopf wie eine tröstliche, kleine Melodie. Es sind ja nur noch ein paar Tage. Dann darf ich wieder nach Hause. Und was immer die Ehrwürdige Mutter an mir zu kritisieren hat … in meinem Kräutergarten lässt sie mich in Frieden.
I
Ich hör die Hahnen krähen …
Bruno von Eberstein hob sich leicht aus dem Sattel seines Pferdes, hielt die Zügel locker mit der Linken und legte eine Hand über die Augen. Weit voraus zog der Neckar eine glitzernde Schleife, dahinter erhob sich die Silhouette von Cannstatt mit dem Turm der Cosmas und Damian geweihten Kirche, deren Spitze wie ein schindelgrauer Finger zum Himmel zeigte. Die Brücke mit den neun Pfosten aus Holz und Stein, die über den Fluss erst durch eines der drei Stadttore und dann in das Gewirr der Gassen führte, war höchstens noch eine Viertelstunde entfernt. Das hieß, er konnte schon jetzt damit anfangen, sich auf ein langes Bad und ein kräftiges Mittagessen zu freuen. Bärbel Häberlin kochte das beste Rahm-Gemüse, das er kannte – er hatte es gegessen, seit er ein Kind war, zusammen mit geschmortem Huhn, mit Fasan oder Hirsch, und es schmeckte so sehr nach Zuhause wie das Brot, das sie buk.
Außerdem würde er Andres wiedersehen, mit dem er auf Neu-Eberstein gespielt hatte … Bärbels Sohn, genauso alt wie er, genauso gescheit und wissbegierig. Aber da hörte die Ähnlichkeit auch schon auf; Graf Wilhelm hatte darauf bestanden, dass Andres lesen und schreiben lernte, doch während Bruno sich bei seinem Schwager Christoph von Zimmern in Meßkirch auf das Ritterhandwerk vorbereitete, durfte Andres nur die Pferde aufziehen, füttern und pflegen, auf denen der Sohn des Grafen ritt. Irgendwann – in etwas reiferen Jahren – wurde von Bruno erwartet, eine angemessene Jungfer von Adel zu finden, mit der er dem Familienstammbaum der Ebersteins einen neuen Zweig hinzufügen sollte. Aber bis dahin war noch etwas Zeit – jedenfalls, wenn es nach Bruno ging. Möglicherweise sah seine Mutter das anders. Möglicherweise hatte sie Pläne, die sie ihm nach seiner Ankunft mitzuteilen gedachte.
Genau genommen hatte sie immer Pläne.
Bruno seufzte und ließ sein Pferd wieder antraben. Natürlich freute er sich darauf, sie wiederzusehen. Er liebte sie fast so sehr, wie sie ihn liebte. Aber sich anzuhören, wie Gräfin Johanna Adelsfräulein miteinander verglich, als stünde sie vor einer Herde Zuchtstuten und überprüfe jedes einzelne Gebiss … nein, er wollte seiner Mutter zwar gern gehorchen und hatte es fast immer getan, aber so wollte er sich keine Frau aussuchen. Er wusste, dass das nicht üblich war, aber unter all den blaublütigen Töchtern musste es doch wenigstens eine geben, die mehr zu bieten hatte als eine annehmbare Ahnenreihe und eine ordentliche Mitgift. Eine, die hübsch war und freundlich, eine, an die er vielleicht sogar sein Herz verlor.
Nun … bisher hatte er sich immer auf seinen Charme verlassen können. Johanna von Eberstein war eine Frau, vor der sich viele fürchteten, aber er selbst hatte noch nie Grund zur Furcht gehabt. Möglicherweise konnte er sich mit etwas Schmeichelei und geschickter Taktik eine Atempause verschaffen. Oder … oder es ging gar nicht um eine Heirat, sondern um irgendetwas anderes, und er musste bis auf weiteres keinen Gedanken an eine Ehefrau, zukünftige Schwiegereltern und Familienintrigen verschwenden. Dazu war es seiner ganz persönlichen Ansicht nach auch noch viel zu früh – sein Vater hatte seine Mutter erst geheiratet, als er fünfundzwanzig gewesen war.
Die Hufe des Pferdes klapperten auf der Brücke, und vom Neckar wehte eine frische Brise zu Bruno von Eberstein hinauf und zerzauste ihm das Haar.
Er freute sich darauf, seine Mutter wiederzusehen. Aber er freute sich auch auf Andres. Er war gespannt darauf, festzustellen, was von der leichtherzigen, fröhlichen Knabenfreundschaft nach fast drei Jahren Trennung noch übriggeblieben war … und was sich vielleicht wiedererwecken ließ.
Schließlich konnte er dort, wo er irgendwann seinen Wohnsitz nahm, ganz bestimmt einen guten Stallmeister gebrauchen.
Johanna ging unruhig vor dem Fenster ihres Zimmers auf und ab. Es war der größte Raum des Hauses, und doch kam er ihr in diesem Moment erstickend eng vor. Einmal mehr wünschte sie sich nach Gernsbach zurück. Dort gehörte sie hin, auf ihre Burg Neu-Eberstein. Die von ihrem Mann Wilhelm begonnene Erweiterung der alten Burg war noch nicht ganz fertig, genauso wenig wie der Bergfried, aber das war ihr Terrain, ihr Schachbrett, auf dem sie jede Figur mit sicherer Hand führte. Hier in diesem Fachwerkhaus, das die Besitzer ihr in den vergangenen Jahren schon mehrfach gegen gutes Geld überlassen und eigens für die adelige Mieterin mit allerlei hübschen Einrichtungsgegenständen herausgeputzt hatten, fühlte sie sich nicht wohl. Hier war sie umzingelt von den Mauern der Stadt, umgeben von Bürgern, deren neuer Stolz und prahlerisches Auftreten sie verunsicherten.
Und trotzdem hatte sich der Aufenthalt hier nicht vermeiden lassen. Zum einen war sie hergekommen, um die berühmten Mineralquellen aufzusuchen, von denen sie sich Heilung versprach. Zwar warnte die junge Nonne sie, dass die Wärme des Wassers ihren Gelenken vermutlich mehr schadete als nützte, aber der Medicus in Gernsbach, der Johannas Familie schon seit Jahren diente, sah das anders: »Die Hitze in Euren Gelenken muss gleichermaßen mit Hitze bekämpft werden«, hatte er Johanna voller Überzeugung erklärt, »so wie man ein Übel mit Feuer ausrottet.«
Allerdings hatte sie festgestellt, dass die Knöchel ihrer Hände und Füße und ihr besonders empfindliches rechtes Knie nach zwei Bädern in den Quellen so stark angeschwollen waren und schmerzten wie seit Monaten nicht mehr. Auch wenn es Johanna widerstrebte, sie musste einräumen, dass Fidelitas’ Rat höchstwahrscheinlich eher zu trauen war. Also verließ sie sich lieber wieder auf die Salben und Umschläge, die ihre klösterliche Pflegerin aus Bad Frauenalb mitgebracht hatte und frisch für sie zubereitete; dabei achtete sie sehr darauf, es mit Anerkennung und Dank nicht zu übertreiben. Sie war fest überzeugt, dass zu viel Lob den Hochmut förderte, und das war bei einer Nonne ganz gewiss nicht angebracht. Schon gar nicht bei einer, die ihr zwar einen ruhigen, gelassenen Respekt entgegenbrachte, merkwürdigerweise aber gleichzeitig von der Gunst, die Johanna ihr erwies, geradezu schändlich unbeeindruckt zu sein schien.
Zum anderen war sie hier in Cannstatt, um in Ruhe mit Bruno reden zu können, ohne dass Wilhelm es direkt mitbekam. Selbstverständlich war ihr Gemahl das Familienoberhaupt, dessen Wort am meisten zählte. Aber achtundzwanzig Jahre Ehe hatten sie gelehrt, das manche Dinge sich besser durchsetzen ließen, wenn man sie selbst und ohne unnötige Einmischung in die eigene Hand nahm. Und Johanna nahm die Dinge ausgesprochen gern in die eigene Hand. Das war der wichtigste Grund, weswegen sie nun schon das dritte Mal herkam – hier war sie ungestört, hier konnte sie ihre Pläne verfolgen, ohne dass der Graf dazwischenging.
Sie warf einen Blick in den kleinen, runden Spiegel, der neben dem Fenster an der Wand hing. Dreiundvierzig Lenze zählte sie jetzt, und noch immer gefiel ihr, was sie sah. Zehn Geburten hatten ihren Körper gezeichnet, doch sie war schlank geblieben, und ihr aschblondes, fast hüftlanges Haar war noch immer fein, weich und glänzend. Ihre Haut pflegte sie mit einer Salbe aus Ringelblumen. Und auch wenn das Vermögen der Ebersteiner in den letzten Jahren zu Johannas Kummer und Ärger beträchtlich geschrumpft war, hatte sie nicht widerstehen können, den teuren Stoff, aus dem ihr Kleid geschneidert war, zu kaufen. Es war ein herrlich glatter, tiefblauer Samt aus Italien, an den Säumen bestickt mit Rosenblüten aus roten und goldenen Fäden. Statt für den steif gefältelten Kragen, der am spanischen Hof getragen wurde und seit Neuestem in ganz Europa in Mode kam, hatte sie sich für einen kastenförmigen Ausschnitt entschieden, ebenfalls von gestickten Blüten eingefasst. Er war züchtig genug für eine Dame ihres Alters, und dicht über der Ausschnittkante hing an einer feinen, goldenen Kette ein mit tiefdunklen Jettsteinen besetztes Kreuz.
Sie hatte sich dieses Kreuz vor dreizehn Jahren umgehängt, als ihre jüngste Tochter Anna kurz vor dem ersten Geburtstag an der Halsbräune gestorben war, zum Zeichen des Gedenkens und der Trauer. Ein Jahr zuvor hatte sie ihre älteste Tochter Amalia zu Grabe tragen müssen, schon mit zweiundzwanzig.
Zehn Kinder hatte sie zur Welt gebracht, sechs Töchter und vier Söhne. Dass nur zwei davon die Welt bereits wieder verlassen hatten, während die anderen allesamt noch lebten, noch dazu bei guter Gesundheit … das war eine Gnade, für die sie der Himmelsjungfrau bei jedem Morgengebet dankte.
Philipp, Amalia, Elisabeth, dachte sie, Felizitas, Kunigunde, Wilhelm, Sibylla, Anna, Otto … und Bruno. Sie flüsterte die Namen in ihrem Geist wie die Anrufungen der Gottesmutter beim Rosenkranz. Den betete sie immer noch, auch wenn ihr Mann Wilhelm schon seit mehreren Jahren davon sprach, das protestantische Glaubensbekenntnis in seinem Herrschaftsgebiet einzuführen. Allerdings hielt er sich inzwischen bemerkenswert zurück. Seit der Kaiser Herzog Ulrich dazu gezwungen hatte, das Augsburger Interim auszurufen, wartete er erst einmal ab, woher der Wind wehte. Johanna hielt das für ausgesprochen weise.
Sie hatte Bruno als letztes ihrer Kinder genannt, obwohl eigentlich Otto der Jüngste war. Otto war inzwischen siebzehn, hatte ständig die Nase in einem Buch und das bleiche Stubenhockergesicht eines Gelehrten. Der Junge studierte auf ihren Wunsch in Tübingen Theologie und war für ein geistliches Amt vorgesehen – in diesen unruhigen Zeiten war er darin halbwegs sicher versorgt, auch wenn sie sich von ihrem gelehrten Sohn insgeheim nur wenig versprach.
Bruno dagegen …
Auf dem Hof erhob sich Unruhe. Durch die welligen Butzenscheiben mit ihren in das Glas eingeschlossenen Luftblasen konnte Johanna den Kutscher und den Reitknecht sehen, die zum Tor rannten und den Riegel zurückschoben. Sie legte eine Hand auf den Mund und spürte, wie ihr Herz freudig schneller schlug. Um ein Haar hätte sie die Flügel aufgerissen und sich über das Sims gelehnt – aber bei allem Entzücken, eine Gräfin Eberstein hängte sich nicht aus dem Fenster wie eine Bauernmagd.
Also sah sie hinter dem Fenster zu, wie das Tor sich öffnete und Bruno in den Hof einritt, den Reisemantel lose über der Schulter. Seine neumodischen Reitstiefel aus Leder glänzten, aber nicht so sehr wie das aschblonde Haar, das ihm dicht und weich bis auf die Schultern fiel. Er hatte es von ihr geerbt.
Ihr schöner Junge. Ihr prachtvoller Sohn.
An diesem Abend saß Andres Häberlin auf einem zusammengezurrten Heubündel im Stall und polierte die Metallbeschläge an dem schweren Ledergeschirr für die beiden Kutschpferde des Grafen. Das war eine Arbeit, die ihm gefiel – sie machte keine Mühe, seine Hände taten sie inzwischen fast von allein und er hatte Zeit zum Nachdenken.
Bruno war wieder da.
Seine Ankunft hatte Andres an den Festzug eines Prinzen erinnert – und das, obwohl er ganz ohne Gefolge oder jegliches Gepränge eingetroffen war, ganz wie ein beliebiger Reisender, der hoch zu Ross nach Hause kam. Aber Gräfin Johanna war aus ihren Räumlichkeiten hinunter zur Haustür geeilt, um ihn zu begrüßen. Sie hatte ihm gerade genügend Zeit gelassen, sich zu waschen und umzuziehen, bevor sie ihn ins Obergeschoss bestellte und dort mehr als zwei Stunden festhielt – vermutlich, damit sie ihn ungestört ganz für sich hatte. Andres’ Mutter war sofort nach Brunos Rückkehr angewiesen worden, ein besonderes Festmahl auf den Tisch zu bringen; sie hatte in höchster Eile beim nächsten Metzger ein Spanferkel gekauft und es am Abend braun und knusprig gebraten auf einem Bett aus Möhren serviert, die mit Honig, Salbei und viel Butter gekocht worden waren. Dazu hatte es dem Vernehmen nach Wein gegeben, und obendrein hatte seine Mutter einen Grießpudding mit Nüssen auf den Tisch gebracht. Von dem hatte Andres auch noch etwas abbekommen, genau wie von den Möhren. Weil er sich um Brunos Pferd kümmern musste, dem am rechten Vorderlauf ein Hufnagel abhandengekommen war, konnte er nicht in der Küche mit dem anderen Gesinde essen, und sie brachte ihm Pudding und Gemüse in den Stall.
Sie sah ihm schweigend zu, wie er seiner improvisierten Mahlzeit alle Ehre erwies; aber er kannte sie viel zu gut, um nicht zu merken, dass sie irgendetwas beschäftigte.
»Hast du schon mit Bruno gesprochen?«, fragte sie plötzlich.
»Noch nicht«, sagte Andres und schob sich den letzten Löffel Pudding in den Mund. »Aber er hat den Braunen selbst in den Stall geführt und mir gezeigt, welcher Hufnagel ersetzt werden muss, und er kommt heute Abend gewiss noch einmal vorbei.« Er lächelte. »Ganz wie früher. Erinnerst du dich?«
Das müde Gesicht seiner Mutter wurde weich. »Gewiss doch.«
In den Jahren, als Andres und Bruno noch Kinder gewesen waren, hatte man Bruno weit häufiger in den Stallungen von Neu-Eberstein als in der Studierstube angetroffen, wo Magister Stefanus Bronn – in den Augen Brunos steinalt, verstaubt und geradezu unerträglich öde – meist vergeblich auf seinen säumigen Schüler wartete. Denn der war zwar hellen Geistes – wie der Magister Graf Wilhelm gegenüber mit einem tiefen Seufzer zugab –, aber wenn er die Wahl hatte zwischen Feder und Papier oder dem Pferderücken, dann entschied er sich unweigerlich für das Letztere.
Also wurde Bärbel ebenso unweigerlich wieder und wieder in den Stall ausgesandt, um den Ausreißer einzusammeln. Bei einer bis heute unvergessenen Gelegenheit hatte sie weder den damals achtjährigen Bruno noch Andres finden können, und endlich hatte der Graf es auf sich genommen, seinen widerspenstigen Sprössling selbst zurückzuholen. Es endete damit, dass beide Knaben den Hintern versohlt bekamen. Als Bruno sich allerdings erbittert über die Lehrmethoden des Magisters beklagte, lieh der Graf ihm sein Ohr und traf eine geradezu salomonische Entscheidung. In Zukunft sollte auch Andres bei Stefanus Bronn in Lesen, Schreiben, Geographie und etwas Latein unterrichtet werden, wenn Bruno im Gegenzug versprach, nie wieder die Stunden zu schwänzen und stattdessen in die Stallungen zu flüchten.
Andres ergriff die Gelegenheit, etwas zu lernen, mit beiden Händen, und die Abmachung zahlte sich nicht nur für ihn aus. Bruno ließ sich von der Begeisterung seines besten Freundes anstecken und gab sich von Stund an zum ersten Mal wirklich Mühe. Der Graf war vom Erfolg seiner Kriegslist höchst angetan. Selbst seine Frau, die es eigentlich höchst schockierend und unannehmbar fand, dass der Sohn der Köchin mit ihrem Liebling in der Studierstube saß, musste zugeben, dass Bruno deutlich sichtbare Fortschritte machte … auch wenn sie sich lieber die Zunge abgebissen hätte, als zuzugeben, dass das Andres’ Verdienst war.
»Diese schönen Zeiten sind vorbei«, sagte Bärbel jetzt.
Es klang wehmütig, sogar ein wenig bitter.
Andres spähte durch das heuduftende Dämmerlicht des Stalles zu ihr hinüber und begriff, dass sie traurig war. Nein – nicht nur traurig. Sie sah aus, als hätte irgendetwas sie vollkommen aus der Fassung gebracht.
»Geht es dir nicht gut?«, fragte er beunruhigt. »War jemand bös zu dir, Mama?«
Bärbel schüttelte leicht den Kopf. »Nichts, worum du dich sorgen müsstest, Kind«, sagte sie. »Du solltest lieber alles dafür tun, dir Brunos Wohlwollen zu erhalten. Jeder Knecht hat einen gütigen Herrn nötig.«
»Aber Bruno ist nicht mein Herr.« Andres musterte sie stirnrunzelnd. »Er ist mein Freund.«
Bärbel lachte. Jetzt klang es mit Gewissheit bitter und zornig.
»Er ist der Sohn des Grafen«, gab sie zurück. »Geboren mit einem Adelstitel und dazu berechtigt, sich eines Tages eine Frau von seinem Stand zu suchen, oder mit etwas Glück sogar darüber, auch wenn er die Burg nicht erben wird, in der du und ich in Lohn und Brot stehen. Solange es ihm gelingt, reich zu heiraten und nicht allzu viele Töchter in die Welt zu setzen, sollte er für den Rest seines Lebens versorgt sein.«
Sie trat auf ihn zu und strich ihm den zerzausten Schopf glatt.
»Du, mein Sohn, bist nichts weiter als ein Reitknecht und der Sohn einer Köchin. Wir sind ganz und gar von der Gnade der Familie abhängig, der wir dienen. Du bist genauso wenig noch ein Kind wie Bruno, also wird es Zeit, dass du das begreifst. Merk dir meine Worte: An dem Tag, an dem du deine Zunge im Umgang mit ihm nicht hütest und bei ihm in Ungnade fällst, stehst du mit leeren Händen da.«
Andres wollte ihr widersprechen, ihr versichern, dass Bruno von anderer Sorte sei als die arroganten Junker, die zuweilen in Neu-Eberstein zu Besuch waren und den Reitknecht im Stall ungefähr genauso deutlich wahrnahmen wie den Dreck, den Andres aus den Hufen ihrer Pferde kratzte. Aber er sah, dass seine Mutter dicht davor war, in Tränen auszubrechen, und zog es vor, zu schweigen.
Stattdessen stand er auf und nahm sie in die Arme. Sie roch nach Holzrauch, nach Honig und gebratenem Fleisch und unendlich vertraut. Nicht zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass er ihr schon lange endgültig über den Kopf gewachsen war. Er drückte das Kinn sachte auf den gestärkten Stoff ihrer Haube.
»Mach dir nicht das Herz schwer, ja?«, sagte er sanft. »Es wird alles gut.«
»Versprichst du mir das?«
Er spürte, wie sich ihre Schultern hoben und senkten, als sie tief einatmete.
»Das tu ich, Mama.« Andres sprach mit Nachdruck. »Das tu ich.«
Als Bruno endlich kam, war die Sonne schon untergegangen. Jörg Stähle, der Kutscher des Grafen, war immer noch nicht wieder zurück; er hatte sich gleich nach dem Gesindeabendessen auf den Weg in die Stadt gemacht, zweifellos zu irgendeiner Schänke, wo man ihm für möglichst wenig von seinen Kreuzern möglichst viele Humpen Bier ausschenkte. Irgendwann mitten in der Nacht würde er sich durch die Seitenpforte wieder in den Hof schleichen, in den Stall gewankt kommen und sich dort auf seiner Pritsche zusammenrollen. Andres hoffte inständig, dass er selbst dann schon im Reich der Träume sein würde; Jörg schnarchte (vor allem dann, wenn er bezecht war) so laut, dass für alle in seiner Umgebung Schlaf ein Ding der Unmöglichkeit war. Kein Wunder, dass er bisher noch keine Frau gefunden hatte, die willens war, ihn zu heiraten, dachte Andres.
Aber es war Brunos Stimme, die er hörte, als er das Warten schon aufgegeben hatte. Er lag in seine Decke eingerollt und war drauf und dran, wegzudämmern.
»He!«
Andres schreckte hoch. Keine drei Ellen von ihm entfernt flammte urplötzlich ein Licht auf, und ein vertrautes, hübsches Gesicht schälte sich aus der Dunkelheit, eingerahmt von schulterlangem Haar, mit einer hohen Stirn, funkelnden Augen, einer geraden Nase und einem Mund, der sich zu einem fröhlichen Grinsen verzog.
»Du glotzt in die Gegend wie eine verdatterte Eule«, spottete Bruno. »Und es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber erst durfte ich mir Mamas Pläne für meine Zukunft anhören und dann noch mit ihr essen. Ich hab uns was mitgebracht – schau!«
Er fegte eine Stelle neben sich sorgfältig von Strohhalmen und Heu frei und stellte erst die dicke Kerze ab und dann einen Tonkrug, in dem es verheißungsvoll schwappte.
»Wein!«, verkündete der Sohn des Grafen heiter. »Von Bärbels Brot war nichts mehr übrig, sonst hätte ich das auch noch dabei.«
»Du und dein ewiger Heißhunger!« Andres schüttelte den Kopf. »Sie hat sich früher ständig darüber beklagt, dass du in ihrer Küche das Backwerk vom Blech, das Schwein vom Spieß und die Suppe aus dem Kessel geholt hast, noch bevor das Essen auf dem Tisch stand. Aber gleichzeitig wollte sie nie, dass dein Vater etwas davon mitbekommt.«
»Und sie hat mich nie verpfiffen.« Bruno lächelte, setzte den Krug an und trank, bevor er ihn Andres hinhielt.
Der Wein hatte ein würziges Aroma, wie eine Mischung aus Trauben und schwarzen Johannisbeeren.
Andres stellte den Krug wieder hin und wischte sich den Mund ab.
»Was für Pläne hat die Frau Gräfin denn geschmiedet? Für deine Zukunft, meine ich?«
Bruno zog eine Grimasse, als sei der gute Tropfen auf seiner Zunge plötzlich sauer geworden.
»Vermählen will sie mich«, sagte er. »Ich hätte es mir eigentlich denken können. Bisher bin ich nur verschont geblieben, weil selbst sie es für unstatthaft gehalten hat, einen Fünfzehnjährigen gemeinsam mit irgendeinem verschreckten Edelfräulein vor den Altar zu zerren. Und bei Christoph in Meßkirch war ich seither vor ihren strategischen Ränken in Sicherheit.«
Er langte nach dem Krug und trank erneut.
»Ich fürchte bloß, jetzt sitze ich in der Falle.«
Andres pfiff lautlos durch die Zähne. »Zu wem will sie dich denn ins Brautbett legen? Hat sie dir das gesagt?«
»Das Mädel heißt Stefanie. Stefanie von Baden. Sie ist die jüngste Tochter des Grafen Ernst von Baden mit seiner dritten Frau, Anna Bombast von Hohenheim. Wenn man meiner Mutter glauben darf, ein Bild an Anmut und Schönheit.« Bruno schnaubte in sich hinein. »Was sie mir wahrscheinlich auch dann erzählen würde, wenn die Kleine einen Buckel, schiefe Zähne und eine krumme Nase hätte.«
Andres hätte gern gelacht, aber er konnte sehen, dass sein Freund sich wirklich Sorgen machte.
»Kannst du sie nicht wenigstens noch ein bisschen hinhalten?«
»Ich glaube nicht.« Bruno schlug mit der flachen Hand auf den Stallboden, und die kleine goldene Flamme der Kerze flackerte heftig. »Sie hat sich richtig in diese Brautwerbung verbissen. Mama stammt selbst aus dem Haus Baden, und sie hat es nie verwunden, dass ihre Verwandtschaft dort nichts Besseres zu tun hat, als den Grafen von Eberstein Stück für Stück Ländereien und Einfluss abzunehmen … jedenfalls ihrer Ansicht nach. Ernst von Baden stammt aus der Durlacher Linie, und die teilt sich mit meiner Familie die Vogtshoheit über das Kloster Frauenalb. Begreifst du jetzt, wieso Mama hinter dieser Ehe her ist wie der Teufel hinter der armen Seele?«
Andres, dem von so viel adeliger Sippenpolitik insgeheim der Kopf schwirrte, versuchte trotzdem nachzuvollziehen, was sein Freund ihm sagen wollte – und ihm blieb der Mund offen stehen, als ihm plötzlich ein Licht aufging. »Sie will das Kloster als Mitgift dafür, dass du das Mädchen heiratest? Ist es das?«
»Ganz genau.« Bruno schnaubte wieder. »Das Kloster und damit endlich wieder die alleinige Vogtshoheit. Dazu so viele Pfründe und Ländereien, wie sie bekommen kann. Für sie ist das Ganze bereits beschlossene Sache. Sie will, dass ich gleich morgen nach Pforzheim aufbreche, mit einem höchst schmeichelhaften Brief an den Markgrafen natürlich. Der mich als einen – wenn auch gottlob ausreichend entfernten – Neffen in den glühendsten Farben anpreist und dem Oheim mitteilt, dass ich mich im Moment auf Brautschau befinde. Stefanie hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird sechzehn, und offenbar bin ich als Überraschungsgeschenk gedacht.«
Andres schwieg und überlegte, während Bruno dem Inhalt des Kruges weiter kräftig zusprach.
»Was hält dein Vater davon?«, fragte er endlich.
»Der hat mit Sicherheit nicht die mindeste Ahnung, was Mama im Schilde führt.« Bruno warf ihm einen Blick zu, in dem sich Ärger und widerwillige Bewunderung die Waage hielten. »Was glaubst du wohl, wieso sie mich hierher nach Cannstatt zitiert hat? Sie will ihn vor vollendete Tatsachen stellen. Mit Kunigunde hat sie es vor sechs Jahren ganz genauso gemacht – zum Glück mochten sie und Christoph sich auf Anhieb richtig gern, auch wenn der eigentlich lieber die arme Amalia geheiratet hätte. Deswegen musste mein Vater als Mitgift kaum Geld und Grundbesitz opfern, damit die Zimmerer Kunigunde nahmen, und hat ohne jedes Wenn und Aber zugestimmt. Jetzt verlässt Mama sich darauf, dass ich dem Kind in Pforzheim den Kopf so sehr verdrehe, dass sie gemeinsam mit einer Frau für mich gleich noch ein ganzes Kloster einsackt und damit in der alten Fehde mit den Durlachern endlich den Sieg davonträgt.«
»Glaubst du, dass sie ihr Ziel erreicht?«
»Vielleicht.« Bruno nahm den Krug und trank aus, was noch darin war. »Wenn der Oheim den Braten nicht zu früh riecht … und wenn die Kleine tatsächlich ihr Herz an mich verliert und den Markgrafen anfleht, dass sie den schmucken Junker aus Gernsbach zum Mann nehmen darf. Jüngste Töchter haben schon das Herz von so manchem Vater erweicht. Aber dazu muss ich mitspielen. Und im Moment komme ich mir vor wie ein Stein, der auf dem Mühlebrett hin- und hergeschoben wird.«
Er betrachtete den leeren Krug kritisch und warf Andres einen reuigen Blick zu. »Tut mir leid – ich hätte mehr davon mitbringen sollen. Aber mir scheint, ich brauche heute Abend etwas, worin ich meinen Ärger ersäufen kann.«
»Und wenn …« Andres, der bisher gemütlich an seinem Heubündel gelehnt hatte, setzte sich auf. »Und wenn du morgen in aller Herrgottsfrühe nach Meßkirch zurückreitest? Und von dort schreibst du einen Brief an Graf Wilhelm … oder du bittest deinen Schwager um Rat? Dann bist du erst einmal außer Reichweite; das würde dir eine Gnadenfrist verschaffen.«
In Brunos Augen blitzte es auf. Aber dann wiegte er nachdenklich den Kopf.
»Das würde Mama sicherlich als Verrat betrachten.«
»Wieso das denn? Ein junger Mann, der sich verheiraten will, wird doch erst einmal mit seinem Vater darüber reden dürfen!«, widersprach Andres. »Wenn ich einen Vater hätte, ich würde es sicher tun. Dummerweise hab ich meinen niemals kennengelernt.«
»Dafür würde Bärbel nie auf die Idee kommen, ihren Sohn in eine Ehe zu zwingen, von der vor allem sie etwas hat«, konterte Bruno. »Das macht auch einen fehlenden Vater wett, finde ich. Du bist in vielerlei Hinsicht ein Glückspilz, Andres.«
Der erinnerte sich nur zu deutlich an das, was seine Mutter keine Stunde zuvor hier im Stall zu ihm gesagt hatte, und beschloss, seine eigene Sicht der Dinge lieber für sich zu behalten.
Eine ganze Weile schwiegen beide. Die Kerze brannte ruhig, und das einzige Geräusch war ein gelegentliches Schnauben und Stampfen der drei Pferde, die hinter ihnen mit hängenden Köpfen vor sich hin dösten.
»Aber weißt du was? Dein Vorschlag gefällt mir.« Brunos Gesicht hatte sich entspannt; jetzt, wo er einen gangbaren Weg vor sich sah, zeigte es wieder den Humor und die Zuversicht, die Andres von Kindesbeinen an bei ihm gekannt hatte. »Ich werde mich morgen früh aus dem Staub machen, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Und sobald mein Vater von den Plänen meiner Mutter weiß, sollen die beiden die ganze Sache unter sich ausmachen, während ich in Meßkirch erst einmal weiter für Christoph den Knappen spiele.«
Er erhob sich vom Boden und geriet kurz ins Schwanken. Andres sprang rasch auf und hielt ihn fest.
Bruno lachte. »Hoppla! Offenbar bin ich beduselter, als ich dachte!« Er zog Andres in eine kurze, herzliche Umarmung. »Danke, Andi. Wenn ich irgendwann hoffentlich auf meiner eigenen Burg sitze, mit einer Frau, die ich mir mit etwas Glück selbst ausgesucht habe, und einem Dutzend wohlgeratener Kinder, dann wirst du bei mir sein, ja? Als Stallmeister?«
Andi. So hatte Bruno ihn genannt, als sie noch Kinder gewesen waren. Offenbar hatte sich an ihrer Freundschaft tatsächlich nichts geändert – egal, was seine Mutter auch glauben mochte.
»Ich werde bei dir sein, als was immer du willst«, erwiderte Andres fest, und er meinte es sehr ernst.
Bruno bückte sich und hob die Kerze auf; diesmal blieb er sicher auf den Beinen.
»Danke, Andi«, wiederholte er, dann drehte er sich um und ging davon.
Andres konnte hören, dass er vor sich hinsang – ein Lied, das dieser Tage bekannt und beliebt war und von vielen Spielleuten angestimmt wurde.
Ich hör die Hahnen krähen
und spür den Tag dabei.
Die kühlen Winde wehen,
die Sternlein leuchten frei.
Singt uns Frau Nachtigalle,
singt uns ein süße Melodei,
sie meldt den Tag mit Schalle.
Dann fiel die Stalltür hinter ihm zu und es war wieder still. Andres tastete sich in der Dunkelheit zu seinem Nachtlager zurück. Er gähnte, zog sich die Decke über den Kopf und schloss lächelnd die Augen.
II
Gift und Galle
Am Tag zuvor in Tübingen.
»Das ist Verrat!« Ambrosius Widmann, Kanzler der Universität, schlug mit der Faust auf den Tisch.
Er war mittelgroß und gedrungen, und wenn er zornig wurde, senkte er den Kopf wie ein Stier, der sich zum Angriff bereitmachte.
»Das ist kein Verrat, das sind die neuen Zeiten«, bemerkte der Mann milde, der ihm gegenüber am offenen Fenster stand und über das Dächergewirr der Oberstadt auf den Neckar hinunterschaute, der in der Frühlingssonne glitzerte. »Und der neue Glaube – auch wenn er Euch nicht passt.«
Er war hochgewachsen und ein wenig hager, das Haar unter seinem Barett schwarz und glatt. Sein schmales Gesicht wurde beherrscht von einer kühn vorspringenden Nase unter humorvollen, dunklen Augen, in denen im Moment allerdings kein Lachen zu finden war.
»Dafür passt er Euch umso besser – nicht?«, schnaubte der Kanzler und sein Kopf senkte sich noch tiefer.
Valentin Schmieder, Doktor der Theologie und seit fünf Jahren Professor, erwartete halb und halb, ihn Feuer speien zu sehen, und seufzte lautlos in sich hinein. Die »neuen Zeiten« waren für Kanzler Widmann ein ständiger Anlass zum Zorn. Seit vierzig Jahren bekleidete er sein verantwortungsvolles Amt, das dem Träger auf Lebenszeit verliehen wurde. Schuld daran, dass sich seine Welt nunmehr in einer dauernden Schieflage befand, waren die Gedanken eines »obskuren kleinen Mönchleins«, wie er den verstorbenen Martinus Luther abschätzig zu titulieren pflegte.
»Ihr solltet dankbar sein, dass ich Eure Promotion bestätigt habe, Valentin«, knurrte er jetzt. »Ohne mich wärt Ihr auch heute noch ein halber Professor, der nur in Tübingen etwas zählt.«
Valentin Schmieder öffnete den Mund, um dem Kanzler zu widersprechen, schloss ihn aber rasch wieder. Es hatte wenig Zweck, Ambrosius Widmann zu erklären, dass Widmann selbst der eigentlich Verantwortliche für die Universitätskrise der letzten fünfzehn Jahre war.
Als Herzog Ulrich 1535 in Tübingen die Reformation eingeführt hatte, war Widmann außer sich vor Entsetzen und Empörung nach Rottenburg und damit auf österreichisches Hoheitsgebiet geflüchtet. Zur Bestürzung des Herzogs und der gesamten Universität hatte er das große Dienstsiegel mitgenommen. Und weil es ihm allein oblag, Promotionen zu vollziehen und akademische Grade zu verleihen, war guter Rat teuer. Der Herzog holte sich mehrere Gutachten ein, unter anderem von Martinus Luther und Philipp Melanchthon – der Letztere hatte selbst in Tübingen studiert und gelehrt und kannte die Verhältnisse aus eigener Anschauung gut genug. Diese Gutachten bewogen Ulrich nach drei Jahren lähmendem Stillstand endlich dazu, Widmann in Abwesenheit seines Amtes zu entheben – was der selbstverständlich nicht widerspruchslos hinnahm. Erbittert überzog er den neuen Dekan Johann Scheurer mit Klagen und die Universität mit förmlichen Protesten gegen jede Promotion, die sein Nachfolger aussprach.
Auch Valentin Schmieder hatte vor fünf Jahren seine Promotion von Johann Scheurer erhalten und sich seither die bange Frage stellen müssen, ob dieser Titel ohne die Bestätigung durch Widmann außerhalb von Schwaben überhaupt irgendetwas wert war.
Im Februar dieses Jahres war Ambrosius Widmann endlich wieder in Amt und Würden eingesetzt worden, aber seine Rückkehr war nicht annähernd so triumphal ausgefallen, wie er sich das vermutlich erträumt hatte. Zwar sorgte das Interim dafür, dass die Obrigkeit dem alten Glauben in Tübingen wieder zu seinem Recht verhalf, aber es war nicht zu übersehen, dass die Bürger nicht die Absicht hatten, den aufgezwungenen Wetterwechsel so ohne weiteres hinzunehmen.
Valentin Schmieder war von Herzog Ulrich erst 1547 als Lehrer an das neu gegründete Evangelische Stift in Tübingen berufen worden. Dieses hatte im ehemaligen Augustinerkloster ein Zuhause gefunden. Das Interim störte den Unterricht dort nicht; Johann Hildebrand hatte bis vor kurzem als Majordomus den Unterricht für die vierzig Stipendiaten so stur wie gelassen aufrechterhalten, und Leonhart Fuchs, derzeit auch Rektor der Universität, hatte ihn nach Kräften unterstützt. All das trug zu Ambrosius Widmanns erklärtem Missvergnügen bei. Valentins Entscheidung sowie die seiner Mitstreiter, als Protestanten zu leben und Protestanten zu unterrichten, bezeichnete er hartnäckig als »Verrat« und erwartete von ihnen, gehorsam wieder unter das Joch der römischen Kurie zurückzukehren.
»Vergesst Luther«, sagte Widmann. »Vergesst Melanchthon. Der hat sich den lateinischen Namen doch bloß zugelegt, damit man ihm seine armselige Herkunft nicht mehr anmerkt. Schwartzerdt heißt er eigentlich, und sein Vater war nichts als ein raufsüchtiger Landsknecht. Praeceptor Germaniae – dass ich nicht lache! Wie irgendeine Universität von Rang diesen lispelnden, käsbleichen Hänfling überhaupt ernst nehmen kann, ist mir ein Rätsel – er hätte bei seinen Leisten bleiben und hier weiter Griechisch lehren sollen. Das konnte er immerhin.«
Widmann wusste höchstwahrscheinlich ebenso gut wie Valentin und so ziemlich jeder Gelehrte deutscher Zunge, dass Melanchthon als Gräzist schlichtweg brillant war und auch auf anderen Gebieten sehr zu Recht große Achtung genoss. Die Art, wie Widmann über ihn sprach, ließ ihn selbst in einem weit schlechteren Licht dastehen als den Mann, dessen Verdienste er gerade so niederträchtig geschmäht hatte.
»Es fällt mir außerordentlich schwer, mein Mäntelchen in den Wind zu hängen«, sagte Valentin. Überrascht stellte er fest, dass er sich sehr beherrschen musste, um dem Kanzler nicht grob über den Mund zu fahren. »Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt – genauso wenig wie Ihr, Cancellarius. Die Dinge ändern sich, und sie aufhalten oder die Zeit mit Macht wieder zurückdrehen zu wollen, ist möglicherweise ausgesprochen närrisch.«
Widmann stutzte und warf ihm einen durchbohrenden Blick zu.
»Soll das heißen, Ihr haltet den Kaiser für einen Narren?«, fragte er sehr leise.
Valentin seufzte. Vielleicht hatte er sich soeben um Kopf und Kragen geredet, aber in diesem Moment war ihm das herzlich gleichgültig.
»Ich bin selbst ein Narr«, erwiderte er müde. »Ebenso wie Ihr. In den Augen Gottes sind wir allesamt Narren, und die wahre Weisheit ist, sich dessen bewusst zu sein. Scio me nihil scire, oder nicht?«
Er ging hinaus und schloss die schwere Holztür leise hinter sich.
Erst, als er an der Stiftskirche vorbeiging, wurde Valentin Schmieder wieder wirklich bewusst, wo er sich befand. Er blinzelte in die tief stehende Sonne und wich gerade noch rechtzeitig einem Händler aus, dessen mit Säcken vollgeladener Handkarren laut ratternd über das Kopfsteinpflaster des Holzmarkts holperte und ihn um ein Haar gerammt hätte.
»Bitte um Vergebung, Magister!« Der Händler tippte sich an die Filzkappe und war gleich darauf in der Münzgasse verschwunden.
Valentin strich instinktiv den schwarzen Luther-Talar glatt, den er schon jahrelang so selbstverständlich trug, und blieb stehen. »Dein Mundwerk läuft schneller, als es dir guttut, mein Sohn«, war einer der Lieblingssprüche seiner Mutter, der in Tübingen hochangesehenen und beliebten Katharina Schmieder. »Eines Tages wirst du dich noch in Teufels Küche reden.«
Möglicherweise war genau das jetzt geschehen.
Ohne nachzudenken, lenkte Valentin den Schritt in Richtung Barfüßergasse und kam an der Stelle vorbei, wo sich bis vor zehn Jahren das Franziskanerkloster befunden hatte. Nach der Aufhebung des Klosters waren die Gebäude verwaist, bis ein Feuer sie vernichtete. Sic transit gloria mundi, dachte Valentin und schüttelte im Stillen den Kopf über sich selbst. Jetzt, da der Ärger über die Auseinandersetzung mit dem Kanzler allmählich verrauchte, wandten sich seine Gedanken wieder einer persönlicheren Angelegenheit zu.
Morgen würde er nach Stuttgart aufbrechen, um seine jüngere Schwester Elsbeth und ihren Mann zu besuchen, die eine erfreulich glückliche Ehe führten und ihr Haus inzwischen mit drei Buben und vier Mädchen bevölkert hatten. Elsbeths jüngste Tochter Friederike war vor kurzem an der Halsbräune erkrankt und nur um Haaresbreite dem Tod entronnen; sie war Valentins erklärte Lieblingsnichte, und er hatte sich eilig eine Vertretung für seine Vorlesungen gesucht, um sie besuchen zu können.
Zu seinem Glück hatte ein neuer Kollege soeben seinen Dienst am Evangelischen Stift angetreten. Der Theologe Martinus Frecht hatte als Hilfsprediger 1548 empört dagegen protestiert, dass Kaiser Karl im Ulmer Münster wieder die katholische Messe lesen ließ. Er war daraufhin festgenommen worden und hatte bis 1549 in Kirchheim in Haft gesessen. Aus Ulm war er offiziell verbannt worden und bei der mühsamen Suche nach einem neuen Wirkungskreis auf Vermittlung von Herzog Ulrich nach Tübingen gelangt. Hier konnte er endlich wieder weitestgehend ungestört sein Lehramt ausüben, und er war mehr als gerne bereit gewesen, für Valentin einzuspringen.
»Lasst Euch nur Zeit mit Eurem Besuch«, hatte er gesagt, sein Lächeln bitter von den unangenehmen Erinnerungen an die letzten turbulenten Jahre. »Ich bin unendlich dankbar, dass mein kleines Schiff zu guter Letzt einen stillen Hafen gefunden hat. Ihr gebt mir durch Euer freundliches Angebot die Zeit, mich einzugewöhnen. Je mehr ich davon habe, desto besser.«
Valentin war gemeinsam mit Elsbeth in der Oberstadt aufgewachsen, den Neckar vor Augen, wann immer er aus dem Fenster seines Zimmers schaute. Der Glockenschlag der Stiftskirche war die Musik gewesen, die seine Kindheit begleitete, und die Professoren waren so oft in seinem Elternhaus zu Gast gewesen, dass er sie schon als zehnjähriger Bub samt und sonders beim Namen kannte. Sein Vater Vitus Schmieder hatte zeitlebens als großer Förderer und Unterstützer der Universität gegolten. Selbst studiert hatte er nicht, sondern sein Vermögen durch den Handel mit kostbaren Stoffen und Bändern gemacht, die er aus Italien, Flandern und Frankreich einführte. Aber er wünschte sich, dass sein Sohn die Bildung bekommen sollte, die er selbst nie gehabt hatte.
Valentin erfüllte ihm diesen Wunsch, ohne dazu gezwungen werden zu müssen. Durch einen hervorragenden Hauslehrer gut vorbereitet, entschied er sich rasch für die Theologie, was seinen überaus gläubigen Vater sehr erfreute. Vitus träumte bereits davon, ihn in der Stiftskirche als Priester die Messe lesen zu sehen. So weit kam es jedoch nie: Zum einen entdeckte sein Sohn die Lehren Luthers, und sie faszinierten und begeisterten ihn ebenso, wie sie Philipp Melanchthon mehr als ein Jahrzehnt zuvor fasziniert hatten. Zum anderen wurde Vitus an einem besonders nassen und stürmischen Tag im Herbst 1533 von einem heftigen Fieber niedergeworfen und starb binnen einer Woche, noch bevor er etwas von den revolutionären Ideen seines Sohnes mitbekam. Valentin betrauerte seinen Tod sehr, war jedoch zutiefst dankbar dafür, dass er seinen Vater nicht mehr hatte enttäuschen müssen.
Als Ambrosius Blarer am 17. September 1534 die erste protestantische Predigt in der Tübinger Stiftskirche hielt, saß Valentin Schmieder unter der Kanzel und lauschte, und seither hatte sein Weg klar und deutlich vor ihm gelegen. Dass eines Tages ein katholischer Kaiser versuchen könnte, die alten Verhältnisse wiederherzustellen, das hatte er damals nicht ahnen können.
Jetzt führte ihn sein Weg an die Stelle, wo Barfüßergasse und Hirschgasse sich trafen; dort lag das von Professoren und Studenten gut besuchte Wirtshaus »Hahn«, in dem man nicht nur ein ausgezeichnetes, selbstgebrautes Bier bekam, sondern auch preiswerte Speisen, die sich selbst diejenigen Studiosi leisten konnten, deren Eltern nicht imstande waren, ihnen den Geldbeutel üppig zu füllen.
Kurzentschlossen trat er ein und stellte erleichtert fest, dass die Schankstube noch nicht allzu sehr bevölkert war. Er fand einen freien Tisch im Hintergrund und hatte sich gerade erst niedergelassen, als der Wirt ihn auch schon erspähte und zu ihm herüberkam.
»Magister Schmieder! Herzlich willkommen – was darf ich Euch bringen?«
Anton Scheibner war ein Mann, dem man ansah, dass ihm das eigene Bier samt der eigenen Kost genauso gut schmeckte wie seinen Gästen. Was ihm inzwischen auf dem Kopf an Haupthaar fehlte, hatte er an Leibesfülle zu viel, aber er strahlte so viel gute Laune und Wohlwollen aus, dass schon allein sein Anblick den Leuten Appetit machte und sie in sein Wirtshaus lockte.
»Eine Halbe und ein wenig Brot«, sagte Valentin und lächelte ihn an.
Der Wirt gluckste belustigt. »Ein wenig Brot? Ich sehe Tag für Tag genügend Professoren hier, die sich den Bauch vollschlagen, als ließe ihr Amt sie anderswo verhungern. Ihr aber seid so dünn wie die Spindel von meinem Susannchen und scheint immer noch zu glauben, Ihr werdet von Büchern allein satt. Nein … ich hab ganz gewiss noch mehr für Euch als bloß ein wenig Brot!«
Womit er in der Küche verschwand.
Wenige Minuten später erschien seine Tochter – ein junges, hübsches Mädchen mit langen, kastanienbraunen Zöpfen, ebenjenes »Susannchen«, von dem er gerade gesprochen hatte. Sie stellte einen Tonkrug vor ihn hin, in dem das Bier des Hauses schäumte, und machte einen Knicks.
»Zum Wohlsein, Herr Magister!«
»Danke, Susanne.«
Valentin trank den ersten, erfrischenden Schluck und beglückwünschte sich zu der Idee, diesen bislang sehr ärgerlich verlaufenen Tag an diesem Ort zum Abschluss zu bringen. Er lebte genügsam und hielt sich mit berauschenden Getränken üblicherweise sorgfältig zurück – schon deswegen, weil er die Folgen der Trunksucht im Hörsaal allzu oft vor Augen hatte – aber das hier hatte er sich wirklich verdient.
Kurze Zeit später kam Susanne erneut an seinen Tisch. Sie trug eine Schüssel vor sich her, aus der ein köstlicher Duft nach gebratenem Fleisch und würziger Tunke aufstieg. Außerdem brachte sie auf einem Holzbrett ein paar dicke Scheiben Brot und ein Töpfchen Kachelmus mit Zwiebeln, mit etwas Kümmel in Butter geschmort, mit Milch und Sahne verrührt und gekrönt von zwei halbierten hartgekochten Eiern.
Valentin bedankte sich erneut und unterdrückte ein Grinsen. Heute würde er das Abendessen seiner Mutter wohl stehenlassen müssen – es sei denn, er wollte sich eine unruhige Nacht, eine verschobene Reise nach Stuttgart und eine Kostprobe der gallebitteren Kräutertränke einhandeln, mit denen Katharina ihren Sohn immer dann traktierte, wenn ihn der Magen drückte.
Und obendrein würde er, wenn er das Wirtshaus verließ, nicht bezahlen müssen. Seit einem bestimmten Tag vor vier Jahren hatte er hier für keine Mahlzeit und keinen Humpen Bier auch nur einen Kreuzer auf den Tisch gelegt.
Während er das Fleisch verspeiste, das mitsamt der Tunke ganz genauso köstlich schmeckte, wie es roch, füllte sich der Schankraum allmählich immer mehr. Bald war auf den Bänken kaum noch ein Platz frei, und Valentin hatte nur deshalb noch seine Ruhe, weil sein Tisch in einer kleinen Nische stand. Susanne hastete an ihm vorüber, gleich mehrere volle Krüge fest ans Mieder gedrückt; er gab ihr ein Zeichen und bestellte eine zweite Halbe.
Als sie wenige Minuten später mit dem Gewünschten in seinen Winkel zurückkehrte, folgte ihr ein junger Mann, blieb bei Valentin stehen und verneigte sich.
»Salve, Magister«, sagte er höflich. »Habt Ihr einen Moment Zeit für mich oder störe ich Euch beim Essen?«
Valentin betrachtete ihn einen Moment lang stirnrunzelnd. Er hatte schon mehrere Semester nicht mehr regelmäßig an der theologischen Fakultät der Universität unterrichtet, kannte die meisten Studenten aber immer noch wenigstens vom Sehen. Dieser machte keine Ausnahme: groß gewachsen und ein wenig schmächtig, das Gesicht mit der hohen Stirn und den schwerlidrigen, grauen Augen blass von zu viel Arbeit bei Kerzenlicht in der Studierstube.
»Eberstein, nicht wahr?«, fragte er. »Otto von Eberstein? Viertes Studienjahr?«
Als der junge Mann nickte, bedeutete er ihm, sich zu setzen, und rief Susanne noch einmal zu sich herüber.
»Einen Teller und einen Löffel für den Studiosus, und ein Bier dazu«, bat er. »Er hat anständiges Essen noch viel nötiger als ich, und ich schaffe den Überfluss, mit dem dein Vater mich bedacht hat, sowieso nie im Leben allein.«
Kurz darauf machte sich Otto über eine reichliche Portion aus Valentins Schüsseln her. Offenbar hatte sein Anliegen durchaus etwas Zeit; Valentin wartete geduldig, bis sein Gegenüber den Löffel hinlegte und einen satten Seufzer von sich gab.