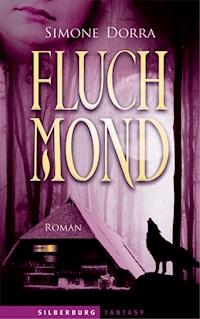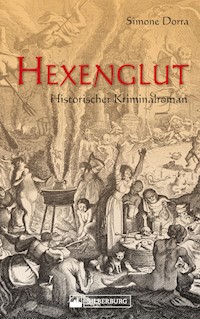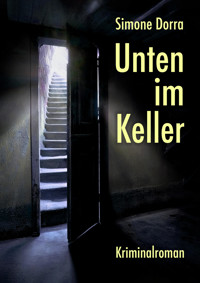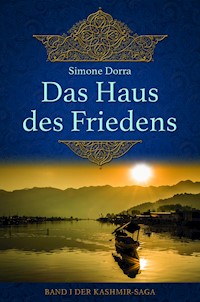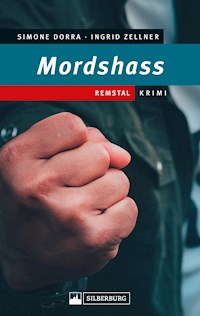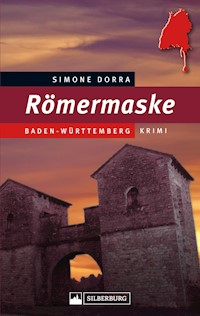Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Leben des Hamburger Kriminalkommissars Malte Jacobsen steht kopf: Nach einem schwierigen Fall wird er wegen Burnouts "zur Erholung" versetzt - ausgerechnet ins schwäbische Waiblingen. Kaum angekommen, muss er sich um einen neuen Fall kümmern: Der Leiter eines kleinen Backnanger Pfadfinderbundes wurde beim Zeltlager an einem Baum erhängt aufgefunden. Schnell ist klar: Das war kein Suizid, sondern Mord! Gemeinsam mit seiner neuen, attraktiven Kollegin beginnt Jacobsen zu ermitteln, aber er findet niemanden, der einen Groll gegen den scheinbar perfekten, allseits geliebten und geachteten Ehemann, Familienvater und Pfadfinder gehegt hätte. Dann wird eine 14-jährige Pfadfinderin aus derselben Gruppe tot aufgefunden. Ob die Fälle zusammenhängen? Hartnäckig kratzt Jacobsen am glänzenden Renommee des ersten Opfers. Und obwohl Erinnerungen an seinen letzten, verstörenden Fall aufbrechen, dringt er unerbittlich vor in ein verzwicktes Labyrinth voller alter und neuer schrecklicher Geheimnisse und tragischer Missverständnisse …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Simone Dorra Nachtruhe
Simone Dorra
Nachtruhe
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Simone Dorra erblickte 1963 in Wuppertal das Licht der Welt und ist seit 1983 in Baden-Württemberg zu Hause. Die gelernte Buchhändlerin arbeitete zunächst in einem Stuttgarter Verlag und gestaltete dann als Sprecherin und Journalistin Radioprogramme für den Privatrundfunk. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Welzheim, wo sie heute als Lokaljournalistin für die örtliche Tageszeitung arbeitet.
Liedtext auf Seite 5 und 125: »Der Piet am Galgen« von Erik Martin, ©mit freundlicher Genehmigung von Erik Martin.
Liedtext auf Seite 118: »Summt der Regen am Abend ins Tal« von Walter Scherf, ©mit freundlicher Genehmigung Voggenreiter Verlag, Bonn.
1. Auflage 2015 ©2015 by Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen. Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen. Coverfoto: ©haveseen – iStockphoto.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1690-8 E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1691-5 Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1430-0
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Inhalt
Autorin
Ausgebrannt
Voll daneben
Nachtwanderung
Der erste Fall
Zwei Witwen
Detektive unter sich
Impeesa
De Mortuis
Anti-social Network
Samthandschuhe
Geisterhaus
… Nützlich zu sein und anderen zu helfen
Schlaf, mein Zelt, wenn der Schlafregen fällt …
Wenn der Nebel auf das Moor sich senkt …
Vom Schweigen und vom Vergessen
Am Mühlkanal
Auf Schatzsuche
In Sicherheit
Bilder
Alles auf Anfang
Mädchengesichter
Mütter und Töchter
Bildbeweis
Scherbenhaufen
Täter und Opfer
Epilog
Dank
Ich sah den Galgen steh’n. Sie zwangen mich zu gehn. Sie wollten meinen Tod, keiner half mir in der Not. Wenn der Nebel auf das Moor sich senkt, der Piet am Galgen hängt.
Erik Martin
AUSGEBRANNT
Es war genau 11.05 Uhr an einem wolkenverhangenen Samstagmorgen in Hamburg, als Kriminalhauptkommissar Malte Jacobsen das Mädchen im Seitenspiegel sah.
Um 11.03 Uhr waren die Nachrichten vorbei. Der gutgelaunte Sprecher aus dem Radio betete die übliche Litanei von Staus und Baustellen herunter und versprach wärmere Temperaturen am Nachmittag. Um 11.04 Uhr begann die gepflegte Reibeisenstimme von Bon Jovi einen Leonard-Cohen-Klassiker zu singen. Gar nicht mal schlecht, dachte Jacobsen. Und um 11.05 Uhr fuhr er über einen Zebrastreifen und entdeckte das Mädchen.
Sie stand links von ihm am Straßenrand, das blonde Haar zu einem akkuraten Pagenkopf geschnitten, der weder zu ihrem mit Glitzerschrift verzierten, hellblauen T-Shirt passte noch zu der engen Röhrenjeans an den dünnen Beinen. Er schätzte sie auf etwa dreizehn. Ihr Gesicht war sommersprossig und ernst, ihre Haut kaum gebräunt und die Zehen in den schwarzen Ledersandalen nackt. Eine Tasche hing an einem langen Riemen von ihrer rechten Schulter. Er fuhr über den Zebrastreifen an ihr vorbei und für einen Sekundenbruchteil glaubte er, dass sie ihn anschaute.
Wieso trägt sie diese Tasche? Wo ist ihr Geigenkasten abgeblieben?
Der Schock traf ihn mit Verspätung, und er fuhr ihm wie ein kurzer, trockener Haken direkt in die Magengrube. Im nächsten Moment registrierte er mit einer Art trägem Staunen, dass sein Wagen – ein nicht mehr ganz taufrischer Toyota, der dringend neue Reifen brauchte – nach rechts ausbrach und auf den Gehsteig zuschlingerte. Die Stimme von Bon Jovi wurde leiser und erstarb.
Er hörte weder das Quietschen der Bremsen noch das wütende Hupen der Autofahrer hinter sich. Der Teil seines Verstandes, der noch funktionierte, dankte dem Schicksal, dass die große Kreuzung gute hundert Meter weiter vorne lag und dass in der Seitenstraße, die er als Abkürzung genommen hatte, kaum jemand unterwegs war. Dann prallte der rechte Vorderreifen gegen die Bordsteinkante, der Wagen kam mit einem Ruck zum Stehen und gleichzeitig ging der Motor aus.
Das Erste, was Jacobsen wieder mitbekam, war das Ticken unter der warmen Motorhaube. Er spürte den eigenen Herzschlag als pulsierendes Pochen im Mund. Langsam schwamm die Welt in sein Bewusstsein zurück. Ein verirrter Strahl helles Sonnenlicht leuchtete auf dem Armaturenbrett, hinter ihm hupte jemand und Bon Jovi sang»… it’s not a cry that you hear at night …«. Wie im Traum drehte er den Kopf nach links und sah einen klapprigen alten Opel an sich vorbeifahren. Eine Faust wurde geschüttelt, ein wutverzerrtes Gesicht starrte ihn an und verschwand. Jacobsen richtete sich auf, die Hände immer noch im Klammergriff um das Lenkrad, und starrte in den Rückspiegel.
Das Mädchen war weg.
Sie hatte ausgesehen wie Beeke Brehm.
Ganz genau wie Beeke.
* * *
Gestern Mittag hatte Kriminalrat Adler ihn angerufen und ihn zu sich ins Büro gebeten. Jacobsen hatte sich missmutig gefragt, was um Himmels willen der Chef eigentlich von ihm wollte. Er hatte eine dieser zahllosen Nächte ohne Schlaf hinter sich, seine Augen brannten und sein Kopf dröhnte.
Das Büro von Kriminalrat Dr. Helge Adler war trostlos; selbst bei langem und wohlwollendem Nachdenken fiel Jacobsen kein besseres Wort dafür ein. Der Boden war mit grünlichem Linoleum ausgelegt, die Wände in einem wenig ansprechenden Graubraun gestrichen und die beiden Fenster so hoch und schmal, dass an trüben Tagen – und von denen gab es in Hamburg viele – ständig das Licht brannte. Den Schreibtisch hatte Adler sich selbst ausgesucht – ein pompöses Ungetüm aus Mahagoni mit einer Platte aus schwarzem Marmor. Anstatt den Raum aufzuwerten, thronte er übermächtig und düster an der Stirnseite und machte die allgemeine Stimmung womöglich noch trübsinniger.
Obendrein besaß Dr. Adler nicht die Statur, um sich hinter einem derartig wuchtigen Möbelstück zu behaupten. Er war lediglich mittelgroß, sein Haupthaar lichtete sich nicht nur an Stirn und Schläfen, sondern sehr zu seinem Leidwesen auch am Hinterkopf, und obwohl seine Anzüge nicht billig waren, sahen sie immer so aus, als wären sie ihm ein wenig zu weit.
Allerdings hatte er schöne Hände, mit langen, eleganten Pianistenfingern; das wusste er und schmückte seine Rechte gern mit einem schweren, goldenen Siegelring. Sein Gesicht war lang und schmal, mit einer kühn geschwungenen Nase und eingefallenen Wangen; es hätte besser zu einem Gelehrten gepasst als zu einem Polizisten. Jetzt richtete er aus schwerlidrigen Augen einen nachdenklichen Blick auf Jacobsen und wartete geduldig, bis der vor dem Schreibtisch Platz genommen hatte.
»Wissen Sie eigentlich, wann Sie das letzte Mal Urlaub gemacht haben?«
Jacobsen blinzelte. Mit dieser Frage hatte er nicht gerechnet.
»Ich sage es Ihnen«, meinte Adler und blätterte säuberlich den Kalender auf, den er vor sich liegen hatte. »Das war vor zwei Jahren, im September. Genau vierzehn Tage.«
Jacobsen sank das Herz. Damals vor zwei Jahren im September … da hatte ein Familienrichter gerade seine Scheidung von Katrin ausgesprochen. Und ein mitfühlender Kollege aus Kiel hatte ihn auf einen Segeltörn mitgeschleppt. Zum Glück verfügte Jacobsen über Seemannsbeine, aber besagter Kollege hatte es außerdem für eine hilfreiche Therapie gehalten, ihn Abend für Abend in der Bootskajüte mit Grog abzufüllen. Aus diesem Grund war Jacobsen sein letzter Urlaub nur noch als eine Reihe alkoholgetränkter, verschwommener Bilder im Gedächtnis, und er hatte ihn so rasch wie möglich verdrängt, genau wie seine misslungene Ehe.
»Jacobsen? Hören Sie mir eigentlich zu?«
Er hatte kein Wort von dem mitbekommen, was sein Chef gesagt hatte.
»Wie bitte?«
»Genau das meine ich.« Die Stimme von Dr. Adler hatte jetzt mehr als einen Hauch von Schärfe. »Sie rennen durch die Gegend wie ein Zombie, und langsam, aber sicher machen Sie Ihre Kollegen nervös. Mich auch, übrigens.«
Jacobsen blieb stumm.
»Ein Urlaub allein reicht nicht, um Sie wieder auf die Spur zu bringen. Ich denke, Sie brauchen einen Tapetenwechsel. Dringend.«
»Was meinen Sie damit?«
»Ich denke, Sie sollten weg aus Hamburg. Und zum Glück gäbe es im Moment die Möglichkeit, Sie zur Kriminalpolizei in Baden-Württemberg zu versetzen … nach Waiblingen, genau genommen. Ein Kollege von dort würde gern nach Hamburg umziehen, weil seine Frau hier seit einem halben Jahr bei Gruner & Jahr die Karriereleiter hinaufklettert und er von einer Wochenendehe genauso die Nase voll hat wie seine beiden Kinder. Das ist Ihre Chance für einen Neuanfang, Jacobsen. Sie könnten dort mit Ihren Fähigkeiten ganz neu durchstarten … und die sind zum Glück ja beträchtlich.«
»Wie schön, dass Sie mir einen Neuanfang überhaupt noch zutrauen.« Zu mehr fehlte Jacobsen schlichtweg die Energie. Schwaben?, dachte er. Wieso ausgerechnet Schwaben? Wahrscheinlich, weil aus Bayern keiner mehr wegwill, der einmal dort gelandet ist. Verdammt noch mal.
»Ihre Schwester wohnt doch in Stuttgart, nicht?«
»Backnang«, erwiderte Jacobsen. »Dreiunddreißig Kilometer von Stuttgart weg. Mit dem Auto braucht man eine knappe halbe Stunde … wenn man nicht im Stau steckenbleibt.«
»Na prächtig. Dann haben Sie doch gleich eine Anlaufstelle und können in Ruhe herausfinden, wie Sie klarkommen. Mit den Kollegen und mit den Leuten da unten. Die Schwaben sind ein ziemlich … spezielles Völkchen, hab ich mir sagen lassen.«
Jacobsen verkniff sich jeden Kommentar. Seine Schwester Heike lebte jetzt seit fast fünfzehn Jahren in Schwaben. Sie war Physiotherapeutin und hatte ihren Zukünftigen bei einer Schulung im Schwarzwald kennengelernt. Es hatte fast sofort gefunkt … und zwar so heftig, dass Heike binnen sechs Monaten ihren Job an einer Hamburger Klinik kündigte, ihre Wohnung auflöste und mit ihrem Mann Kurt ganz neu anfing. Jetzt hieß sie Heike Voigt, hatte einen Sohn und war nach wie vor sehr glücklich – jedenfalls soweit ihr Bruder das beurteilen konnte. Er hatte seinen Schwager erst bei der Hochzeit kennengelernt, die ein Riesenfest mit genau achtzig Voigts und zwei Jacobsens gewesen war. Der Jacobsen, der nach der Trauung übrig blieb, hatte sich gefühlt wie auf einem fremden Planeten. Einem fremden Planeten, auf den sein Chef ihn gerade abzuschieben gedachte.
»Ich hab bei dieser Versetzung doch auch mitzureden, oder?«, fragte er.
»Ja, das haben Sie.« Dr. Adler schürzte die Lippen. »Ich gebe allerdings zu bedenken, dass Sie angesichts der Prognose des Therapeuten und seines Berichtes«, er klopfte mit den Fingerspitzen auf die Mappe, die vor ihm lag, »wirklich nichts Klügeres tun können, als sich eine Auszeit zu nehmen und dann mit frischen Kräften woanders neu anzufangen.«
Neu anfangen. Mit frischen Kräften. Um Himmels willen!
»Wie Sie meinen«, sagte Jacobsen laut.
»Deswegen haben Sie, bevor es losgeht, noch drei Wochen Urlaub … zum Durchatmen sozusagen. Ich an Ihrer Stelle würde so schnell wie möglich mein Zeug zusammenpacken und danach zu Ihrer Schwester fahren. Das lässt Ihnen gleich noch ein bisschen Zeit zum Akklimatisieren.« Dr. Adler beugte sich leicht vor. »Schauen Sie nicht so drein, als würde ich Sie in ein Straflager deportieren lassen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie so wie in den letzten Wochen unmöglich weitermachen können. Die Kollegen machen sich Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Ihr gesamtes Potential können Sie wahrscheinlich erst dann wieder ausschöpfen, wenn Sie die Geschichte vom letzten Winter endgültig verkraftet haben.«
Die Geschichte vom letzten Winter. Nein, er hatte sie nicht verkraftet … weder allein noch gemeinsam mit dem Traumatherapeuten, zu dem der Polizeiarzt ihn geschickt hatte. Ganze zwanzig erfolglose Sitzungen lang.
»Dann sollte ich mich jetzt wohl besser beeilen. Ich hab Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, die muss ich noch fertig machen.«
Jacobsen stand auf und ging hinaus.
In sein eigenes Büro zurückgekehrt, schrieb er in grimmigem Schweigen zwei Abschlussberichte fertig, den ersten über einen Mord, den anderen über einen grauenvoll danebengegangenen Raub mit Todesfolge. Das hielt ihn bis zum späten Nachmittag beschäftigt. Dann speicherte er die Akten ab, schaltete den Computer aus und fuhr nach Hause, um seine Koffer zu packen. Seit der Scheidung von Katrin war das keine große Sache mehr; in einer halben Stunde war er fertig und trat hinaus auf den winzigen Balkon seiner Wohnung in der Schiffbeker Höhe.
Dort setzte er sich auf den mitgenommenen Kunststoffgartenstuhl, den er eigentlich seit zwei Jahren gegen ein anständiges Modell austauschen wollte. Er trank starken Kaffee und rauchte, während hinter ihm im Wohnzimmer leise der Fernseher lief. Die Sonne berührte die Dächer der Häuser und verwandelte die Fensterscheiben in feurig rote Spiegel. Die zwei Zimmer hinter ihm waren die Höhle gewesen, in die er sich nach Dienstschluss verkriechen konnte. Jetzt würde er sie aufgeben und eine neue finden müssen.
Er ging erst wieder hinein, als drinnen das Telefon klingelte. Es war seine Schwester. Er erklärte ihr die Lage und rechnete nicht wirklich damit, dass sie sich freute. Aber Heike überraschte ihn.
»Gar kein Problem – natürlich kannst du erst einmal bei uns wohnen«, sagte sie. Sie klang gleichzeitig energisch und liebevoll. »Wir haben Platz genug … und für deinen Erholungsurlaub kannst du unser Ferienhaus haben, wenn du möchtest. Kurt hat es von seinem Vater geerbt. Es liegt in der Nähe von Murrhardt mitten im Wald; da hast du deine Ruhe. Ich richte alles für dich her, bevor du kommst. Und um eine Wohnung für dich können wir uns später immer noch kümmern.«
Die Idee mit dem Ferienhaus erleichterte ihn; die Vorstellung, während des Zwangsurlaubs sofort mit Heike und ihrer Familie klarkommen zu müssen – die er vor sechs Jahren das letzte Mal gesehen hatte –, bereitete ihm Bauchschmerzen. Er wünschte sich selbst mehr Begeisterung für Heikes Wärme und Freundlichkeit, aber es gelang ihm nicht. Er dachte an seinen Schwager, zu dem er weder bei Heikes Hochzeit noch danach einen guten Draht gefunden hatte, und sein Herz sank.
»Danke«, sagte er langsam. »Danke, Heike.«
»Schon gut.« Er konnte hören, dass sie lächelte. »Ich freu mich schrecklich auf dich, Malte. Bis bald, ja?«
»Bis bald.« Er legte auf.
* * *
Wieder hupte es, diesmal dicht an seinem Ohr … und mit einem Schlag landete Jacobsen wieder in der Gegenwart. Er wandte den Kopf und sah, dass ein blauer VW-Bus an ihm vorbeiknatterte. Hinter dem Beifahrerfenster zeigte ihm jemand den Vogel.
Ein blauer VW-Bus. Lieber Gott.
Er drehte den Schlüssel im Zündschloss, und glücklicherweise sprang der Wagen an. Er biss die Zähne zusammen und trat vorsichtig aufs Gas. Der Toyota rumpelte von der Bordsteinkante herunter, und kurz darauf war er über die Kreuzung. Ein kleines Stück weiter gab es einen Fastfood-Drive-in. Jacobsen bog in den Parkplatz ein, stellte den Motor ab und spürte, wie ihm die Kraft aus Armen und Beinen wich. Er tastete ungeschickt nach der Zigarettenpackung in seiner Jackentasche. Die Hand, die das Feuerzeug hielt, zitterte so heftig, dass es drei quälende Versuche brauchte, bis er den ersten erlösenden Zug tun konnte. Er schloss die Augen.
Wenn Adler das hier mitbekommen hätte, er würde dich nie im Leben versetzen … weder nach Schwaben noch sonst wohin. Er würde dich in das Zimmer von diesem Traumatherapeuten schleifen, dich dort einsperren und den Schlüssel wegwerfen.
Das Bild des Mädchens hatte sich in seine Netzhaut eingebrannt wie die Helligkeit nach einem unvorsichtigen Blick direkt in die Sonne … blonder Pagenkopf, blaues Glitzershirt, Röhrenjeans, bloße Füße in Sandalen … und jetzt wurde es von dem Bild des anderen Mädchens überlagert, das ihr so verblüffend glich.
Aber Beeke Brehm hatte einen dunkelblauen Wintermantel getragen auf dem Foto, das monatelang in jeder Zeitung abgedruckt worden und bei jeder Nachrichtensendung über den Bildschirm geflimmert war. Einen dunkelblauen Wintermantel, weil es kalt war und Schnee lag. Sie hielt ihren Geigenkasten unter dem Arm und ihre Augen lächelten unter dem blonden Pony ihrer Pagenfrisur.
»Beeke (13) auf dem Heimweg vom Geigenunterricht entführt!«, hatten die Schlagzeilen im letzten Jahr geschrien, zwei Tage vor Weihnachten.
Beeke war pünktlich und verlässlich gewesen, also machte ihr Vater Wilhelm Brehm, ein pensionierter Marineoffizier, sich schon eine knappe Stunde nach ihrem Ausbleiben auf die Suche. Von Beeke fand er keine Spur, stattdessen entdeckte er ihren Geigenkasten, den jemand offenbar achtlos in ein verschneites Gebüsch geworfen hatte, und wenige Meter weiter ihren zerrissenen Mantel.
Die Medien zeigten das Patrizierhaus in Blankenese, wo Beeke allein mit ihrem Vater lebte, sie gruben Porträts von Wilhelm Brehm in seiner schmucken Marineuniform aus, und sie sezierten jedes Detail von Beekes Leben. Die Zuschauer erfuhren, dass Beekes Mutter nach nur kurzer Ehe an Krebs gestorben war – »Alleinerziehender Vater verzweifelt: Gebt mir mein Kind zurück!«–, dass ihre Mitschüler auf dem Gymnasium sie mochten, und die Fernsehsender zeigten ergreifende Bilder von einer Mahnwache mit Kerzenschein und vielen bedrückten Klassenkameraden am Marion-Dönhoff-Gymnasium, das Beeke seit zwei Jahren besuchte.
Er erinnerte sich an die frustrierende Analyse der fast nicht vorhandenen Spuren – ein braunes Haar auf Beekes Mantel, der Teilabdruck eines Daumens auf dem Geigenkasten – und an die Hoffnung, die in der »SOKO Beeke« aufflammte, als sich ein Rentner meldete, der beim Gassigehen mit seinem Dackel am Tat-Abend einen Schrei gehört und einen blauen VW-Bus gesehen haben wollte, der mit quietschenden Reifen um die Ecke der Allee verschwand. Fortan geisterten blaue VW-Busse durch die Medien, jeder Besitzer eines solchen Fahrzeuges im Großraum Hamburg wurde überprüft, aber ohne Ergebnis. Dann wurde der Radius erweitert, und ein groß angelegter Speicheltest in Hamburg und Umgebung war der Presse noch einmal ein paar dramatische Schlagzeilen wert. Da war es schon Anfang Februar.
Das Gesicht von Beekes Vater war Jacobsen aus dieser Zeit noch am deutlichsten in Erinnerung. Der höfliche, stets beherrschte alte Soldat verfiel förmlich vor seinen Augen; er verlor an Gewicht, und jedes Mal, wenn Jacobsen ihn aufsuchte, um ihn über die Fortschritte der Ermittlungen zu informieren, von denen es bestürzend wenige gab, sah er ein wenig grauer und erschöpfter aus.
Und dann – Ende Februar – kam der Paukenschlag. Ein blauer VW-Bus prallte vor dem Elbtunnel gegen eine Mauer; die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, meldeten den Fahrer, dem der Wagen gehörte, routinemäßig an die Sonderkommission. Er wurde wie alle Besitzer blauer VW-Busse zum Speicheltest gebeten und stimmte nach kurzem Zögern zu. Der Mann war noch nicht straffällig geworden, aber das Haar von Beeke Brehms Mantel und der Daumenabdruck auf dem Geigenkasten stammten von ihm. Obendrein fand sich in den gerade erst analysierten Proben des Speicheltestes von Anfang des Monats eine, die teilweise mit der von dem Haar auf Beekes Mantel übereinstimmte. Es stellte sich heraus, dass ein Cousin des Mannes sie abgegeben hatte, der in Hamburg wohnte. Beekes Mörder hatte das Weihnachtsfest im vergangenen Jahr bei ihm verbracht … und Beeke war drei Tage vor dem Heiligen Abend verschwunden.
Jacobsen griff erneut nach der Packung. Die Bilder in seinem Kopf waren wie ein Mühlrad mit scharfkantigen Speichen, das sich hinter seinen Schläfen drehte. Er steckte sich die zweite Zigarette an. Seine Hand zitterte jetzt nicht mehr ganz so stark, und er dachte an den Apfelhof im Alten Land.
Er hatte diesen Hof, wo Beekes Leiche schließlich gefunden wurde, nur auf Bildern gesehen, und in einem sehr verborgenen Winkel seines Herzens empfand er immer noch eine tiefe Dankbarkeit dafür. Das Kind lag kaum einen halben Meter tief im Lehmboden eines Lagerschuppens verscharrt; die Polizeibeamten mussten erst ein Dutzend vollbeladener Apfelkisten beiseiteschaffen, bevor sie anfangen konnten zu graben und endlich auf die in einen grauen Müllsack gewickelte Leiche stießen.
Sein Kollege Geert Terheugen, der im Gegensatz zu ihm mit auf dem Hof gewesen war, hatte sich nach Aufklärung des Falles vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet; er hätte ohnehin nur noch zwei Jahre Dienst vor sich gehabt, liebte seine Familie innig und ganz besonders seine Enkeltochter. Eines Abends hatten sie zusammengesessen, und plötzlich hatte Terheugen sich geschüttelt und gesagt: »Als wir diesen verdammten Sack aufgemacht haben, da dachte ich einen Augenblick, es wäre das Gesicht von meiner Lütten. Und jetzt träume ich dauernd davon.«
Wovon Beekes Vater träumte, hatte Jacobsen nie erfahren. Er sorgte dafür, dass die Presse den Mann weitgehend in Ruhe ließ, und er stand neben ihm, als Beeke zwei Wochen nach ihrer Entdeckung auf dem Apfelhof endgültig begraben wurde. Danach brachte er ihn in sein leeres Haus zurück. Der alte Soldat bedankte sich mit einem Handschlag bei ihm und dem Pfarrer, der sie begleitet hatte, und schickte sie beide nach Hause. An diesem Abend holte Jacobsen die Flasche »Jack Daniels« heraus, die seit Jahren unangetastet in seiner untersten Schreibtischschublade verstaubte, und ließ sich mit finsterer Entschlossenheit volllaufen.
Am nächsten Morgen erreichte ihn ein Anruf von Brehms Nachbarin, die seit dem Tod seiner Frau jeden dritten Tag bei ihm putzte; sie hatte in der Küche einen Kaffee gekocht, den die beiden immer gemeinsam tranken, und war dann zu Brehms Schlafzimmer hinaufgegangen, weil er noch nicht heruntergekommen war. Die Tür war nur angelehnt, die Vorhänge nicht zugezogen.
Eine halbe Stunde später stand Malte Jacobsen in diesem Schlafzimmer, unrasiert, verkatert und bleich. Hinter ihm bemühte sich der bestürzte Pfarrer, die schluchzende Nachbarin zu beruhigen, und vom Nachttisch lächelte aus einem silbernen Fotorahmen Beeke in ihrem Wintermantel, den Geigenkasten unter dem Arm.
Wilhelm Brehm lag in seiner Ausgehuniform auf dem Bett. Die Pistole, mit der er sich erschossen hatte, hielt er noch in der Hand.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Jacobsen das Gefühl hatte, weiterfahren zu können, ohne sich oder anderen irreparablen Schaden zuzufügen.
Er fädelte sich in den dichten Verkehr nach Süden ein, die Augen gegen jede Ablenkung starr geradeaus auf die Straße gerichtet. Keine Mädchen am Straßenrand mehr. Niemand mit den trostlosen Augen von Wilhelm Brehm oder dem runden, harmlosen Bauerngesicht des Täters, hinter dem der Tod lauerte. Allerdings würde die Tatsache, dass er zwischen sich und seine Erinnerungen mehr als 600 Kilometer brachte, ihn nicht notwendigerweise schützen. Das Mühlrad hatte einstweilen aufgehört sich zu drehen, aber er machte sich keinerlei Illusionen. Es war immer noch da, und es war entsetzlich leicht, es zum Laufen zu bringen.
Hamburg blieb hinter ihm zurück, Häuser und Hafen grau unter einem neu einsetzenden Nieselregen.
* * *
»Du kannst also bei der Feier wirklich nicht dabei sein?«
Peter von Weyen spürte, wie sich sein Rücken versteifte. In letzter Zeit geschah das automatisch, wann immer seine Frau mit ihm sprach.
»Das Lager«, erinnerte er sie und registrierte abwesend, wie überdrüssig seine Stimme klang. Es war so verdammt anstrengend, sich ihr gegenüber ständig um Geduld zu bemühen. »Wir haben es seit Monaten vorbereitet, und das weißt du, Yvonne.«
»Manchmal glaube ich, Lukas kann von Glück sagen, dass er auf die Pfadfinderarbeit mindestens so sehr abfährt wie du.« Yvonne sprach leise und heftig. »Denn wenn dem nicht so wäre, dann würdest du ihn genauso links liegen lassen wie mich.«
»Ich lasse dich nicht links liegen, Liebling.«
Selbst für ihn hörte es sich an wie eine Floskel… ein Zauberwort, das dazu dienen sollte, sie zu beruhigen. Nur dass dieser Zauber schon lange nicht mehr funktionierte.
Er betrachtete sie. Eigentlich hatte Yvonne sich in fünfzehn Jahren Ehe gar nicht so sehr verändert. Sie achtete auf ihre Figur, besuchte regelmäßig ein Fitnessstudio und aß gesund. Das warme Weizenblond, das sie ihrem gemeinsamen Sohn vererbt hatte, wuchs inzwischen nicht mehr ganz natürlich nach, aber die Farbe, die sie benutzte, um es aufzufrischen, war geschickt gewählt und stand ihr gut. Eigentlich war sie noch genauso schön wie an dem Tag, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Eigentlich. Wenn da der bittere, unzufriedene Zug um ihren Mund nicht gewesen wäre. Früher tauchte er nur ab und an einmal auf, wenn er ein gemeinsames Essen oder einen Ausflug zu dritt mit Lukas absagen musste, weil die Termine, die die Arbeit im Pfadfinderbund ihm auferlegte, dazwischenkamen. Inzwischen hatte er sich so tief eingegraben, dass er überhaupt nicht mehr verschwand.
»Ich lasse dich nicht links liegen, Liebling«, wiederholte er. »Wenn das Lager erst einmal vorbei ist …«
»… dann machst du es wieder gut. Aber gewiss doch.« Yvonne zog eine Grimasse. »Wieso kommt mir das bloß so bekannt vor? Und wieso kann ich es nicht glauben?«
Plötzlich und vollkommen ungebeten ging ihm Susanne durch den Kopf … ihre leise Stimme, der demütige Blick, der ihm ständig folgte, als wagte sie es nicht, ihn auch nur für einen Moment aus den Augen zu lassen, aus lauter Angst, dass er dann verschwand. Er fühlte, wie sich sein Gewissen regte. Yvonne und er, sie hatten einander ganz zu Anfang versprochen, sich niemals anzulügen. Und inzwischen fiel es ihm immer leichter, sie zu hintergehen.
Er schüttelte das Bild ab.
»Ich kann nichts dafür, dass du mir nicht glaubst«, antwortete er, und diesmal gab er sich keine Mühe mehr, seine Ungeduld zu verbergen. »Ich tu mein Bestes … und das wäre dir auch klar, wenn du irgendwann einmal aufhören würdest, dich aufzuführen wie ein verwöhntes, egoistisches Kind.«
»Ich bin egoistisch?« Sie starrte ihn an, so fassungslos wie feindselig. »Du bist doch derjenige, der jedem vernünftigen Gespräch aus dem Weg geht und sich hinter seinen Pflichten verschanzt! Nicht nur dass du dich keinen Deut mehr um die Firma kümmerst, du benutzt außerdem die Pfadfinder wie einen Schild … damit du nicht mehr Zeit mit mir verbringen musst als nötig. Und damit du nicht mit mir reden musst. Das ist erbärmlich.«
Verdammt! Konnte sie nicht endlich den Mund halten?
»Der ganze Streit ist erbärmlich«, erwiderte er schroff. »Und überflüssig obendrein. Ich hab wirklich keine Zeit für diesen Blödsinn.«
Er wollte nur noch weg aus diesem Zimmer … weg von der erdrückenden Atmosphäre aus enttäuschten Erwartungen und immer denselben Vorwürfen. Nur seine lang antrainierte Rücksichtnahme brachte ihn dazu, sich noch einmal umzudrehen, bevor er hinausging.
Yvonne stand mitten im Zimmer, starr wie ein Ladestock. Ihr Gesicht war bleich, mit hochroten Flecken auf den Wangen. Verzweiflung und Wut strahlten von ihr aus wie Hitze von einem Backofen.
»Wir unterhalten uns später«, versprach er. »Wenn ich wieder zurück bin. Vielleicht hast du dich ja bis dahin beruhigt.«
Besser, er verließ sich nicht allzu sehr darauf.
Als er die Tür hinter sich schloss, geschah es mit einem nachdrücklichen Knall.
* * *
Das Zimmer war dämmerig, die Jalousien gegen das helle Sonnenlicht heruntergezogen. Susanne Steffens stand in ihrem Zimmer vor dem Bett und betrachtete den offenen Rucksack, der auf der Matratze stand.
Vor jedem Pfadfinderlager gab es eine Packliste mit Dingen, die in diesen Rucksack gehörten, und mit anderen Dingen, die darin nichts zu suchen hatten. Isomatte, Schlafsack, Hosen und Shirts, Wäsche zum Wechseln, Zahnpasta, Zahnbürste und Seife – absolut erwünscht. Schreibzeug, Tasse, Teller und Besteck – unbedingt notwendig. Handys und Gameboys – strikt verboten. »Wenn ich der Generation Smartphone dabei zuschauen will, wie sie ununterbrochen auf ihr Display stiert, dann muss ich dazu kein Lager veranstalten«, sagte Malenga immer. »Während der paar Tage, die wir gemeinsam um das Lagerfeuer sitzen, möchte ich eure Gesichter sehen. Und sicher sein, dass ihr es mitkriegt, wenn ich etwas sage.«
Susannes Handy lag neben dem Rucksack. Sie hatte kein Smartphone, nur ein älteres Nokia-Modell, mit dem man telefonieren und SMS schicken konnte. Zum Surfen im Internet taugte es nicht.
Dieses ganze Online-Schlamperzeugs gewöhnst du dir gar nicht erst an. Denn sonst kommen erst die schlechten Noten und dann der liederliche Umgang mit all den notgeilen, lüsternen Jungs, die dich in den Dreck ziehen.
Susanne war es gewöhnt, die Stimme ihres Vaters als ständiges Flüstern in ihrem Hinterkopf zu hören. Du musst mehr lernen, mahnte sie. Wir wollen, dass du ein ordentliches Mädchen wirst, raunte sie leise. Hilf Mama beim Wäschezusammenlegen, Susannchen. Räum dein Zimmer auf. Wenn in der Schule Unterricht ausfällt oder die Pfadfinderstunde länger dauert, ruf unbedingt zuhause an. Wir wollen wissen, wo du bist, Susannchen, sonst machen wir uns Gedanken. Flüsterflüsterflüster.
»Ordentlich« war ein Wort, das ihr Vater ständig im Munde führte. Ordnung bedeutete für ihn nichts weniger als ein Lebensprinzip, dessen starre Regeln er allein festlegte. Ein Abweichen davon war in seiner Vorstellung schlichtweg ausgeschlossen. Als Resultat lebten Susanne und ihre Mutter in einem eng gezurrten Korsett, aus dem es kein Entkommen gab. Ihre Mutter hatte sich damit abgefunden … Susanne nicht. Noch nicht.
Zwei saubere Hosen. Ein Klufthemd zum Wechseln, dunkelgrün mit der schwarz gestickten Lilie auf dem goldenen Pfadfinderabzeichen. Susanne faltete die Kleidungsstücke säuberlich zusammen und verstaute sie in dem entsprechenden Fach. Morgen begann das Lager; bevor es losging, würde sie noch ihr Essgeschirr einpacken.
Sie dachte an den Mann mit dem gebräunten Gesicht und den lachenden, blauen Augen. Sie dachte an Arme, die sie hielten, und an eine weiche Stimme, die zur Gitarre zahllose Lieder sang und ihr wunderbare Dinge versprach. Dinge wie Glück – und Freiheit.
Aber nur, solange ihr Vater zuließ, dass sie die Gruppenstunden und Lager besuchte. Sein Verbot war Gesetz, und die Angst davor hing über ihr wie das Damoklesschwert, von dem sie einmal in einem Sagenbuch gelesen hatte. Ein Schwert, das nur von einem dünnen Pferdehaar daran gehindert wurde, den, der darunter saß, aufzuspießen.
Noch erlaubte er ihr, ein Teil des Pfadfinderbundes zu sein. Noch hatte sie die Chance, sich zu dem Mann mit der Gitarre davonzustehlen.
Noch.
VOLL DANEBEN
Jacobsen wachte auf und stellte fest, dass ihm die Sonne voll ins Gesicht schien. Er wusste nicht, wo er war, setzte sich auf und erhielt als Antwort das resignierte Quietschen eines alten Lattenrosts. Niedlich karierte und gerüschte Vorhänge rahmten das große Fenster gegenüber vom Bett ein; Raffhalter in Blumenform hielten sie zur Seite. Seine Exfrau Katrin hatte ihm erklärt, wie die Dinger hießen, mit denen man Gardinen da hielt, wo sie sein sollten; es gehörte zu ihrem Job als Innenarchitektin, so etwas zu wissen. Allerdings wäre sie lieber gestorben, als solche Vorhänge in irgendeiner Wohnung aufzuhängen, die sie eingerichtet hatte. »Landhaus-Petersilie« hatte sie diesen Stil abfällig genannt. Er konnte ihre Stimme beinahe hören … hell, scharf und immer ein bisschen unzufrieden.
Schwaben … natürlich. Er war in Schwaben. In Heikes und Kurts Feriendomizil.
Gestern war er am frühen Abend angekommen. Er hatte keinen Blick auf die Altstadt von Backnang verschwendet, die in Touristenführern als »gut erhalten« und »malerisch« angepriesen wurde, sondern sich von seinem Navi zum Einfamilienhaus seines Schwagers am Stadtrand dirigieren lassen. Sauber gestutzte Hecke, sorgsam gemähter Rasen, Terrasse mit Holzboden und Loungemöbeln, Sonnenkollektoren auf dem Dach. Heike und ihr Mann, die ihn mit Käseplatte, frischen Baguettes und Wein willkommen hießen. Ein vierzehnjähriger Neffe, von dem er zunächst nicht viel mehr mitbekam als einen kurzen, abschätzenden Blick aus blauen Augen unter einer tiefschwarz gefärbten Haartolle hervor, ehe er wieder in seinem Zimmer verschwand. »Er erinnert sich kaum an dich«, meinte Heike, »und er ist mitten in einer Emo- und Manga-Phase. Lass ihm Zeit, das wird schon.« Sie luden ihn ein, erst einmal eine Nacht im Gästezimmer zu verbringen, aber er lehnte ab und ließ sich lieber von Kurt die genaue Adresse des Ferienhauses für sein Navi geben.
Das Haus lag tatsächlich mitten im Wald, auf einer Lichtung, die man erst nach reichlich Serpentinenkurverei den Berg hinauf erreichte – ein schlichtes Holzgebäude mit einem kleinen Stück Rasen davor und einer Grillstelle. Es gab ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kaminofen, Fernsehsessel und Sofa und eine Küche, die alles enthielt, was man brauchte, um sich selbst zu versorgen. Heike hatte ihm einen Picknickkorb mitgegeben; Jacobsen machte mit dem Inhalt fast vollständig kurzen Prozess. Einkaufen würde er trotzdem nicht so schnell müssen – der Kühlschrank war wohlgefüllt, die winzige Speisekammer auch.
Zum ersten Mal nahm er die ruhige Fürsorge, mit der Heike und Kurt alles für ihn vorbereitet hatten, richtig zur Kenntnis, und plötzlich schämte er sich dafür, dass er so wenig Dankesworte gefunden hatte. Er würde das nachholen, so bald wie möglich. Aber zunächst legte er sich im Schlafzimmer in das frisch bezogene Bett und schlief fast sofort ein. Nach ungezählten durchwachten Nächten in Hamburg stellte sich allein schon das als positive Überraschung heraus.
Das Badezimmer war klein, wirkte aber ganz neu und sehr modern. Es gab sogar eine verblüffend geräumige Dusche. Um beim Rasieren in den Spiegel schauen zu können, musste er sich allerdings ganz leicht bücken. Ein müdes Gesicht starrte ihm entgegen, mit Dreitagebart, grimmigen Augen und schmallippigem Mund unter einem zerzausten, kurz geschnittenen Haarschopf. Kriminalhauptkommissar Malte Jacobsen, Besoldungsgruppe A 12, Beamter im gehobenen Dienst, dreiundvierzig, seit zwei Jahren geschieden.
»Alter, du hast auch schon besser ausgesehen«, knurrte er sein Spiegelbild an und gähnte.
Das Spiegelbild gähnte schlecht gelaunt zurück. Er seufzte, schaltete den Rasierer ein und dachte dankbar daran, dass sich in Heikes Küchenschrank auch ein Pfund Kaffee befand.
Die Kaffeemaschine funktionierte, der Gasherd auch; zwei Becher voll starkem, schwarzen Gebräu und vier Spiegeleier später trat er ins Freie, zog sich einen der Kunststoffstühle neben die Terrassentür und rauchte.
Es war sehr ruhig; Jacobsen war gewöhnt an das Quietschen der U-Bahn auf den Schienen, das jaulende Auf und Ab der Polizeisirenen und das ständige Rauschen vorbeifahrender Autos, und jetzt dröhnte ihm die Stille in den Ohren. Rings um die kleine Lichtung lag Mischwald wie ein grüner Gürtel. Die Kuckucksrufe hinter den Bäumen und das geschäftige Schnabelgehämmer eines Spechts klangen beinahe exotisch.
Seine Besitztümer waren in ein Dutzend Umzugskartons verpackt und warteten größtenteils noch in Hamburg darauf, dass er sie nachholte, ebenso wie seine Möbel. Er hatte nur einen Koffer mit Kleidung und ein paar Schmöker mitgebracht, die seit Jahren ungelesen in seinen Regalen verstaubten. Außerdem gab es hier einen Fernseher, und Heike war nur einen Anruf weit entfernt. Theoretisch musste er sich auch ohne sie und ihre Familie nicht langweilen, aber er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so lange mit sich allein gewesen war.
Der Himmel überzog sich mit einer Wolkenschicht, und ein kurzer Regenschauer scheuchte ihn wieder nach drinnen. Er holte sich eines der Bücher, die er am Abend zuvor säuberlich im Regal aufgereiht hatte – alphabetisch, weil er es hasste, nach irgendetwas suchen zu müssen. »Fräulein Smillas Gespür für Schnee« fiel ihm in die Hände, von Peter Høeg; irgendwie fand er es auf schräge Weise witzig, in einem Ferienhaus in Süddeutschland zu sitzen und einen Krimi zu lesen, der von einem dänischen Autor geschrieben war und teilweise in Grönland spielte.
Er ließ sich in dem bequemen Sessel nieder, der vor dem Kaminofen stand, und versank binnen Minuten in der Geschichte der Heldin, die ihre Identität verloren hatte und herauszufinden versuchte, wer einen kleinen Jungen ermordet hatte, den sie liebte. Høegs Sprache packte ihn mit ihrer Kraft, und die stille, leidenschaftliche Härte von Smillas Kampf um die Wahrheit hielt ihn so lange fest, bis ihn irgendwann am frühen Nachmittag die Müdigkeit erneut überkam und er zum zweiten Mal in Heikes Ferienhaus einschlief.
* * *
Ein lautes, splitterndes Klirren.
Jacobsen fuhr jäh hoch und spürte, wie das aufgeschlagene Buch von seinen Knien auf den Fußboden rutschte. Gleichzeitig hüpfte ein Ball über den Teppichboden auf ihn zu, prallte von seinem Schienenbein ab und hinterließ eine feuchte Schmierspur auf den Buchseiten.
Er hob den Kopf, sah das ausgezackte Loch in der Terrassentür und war aufgesprungen, noch ehe er richtig wusste, was er tat. Der Instinkt war so gut antrainiert, dass seine rechte Hand automatisch nach der Stelle griff, wo seine Dienstwaffe im Schulterhalfter saß.
Sie war nicht da, genauso wenig wie das Schulterhalfter. Natürlich nicht.
Einige der Spinnweben in seinem Kopf lösten sich auf. Er ging zu dem Loch in der Scheibe hinüber; ihm fiel ein, dass er barfuß war, und er wich vorsichtig den verstreuten Scherben aus. Schon bevor er die Tür öffnete, hörte er draußen leise Stimmen.
»… wenn Malenga das mitkriegt …«
»… ich werde es ihm sagen müssen, besser, er erzählt es meiner Mutter als ich … oh, da kommt jemand!«
Vor Jacobsen standen auf der kurz geschorenen Rasenfläche zwei Jungen, das tiefgoldene Licht des Spätnachmittags im Rücken. Es dauerte eine Weile, bis er ihre Gesichter deutlich erkennen konnte, und im ersten Moment sahen sie sich in ihrem gemeinsamen Schrecken verblüffend ähnlich. Auf den zweiten Blick hätten sie allerdings kaum unterschiedlicher sein können. Sie waren dreizehn, vielleicht vierzehn, der eine schlank und hochgewachsen für sein Alter, der andere einen halben Kopf kleiner und kompakt, ohne wirklich dick zu sein. Der Kleinere hatte einen zerzausten, hellbraunen Stoppelkopf, eine Stupsnase und sommersprossige Haut. Der andere trug sein Haar länger; es war sonnenblond und fiel ihm bis fast auf die Schultern. Sein Gesicht hatte schon viel von seinem Babyspeck verloren, und die Knochenstruktur unter der gebräunten Haut versprach, dass aus dem hübschen Kind in nicht allzu ferner Zukunft ein sehr gut aussehender Mann werden würde. Einer mit Führungsqualitäten obendrein, denn der kleinere Junge war jetzt schon von Kopf bis Fuß sein Gefolgsmann.
Erst jetzt bemerkte Jacobsen, dass die beiden gleich angezogen waren – nicht T-Shirt und Jeans, die allgemein anerkannte »Uniform« aller Jugendlichen, sondern robuste, schwarze, knielange Hosen, dazu dunkelgrüne Hemden mit aufgekrempelten Ärmeln und sauber zusammengerollten Halstüchern in kräftigem Gelb und Blau. Aufnäher auf der Brusttasche zeigten eine stilisierte schwarze Lilie auf goldenem Grund. Pfadfinder.
Er kratzte sich die rauschenden Bartstoppeln am Kinn und betrachtete die beiden mit zusammengekniffenen Augen. »Hallo Jungs. Wenn das eure tägliche gute Tat war, dann bin ich alles andere als beeindruckt.«
Sie liefen gleichzeitig rot an, aber der Größere erholte sich zuerst – ganz, wie er es erwartet hatte.
»Es … es war keine Absicht. Ich wollte bloß die Hauswand treffen, und dann hab ich danebengeschossen.«
Der andere Junge öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, dann schlug er die Augen nieder und klappte ihn wieder zu.
»Sehr nobel«, erwiderte Jacobsen trocken. »Ich hoffe, die Eltern von deinem Kumpel haben eine gute Haftpflichtversicherung.«
»Woher wussten Sie …«, platzte der Kleinere heraus, dann verstummte er und errötete erneut.
»Weil du mit deinem ehrlichen Gesicht so schlecht lügen kannst«, meinte Jacobsen, »und weil dein Freund die blauen Flecken an den Beinen hat und nicht du. Er hat offenbar viel mehr Übung beim Fußballspielen, und wenn er geschossen hätte, wäre die Terrassentür noch heil. Du wirst oft gefoult, oder?«, fragte er, an den Größeren gewandt.
Der Junge grinste, eine Mischung aus Verlegenheit und Stolz. »Ziemlich«, sagte er, »und der Bluterguss da ist von letzter Woche, kurz bevor wir auf das Lager gefahren sind. Wir haben aber trotzdem gewonnen, 3 : 0.« Er hielt inne und betrachtete den Mann vor sich neugierig. »Was sind Sie – Detektiv oder so was?«
»Kriminalhauptkommissar«, sagte Jacobsen, »aber auf Urlaub. Was für ein Lager? Seid ihr hier in der Nähe?«
Der Kleinere deutete unbestimmt in Richtung Waldrand. »Noch einen Kilometer weiter den Berg hinunter«, sagte er. »Unser Stammeslager.«
»Aha. Und was sollte das hier werden – ein Hajk, eine Übung mit dem Kompass, oder seid ihr abgehauen?«
»Eine Übung mit dem Kompass«, sagte der Größere, »und den Ball haben wir mitgenommen … für alle Fälle.« Wieder dieser neugierige Blick. »Sie wissen aber gut Bescheid über Pfadfinder.«
»Weil ich selber mal einer war«, erwiderte Jacobsen gelassen, »wenn auch nicht lange.«
»Mein Vater sagt, wenn man einmal Pfadfinder ist, dann bleibt man das sein ganzes Leben«, konterte der Junge ebenso gelassen.
Jacobsen musste sich ein anerkennendes Grinsen verkneifen. Gut pariert, alle Achtung.
»Ist dein Vater auf dem Lager?«
Der Junge nickte.
»Dann bestell ihm einen schönen Gruß von mir. Er soll hier vorbeikommen, dann können wir die Einzelheiten wegen der Versicherung klären; vielleicht hat euer Stamm ja eine, die für so was zuständig ist. Ich bin heute und morgen den ganzen Tag hier. Ach, und übrigens – ich heiße Malte Jacobsen.«
»Lukas von Weyen«, sagte der Junge automatisch.
Jacobsen hätte sich nicht gewundert, wenn der Vorstellung eine schwungvolle Verbeugung gefolgt wäre … vielleicht weil dieser Junge mit seiner natürlichen Eleganz genauso gut in ein früheres, weit förmlicheres Zeitalter gepasst hätte.
»Ich sag ihm Bescheid, und er kommt dann zu Ihnen, spätestens morgen.«
»Und du? Wie heißt du?«, fragte Jacobsen, an den anderen Jungen gewandt.
Der war der Unterhaltung stumm und aufmerksam gefolgt, offensichtlich kein bisschen überrascht, dass man ihn ignorierte.
»Sven«, sagte er schüchtern. »Sven Bender.«
»Okay, Sven.« Jacobsen betrachtete ihn aufmerksam. »Sag mal … wer ist Malenga?«
»Das ist der Vater von Lukas«, erwiderte Sven nach einer kurzen, überraschten Pause, und Jacobsen fragte sich, ob die Heldenverehrung in seinen Augen wohl eher von Weyen senior oder von Weyen junior galt. »Malenga ist sein Fahrtenname.«
»Ach so.« Jacobsen drehte sich um, stieg zum zweiten Mal behutsam über die Scherben hinweg und sammelte den Ball auf. Er warf ihn durch die offene Tür nach draußen. »Ab zurück ins Lager mit euch!«, rief er. »Sonst bekomme ich es noch vor dem Abendessen mit einer Rettungsexpedition zu tun.«
»Auf Wiedersehen!«, riefen zwei Stimmen gehorsam im Chor, dann rannten die Jungen über die kleine Wiese davon und verschwanden im Wald.
Hoffentlich nicht so bald, dachte Jacobsen gähnend und machte sich auf die Suche nach einer Kehrschaufel. Er würde notgedrungen Heike anrufen müssen wegen der zerbrochenen Scheibe. So ein Mist.
* * *
Wie leicht wir zu dem Umgangston zurückgefunden haben, der zu Beginn unserer Freundschaft gang und gäbe war. Wie leicht, dir zuzuschauen, während du so geschickt wie immer ein kleines Feuer angezündet hast. Wie leicht es war, mich scheinbar entspannt dir gegenüber niederzulassen und dir zuzuhören, während du von den Abenteuern der Kinder erzählt hast, die ihre Eltern dir so bedenkenlos anvertrauen.
Sie wissen nicht, wer du wirklich bist. Aber ich weiß es. Und nach dieser Nacht wirst du keinem Kind jemals wieder schaden.
NACHTWANDERUNG
Sven öffnete die Augen und blinzelte zu dem schwarzen Tuch über seinem Gesicht hinauf. Es war irgendwie komisch … es fühlte sich so ganz anders an als zuhause in seinem Bett wach zu werden. Keine Leuchtsterne auf einer blau gestrichenen Decke – seine Mutter hatte sie vor drei Jahren als Geschenk zu seinem zehnten Geburtstag aufgeklebt –, nirgendwo die vertrauten Umrisse der Möbel in seinem Zimmer. Klar, dachte er, das ist ja auch nicht mein Zimmer. Ich bin seit einer Woche auf einem Pfadfinderlager. Zwanzig Minuten hatte die Fahrt in dem Kleinbus gedauert, der dem Pfadfinderbund Impeesa gehörte, und er dankte noch jetzt, Tage später, seinem Schicksal, dass ihm trotz der vielen Haarnadelkurven nicht schlecht geworden war. Nichts konnte peinlicher sein, als vor aller Augen in eine Papiertüte zu kotzen, auf der stand: »Das sollten Sie besser für sich behalten.« Seine Mutter sammelte diese Tüten auf ihren Flugreisen, denn »man weiß ja nie, wann man sie mal wieder braucht«. Das sagte sie gern und oft.
Die Luft war kalt und roch nach Holzrauch; als er sich vorsichtig weit genug aus seinem Schlafsack herausgeschlängelt hatte, um sich aufzusetzen, konnte er den schwachen, rötlichen Schimmer des Feuers sehen, das in der Mitte der Jurte fast ausgegangen war. Er fummelte in der Hosentasche seines Jogginganzuges nach seiner Armbanduhr. Die grün leuchtenden Zeiger sagten kurz vor fünf. Die Sonne würde bald aufgehen, und in dem Rauchloch über den mit Seilen zum Dreibein zusammengeschnürten Holzstangen, die die Jurte trugen, färbte sich der Himmel zu einem schwachen Graublau. Seine Blase hatte allerdings entschieden, dass es Zeit war, sich nachdrücklich zu melden – was in diesem Fall hieß, dass er so leise wie möglich den Reißverschluss aufziehen und neben der Isomatte nach seinen Sandalen tasten musste. Er konnte sich nicht erinnern, wo die kleine Taschenlampe lag, die ihm seine Oma kurz vor Beginn des Lagers geschenkt hatte, und als er nach reichlichem Herumgetaste die Sandalen endlich fand, musste er sie unter Lukas hervorziehen, der neben ihm lag und sie im Tiefschlaf halb unter sich begraben hatte.