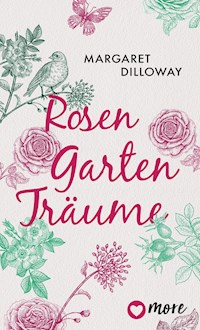
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Schwierig und widerstandsfähig. Gedeiht nur unter bestimmten Bedingungen.“ Das beschreibt mich ziemlich genau. Vielleicht mag ich diese Rosensorte deshalb so sehr.
Rosen sind die Leidenschaft von Galilee Garner. Als Amateurzüchterin kreuzt sie ihre Pflanzen sorgfältig und versucht immer wieder aufs Neue, eine perfekte Sorte ihrer Lieblingsblume, der Hulthemia, zu züchten. Ihr Traum ist es, eines Tages den großen Rosenwettbewerb zu gewinnen. Der Rest von Gals Lebens verläuft in festen Bahnen. Sie unterrichtet Biologie an der High School und jeden zweiten Abend verbringt sie bei der Dialyse. Ihr Alltag lässt Gal nur wenig Zeit für Freundschaften und genauso mag Gal es. Ihr Job, die Dialyse und nicht zuletzt ihre Rosen, die sie noch nie in ihrem Leben enttäuscht haben. Bis eines Tages Riley, Gals Nichte, unangekündigt bei ihr klingelt und Gals wohlgeordnetes Leben gründlich auf den Kopf stellt. Plötzlich sieht sich Gal gezwungen ihre geliebte Routine aufzugeben und sich dem Leben und ihren Mitmenschen wieder zu öffnen. Aber kann sie das nach der all der Zeit überhaupt noch?
Der Titel erschien vormals unter "Die Liebe zu Rosen mit Dornen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Schwierig und widerstandsfähig. Gedeiht nur unter bestimmten Bedingungen«
Das beschreibt mich ziemlich genau. Vielleicht mag ich diese Rosensorte deshalb so sehr.
Rosen sind die Leidenschaft von Galilee Garner. Als Amateurzüchterin kreuzt sie ihre Pflanzen sorgfältig und versucht immer wieder aufs Neue, eine perfekte Sorte ihrer Lieblingsblume, der Hulthemia, zu züchten. Ihr Traum ist es, eines Tages den großen Rosenwettbewerb zu gewinnen. Der Rest von Gals Lebens verläuft in festen Bahnen. Sie unterrichtet Biologie an der High School und jeden zweiten Abend verbringt sie bei der Dialyse. Ihr Alltag lässt Gal nur wenig Zeit für Freundschaften und genauso mag Gal es. Ihr Job, die Dialyse und nicht zuletzt ihre Rosen, die sie noch nie in ihrem Leben enttäuscht haben.
Bis eines Tages Riley, Gals Nichte, unangekündigt bei ihr klingelt und Gals wohlgeordnetes Leben gründlich auf den Kopf stellt. Plötzlich sieht sich Gal gezwungen ihre geliebte Routine aufzugeben und sich dem Leben und ihren Mitmenschen wieder zu öffnen.
Aber kann sie das nach der all der Zeit überhaupt noch?
Der Titel erschien vormals unter »Die Liebe zu Rosen mit Dornen«.
Über Margaret Dilloway
Margaret Dilloway, die Tochter einer japanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters, wuchs im kalifornischen San Diego auf. Obwohl sie sich als Schriftstellerin fühlte, seit sie einen Stift halten konnte, versuchte sie sich auch in anderen Kunstformen, besuchte die Kunsthochschule und hat einen Abschluss in Studio Art. Nach dem College arbeitete sie für zwei Wochenzeitungen und schrieb diverse Internetbeiträge, während sie ihre drei Kinder beaufsichtigte und an ihren schriftstellerischen Fähigkeiten arbeitete. Margaret Dilloway lebt mit ihrer Familie in San Diego.
Jörn Ingwersen, Jahrgang 1957, ist ein Allroundtalent. Er hat sich als Musiker, Übersetzer und Autor einen Namen gemacht. Im Frühjahr 2000 veröffentlichte er im Aufbau Taschenbuch Verlag mit »Falscher Hase« einen weiteren Sylt-Krimi.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Margaret Dilloway
Rosengartenträume
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
März
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
April
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Mai
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Juni
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Juli
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
August
Kapitel 36
Kapitel 37
September
Kapitel 38
Kapitel 39
Oktober
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
November
Kapitel 44
Dank
Impressum
Für Deborah, für die Inspiration
Für Keith, für das Vertrauen
Manche Leute klagen immerfort, dass Rosen Dornen haben.
Ich dagegen freue mich, dass Dornen Rosen haben.
Alphonse Karr
WINSLOW BLYTHEDas Große Rosenbuch
März
In diesem Monat werden Sie erleben, welche Vorteile es mit sich bringt, dass Sie Ihre Rosen letzten Monat eingehend beschnitten haben. Manchmal tut ein wenig liebevolle Strenge gut. Wer ein Gewächshaus besitzt, freut sich vielleicht schon zum Monatsanfang über die ersten Blüten, doch wir anderen werden bis zum Monatsende warten müssen.
Nun ist der Frühling fast da. Nach dem harten Winter werden Ihre Rosen einiges an Nährstoffen brauchen. Für einen guten Start mit kräftigen Blättern verwenden Sie normalen Dünger (Stickstoff, Phosphat und Kaliumoxid zu gleichen Teilen).
Nachdem der Winterregen nachgelassen hat, bekommen wir es jetzt mit den ersten Frühjahrsschädlingen zu tun. Biogärtner stehen früh auf und sammeln alle Schnecken von den Rosen. Versuchen Sie es mit Marienkäfern, um der Blattläuse Herr zu werden, oder waschen Sie die Rosenblätter per Hand. Gift sollte nur streng nach Anweisung verwendet werden. Halten Sie es von Kindern und unseren haarigen Freunden fern.
1
Einen Moment lang denke ich, mir ist ein Fehler unterlaufen. Meine Pinzette hält inne und zittert über der gelben Rose. Die Blütenblätter habe ich bereits abgelöst, um das Staubblatt bloßzulegen, das den Pollen dieser männlichen Pflanze freisetzen wird. Aber ist das die Rose, die ich mir vorhin vorgenommen hatte? Oder wollte ich eigentlich die weiße Rose mit den orangefarbenen Blättern und der offenen Blüte, die fast wie eine Margerite aussieht? Die Eltern kenne ich nur unter ihrem Code: G120 und G10. Ich überprüfe die Daten noch einmal in meinem Notizbuch. Ich kreuze keine Pflanzen, ohne diese Codes einzutragen. So kann ich jedes Ergebnis wiederholen oder bearbeiten. In letzter Zeit lässt mein Gedächtnis nach, auch wenn ich es nur ungern zugebe. Ich richte die Lampe neu aus, beruhige meine zitternden Hände und fahre fort.
Ich züchte Rosen. Ich ziehe sie nicht nur. Die meisten Rosenliebhaber ziehen Rosen, die andere bereits perfektioniert haben. Ich hingegen erfinde neue Sorten.
Ich betreibe die Rosenzucht nicht zum Spaß. Jedenfalls nicht nur. Für die meisten Leute ist diese Art von Spaß die reine Quälerei, aber schließlich bin ich ja auch nicht wie andere Leute.
Rosen sind mein Hobby und meine Berufung. Ich hoffe, dass ich eines Tages aufwache und mich in meinem Gewächshaus eine preisgekrönte Rose anlacht, damit ich meinen Job kündigen und mich nur noch den Rosen widmen kann. Mein Hobby hat mich dazu bewegt, diesen einst gepflegten Vorstadtgarten umzupflügen und wildes, dorniges Gestrüpp zu pflanzen. Eine Eigentümergemeinschaft hätte mich schon lange rausgeschmissen.
Man muss schon verrückt sein für das, was ich mit diesen Rosen vorhabe. Ich möchte eine nie da gewesene Hulthemia-Rose züchten und auf den Markt bringen. Eine, die für ihren Duft und ihre unverwechselbare Färbung berühmt ist. Sollte es mir gelingen, diese Rose in meinem Garten zu züchten, gehe ich damit zu einer der kleineren Rosenschauen. Sollte sie einen Preis gewinnen, wäre ich vielleicht mutig genug, an einer der größeren Shows wie der »American Rose Society Convention« teilzunehmen. Sollte eine meiner Rosen die »Queen of Show« werden, wäre das in etwa so, als würde ein Mädchen, das von der Modelschule geflogen ist, Miss America werden. Es würde mir das nötige Selbstvertrauen geben, dass meine Rose die teure Patentierung wert ist, die immerhin zwei Riesen kostet, ohne Anwaltshonorar.
Mein größter Traum wäre es, eine Rose in den Testgärten der American Rose Society unterzubringen, wo auserwählte neue Rosen zwei Jahre lang unter wechselnden klimatischen Bedingungen gehalten werden, um zu sehen, wie sie sich machen. Von diesen kürt die Rose Society die eine oder andere als die Beste der Besten.
Wie stehen meine Chancen? Auf der einen Seite sind da die großen Rosengärtnereien mit ihren endlosen Ressourcen, die jedes Jahr Hunderttausende neuer Sämlingssorten hervorbringen. Nur zwei bis drei davon schaffen es auf den Markt.
Und auf der anderen Seite bin da ich, Galilee Garner, eine Hobbyzüchterin mit großem Garten und günstigstenfalls ein paar hundert neuen Sämlingen, die versucht, sich gegen professionelle Betriebe durchzusetzen. Es sieht nicht besonders gut für mich aus, oder?
Allerdings ist dabei auch noch etwas anderes im Spiel, nämlich Glück. Der Einfluss des Faktors Glück ist nicht zu unterschätzen. Es ist wie bei einer Lotterie. Manchmal gewinnt jemand alles, obwohl er nur einen Dollar eingesetzt hat, während ein anderer, der ein Jahr lang jede Woche hundert Dollar investiert hat, leer ausgeht.
Nehmen Sie zum Beispiel den Mann, der die Dolly-Parton-Teerose in seinem Keller gezüchtet hat. Er zog diverse Rosenhybride und fand einen hässlichen, kleinen orangeroten Sämling, der bei seiner ersten Blüte nur zwölf Blätter bekam, nicht die zwanzig, die man erwarten würde. Als sich seine Hand um den Sämling schloss, um ihn herauszureißen, roch er kurz daran. Der Duft war einmalig.
Er ließ die Pflanze leben. Sie bekam unglaubliche sechzig Blütenblätter, was ihr den Namen einbrachte und sie zu einer der beliebtesten Rosen aller Zeiten machte. Ich glaube, mit Dolly Parton konnte sich der Mann zur Ruhe setzen. Nur weil er Glück hatte.
Und ich beschäftige mich mit Rosen, die jede Menge Glück brauchen können. Ich züchte nicht die einfachen Rosen, wie man sie in jedem Gartencenter oder Baumarkt bekommt. Ich liebe die Hulthemia-Rosen. Sie sind kompliziert und renitent und gedeihen unter unterschiedlichsten Bedingungen. Wie jeder Rosenzüchter habe ich meine ganz eigenen Methoden, eigene Düngerrezepte, eigene Vorstellungen. Ich achte genauestens auf die Temperatur, wie ein Eisverkäufer in der Sahara, weiß aber auch, dass mein erfolgreicher Sämling selbst widrige klimatische Bedingungen überleben muss. Ich verabreiche genau die nötige Menge Wasser und Dünger, genau zur richtigen Uhrzeit. Bei Pilzbefall wie dem Echten Mehltau oder dem Sternrußtau greife ich ein, bevor sich die Krankheit auf andere Pflanzen ausbreitet. Ich setze Marienkäfer aus, damit sie die kleinen, grünen Blattläuse fressen, diese winzigen Viecher, die den Rosen schon zu Moses’ Zeiten zugesetzt haben.
Und solange den Hulthemias nichts Unvorhergesehenes zustößt, was im Schutz meines Gewächshauses eher selten vorkommt, machen sie sich wunderbar.
Kompliziert und renitent. Blüht und gedeiht nur unter ganz spezifischen Bedingungen. Das beschreibt mich eigentlich ziemlich gut. Vielleicht mag ich diese Rosen deshalb so gern.
Ein Schüler von mir hat mich mal mit diesen Worten beschrieben, »kompliziert und renitent«, auf der »Bewerte deinen Lehrer«-Seite, die Dr. O’Malley, unser Schuldirektor, eingerichtet hat. Eine dämliche Website. Nur eine weitere Möglichkeit, sich als Experte aufzuspielen, ohne die Hintergründe zu kennen. Eine Website, über die sich der Direktor vermutlich zusammen mit den Eltern amüsiert, wenn sie beim Elternabend zusammensitzen. »Diese Mrs Garner«, werden sie sagen, »wird sie es denn nie begreifen?«
Renitent. Sowohl die Wortwahl als auch die treffende Beschreibung des anonymen Schülers fand ich bemerkenswert. Hätte dieser Schüler genauso viel Zeit in meinen Biologieunterricht investiert wie in das Verfassen seiner Bewertung, hätte er vielleicht bestanden. Ich vermute, dass es sich um einen »er« handelt, denn als Postskriptum fügte er hinzu: »Dauer-PMS. Es reicht.« Weibliche Wesen sparen sich solcherart Anfeindungen.
Die meisten Leute sind von meinem Rosenhobby überrascht. Ich sehe eher aus, als hätte ich ein Geheimlabor in meinem Keller, eine Folterkammer vielleicht, aber keinen Rosengarten. Visuell gibt es keine vernünftige Erklärung für meine Besessenheit. Rosen sind weich und duften, was auf mich nicht zutrifft. Wenn wir Lehrer nebeneinander Aufstellung nehmen müssten, würde man mich da als Rosenliebhaberin erkennen? Nein. Man würde jemanden wie Dara wählen, die Kunstlehrerin mit ihrem sorgfältig verwuschelten Heiligenschein aus Botticelli-Locken. Oder Mrs Wingate, die Englischlehrerin, deren stufige Tellerröcke mich mit ihren vielen Lagen und ihren Rüschen manchmal an Rosen erinnern. Nicht mich, die unverhohlen und unerbittlich in die Welt starrt, die Augen hinter der getönten, runden Brille kaum zu sehen. Ein Gartenzwerg, aber ohne das fröhliche Lächeln.
Ich bin klein, weil meine Nieren schon in jungen Jahren nicht richtig funktionieren wollten, knapp unter eins fünfzig, selbst an meinen guten Tagen. Noch nie hat mich jemand als »hübsch« bezeichnet. Eher so was wie: »Sie sieht ganz gut aus, den Umständen entsprechend.« Mein Gesicht ist immer verquollen. Meine Haut leuchtet zwar nicht, aber wenigstens sind mir Sommersprossen erspart geblieben, weil ich fleißig Sonnencreme benutze und Hüte trage.
Bei eingehenderer Betrachtung der Rose wird man verstehen, warum ich mich zu ihr hingezogen fühle. Floristen entfernen die Stacheln, damit man sich beim Kauf nicht daran sticht, und manche Züchter haben die Stacheln ganz weggekreuzt und glattstämmige Sorten geschaffen. Ich persönlich würde meine Rosen nicht für irgendwen entstacheln wollen. Ich liebe Rosen – mit Stacheln und allem, was dazugehört. Vielleicht sollten die Leute lernen, besser aufzupassen.
Mein Haus steht in Santa Jiminez, einem kleinen Ort landeinwärts von San Luis Obispo, mitten in Kalifornien. Es ist eine gute Gegend, um Rosen zu züchten, mit eher milden Wintern und frühem, warmem Frühling. Hier finden sich die unterschiedlichsten Häuser, von kleinen Cottages über Bauernhöfe bis zu den Villen der Wohlhabenden, aus denen viele unserer Schüler stammen.
Ich wohne am Ortsrand, auf einem langen, schmalen Stück Land. Mein Haus steht ganz vorn, das Land erstreckt sich dahinter. Lang wie breit wäre es mir lieber gewesen, um mehr Abstand zu meiner Nachbarin zu haben.
Hier ist es ganz anders als dort, wo meine Schwester und ich aufgewachsen sind, in Encinitas, unten im Süden Kaliforniens. Die Grundstücke waren klein wie Briefmarken, sodass man seinen Nachbarn »Gesundheit!« wünschen konnte, wenn sie niesten. Meine Eltern wohnen noch da, auf derselben Ranch, die sie vor Urzeiten zu einem Spottpreis gekauft haben.
Dumpf klopft es an der Plexiglastür. Das Gewächshaus ist aus Plexiglas, denn richtiges Glas sprengt momentan noch mein Budget. Ich schiebe die Golddrahtbrille an meiner verschwitzten Nase hoch. »Herein!« Ich habe keine Angst vor Fremden. Ich bin schon so lange allein, dass ich mich nur um das kümmere, was ich direkt vor der Nase habe.
Es ist meine Freundin Dara. Sie tippt auf ihre quietsch-gelbe Plastikuhr. »Du bist ja noch gar nicht fertig.« Ihre Locken sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ich streiche meinen Pony aus der Stirn, aus meinen Augen. Wir haben uns im Lehrerzimmer der St. Mark’s School kennengelernt, vor fast drei Jahren, als Dara neu an der Schule war.
Ich hatte Dara gebeten, mir mit der Zeichnung der Hulthemia zu helfen, die ich züchten wollte, denn meine Skizzen sind kaum besser als Höhlenzeichnungen. Daraufhin malte sie ein so hübsches Aquarell meiner Traumblume, dass ich es mir ins Schlafzimmer gehängt habe. Danach wollte sie noch mehr Rosen sehen und kam zum Zeichnen rüber in meinen Garten. Dann fragte Dara, ob sie Fotos von DNA-Strängen für eines ihrer Konzeptkunstprojekte verwenden dürfe. Es dauerte nicht lange, bis sie mich in anspruchsvolle Kinofilme mitschleppte – und ich sie in Popcorn-Streifen. Im Lauf der Jahre ist unsere Freundschaft gewachsen. Inzwischen ist sie meine beste Freundin.
Heute, im Gewächshaus, glüht ihr Gesicht, und zwei verschwitzte Halbmonde bilden sich auf ihrer mitternachtsblauen Seidenbluse. Es ist März und für die Jahreszeit ungewöhnlich heiß, fast wie im Süden Kaliforniens, was mir aber noch gar nicht weiter aufgefallen ist, nicht mal hier drinnen in meiner Sauna von einem Gewächshaus. Hier wird es im Sommer über vierzig Grad heiß, und wir haben uns allzu sehr an Klimaanlagen gewöhnt. Das Resultat sind Menschen wie Dara: Weil sie ungefilterte Luft nicht mehr kennen, überhitzen sie und können damit nicht umgehen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, in übermäßig kontrolliertem Klima zu leben. Ich versuche, im Rahmen meiner gesundheitlichen Einschränkungen möglichst natürliche Temperaturverhältnisse herzustellen.
»Du störst mich in einem entscheidenden Moment«, sage ich zu ihr, obwohl ich eigentlich fast fertig bin. »Ich mache gerade ein neues Rosenbaby.« Dara sagt, Rosen seien ein Freud’scher Ersatz für mein mangelndes Liebesleben. Ich erkläre ihr, dass ich nichts vermissen kann, was ich nie hatte. Na ja, einmal war da dieser Junge auf dem College, der auch Biologie studierte. Ich dachte, unsere langen Lernabende und die lustigen Sticheleien hätten mehr zu bedeuten, aber er war anderer Ansicht.
»Bist du so weit?« Dara sieht tatsächlich aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, also schiebe ich ihr – ohne die Hände zu bewegen – mit dem Fuß einen Hocker hin.
Dara könnte meine Zwillingsschwester sein, wenn Zwillinge Gegenpole wären. Ich bin klein, sie ist groß, mit langen Gliedern. Ich bin dünn, mit schlaffer Haut, die mich zwanzig, dreißig Jahre älter aussehen lässt, als ich eigentlich bin, sie dagegen ist kräftig und sportlich. Meine Haare sind fast schwarz, ihre sind von diesem Goldblond, das die Leute aus der Flasche zaubern wollen. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie die Kunstlehrerin an der katholischen Privatschule ist, an der wir beide unterrichten, und ich die Biologietante, sind wir das perfekte Yin und Yang. Nur unsere Füße sind gleich, beide Größe 41. Bei ihrer Größe sehen solche Füße besser aus. Das erkennt sogar ein unkünstlerischer Mensch wie ich.
Natürlich würde sie nie auf die Idee kommen, so praktische Sneakers zu tragen wie ich, wohingegen ich umfallen würde, wenn ich auf ihren spitzen, hochhackigen Schuhen laufen müsste wie die böse Hexe aus dem Zauberer von Oz. »Bei What Not to Wear? hieß es, so was trägt man heute«, protestiert sie dann.
»Man soll es nicht tragen. So heißt doch die Show«, sage ich dann immer, um sie zu ärgern. »Außerdem ist Kabelfernsehen Mist. Es ist zu teuer, und das Leben ist zu kurz.«
Da rollt sie dann immer mit den Augen, als wäre sie meine kleine Schwester und nicht eine vier Jahre jüngere Kollegin.
»Du wirst noch zu spät kommen.« Sie stützt ihren Ellbogen auf einen Tisch und hält ihr Gesicht in den Wind vom Ventilator. »Kaum zu glauben, dass du hier drinnen nicht tot umfällst.«
»Ich könnte auch selbst fahren.« Ich lege die von den Blüten befreiten Staubblätter in ein sauberes Glas. Später werden die Staubbeutel an der Spitze ihren Pollen abgeben, den ich dann wiederum einsammle und auf die Mutterpflanze übertrage.
Nachdem ich den Blütenstaub von der Vaterrose auf die Mutterrose weitergegeben habe, lasse ich sie eine Weile in Ruhe. Mit etwas Glück reift die Mutterblüte zu einer Hagebutte heran, in der sich die Samen befinden. Ich schneide die Frucht auf und stecke sie in Torfmoos; dann stelle ich sie in den Kühlschrank, um die Winterruhe einzuleiten. Im nächsten Frühling werde ich die Samen einpflanzen, und aus dieser Kreuzung erwächst hoffentlich eine wunderschöne Rose, mit den besten Eigenschaften ihrer Eltern.
Die Mutter ist eine Hulthemia von kräftigem Purpurrot, mit einem ebenso kräftigen, blutroten Herz, das zu den Blütenblättern hin verläuft. Hulthemias sind nicht sehr bekannt. Sie sind relativ neu und besonders schwierig zu ziehen. Von der Zucht lassen die meisten Laien lieber gleich die Finger. Die Blüten sind rund wie bei einer Alten Rose, aber die Mitte öffnet sich und zeigt das gelbe Staubblatt und den unverwechselbaren dunklen Fleck im Herzen. »Fleck« ist nicht das hübscheste Wort, aber das sagen Züchter nun mal. Die Flecken sind normalerweise rot, können jedoch auch von dunklem Rosa zu Purpur oder Orange variieren. Sie sind immer dunkler als die sie umgebenden Blütenblätter.
Wenn sie anders aussehen als andere Rosen, die man so kennt, dann weil sie es sind. Sie sind keine echten Rosen. Diese Rosen sind Hybride einer Blume namens Hulthemia persicas, die für die Perser nur wucherndes Unkraut mit dornigen Ranken war. 1836 erregte eine zufällig im Garten des Palais du Luxembourg wachsende Hulthemia-Hybride die Aufmerksamkeit der Rosenzüchter. Sie wollten für ihre normalen Rosen auch so rote Herzen haben.
Es dauerte hundertneunundvierzig Jahre, bis man so weit war. Die ersten Hulthemias, einschließlich des Exemplars im Pariser Garten, waren unauffällig und unfruchtbar. Der Durchbruch gelang erst Ende der 1960er Jahre einem Engländer namens Jack Harkness, dem mit der berühmten Harkness- Rose. Sein Freund Alec Cocker war davon überzeugt, dass die Blume zu züchten sein müsste. Er beschaffte sich Hulthemia-Samen aus dem Iran und gab einige davon an Harkness weiter. 1985 schließlich gelang ihm eine Sorte, die sich fortpflanzte: Tigris. Diese frühe Hulthemia wurde mit echten Rosen gekreuzt, ein Projekt, an dem zahlreiche Züchter beteiligt waren, und schließlich kam das heraus, was wir heute kennen.
Es gibt spezifische Anforderungen, die eine Hulthemia für den einfachen Rosenfreund erfüllen muss. Die Leute wollen einen Rosenbusch, der ihren kleinen Hinterhof nicht überwuchert. Außerdem wollen sie duftende Blüten. Sie wollen einen Rosenbusch, dessen zahllose Knospen immer wieder nachwachsen. Dieses wiederholte Aufblühen wurde unseren modernen Rosen erst vor nicht allzu langer Zeit angezüchtet, übernommen von den chinesischen Rosen. Erst um 1798 begann man in Frankreich, chinesische mit europäischen Rosen zu kreuzen.
Kurz gesagt erwartet der Kunde immer das Unmögliche. Zum Supermarktpreis.
Bisher gibt es eine solche Hulthemia nicht. Der Erste, der eine derart konsumentenfreundliche Blume auf den Markt bringt, wird ein Vermögen machen. Ihren (denn ich habe vor zu gewinnen) Namen werden Rosenzüchterbarden singen und lobpreisen.
Dem Duft ist von allen Anforderungen am schwersten beizukommen. Er wurde den modernen Sorten ausgetrieben. Üblicherweise hatten es die Rosenzüchter eher auf Strapazierfähigkeit und Krankheitsresistenz abgesehen, um sicherzustellen, dass Großgärtnereien die Rosen in Massen produzieren und zu jeder Jahreszeit in die ganze Welt verschicken können.
Düfte ergeben sich eher zufällig, nicht immer in Verbindung mit einem rezessiven Gen, nicht immer berechenbar. Dass beispielsweise die Großeltern einer Rose geduftet haben, muss nicht bedeuten, dass auch das Enkelkind duftet. Darüber hinaus sind Duftrosen oft empfindlicher, und die meisten Gelegenheitszüchter wagen es nicht, sich daran zu versuchen.
Ich habe eine öfter blühende Hulthemia in Arbeit, eine Pflanze der fünften Generation, deren Vorfahren ich fünf Jahre lang gekreuzt habe. Letztes Jahr blühte sie im Frühling, Sommer und Herbst und brachte eine Blüte nach der anderen hervor, wenn ich sie beschnitt. Nächsten Monat will ich sie mit auf eine Rosenschau in San Luis Obispo nehmen.
Noch habe ich der Rose keinen offiziellen Namen gegeben. Für mich ist sie nur G42, eine orangefarbene Hulthemia mit diesem dunkelroten Herzen. Dieses Jahr hoffe ich, dass mir auch der Duft gelingt. Wenn sie die Probe besteht, wird man sie als »Gal« kennen.
Die Rose ist streng geheim und hat einen besonderen Platz in meinem Gewächshaus. Bei einem Besuch vor fünf Jahren hat mir mein Vater, der früher Bauunternehmer war, dieses Gewächshaus aus einem Bausatz zusammengebastelt. Hier habe ich Arbeitsbänke, die meiner bescheidenen Größe entsprechen, und Hocker mit Rollen. Hier dürfen keine Bienen rein, aber ein paar – wie auch einige Blattläuse – finden den Weg doch immer. Bienen sind nicht gerade meine Freunde. Wenn hier einer Rosen bestäubt, dann bin ich das. Wie ein verrückter Wissenschaftler.
Ich war schon immer so, seit ich als Teenager im Biologieunterricht Rosen züchten sollte. Als sie zum ersten Mal wiederaufblühten, war ich Feuer und Flamme. Ich verwandelte die Garage meiner Eltern in eine Zuchtstation. Obwohl keine meiner Kreationen einzigartig genug für eine Rosenschau war, konnte ich doch nicht aufhören. Dieses Hobby macht süchtig.
Während Dara nun neben mir transpiriert, reinige ich meine Pinzette mit einem sterilen Wattebausch und lege sie in ihren Plastikkasten, wo sie mit den anderen Pinzetten klappert. »Aber wenn du schon mal da bist, kannst du mich auch fahren.«
Dara grinst und knallt mit einem rosa Kaugummi. »Allein kommst du aber nicht nach Hause.«
Ich lächle meine Freundin an und boxe ihr kumpelhaft an den Arm. »Danke, Kleine.« Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wenn Dara jemals ihr eigenes Leben leben will.
»Dann mal los.« Sie spielt mit der Wasserflasche in ihrer Hand herum. Bestimmt würde sie gern etwas trinken, weiß aber, dass ich vor der Behandlung nichts trinken darf, also lässt sie es. Dafür ist Dara viel zu höflich. Obwohl sie es nicht sein müsste. Und doch ermutige ich sie nicht zu trinken, weil ich davon tatsächlich noch durstiger werde. Mein Mund ist trocken und klebrig, und ich wische mit dem Handrücken über meine aufgesprungenen Lippen.
Ich deute auf ein Notizbuch auf dem Tisch. »Brad kommt heute vorbei. Erinnere mich daran, den Gewächshausschlüssel unter die Matte zu legen.« Brad ist der Quarterback vom Footballteam, der beste Pitcher in unserem Baseballteam, der Schulsprecher und obendrein der beste Schüler in meinem Biologie-Leistungskurs. Als von der Schule geforderter Sozialdienst hilft mir Brad mit den Rosen. Selbstverständlich ist Brad mein Lieblingsschüler, an manchen Tagen das Einzige, was mich dazu bewegen kann, zur Schule zu gehen.
Brad besitzt die Fähigkeit, sich lateinische Namen zu merken, die Familie, die Gattung, die Art, die Unterart. Es fällt ihm so leicht wie anderen Jungen die Baseballstatistik. Er hat einen Blick für Details, den ich zu schätzen weiß. Unsere Gehirne arbeiten gleich, auch wenn ich ihm das niemals sagen würde. Ich habe überlegt, ob ich die Rose nach ihm benennen soll, mich jedoch dagegen entschieden. Rosen werden normalerweise nicht nach Männern benannt. Kein Mann möchte seiner Frau einen Strauß »Brad«-Rosen mitbringen.
Wegen Schülern wie Brad bin ich überhaupt Lehrerin geworden. Junge Menschen formen und das alles. Es macht Spaß, solange sie bereit sind, sich formen zu lassen. Das und die Sommerferien und das frühe Aufstehen machen das Lehrerdasein für mich perfekt. Den Rest des Tages habe ich für meine Rosen, trotz meiner anderen Probleme.
»Komm schon«, sagt Dara und reicht mir die Hand, um mir aufzuhelfen, wobei ich im Stillen glaube, dass eigentlich sie Hilfe braucht in ihrem unpraktischen, engen Rock.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Rock gegen die Kleidervorschriften der Schule verstößt.« Ich komme hoch, während sie rückwärtswankt.
Sie rollt mit den Augen und lässt noch mal ihren Kaugummi knallen. »Man nennt es ›Style‹. Solltest du auch mal probieren.«
»Die Form folgt der Funktion, Dara. Eine Kunstlehrerin sollte das wissen.« Ich schließe die Gewächshaustür und verriegle sie. Auf der anderen Seite des Zauns sehe ich meine Nachbarin, die alte Mrs Allen, die in ihrem schwarzen Seidenkimono mit dem großen, schwarzen Strohhut ihren Rasen sprengt – wie eine Statistin in einem Stummfilm. Von hier aus kann ich den roten Schlitz sehen, der ihr Mund ist. Ich hebe meine Hand, um zu winken, und sie winkt beinah zurück, dann fällt ihr ein, wer ich bin, und sie lässt ihre Hand mit finsterer Miene sinken. Die stinkende Fischbrühe, mit der ich meine Rosen bearbeitet habe, hat mir letztes Jahr einen Besuch der Polizei eingebracht. Das hab ich ihr zu verdanken. Die Nachbarskinder nennen sie alte Hexe. Wenn ich klein wäre, würde ich das wahrscheinlich auch tun. Ich frage mich, was die Kinder wohl zu mir sagen. Verrückte Rosenfrau?
Ich lächle Dara an und lasse mich auf den Beifahrersitz ihres Autos sinken.
Obwohl sie weiß, was auf sie zukommt, besteht Dara darauf, im Wartezimmer zu bleiben. Ich melde mich an, muss mich endlosen Sicherheitschecks unterziehen und kriege hunderttausend Armbänder angelegt, als würden sie ein wildes Tier markieren. Wer wollte es mir verdenken, wenn ich wegliefe? Das Krankenhaus war von jeher mein zweites Zuhause. Das kommt dabei heraus, wenn man zwei Nierentransplantationen und Jahre der Dialyse hinter sich hat.
Die Krankenschwester, die neu sein muss, weil ich sie noch nie gesehen habe, unterbricht ihr Tippen und mustert mich eingehend. »Galilee Garner?« Sie kriegt den Namen kaum über die Lippen.
»Jep.« Ich setze mich auf den Stuhl. »Sie können mich Gal nennen.«
Galilee ist der Name, den mir meine Eltern verpasst haben, nach einem Hippietrip ins Heilige Land, damals in den Siebzigern. The Sea of Galilee.
Als ich zwei wurde, war klar, dass aus mir keine Galilee werden würde. »Galilee« rollt von der Zunge wie eine Melodie und ist für süße, kleine Lockenköpfe im rosa Kleid mit Schleifchen gedacht. Nicht für mich. Also nannten sie mich kurz Gal.
Meine ältere Schwester war da besser dran. Becky. Niemand hat den Namen meiner Schwester je falsch buchstabiert oder sie gebeten, ihn noch mal zu wiederholen.
»Geht es Ihnen gut?«, fragt die Frau, betrachtet meine blassgelbe Haut, meine müden Augen, die Narben an meinen Unterarmen.
Ich nicke. Ich mache die Leute im Krankenhaus nervös, wenn sie mich nicht kennen. Sobald ich in eine Notaufnahme komme, werde ich allen anderen Patienten vorgezogen, selbst wenn jemand sein Bein in der Kühltasche dabeihat. Es liegt wohl an meiner Ausstrahlung. Todgeweiht.
Die Frau stellt mir die üblichen Fragen, wo ich geboren bin und wo versichert.
Im Miami-Vice-artigen Wartezimmer sitzt heute eine ältere Frau, deren Haare aussehen, als türmte sich hellrosa Zuckerwatte auf ihrem Kopf, und ein Mann mit einer eindrucksvollen Wampe, der alle paar Minuten rülpst. Ich frage mich, ob die rosa Haare wohl Absicht sind.
Dann sitzt da noch Mark Walters, ein älterer Mann, der sich eine Autozeitschrift direkt vors Gesicht hält, weil er seine Lesebrille vergessen hat. Alle nennen ihn Mark Twain, wegen seines vollen, weißen Schnauzbarts und dem wilden, weißen Haarschopf. Ich finde eher, er sieht aus wie Einstein. Immer trägt er weiße Kleidung, als hielte er sich für einen Engel. Heute sind es weiße Jeans, ein weites, weißes Shirt mit V-Ausschnitt, aus dem seine weiße Brustbehaarung quillt. Ich wünschte, er würde sich bedecken. Selbst von hier aus, am anderen Ende des Zimmers, kann ich sein Old-Spice-Aftershave riechen. Es kribbelt in der Nase.
Als er merkt, dass ich ihn beobachte, blickt er von seiner Zeitschrift auf und zwinkert mir zu. Die eine buschige Augenbraue verdeckt beinah sein faltiges Auge. Es ist mir nicht unangenehm. Ich starre die Menschen immer mit ernster Miene an, vor allem meine Schüler. Eine Schwester kommt und holt ihn ab. Es ist Schwester Sonya, eine große, russische Frau, die an ihrer Arbeit ungefähr so viel Freude zu haben scheint wie ein Beerdigungsunternehmer.
»Mr Walters, fit wie eine Fiedel sehen Sie aus!«, flötet sie.
Ich traue meinen Ohren nicht.
»Eine Fiedel, die am Strand im Regen gelegen hat vielleicht.« Seine Stimme klingt rau, das Atmen fällt ihm schwer. Langsam steht er auf, und sie reicht ihm den Arm.
Mark. Mark ist hier, weil er seine Blutdruckmedikamente nicht genommen hat. Er war zu sehr damit beschäftigt, Steaks zu essen und sich einen anzusaufen, als dass es ihn gekümmert hätte. Hat erst seine Leber eingebüßt und eine neue bekommen. Aber weil er dafür gesorgt hat, dass auch noch seine Nieren versagen, steht er jetzt auf der Warteliste.
Und neulich wurde er als dringlicher eingestuft als ich.
Ich bin mit Reflux zur Welt gekommen. Es bedeutet, dass die Harnröhrenklappe zwischen Niere und Blase nicht richtig schließt. Meine Mutter konnte mir die Windeln gar nicht schnell genug wechseln, weil ich so viel Urin produzierte. Ständig hatte ich Blasenentzündungen, dann Nierenentzündungen. Bis die Ärzte wussten, wo das Problem lag, war ich vier Jahre alt und eine Niere schon verkümmert. Der anderen erging es nicht viel besser, und sie versagte, als ich zwölf war. Meine Mutter war die erste Spenderin. Die Niere hielt zwölf Jahre. Die zweite kam von einem Toten, der das Kästchen auf seinem Führerschein angekreuzt hatte. Die hielt nur vier Jahre, bis mein Körper zu dem Schluss kam, dass es sich definitiv um einen Fremdkörper handelte. Seit acht Jahren gehe ich zur Dialyse.
Im Grunde reinigt die Dialyse das Blut wie eine Niere. Über eine Vene wird man an eine Maschine angeschlossen, und das ganze Blut wird hindurchgepumpt und gefiltert. Es gibt verschiedene Arten der Dialyse, aber ich gehe zu der, die alle paar Tage durchgeführt wird. Man kann nachts oder tagsüber hingehen. Ich mache die Dialyse über Nacht, weil es einfacher ist und ich schlafen kann. Wenn man eine Behandlung auslässt, fühlt man sich, als hätte man eine Grippe, und das Gehirn arbeitet nicht mehr so gut. Stellt man die Dialyse ganz ein, versagen nach und nach sämtliche Organe, und man stirbt.
Mehr als eine halbe Million Amerikaner geht zur Dialyse. Theoretisch kann man damit sehr lange überleben. Es hängt von den Begleitproblemen jedes Einzelnen ab. Im ersten Jahr der Behandlung sterben zwanzig Prozent der Dialysepatienten, die Hälfte davon während der ersten drei Monate. Diese Leute haben höchstwahrscheinlich noch mehr gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck oder Diabetes, deretwegen die Nieren überhaupt erst versagt haben. Infektionen sind ein weiteres Problem. Man hat praktisch kein Immunsystem mehr, sodass eine kleine Erkältung zur tödlichen Bedrohung werden kann.
Die Wahrscheinlichkeit zu sterben wächst mit jedem Jahr, in dem man zur Dialyse geht. Im zweiten Jahr liegt die Überlebensrate bei vierundsechzig Prozent. Im fünften Jahr bei dreiunddreißig Prozent. Im zehnten Jahr fällt sie auf nur noch zehn Prozent.
Ich nähere mich dem zehnten Jahr.
Daher ist es lebenswichtig, dass ich so bald wie möglich eine neue Niere bekomme, aber es gibt einfach nicht genug davon. Die Menschen stehen nicht gerade Schlange, um Nieren zu spenden, wie sie es beim Blutspenden tun.
Heute bin ich für einen Blutflusstest im Krankenhaus, um zu sehen, wie gut mein Blut durch eine neue Niere fließt. Die Ärzte wollen mir keine kostbare Niere geben und dann feststellen, dass sie eingeht, weil kein Blut hindurchfließt.
Ich setze mich wieder auf meinen Platz im Wartezimmer. Dieselbe Schwester kommt, um mich abzuholen.
»Sind Sie so weit, Miss Garner?« Schwester Sonya hat sich schon wieder umgewendet. Ich überlege einen Scherz, irgendwas, das sie zum Lachen bringt. Mir fällt nichts ein. Ich kenne Sonya seit fünf Jahren, aber noch nie hat sie über etwas anderes als über Blutdruck und Puls gesprochen.
Scheiß drauf, denke ich, auf sie und Mark. Die sind mir egal. Ich schlurfe ihr hinterher und bin mir schmerzlich bewusst, dass mein Gang auch nicht besser aussieht als Marks, obwohl der mindestens dreißig Jahre älter ist.
2
Es wird gerade dunkel, als Dara mich nach Hause bringt. Die Luft ist kühl – kühl für Kalifornien. Die Leute aus dem Osten würden Shorts anziehen. Ich trage eine dicke Jacke. Ich falte meine Hände auf dem Schoß. Dara und ich haben es bisher vermieden, über den Test zu sprechen. Normalerweise reden wir nicht über meinen Gesundheitszustand. Würde ich mich mit dem Mist aufhalten, wäre ich noch verrückter, als ich es ohnehin schon bin. Trotzdem sage ich: »Sollte ich das noch mal machen müssen, dann bitte nicht so bald.«
Der MRA-Test, dem ich mich gerade unterzogen habe, glich eher einer mittelalterlichen Folter als einer modernen medizinischen Untersuchung. Erst haben sie mir ein Kontrastmittel auf Proteinbasis gespritzt. Dann haben sie mich auf ein Gestell geschnallt und in die Maschine geschoben. Da stellte sich heraus, dass ich Platzangst bekomme; denn es dauerte nicht lange, bis ich den Panikknopf drückte. Man gab mir ein Beruhigungsmittel, damit ich die neunzig Minuten still liegen konnte, in denen ich der Maschine beim Surren zuhörte und hoffte, niemand hätte Metall im Raum zurückgelassen, das mir um die Ohren fliegen könnte. Ich stand es nur durch, indem ich die Augen schloss und an meine Rosen dachte. Es funktionierte. Ich hatte sogar eine Idee für eine neue Elternpaarung, die ich ausprobieren möchte, wenn ich in diesem Herbst Samen bekomme.
»Du hast es überstanden. Wie immer.« Meine Freundin sieht mich an.
Dara biegt in meine Straße ein. Ich freue mich zu sehen, dass im Gewächshaus Licht brennt und ein verbeulter, blassroter Honda Civic auf der Straße parkt. Drinnen sehe ich Brads Umrisse, und der Wasserschlauch rauscht.
»Er ist spät dran.« Dara runzelt die Stirn. »Fördert das Gießen am Abend nicht den Pilzbefall?«
»Entscheidend ist die Drainage. Solange die Erde gut entwässert, kann man auch abends gießen.« Eigentlich sollte er bis um sechs fertig gewesen sein. Es ist sieben.
Gerade sind wir auf dem Weg zum Haus, als das Licht ausgeht und die Tür zum Gewächshaus zufällt. Brad erscheint, seine Zähne schimmern im Licht der Veranda, das Handy leuchtet in seiner Hand.
»Tut mir leid. Das Training hat länger gedauert.« Er wirft seine Haare aus dem Gesicht, denn er trägt sie so, dass sie ständig geworfen werden müssen und ein Auge stets verdeckt bleibt. Für mich sieht es etwas mädchenhaft aus. Brad selbst ist fast zu hübsch für einen Jungen, mit fein geschwungener Nase und strahlend hellgrünen Augen mit so schwarzen Wimpern, dass er aussieht wie geschminkt. Aber er hat das kräftige Kinn seines Vaters und die großen Ohren, was dem Femininen entgegenwirkt.
Brad Jensen ist ein Stipendiumsschüler. An manchen Schulen würde ihn das zum Außenseiter stempeln. In unserer Schule ist er der Beliebteste von allen. Fleißig, intelligent und höflich. Alles, was man sich von einem Kind wünschen würde. Die Mütter sämtlicher Mädchen, mit denen er jemals ausgegangen ist, haben ihn praktisch adoptiert. Niemand missgönnt ihm sein Stipendium, wo doch seine Mutter im Irak ums Leben kam, als er noch klein war, und er von seinem alleinstehenden Vater, dem Hausmeister der Schule, großgezogen wurde.
»Es wäre mir lieber, wenn du zu Hause beim Lernen wärst statt hier.« Ich krame meinen Schlüssel hervor, taste nach dem Schloss. Dara sieht mir einen Moment lang zu, dann nimmt sie ihn mir aus der Hand. »Hey, ich kann das selbst.«
»Ich will hier nicht den ganzen Abend stehen und warten.« Sie schließt die Tür auf.
»Kein Problem, Mrs Garner. Ich habe gesagt, dass ich es mache, und ich habe es gemacht.« Wieder wirft Brad seine Haare. Ich weiß wirklich nicht, was die jungen Mädchen daran finden.
»Du solltest mal zum Friseur gehen. Damit du besser gucken kannst.« Ich gehe ins Haus. »Gute Nacht, Brad.«
»Nacht.« Bis ich ganz drinnen bin, hat er schon den Wagen angelassen.
»Dieser Junge. Gibt es eigentlich irgendwas, wofür er sich nicht interessiert?« Dara macht Licht. »Weißt du, worüber er mir im Leseraum erzählt hat? Über französisches Kino.« Sie schnaubt. »Als hätte er eine Ahnung davon.«
»Ich schätze, er wollte dich beeindrucken.« Dara ist die hübscheste und jüngste Lehrerin an der Schule, erst zweiunddreißig. Selbstverständlich sind alle Jungs in sie verliebt, obwohl sie immer Abstand wahrt. Ich stütze mich an der Wand im Flur ab und mache mich auf den Weg ins Schlafzimmer, vorbei an der sehr sauberen, fast unbenutzten Toilette. Bei meiner Art von Dialyse muss man nicht mehr pinkeln – das einzig Praktische daran. »Er ist ein vielseitig begabter Junge«, fahre ich fort. »Ich glaube, er wird sich sein College aussuchen können. Es tut mir nur leid, dass er bald seinen Abschluss macht.«
Sie geht mir voraus. Das Schlafzimmer ist hellgrün, mit rosafarbenen Akzenten. Ich schlafe noch im Himmelbett aus meiner Kindheit, nur den weißen Himmel habe ich durch weiße Vorhänge aus Gaze ersetzt. Ich habe mehr Geld für Matratze und Bettzeug ausgegeben als für mein ganzes Wohnzimmer. Hier verbringe ich die meiste Zeit.
Sie schlägt die Bettdecke zurück. »Bitte schön. Alles bereit.« Dara sinkt gegen den Türpfosten.
Plötzlich wird mir bewusst, wie müde sie sein muss. Fast so müde wie ich. »Danke, dass du bei mir geblieben bist, Dara.«
»Ich komme morgen mal rein, um nach dir zu sehen.« Es ist Freitagabend.
Sie hat auch so schon genug zu tun. Ich bin zeitaufwendig. »Nein, es geht schon. Ich hab noch Dosen mit Hühnersuppe. Die kann ich essen.«
»Wenn du glaubst, ich würde nicht nach dir sehen, hast du dich getäuscht.«
Ich winke ab. »Jetzt aber raus hier.«
Als sie geht, höre ich die Haustür zuschlagen.
An meinem Anrufbeantworter blinkt die rote Lampe, und auch ohne nachzusehen, weiß ich, dass es meine Mutter ist. Ich bin noch nicht bereit, mit ihr zu sprechen. Ich stehe auf und mache das helle Außenlicht an, das den Weg zum Gewächshaus beleuchtet.
Ich sollte mich hinlegen. Schließlich fließt immer noch Beruhigungsmittel durch meine Adern. Aber im Moment fühle ich mich eher entspannt als benebelt, und ich will nur noch einen kurzen Blick auf die Rosen werfen.
Das Gewächshaus ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. An der schmalen Wand gegenüber vom Eingang habe ich einen Schreibtisch mit Regalen voller Notizbücher, in denen meine Elternpflanzen und sämtliche Kreuzungen detailliert aufgelistet sind.
In der Mitte vom Gewächshaus stehen drei flache Kisten, eins zwanzig breit und eins achtzig lang, mit Blumenerde und Torf, der aussieht wie mit Perlen versetzt. Das sind die Pikierkisten mit den Sämlingen, in denen meine neuen Rosen austreiben.
Weiter hinten an den Wänden stehen Tische mit Töpfen meiner älteren Rosen, den Elternpflanzen, sorgsam in einigem Abstand voneinander, um eine versehentliche Bestäubung zu verhindern, fünfzig Zentimeter auseinander, um eine vernünftige Belüftung sicherzustellen. Jede Einzelne ist sorgfältig am Topf beschriftet und sowohl in ein Notizbuch als auch im Computer eingetragen.
Und dann ist da noch meine streng geheime Rose, die öfter blühende G42, an einem besonderen Platz auf meinem Arbeitstisch. Obwohl ich mir in diesem Jahr noch zusätzlich einen Duft erhoffe, müsste sie auch so gut genug sein, um sie auf den Markt zu bringen.
Hinter dem Gewächshaus stehen meine Blumen in Reihen. Sie sind ebenfalls kategorisiert. Dem Gewächshaus am nächsten, in einigem Abstand zu den anderen, habe ich die Töpfe mit meinen Wurzelstöcken. Hat man einen guten Sämling, nimmt man ihn und pflanzt ihn in einen Wurzelstock, um weitere, exakt identische Sämlinge zu bekommen. Dann versucht man, diese draußen einzupflanzen, um zu sehen, wie es ihnen ergeht. Nicht alle sind für draußen geeignet. Viele sterben ab. Einige kommen wieder und überraschen einen auf unerwartete Weise.
Dann habe ich noch andere Rosen, nach Klassen sortiert, mit Wegen dazwischen. Hulthemias sind mir zwar die liebsten, aber hier draußen habe ich alle möglichen Rosen: Hybride, Teerosen, Kletterrosen. Darunter befinden sich auch meine zweitliebsten: Englische Rosen, David-Austin-Rosen, dick und duftend, fast wie kleine Salatköpfe.
Der Garten ist funktional angelegt, wie auf einem Bauernhof, nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten. Viele Gelegenheitsgärtner pflanzen andere Blumen, die blühen, wenn die Rosen nicht mehr wollen. Beliebt sind Freesien mit ihrem schweren Duft oder Ranunkeln, die auf ihren dicken Stämmen wippen. Das ist nichts für mich.
Hier draußen fliegen die Bienen, wie sie wollen, hier lasse ich der Natur ihren Lauf, mehr oder weniger. Im November fressen die Vögel die Hagebutten und scheiden die Samen auf ihren Wanderungen aus. Ich wollte schon Peilsender in die Hagebutten stecken, um zu sehen, wo sie bleiben.
Jetzt schließe ich die Tür auf und sehe mich um. Die Schläuche sind weggeräumt, das Wasser ist abgestellt, die Rosenscheren hängen wieder am Bord. Ich mache das Licht aus und schließe ab, überzeuge mich davon, dass der Schlüssel nicht unter der Matte liegt.
Langsam holt mich die Müdigkeit ein. Ich gehe wieder ins Haus.
Drinnen ist es dunkel. Nur das Summen vom Kühlschrank und mein eigener Atem sind zu hören. Ich bahne mir einen Weg durch das dunkle Haus in mein Schlafzimmer, gehe vorsichtig, um nicht über irgendwelche Möbel zu fallen. Ich knipse das trübe Nachttischlämpchen an und betrachte das blinkende Licht am Anrufbeantworter. Ich hole tief Luft, rufe meine Mutter zurück und stelle den Lautsprecher an, während ich meine Schuhe und Strümpfe ausziehe und in mein Nachthemd schlüpfe, ein langes Footballtrikot, das ich von meinem Vater geerbt habe.
»Hallo, wie geht es dir?«, frage ich, als sie abnimmt. Meine Stimme klingt ungewöhnlich laut in diesem Haus, und ich verkneife mir den Drang zu flüstern.
»Gut, danke, und dir?« Darum kommen wir nicht herum, egal, wie oft am Tag ich mit ihr spreche. »Ich ruf dich gleich zurück.« Sie legt auf, genau wie ich. Mom möchte mir die Kosten für die Ferngespräche ersparen.
Das Telefon klingelt. »Wie war es denn?« Mom versucht, gelassen zu klingen, doch darin schwingt die Sorge unüberhörbar mit, wie leise Geigen.
»Dara hat mich gefahren. Es geht mir gut.« Zwei Sachen möchte Mom hören: dass ich nicht allein bin und dass es mir gut geht.
»Musst du den IVP-Test denn jetzt machen?«
»Dieser Test bringt bei mir keine Ergebnisse, Mom.«
Der MRA-Test war ein letzter, verzweifelter Versuch, meinen Blutfluss zu messen. Die besten Ergebnisse bekommt man durch ein intravenöses Pyelogramm, auch IVP-Test genannt, aber ich reagiere allergisch auf den Farbstoff im Kontrastmittel. Ich habe einen CO2-Test bekommen, bei dem sie Kohlendioxid durch den Körper pumpen: ohne Ergebnis. Und jetzt diese MRA. Wenn die MRA nicht funktioniert, wird meine Ärztin auf einem IVP-Test bestehen, ob ich nun allergisch bin oder nicht.
Ich wechsle das Thema. »Wie war die Kunstausstellung in der Bücherei?«
»Fabelhaft. Ich habe ein Aquarell verkauft. Gal, ich könnte morgen früh bei dir sein.«
»Du hast ein Aquarell verkauft?« Ich will nicht, dass sie mich besucht. »Herzlichen Glückwunsch! Das ist ja toll, Mom. Wie viel?«
»Ist doch egal. Möchtest du, dass ich komme?«
Unter anderem deswegen habe ich meine Heimatstadt verlassen. Wenn meine Mutter in der Nähe ist, lässt sie mir keine Ruhe, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, obwohl sie lieber rausgehen und ihre Landschaftsbilder malen sollte.
»Der Test war nichtinvasiv, Mutter.« Ich ersticke meinen Seufzer im Kopfkissen. Meine Eltern wollen demnächst nach Frankreich, um die Landschaft zu genießen, Weingüter in der Champagne zu besuchen und schimmligen Käse zu essen, der hier verboten wäre. Ich werde nicht zulassen, dass meine Mutter ihre Reise meinetwegen storniert, obwohl sie immer eine Reiserücktrittsversicherung abschließt »für den Fall, dass irgendwas mit Gal ist«.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht? Du klingst so anders.« Wenn sie hier wäre, würde sie mir Tee machen und mich streicheln. Einen Moment lang wünsche ich sie mir her.
»Ich habe ein Beruhigungsmittel bekommen. Morgen rede ich weniger wirr.« Ich lege meine Brille auf den Nachtschrank und reibe mir den Nasenrücken. Ich möchte das Thema wechseln. »Hast du was von Becky gehört?«
Seltsamerweise zögert sie. »Ja, hab ich.«
Mir fallen die Augen zu. Ich bin so kurz vorm Einschlafen, dass ich bereue, gefragt zu haben, aber ich ahne, dass da noch was kommt. »Was ist los? Hat sie mal wieder ihren Job verloren?« Becky ist Pharmareferentin, reist durch ihr zugewiesenes Gebiet und verkauft Ärzten Medikamente. Wie ich, hat auch sie Biologie studiert, und oberflächlich betrachtet sieht sie in ihrem schicken Kostüm aus wie eine Managerin mit glänzenden, geglätteten Haaren und sorgfältig aufgetragenem Make-up.
»Verloren nicht. Sie hat einen neuen. Jetzt ist sie noch mehr unterwegs.« Moms Stimme klingt seltsam. »Riley kommt her, um bei uns zu wohnen. Sobald wir aus Frankreich zurück sind.«
»Ach, so?« Ich gähne. Riley ist Beckys Tochter. Der Vater hat damals ziemlich schnell das Weite gesucht.
»Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist.« An Moms Ende der Leitung klappern Topfdeckel, was bedeutet, dass sie noch nervöser ist als nach einer meiner Operationen. »Wir wollen doch diesen Sommer Tante Betty besuchen, nach ihrer Knieoperation …« Ihre Stimme wird immer leiser. »Teenager können ganz schön anstrengend sein.«
»Hast du ihr das gesagt?« Mom lässt sich von Becky alles gefallen, schickt ihr Geld, wenn Becky ihr Konto überzogen hat, was bestimmt öfter vorkommt, als ich weiß. »Hast du ihr gesagt, dass sie nicht noch mehr Probleme machen soll?«
Mom ignoriert mich, also weiß ich, dass sie nichts dergleichen getan hat. »Es wird schon gehen.«
»Tut es doch immer. Selbst wenn es schlecht geht.« Ich lächle über meinen müden Scherz.
»Ha, ha.«
Meine Gedanken driften ab. Arme, kleine Riley. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, wohnte ich noch zu Hause. Wie lange ist das schon her? Inzwischen ist sie fünfzehn.
Als Riley noch ganz klein war, vielleicht zwei Jahre alt, habe ich Becky einmal in San Diego besucht. Sie war von ihrem ersten Job als Pharmareferentin suspendiert worden. Damals war Becky eine Partymaus, die kiffte und trank und wer weiß, was sonst noch alles. Wir hielten »suspendiert« für eine freundliche Formulierung für »entlassen, weil sie verkatert zur Arbeit gekommen ist«.
Ich wollte ihr etwas vorbeibringen. Ich weiß nicht mehr, was. Die Haustür war nicht abgeschlossen. Ihre Katze miaute mich an.
»Riley? Becky?« Ich ging hinein.
Becky lag besinnungslos auf dem Sofa.
Ich schüttelte meine Schwester. Sie reagierte nicht. Ich schlug ihr ins Gesicht. »Becky? Wo ist Riley?«
»Hmmmm?« Becky schaffte es, die Augen aufzuschlagen, konnte aber nicht klar sehen.
Da hörte ich ein Weinen von draußen. Riley stand mit durchhängender Windel auf der Terrasse und klammerte sich an den Nacken des alten Golden Retrievers, den Becky von ihrem Ex geerbt hatte. Ihre tannenbaumgrünen Augen waren gerötet, ihre Wangen und Arme dreckig, aber sie war unversehrt. Sie streckte mir die Ärmchen entgegen.
Ich nahm sie mit und brachte sie rüber ins Haus meiner Eltern. Erst Stunden später wachte Becky auf und merkte, dass ihre Tochter weg war.
Danach kam Riley zu ihrem Vater, und wir dachten, alles sei in Ordnung. Seine Mutter hütete Riley, wenn er bei der Arbeit war. Becky riss sich am Riemen, ließ die Partys sein und besuchte ihre Tochter regelmäßig. Wir schrieben den Vorfall ihrer Unreife zu.
Ein paar Jahre später starb Rileys Großmutter, und Rileys Vater schwängerte eine andere Frau. Eine Frau, der es nicht gefiel, dass Rileys Vater schon mal eine Familie gehabt hatte. Er heiratete sie und zog nach Boston, und Riley kam wieder zu Becky. Soweit ich weiß, wollte Rileys Vater über den monatlichen Unterhaltsscheck hinaus keinen weiteren Kontakt.
Becky war für ihren neuen Job bei einer anderen Arzneimittelfirma nach San Francisco gezogen. Wenn Becky feierte, achtete sie darauf, dass sie nüchtern oder zumindest einsatzfähig zur Arbeit erschien; denn diese Stelle behielt sie einige Jahre. Ich hatte schon vermutet, dass sie sich zwar beim Alkohol einschränkte, aber hin und wieder nichts gegen die extrastarken Schmerzmittel aus ihrem Sortiment einzuwenden hatte. Ich konnte es an ihrer Stimme hören, wenn wir mal telefonierten, was selten vorkam. Trotz ihres ordentlichen Gehalts steckte sie doch immer in finanziellen Nöten. Ihre Männer waren zahlreich und führten stets fragwürdige Berufsbezeichnungen wie »Nightclub-Promoter«.
Meine Mutter wollte nicht wahrhaben, dass irgendwas faul war. »Das würde mir Riley doch erzählen«, sagte sie immer. Mom flog rauf, um Riley zu holen, flog wieder mit ihr zurück und behielt sie im Sommer wochenlang bei sich. Ich ging davon aus, dass meine Eltern einen stabilisierenden Einfluss auf Riley hatten, wie ihn auch ihre Großmutter väterlicherseits gehabt hatte, als sie noch ganz klein gewesen war. Ich nahm an, dass Riley sich nicht daran erinnerte, je vernachlässigt worden zu sein.
»Riley will bestimmt bei ihrer Mutter bleiben«, sagte ich. Mit acht Jahren zeigte Riley meiner Schwester gegenüber eine unbändige und unverdiente Loyalität.
»Es ist alles in Ordnung, Tante Gal«, erklärte sie mir am Nachmittag ihres achten Geburtstags am Telefon.
»Guck in eure Schränke und sag mir, was drin ist«, forderte ich sie auf.
Sie reagierte sofort. »Spaghetti-Os, Pizza und viel Gemüse. Ganz viel Gemüse. Meine Mutter zwingt mich, das Zeug zu essen.«
Ich hatte sie erwischt. »Ihr bewahrt Pizza im Küchenschrank auf?«
»Ich dachte, du meinst den Kühlschrank.«
Und so war es immer. Riley beschützte und verteidigte ihre Mutter, und Becky nötigte meiner Mutter alle Hilfe ab, die sie kriegen konnte, ohne sich einzugestehen, dass sie ihre Tochter schon vor langer Zeit hätte weggeben sollen.
Das alles fällt mir ein, während ich an die Zimmerdecke starre und mir anhöre, wie meine Mutter Ausreden für meine Schwester erfindet. Schließlich sage ich: »Was Riley braucht, ist eine vernünftige Ausbildung und ein stabiles Zuhause. Ihre Mutter hat sie total verkorkst.« Ich denke an meine Kollegen mit Kindern. Das erste Kind ist vom Schulgeld befreit. Schon immer hat es mir in meiner sparsamen Seele wehgetan, dass ich diesen Umstand nicht nutzen konnte. »Sie sollte herkommen. Kostenlos ihren Abschluss an einer Privatschule machen.«
»Du wärst ihr nicht gewachsen.«
»Du hast mich noch nicht in Aktion mit meinen Schülern gesehen.« Ich lache in mich hinein. Oh, ich schlafe schon fast. Ich sehe mich am Strand von San Diego, wie ich einen Zeh in den eiskalten Pazifik strecke. »Der Verschmutzungsgrad ist hoch«, nuschle ich. Ich träume von einem meiner Highschool-Projekte. Meerwassertests.
Ihre Stimme wird sanfter. »Ich lass dich mal lieber ausruhen.«
Ich schaffe es gerade noch, die Taste am Telefon zu drücken. Schmerzmittel sind besser als Schlaftabletten. Mondlicht fällt getupft durch die Chiffonvorhänge und wirft abstrakte Rosenmuster an die Decke. Ich schließe die Augen und stelle mir den Stammbaum meiner Rosen vor. Hulthemias. Dreidimensional stehen sie um mich herum, umtanzen mich wie die frechen Blumen bei Alice im Wunderland. Ich lächle im Halbschlaf. Vielleicht kann ich die Rosafarbene mit der Gelben paaren. Ich kreuze Hulthemias in meinem Kopf, und ihre Sprösslinge werden so schnell geboren, als liefe ein Film vor meinem inneren Auge ab. Bis ich einschlafe.
3
Am Montag nach der Behandlung laufe ich vor meiner Klasse auf und ab, und meine bequemen Turnschuhe quietschen auf dem schwarzen Linoleum. Die Übungsräume der Naturwissenschaften haben sämtlich schwarze Linoleumböden und schwarze Pulte. An Halloween schmücke ich den Raum wie ein Verlies. Hier gibt es keine Gasleitungen für Bunsenbrenner wie im Chemieraum, aber dafür steht auf den Pulten unter den Fenstern ein ganzes Sortiment von Mikroskopen. Es ist ein Raum, der die Schüler zum Träumen verleitet, im ersten Stock des Gebäudes, mit Blick auf kahle Baumwipfel und den Sportplatz, wo gerade eine Klasse Flag-Football spielt.
Hier hängen keine Heiligenbilder an den Wänden wie im Religionsraum. Die meisten katholischen Schulen sind heutzutage nicht sonderlich katholisch. Es gibt hier nicht mal Nonnen, jedenfalls so gut wie keine. Unser Priester kommt nur einmal im Monat, um die Messe zu lesen. Ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale Privatschule.
Seit acht Jahren arbeite ich hier. Kurz bevor meine Niere wieder versagte, habe ich angefangen. Ich kam von einer öffentlichen Highschool, mit gleichgültigem Kollegium und noch gleichgültigeren Schülern. Eine kleinere Privatschule bot mir eine willkommene Abwechslung.
Der Direktor, Dr. O’Malley, wirkte besorgt, als er mich beim Vorstellungsgespräch zum ersten Mal sah, und musterte mich von Kopf bis Fuß. »Wie wollen Sie die Kinder bändigen?«, hatte er gefragt.
Ich richtete mich zu meiner vollen Größe auf. »Erstens komme ich von einer öffentlichen Schule und hatte nie irgendwelche Probleme. Ich dachte, an dieser Schule würde schlechtes Betragen nicht geduldet. Zweitens ist die Zunge mächtiger als das Schwert.«
Dr. O’Malley hatte gelächelt. »Ich glaube, es heißt ›Feder‹. Aber Sie haben recht. Wir haben hier wirklich brave Kinder.«
»Ich weiß, was Sie denken.« Ich lehnte mich über seinen Schreibtisch. »Ich bin krank und werde Sie viel Geld kosten.«
Er wollte widersprechen, doch ich hob meine Hand.
»Lassen Sie mich eins sagen: Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Ein kerngesunder Mensch könnte morgen von einem Sattelschlepper überfahren werden. Aber ich garantiere Ihnen: Egal, wie viel Zeit mir noch bleibt, wenn ich diese Schule verlasse, wird sie in einem besseren Zustand sein, als ich sie vorgefunden habe.« Ich lehnte mich zurück, hatte gesagt, was ich zu sagen hatte.
Am Ende fand die Schulleitung keinen Grund, mich nicht einzustellen. Schließlich konnten sie ja schlecht sagen, dass ich ihnen zu klein war oder unqualifiziert. Seitdem bin ich hier.
Heute wird die Klasse etwas über Osmose lernen. Osmose dürfte wohl einigermaßen leicht zu verstehen sein, und außerdem macht das Experiment Spaß. Ich habe Kartoffeln mitgebracht. Wir haben sie aufgeschnitten und in Wasser eingelegt: eine ohne alles, eine gesalzen und eine gezuckert. Die Schüler sollen erklären, wieso die gesalzene Kartoffel so weich, die gezuckerte nicht ganz so weich und die ohne alles härter wurde. Die Osmose bringt das Wasser der Kartoffel dazu, dem Salz entgegenzustreben.
Ein Mädchen mit rotem Pferdeschwanz in Cheerleader-Uniform meldet sich. Die Cheerleader-Uniformen sind den normalen Schuluniformen nicht unähnlich: ein karierter Rock mit einem Sweater, auf dem St. Mark’s steht, statt weißer Bluse mit Rock. »Können wir dieselbe Schale für alle drei benutzen?«
Ich bin die Arbeitsanweisungen längst durchgegangen, aber sie hat geträumt. Ich wende mich dem Rest der Klasse zu. »Jemand eine Ahnung?«
John, ein Junge im Schulsweatshirt, lässt seine Glasbecher aneinanderklirren. »Sag mal, Sarah, wie viele Becher stehen denn vor dir?«
Der Rest der Klasse kichert. Wäre sie eine Figur aus einem Comic, würde über ihrem Kopf eine riesige Glühbirne aufleuchten. »Ah! Jetzt weiß ich’s!«
»Ich dachte, die Cheerleader an dieser Schule wären besonders schlau«, murmelt ein Junge und schüttelt seine schwarzen Locken.
»Hey, hier ist nur Platz für einen Klugscheißer.« Ich trommle mit den Fingern auf dem Tisch vor John herum.
Er grinst verschmitzt. »Sie?«
Ich nicke und lächle. »Sollte noch jemand Fragen haben, wird John euch liebend gern unter die Arme greifen. Ohne dumme Sprüche.«
Er schnaubt und zieht die Schultern ein, sagt aber nichts mehr.
Schließlich kommen die Schüler zur Ruhe und widmen sich ernsthaft dem Versuch. Die Stunde dauert fünfzig Minuten, und fast vierzig sind noch übrig.
Ich sitze an meinem Arbeitstisch am hinteren Ende der Klasse, von wo ich alle gut im Blick habe, ohne dass sie mich sehen können. Obwohl ich mich am Wochenende ausgeruht habe, bin ich doch ganz schön erledigt und hoffe, nichts auszubrüten. Ganz vorn hustet jemand, und ich lausche aufmerksam. Klingt für mich wie trockener, allergischer Husten. Nach fast zwölf Jahren als Lehrerin kann ich den Unterschied inzwischen erkennen. Als mir auffällt, dass ich wegen möglicher Bazillen die Luft anhalte, gestatte ich mir ein gewaltiges Gähnen.
Auf dem Tisch steht meine Flasche mit dem halben Liter Wasser, der Hälfte meiner täglichen Ration. Patienten, die noch Urin produzieren, dürfen mehr trinken. Es ist nicht viel, aber besser als damals, als ich mit der Dialyse anfing und mir nur eine kleine Flasche Wasser erlaubt war.
Aufgrund des Flüssigkeitsmangels sieht meine Haut aus wie die einer Eidechse. Ein schlichter Handcremespender steht auf meinem Tisch. In einer abgeschlossenen Schublade liegen die Pillen, die ich regelmäßig nehmen soll, und meine faden, dialysefreundlichen Zwischenmahlzeiten mit niedrigen Phosphor- und Kaliumwerten. Wenn man zu viel davon isst, kann man einen Herzinfarkt bekommen. Ich sollte meine eigene Diät auf den Markt bringen. Der Slogan wäre: »Schmeckt so schlimm, da purzeln die Pfunde.« Ich grinse.
Ich öffne meine Rosendatei auf dem Computer. Der Stammbaum meiner Rosen breitet sich vor mir aus. G42 müsste demnächst blühen. Ich hoffe, sie duftet. Ihre Eltern waren die öfter blühende Rose vom letzten Jahr und eine andere Öfterblühende. Deren Großeltern duften. Bei meinen Sorten scheint der Duft immer eine Generation zu überspringen, so wie die blauen Augen in manchen braunäugigen Familien. Das sagt mir meine Intuition, obwohl ich damit nicht immer richtigliege. Am Ende bin ich doch jedes Mal überrascht.
Plötzlich steht Dara neben mir, lautlos in ihren Ballettschuhen. Sie hat gerade eine Freistunde. Ich merke, wie leiser Unmut in mir aufsteigt. Sie sollte nicht meinen Unterricht stören, nur weil sie sich langweilt. Außerdem muss ich zugeben, dass ich etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen, nämlich mich im Unterricht mit meinen eigenen Rosen zu beschäftigen. Ich schalte den Bildschirm aus, damit sie nicht sieht, was ich tue. Dara ist dafür bekannt, dass sie einem gern Standpauken hält.
»Möchtest du endlich auch mal was über Osmose erfahren?« Ich drehe mich auf meinem Stuhl um. »Oder ist etwas Wichtiges passiert, von dem ich wissen sollte?«
Sie setzt sich auf den Plastikstuhl neben mir. »Ich kam gerade vorbei und hab gesehen, dass du nichts zu tun hattest.« Sie deutet auf den Computerbildschirm. »Ich plane gerade das nächste Semester und hatte eine tolle Idee.«
Es ist nicht vorgesehen, dass Lehrer einander während der Stunde besuchen. Ich weiß auch, warum. Meine Schüler interessieren sich nur noch für uns, nicht für ihren Versuch. »Lass uns heute Mittag reden, Dara. Nicht vor den Kindern.«
Darüber geht sie hinweg. »Wie wär’s, wenn wir ein gemeinsames Projekt machen würden? Biologie und Kunst.«
»Meine Schüler können nicht zeichnen. Deshalb haben sie den Biologiekurs belegt.« Ich zwinkere den neugierigen Schülern zu.
Sie blinzelt, und mir fällt auf, wie viel Wimperntusche und Eyeliner sie trägt. Er ist in die kleinen Fältchen unter ihren Augen gelaufen. »Erstens können ganz viele Biologen zeichnen. Und ganz viele Künstler kennen sich mit Biologie aus. Was glaubst du denn, wer die Anatomiebücher illustriert?«
»Ist ja gut. Es sollte ein Scherz sein.«
»Es klang aber nicht wie ein Scherz.« Sie verschränkt die Arme. »Verdammt, Gal, das ist eine gute Idee. Mach sie nicht gleich nieder.«
Mir wird klar, dass das, was ich gesagt habe, nicht nur ein Scherz war. Sollte ich das tatsächlich glauben, würde ich mir in die eigene Tasche lügen.
Ich mache den Mund auf, um mich zu entschuldigen. Die Niere. Immer ist es die Niere. Ich sollte meine Krankheit nicht mehr als Ausrede für irgendwas benutzen. Ich sollte meine Stimmungsschwankungen im Griff haben. Vielleicht ist mein Hirn vom ewigen Wassermangel ausgedorrt. Meine Augen sind trocken, und ich reibe hinter der Brille herum.
Vorletztes Wochenende habe ich Dara angepflaumt, als wir uns nicht einig werden konnten, wo wir im Kino sitzen wollten, um Black Swan zu sehen. Sie wollte in die Mitte, ich an den Gang. Ich sagte, da sie den Film ausgesucht habe, dürfe ich aussuchen, wo wir uns hinsetzten. Ich bekam meinen Willen. Wie meistens. Was allerdings nicht hieß, dass ich immer recht hatte.
Dara redet immer weiter. »Das Projekt würde sich um Konzeptkunst drehen. Dafür müssen sie nicht zeichnen können, und die Kunstschüler müssen sich nicht in Biologie auskennen. Obwohl sie es vermutlich tun.« Sie deutet auf die Kinder. »Ich sehe hier zehn Schüler, die auch in meinem Kunstkurs sind.«
Das verstärkt meinen Unmut nur noch mehr, vor allem, weil inzwischen alle ihre Arbeit unterbrochen haben und zu uns sehen, um zu erfahren, was vor sich geht. Dara ist beliebt. Die coole Lehrerin, bei der die Schüler im Unterricht essen und zum Zeichnen rausgehen dürfen. Ich bin die Böse, bei der sie denken müssen und keine Extrapunkte kriegen. »Das erklärt wohl ihren mangelnden Sinn für Wissenschaft.«
Ihr Hals wird rot und fleckig, und ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin. Das war daneben, Gal. Sie steht auf.
Ich fühle mich schrecklich. »Dara.«
»Vergiss es.« Das Futter ihres Wollrocks raschelt, als sie geht.
Die ganze Klasse beobachtet uns, flüstert, lacht. Einige sind erschrocken über das, was ich gesagt habe. Starren mich an. Kinder sind Wölfe. Beim ersten Anzeichen von Schwäche schlagen sie zu.





























