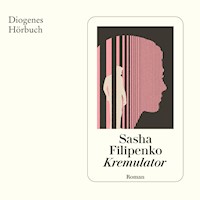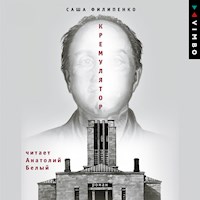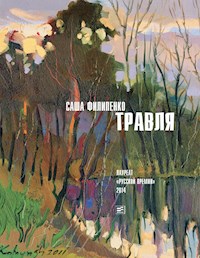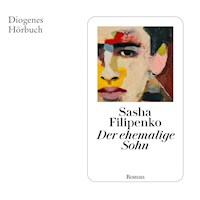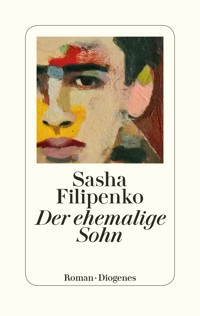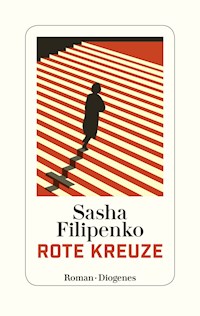
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander ist ein junger Mann, dessen Leben brutal entzweigerissen wurde. Tatjana Alexejewna ist über neunzig und immer vergesslicher. Die alte Dame erzählt ihrem neuen Nachbarn ihre Lebensgeschichte, die das ganze russische 20. Jahrhundert mit all seinen Schrecken umspannt. Nach und nach erkennen die beiden ineinander das eigene gebrochene Herz wieder und schließen eine unerwartete Freundschaft, einen Pakt gegen das Vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sasha Filipenko
Rote Kreuze
Roman
Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer
Diogenes
Besten Dank an
Konstantin Boguslawski
für seine Hilfe bei meiner
Arbeit an diesem Buch
Als die Unterschrift gesetzt ist, sagt die Frau (die so sonderbar ist wie alle Immobilienmakler):
»Gratulation! Ich freue mich sehr für Sie. Schauen Sie doch nicht so finster, Sie haben von mir das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis gekriegt!«
Die Maklerin zieht einen Lippenstift aus ihrer Handtasche und spricht mit ihrer tiefen Stimme weiter, ohne auf die nunmehr ehemalige Besitzerin zu achten:
»Für uns beide ist das eine echte Win-win-Situation! Mit wem werden Sie eigentlich hier wohnen?«
»Mit meiner Tochter«, antworte ich und blicke hinaus auf den Kindergarten im Hof.
»Wie alt?«
»Drei Monate.«
»Wie süß! Eine junge Familie! Glauben Sie mir, Sie werden mir noch dankbar sein.«
»Wofür?«
»Was heißt, wofür? Ich hab’s Ihnen doch erzählt! Sind Sie aber vergesslich. Auf Ihrem Stockwerk gibt es nur eine einzige Nachbarin. Und die ist neunzig Jahre alt, alleinstehend und leidet an Alzheimer. Das ist doch der absolute Jackpot! Freunden Sie sich mit ihr an, dann gehört die Wohnung Ihnen.«
»Danke!«, sage ich, ohne sie anzusehen.
Die Wohnung ist leer. Kein Stuhl, kein Bett, kein Tisch. Ich packe meine Tasche aus. Die ehemalige Besitzerin kann sich nicht losreißen. Sie steht am Fenster, hängt Erinnerungen nach und glättet, als würde sie Wäsche bügeln, die Fältchen im Lack des Fensterbretts. Sinnlos, ich mache hier sowieso alles neu.
»Bleiben Sie heute allein hier?«
»Ja.«
»Und wo werden Sie schlafen?«
»Ich habe einen Schlafsack und einen Wasserkocher …«
»Wenn Sie möchten, kommen Sie mit zu mir.«
»Nein.«
Die Maklerin kapituliert. Ich bin zu jung für sie. Sie hakt die frühere Besitzerin unter und verlässt mit ihr die Wohnung. Ich bleibe allein zurück und setze mich auf den Boden.
Das war’s, denke ich, Vorhang. Ein Leben ist zu Ende – und ein anderes Leben beginnt. Eine transzendente Null. Mit meinen dreißig Jahren bin ich nun ein Mensch mit entzweigerissenem Schicksal. Ich darf es noch einmal versuchen. Was ist dagegen schon einzuwenden. Selbstmord ist nicht mein Ding; außerdem habe ich jetzt eine Tochter.
Ich weiß kaum noch, woran ich an jenem Abend gedacht habe. Nebel im Kopf, und Staub, der in einem Lichtstrahl tanzt. Mehr ist hier nicht. Eine Stunde Pause, Atemholen vor dem nächsten Versuch zu leben. Die erste Geschichte vorbei, die zweite in den Startlöchern. Ein Abgrund, und eine Hängebrücke in Form eines Menschen. Wenn du ans andere Ufer willst, wirf dich selbst hinüber. Das Glück hat immer eine Vergangenheit, sagt meine Mutter gern, und jeder Kummer hat eine Zukunft.
Wie ein schiffbrüchiger Seefahrer beschließe ich, die unbekannte Insel, auf der ich gestrandet bin, zu erkunden. Minsk. Warum bin ich überhaupt hierhergezogen? In ein Bruderland zwar, aber doch ist alles fremd. Die Rote Kirche und der breite Boulevard, das Denkmal für einen kahlen Dichter und dieser Sarkophag, der Palast der Republik. Lauter Gebäude und keine einzige Erinnerung. Fremde Fenster, unbekannte Gesichter. Was ist das überhaupt für ein Land? Was weiß ich über die Stadt? Nichts. Meine Mutter hat hier nochmals geheiratet.
Vor dem Hauseingang liegt ein schlampiger Stapel aussortierter Bücher. Ich sehe mir eines an. Jakub Kolas. Neues Land.
Wieder im dritten Stock angelangt, bemerke ich an meiner Wohnungstür ein rotes Kreuz. Nicht groß, aber knallrot. Wahrscheinlich ein Scherz der Maklerin, denke ich. Ich lasse meine Einkaufstaschen beim Lift stehen und beginne, das Kreuz abzurubbeln, da sagt hinter mir eine Stimme:
»Was machen Sie da?«
»Ich mache die Tür sauber«, sage ich, ohne mich umzudrehen.
»Warum?«
»Irgendein Vollidiot hat hier ein Kreuz aufgemalt.«
»Schön, Sie kennenzulernen! Der Vollidiot bin ich. Bei mir ist kürzlich Alzheimer diagnostiziert worden. Bisher leidet nur mein Kurzzeitgedächtnis – manchmal weiß ich nicht mehr, was vor ein paar Minuten passiert ist, aber der Doktor sagt, sehr bald wird auch das Sprechen beeinträchtigt sein. Ich beginne, Wörter zu vergessen, und irgendwann kann ich dann nicht mehr gehen. Schöne Aussichten, nicht wahr? Die Kreuze habe ich hier aufgemalt, damit ich nach Hause finde. Obwohl, wie’s aussieht, werde ich bald auch nicht mehr wissen, was sie bedeuten.«
»Das tut mir leid.« Ich bemühe mich, höflich zu sein.
»Schon gut. In meinem Fall hätte es nicht anders enden können!«
»Wieso?«
»Weil Gott Angst hat vor mir. Zu viele unbequeme Fragen kommen da auf ihn zu.«
Die Nachbarin stützt sich auf ihren Gehstock und atmet schwer. Ich schweige. Das Letzte, worauf ich jetzt Lust habe, ist über Gott zu reden. Ich wünsche der Alten eine geruhsame Nacht, schnappe meine Einkaufstaschen und will in meine Wohnung hinein.
»Wollen Sie sich denn nicht mal vorstellen?«
»Alexander, ich heiße Alexander.«
»Kehren Sie Damen eigentlich immer den Rücken zu, wenn Sie mit ihnen reden?«
»Verzeihung. Ich heiße Sascha, und das hier ist mein Gesicht. Auf Wiedersehen!«, antworte ich mit einem aufgesetzten Lächeln.
»Wie ich heiße, interessiert Sie also nicht?«
Nein. Interessiert mich nicht. Mann, was für eine aufdringliche Hexe! Was will die überhaupt von mir? Ich muss nach Hause. Die Augen schließen und endlich aufwachen. Die letzten dreißig Jahre hat dieser Trick gut funktioniert. Alles Schlimme, die furchtbarsten Dinge sind mir immer nur im Traum passiert und nie in Wirklichkeit. Ich war glücklich und kannte keinen Kummer, froh war ich und kannte kein Leid. Die letzten Monate sind einfach zu schwer gewesen. Verdammt, ich will einfach nur meine Ruhe!
»Ich heiße Tatjana … Tatjana … Tatjana … och, jetzt fällt mir der Vatersname nicht mehr ein … Kleiner Scherz! Ich bin Tatjana Alexejewna. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, junger Mann mit schlechten Manieren!«
»Mich nicht.«
»Ach nein?«
»Na ja – es ist mir einfach egal. Tut mir leid, ich habe einen schweren Tag hinter …«
»Das verstehe ich! Alle haben schwere Tage. Schwere Monate, schwere Leben …«
»War sehr nett, Sie kennenzulernen, Tatjana Alexejewna. Alles, alles Gute Ihnen! Glück, Erfolg und Wohlergehen«, sage ich sarkastisch.
»Wissen Sie, bei mir hat das alles erst begonnen …«
Ach komm, das nervt jetzt aber wirklich! Zuerst die Maklerin, jetzt diese Alte. Mir ist nicht nach reden, und die Nachbarin merkt das, eindeutig. Mehr noch, sie spürt, dass ich jede noch so kurze Pause zur Flucht nutzen würde, und redet, ohne Luft zu holen.
»Ja, das wird alles recht schnell zu Ende gehen … In einem Monat oder zwei … Sehr bald wird von mir, von meinem Schicksal, nichts übrig sein. Denn Gott verwischt seine Spuren.«
»Tut mir sehr leid …«, sage ich unwillig.
»Ja, das haben Sie schon gesagt. Ich vergesse schnell, aber nicht so schnell! Zeigen Sie mir, wie Sie sich hier eingerichtet haben?«
»Ehrlich gesagt, habe ich noch keine Möbel außer Klo und Kühlschrank – da gibt’s nichts zu sehen. Vielleicht in einer Woche oder zwei?«
»Möchten Sie sehen, wie ich wohne?«
»Na ja, es ist schon etwas spät …«
»Ach, nur keine Scheu, Sascha, kommen Sie herein!«
Begeistert bin ich nicht gerade, aber ich füge mich ihrem Wunsch. Schließlich hat es wenig Sinn, mit einer Verrückten zu diskutieren. Die Nachbarin stößt die Tür auf, und ich stehe in ihrer Wohnung.
Es sieht aus wie in einem Atelier. Überall Leinwände. Nichts Besonderes. Diese Art von Malerei hab ich noch nie gemocht. Konturlose, blasse Töne. In jedem Viereck Ausweglosigkeit. Gesichtslose Menschen, farblose Städte. Allerdings verstehe ich wenig von Kunst.
Mitten im Wohnzimmer hängt ein dunkelgraues Quadrat. »Fangen Sie ein neues Bild an?«, frage ich, um das Schweigen zu durchbrechen.
»Was meinen Sie?«
»Diese Leinwand hier.«
»Nein, die ist fertig.«
»Ach ja? Und was stellt das dar?«
»Mein Leben.«
Pffff. Da haben wir’s. Trauerfanfaren und Tragödienpathos. Alte Leute neigen dazu, ihr eigenes Unglück überzubewerten. Mein Leben … Reicht mir ein Taschentuch, nein, gleich zwei! Die Alten glauben immer, nur sie haben es schwer gehabt. Fast rutscht mir heraus, dass ich in puncto Unglück so manchem etwas voraushabe, aber ich beherrsche mich gerade noch rechtzeitig.
»Man hat mir natürlich erzählt, dass Minsk eine graue Stadt ist, aber doch nicht so grau!«
»In diesem Bild kommt Minsk fast nicht vor.«
»Ich würde sagen, in diesem Bild kommt überhaupt fast nichts vor.«
»Denken Sie, es stimmt nicht, wenn ich sage, das ist mein Leben?«
»Gar nichts denke ich …«
»Sie denken, da gehe ich nach Hause, tue niemandem etwas zuleide und dann das: Auf einmal steht da diese wahnsinnige Alte und will mir ihr Schicksal klagen?«
»Wollen Sie das denn?«
»Interessiert Sie das denn gar nicht?«
»Wenn ich ganz ehrlich bin, nein.«
»Schade. Ich würde Ihnen gern eine unglaubliche Geschichte erzählen. Eigentlich keine Geschichte, sondern eine Biographie der Angst. Ich möchte Ihnen erzählen, wie das Grauen einen Menschen unvermittelt packt und sein ganzes Leben verändert.«
»Sehr beeindruckend, aber vielleicht ein andermal?«
»Sie glauben mir nicht? Na gut … Wissen Sie, vor gut einem Jahr stand ich genau hier, wo Sie jetzt stehen. Am 31. Dezember. Es schneite, und das 20. Jahrhundert ging zu Ende. Ganz normal, ohne besondere Vorkommnisse, es blieben nur noch wenige Stunden. Dann würde die Kreml-Uhr zwölf schlagen und der mit Tabletten vollgepumpte Präsident des Nachbarstaates verkünden, er sei amtsmüde. In der Küche lief der Fernseher, und im Backofen brannte wie immer etwas an. Ich hatte nichts Besonderes geplant – es war halt wieder mal Silvester, wie viele davon habe ich schon erlebt? Jadwiga würde anrufen, sonst habe ich ja niemanden. Ich würde ein bisschen Kuchen essen und im Ogonjok blättern. Würde zuerst das neue Jahr in Moskau begrüßen, dann das nach Minsker Zeit. Mit einem Wort, ich erwartete rein gar nichts vom Ende des Jahrhunderts, da klingelte es plötzlich an der Tür. Wahrscheinlich die Nachbarin, dachte ich. Vor Ihnen hat hier eine sehr sympathische, freundliche Frau gewohnt – eine richtige Kommunistentochter. Ihr Vater war Handlanger in der Partei, aber sie war in Ordnung – genügsam und anständig. Hat mich immer mit einem Dackelblick angesehen, als würde sie um Verzeihung bitten. Jedenfalls dachte ich, wahrscheinlich braucht sie Salz oder so, aber da täuschte ich mich! Es war der Postbote. Stellen Sie sich vor. Ein echter Postbote! Am 31. Dezember! Und er brachte mir den Brief, auf den ich die ganze zweite Hälfte meines Lebens gewartet habe …«
Die Nachbarin sagt »zweite Hälfte meines Lebens«, und ich spitze die Ohren. Zum ersten Mal an diesem Abend bin ich wirklich hier in diesem Zimmer. Bislang war ich nur zum Schein anwesend, jetzt höre ich aufmerksam zu.
»Da lag er nun, auf dem Tisch. Lag einfach da. Ein ganz normales Kuvert. Da hatte ich ein halbes Jahrhundert gewartet, und nun konnte ich mich nicht entschließen, ihn zu öffnen. Nichts hatte ich im Leben so gefürchtet wie dieses Stück Papier. Irgendwann fasste ich mir ein Herz und riss den Brief auf. Er war es! Ich begann zu weinen. Wischte mir die Augen und schniefte. Ich ließ den Brief liegen und rief zuerst Jadwiga an.
›Der Brief ist gekommen! Er lebt!‹
›Machst du Witze?‹
›Nein!‹
›Wo denn, weit weg?‹
›So zweihundert Kilometer von Perm.‹
›Ich fahre mit!‹
›Schön!‹
Ich hab bei der Auskunft angerufen. Das Fräulein war bester Laune, hat mir ein gutes neues Jahr gewünscht.
›Der nächste Flug nach Moskau geht heute um zehn Uhr abends. Schaffen Sie das?‹
›Ja, außer ich werde auf dem Weg dahin überfahren.‹
Jadwiga kam zu mir, wir haben Tee getrunken und ein Taxi gerufen. Die Dame am Telefon sagte, wir hätten Glück, noch eins zu kriegen – es sei Silvester und keiner da. ›Zeig mal her!‹, bat meine Freundin, und ich reichte ihr den Brief.
Wir schlossen die Wohnung ab und gingen hinaus in den Hof. Der Taxifahrer stand bei seinem Wagen. Er machte uns den Kofferraum auf, half aber nicht mit den Taschen.
›Ich bin Chauffeur‹, sagte er, ›kein Lastenträger.‹
Wir fuhren zum Flughafen, gingen zum Schalter. Wir schnauften, waren ganz außer Atem.
›Keine Sorge‹, sagte das Fräulein, ›Sie haben noch genügend Zeit! Jetzt fliegen Sie nach Moskau, dort haben Sie dann ein paar Stunden Aufenthalt.‹
›Wann bist du das letzte Mal geflogen?‹, hab ich Jadwiga gefragt.
›Noch nie‹, war ihre Antwort.
Sehen Sie das Bild vor sich? Silvester, und zwei alte Schachteln fliegen ins Unbekannte …
Bis Moskau war es ein ruhiger Flug, danach hat das Flugzeug gewackelt, als würde Gott damit Fußball spielen. Die Landung ist nicht beim ersten Mal gelungen, wir mussten noch eine Runde drehen. Die Leute haben sich seltsam benommen, das weiß ich noch, sie schrien sogar. Ein Mann vor uns hat gewinselt wie ein Hund. Aber ich mache ihm keinen Vorwurf. Angst ist etwas Komplexes. Ich weiß, wovon ich rede.
Nach der Gepäckausgabe ist ein Dickwanst an uns herangetreten:
›Wo wollt ihr hin?‹
›Dahin‹, hab ich gesagt und ihm das Kuvert hingehalten.
›Das ist aber nicht hier. Das ist drei, vier Stunden Fahrt entfernt. Ihr habt Glück – dort wohnt mein Alter.‹
›Wenn Sie uns nur zum Bus …‹
›Was für ein Bus, am 1. Januar?‹
Am Morgen kamen wir in der kleinen Stadt an. Finsternis, und auf dem verschneiten Hauptplatz stand frierend und ohne Arme der große Führer. Ich fragte: ›Warum hat Stalin so einen kleinen Kopf?‹
›Den alten hat jemand abgehauen. Wir haben bei der Behörde einen neuen bestellt, aber mit der Größe ist was schiefgegangen. Na ja, nochmals einen neuen können wir uns nicht leisten, und es wird auch niemand einen basteln, solange dieser noch dran ist. Wo werdet ihr denn wohnen?‹
›Wissen wir nicht‹, antwortete ich.
›Wenn ihr euch traut, könnt ihr bei meinem Alten übernachten. Er ist kein schlechter Kerl. Er hat hier im Lager gesessen. Danach hat er nicht gewusst, wohin mit sich, ist geblieben und wurde Aufseher. So bin ich dort geboren, hinterm Stacheldraht. Die Mutter haben wir vor drei Jahren beerdigt. Ich bin schon lang von hier weggezogen, in die Stadt. Und wen besucht ihr hier?‹
›Einen Menschen‹, sagte ich.«
Die Nachbarin verstummt. Ein paar Sekunden schweigt sie, ich fürchte schon, Zeuge eines weiteren Gedächtnisschwunds zu sein, doch da regt sie sich und sagt:
»Ich bin 1910 in London geboren …«
Alexej Alexejewitsch Bely war ein herzensguter Mensch und ein gläubiger Christ. Er lernte Tatjana Alexejewnas Mutter 1909 in Paris kennen, bei den Ballets russes. Ljubow Nikolajewna Krassnowa war Ballerina, und sie starb bei der Entbindung. Tatjana wurde von zwei Frauen erzogen: einer Französin, die sie das Wort Gottes lehrte, und einer Engländerin, die für ihre gute Haltung sorgte.
Der Tod seiner Frau veränderte Alexej Bely durch und durch. Der einst lebenslustige und arglose Mensch brach von heute auf morgen mit der Kirche und widmete den Rest seines Lebens dem Kampf gegen die Unwissenheit. Zumindest bildete er sich das ein …
Meiner Nachbarin zufolge war Bely ein Neurotiker. Jede Kleinigkeit warf ihn aus der Bahn. Wenn ihm morgens ein Unbekannter einen guten Tag wünschte, lächelte er übers ganze Gesicht und schwärmte stundenlang von dem Zivilisationsniveau, das die britische Gesellschaft erreicht habe. Wenn ihn aber jemand angepöbelt hatte, saß er am Kamin und beklagte die Unvollkommenheit dieser Welt. Während des Hausunterrichts kam Alexej Alexejewitsch oft ins Kinderzimmer, machte es sich in einem Sessel bequem und unterbrach die Gouvernanten: »Gott gibt es schlichtweg nicht! Unsere liebe alte Mademoiselle hat zu lange im vorsintflutlichen Russland gelebt, das als einzige Leistung für sich beanspruchen kann, die Zahl der Finger beim Bekreuzigen von zwei auf drei erhöht zu haben. Es gibt keinen Gott, mein Kind, und eine Seele auch nicht! Die Menschen sind eine Spezies, eine Spezies wie, sagen wir, Pferde oder Hunde. Es heißt zwar oft, dass wir vollkommener sind … Na gut, in gewissem Sinne sind wir das auch – wir haben gelernt, Brücken zu bauen, Dampfer und Omnibusse, aber das war es dann schon mit unseren Erfolgen. Die Seele, von der unser liebes Kindermädchen hier spricht, ist nichts anderes als eine Finte unseres Gehirns, eine geschickt gestellte Falle, nicht mehr als das. Es gibt kein Himmelreich und kein Leben nach dem Tod, denn es gibt nichts außerhalb unserer Gedanken. Der Kopf ist nicht unsere Waffe, sondern unser Hauptproblem. Wenn wir glauben, dass wir irgendetwas begreifen können, täuschen wir uns fatal. Frei nach Descartes würde ich sagen: ›Ich irre, also bin ich.‹ Deine Mama ist gestorben an dem Tag, an dem du geboren wurdest, und sie wird nie wieder irgendwo sein. Es gibt keine Auferstehung und auch sonst keinen derartigen Schwachsinn. Es gibt nur Aberglauben und Lüge. Wir müssen uns als Vertreter einer Spezies betrachten, die es früher nicht gab und irgendwann nicht mehr geben wird. Jede Sekunde, in einem fort, betrügt uns unser Gehirn. Indem es uns hoffen lässt, macht sich das Gehirn unablässig über uns lustig. Eigentlich zeichnet genau das uns Menschen aus, meine Liebe – der Selbstbetrug.«
1919 beschloss Alexej Alexejewitsch Bely, nach Russland zu ziehen. Er kam ins Zimmer und verkündete freudig: »Wir gehen weg! Hier in London leben die Alten. Der neue Mensch – ich gehöre schon nicht mehr dazu, aber du, meine Liebe, zweifellos – lebt in Russland.«
Nach dieser recht seltsamen Aussage nahm Alexej Alexejewitsch einen Schluck Whiskey und ging hinaus. Der Umzug war beschlossene Sache.
Für einen Trinker war Bely ausnehmend tatkräftig. Pläne setzte er um, Aufgaben erledigte er. Bei der Übersiedelung nach Russland nahm er das Wort ›Rückkehr‹ bewusst nie in den Mund. Tatjana Alexejewnas Vater bestand darauf, dass sie in ein absolut neues, in der gesamten Menschheitsgeschichte einzigartiges Land fuhren. Nun ja, in gewisser Weise sollte er recht behalten.
»Das war wohl die erste Rebellion, die ich je erlebt habe. Unsere lieben Kindermädchen haben sich strikt geweigert mitzufahren.
›Dumme Hühner!‹, hat Vater schmunzelnd gesagt. ›Versteht ihr denn nicht, dass das jetzt euer Land ist? Wie könnt ihr übersehen, dass das in Russland kein banaler Regierungswechsel war, sondern eine Revolution des Geistes! Petersburg und Moskau sind jetzt Städte des kleinen Mannes! Ab jetzt ist alles dort auf die Verbesserung des Lebens von euresgleichen ausgerichtet – von gewöhnlichen Menschen!‹
Der gewöhnliche Mensch … Papa hat oft gesagt: der gewöhnliche Mensch. Ein sperriges Wortgefüge, nicht? Der gewöhnliche Mensch … Wer ist das? Ein Parasit, der Gemeinheiten begeht, oder ein namenloser Held, der Gutes vollbringt? Der gewöhnliche Mensch … Wie vielen von ihnen bin ich begegnet? Hunderte Varianten hat mir mein Schicksal vorgeführt, aber eine Antwort habe ich nicht bekommen. Manchmal schien mir, ein gewöhnlicher Mensch ist ein schlechter Mensch, weil ich zeitweise nur von solchen umgeben war. Ihre Verhaltensnorm war die Niedertracht, doch kaum hab ich mich in diesem Irrglauben eingerichtet, sind auf einmal vollkommen andere Menschen aufgetaucht, besondere Menschen, anständige. Wahrscheinlich wäre die richtigste Antwort, dass jeder Mensch ein gewöhnlicher Mensch ist, aber mit der Zeit hab ich auch dies verworfen, weil ich einige absolut außergewöhnliche Menschen kennenlernen durfte … Aber im Grunde … Im Grunde ist das alles Wortklauberei! Nicht böse sein, Sascha, ich bin abgeschweift. Also, wo war ich gerade? Ah ja, ich hab Ihnen von den Kindermädchen erzählt. Jedenfalls, vielleicht haben meine Erzieherinnen ja sogar verstanden, dass Moskau jetzt die Stadt des gewöhnlichen Menschen ist, aber hinfahren wollten sie trotzdem nicht. In ihrer Verzweiflung führten sie ihr letztes und, wie sie meinten, überzeugendstes Argument ins Treffen:
›Alexej Alexejewitsch, es ist ja nicht wegen uns oder Ihnen, aber denken Sie doch an unsere kleine Tata! Wollen Sie wirklich ihr Leben zerstören? Haben Sie denn nicht von den schrecklichen Dingen gehört, die in Russland geschehen? Möchten Sie nicht lieber allein hinfahren, und wenn alles tatsächlich so ist, wie Sie es beschreiben, kommen wir mit Tata in einem Jahr nach?‹
›Nein!‹, hat der Vater streng gesagt. ›Wir fahren los, und zwar bald!‹«
Der Umzug fand Anfang 1920 statt. Während vernünftige Leute aus dem Land flüchteten, nahmen die Belys die umgekehrte Richtung, gegen den Strom, ins Epizentrum der Geschichte. Neue und grundsätzlich andere Menschen sahen sie keine, dafür schon am ersten Tag drei Blasorchester.
»Worüber freuen sich die Leute, die da marschieren?«, fragten sich die Kindermädchen. »Sie haben kein Wasser, kein Gas, keinen Strom! Nichts haben sie, außer den Mundstücken von Vater Staat, die ihnen an den Lippen festfrieren.«
»Wartet nur ab, meine Lieben!«, erwiderte der Vater darauf fröhlich. »Mal sehen, was ihr in einem Jahr sagt!«
»Sie haben versprochen, dass wir in ein Land fahren, wo der gewöhnliche Mensch glücklich ist, aber bisher hören wir nur von Aufständen!«
»Ich hab doch gesagt, reden wir in einem Jahr weiter!«
In Moskau herrschte Hunger. Tatjana Alexejewnas Vater schien das allerdings keineswegs zu beunruhigen. Irgendjemand fand sich immer, der der Familie half. Namen nannte Alexej Alexejewitsch keine, in den Gesprächen fielen nur Spitznamen. Das kleine Mädchen merkte sich zwei: Starik und Lukitsch. Was ihr Vater genau machte, verstand sie nicht, seine häufigen Geschäftsreisen nach Europa betrafen allem Anschein nach immer wichtigere Staatsangelegenheiten.
Abends, wenn die Kleine im Bett war, flüsterten die Kindermädchen im Nachbarzimmer.
»Mein Gott, sieht denn Alexej Alexejewitsch das alles nicht? Wieso versteht er nicht, dass man die Menschen nicht erziehen und nicht retten kann? Er redet ständig von einem neuen Menschen, aber sieht er denn nicht, dass dieser Mensch aus toter Erde geboren wird! Diese Roten werden natürlich nicht an der Macht bleiben! Hier wird es bestimmt noch jahrzehntelang drunter und drüber gehen!«
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht …«, sagte die Französin. »Mir erscheint das gar nicht mehr so dumm. Alexej Alexejewitsch hat wohl wirklich mehr Weitblick als wir. Die Zarenfamilie ist tot, das Land wird nie wieder wie vorher sein. Ich glaube nicht, dass die Roten verschwinden werden. Kaum zu glauben, dass vor ein paar Jahren erst Koltschak uns in London besucht hat, und jetzt murksen sie ihn ab wie einen Hund …«
»Noch schwerer zu glauben, dass Alexej Alexejewitsch für diese Leute ist … Dass das bloß kein böses Ende nimmt …«
Anders als den Kindermädchen gefiel es Tatjana in Moskau sofort. Wie Alice tauchte sie in ein Wunderland ein.
»Die Provinz der Menschheit …«, ätzte die Französin.
»Die suburbs des gesunden Menschenverstands …«
»Ein Staat, der noch nicht mal konfirmiert ist …«
Während die Gouvernanten einander mit Spott überboten, erforschte das Mädchen neugierig Moskau. Volksküchen, Mineralwasser aus Bordschomi, Imbisse und Limonaden. Die frischgeschlüpften neuen Menschen. Laut krakeelende Genossen schlugen ihre Trommeln und schwenkten rote Fahnen. Die Kindermädchen hielten sich die Ohren zu, doch Tatjana blieb stehen und versuchte, die weißen Buchstaben zu entziffern: »Stolz auf die neue Maschine«. Toll! Tatjana schaute diesen Burschen zu und wünschte sich sehnlich, auch so eine riesige rote Fahne zu tragen. Wie hätte es einem Kind im Land des zunehmenden Infantilismus auch nicht gefallen sollen?
Jeden Tag gingen sie zum Zeitungskiosk. Während die sowjetischen Männer für die Prawda Schlange standen, kauften die Gouvernanten Literaturzeitschriften wie Znamja, Moskwa und Sewernoje sijanije. Nach diesem täglichen Ritual gingen sie mit einem ganzen Stapel Papier spazieren. Das war alles so faszinierend! Immer wieder blieb Tatjana stehen, um irgendwo ein neues Wort zu lesen.
»Was ist ein Pro-let-kult?«
»Nichts Wichtiges«, grummelten die alten Damen einmütig.
»Ich bin in die Schule Nr. 4 gekommen. Eine Versuchsschule mit ästhetischer Erziehung, eine Ganztagesschule. Wir wurden von morgens bis abends beschäftigt. Allgemeinbildung bis zum Mittag, Zeichnen, Rhythmik und Modellieren nachmittags. Der Vater war zufrieden, die Kindermädchen anscheinend auch. Einmal hat am Abend ein Freund meines Vaters gefragt, in welche Schule ich gehe, und ich hab stolz gesagt, in eine Schule für Kinder begabter Eltern. Ein sehr treffender Versprecher. Im Grunde war es auch so. In diese Schule haben sie nicht jeden aufgenommen. Hier wurden die Sprösslinge der Elite unterrichtet. Bei den bloßen Namen unserer Eltern fielen die meisten Bürger des neuen Staates fast in Ohnmacht, aber was ging das uns an? Kinder sind Kinder …«
Während Tatjana Quadrate formte, hatte ihr Vater Alexej Alexejewitsch Bely ständig in Europa zu tun. 1924 musste er wieder umziehen, diesmal in die Schweiz. Bely pendelte zwischen Genf und Berlin, und Tatjana blieb, trotz all ihrer neuen Hauslehrer, sich selbst überlassen. Bern, Lausanne, Zürich. Burgen, Berge, Städte. Zusammen mit ihren Erziehern reiste sie durch die Schweiz und kam gar nicht auf die Idee, dass sie einmal nach Moskau zurückkehren sollte.
Den Frühling 1929 verbrachte Tatjana allein. Papa hatte vor allem in Zürich zu tun, und sie konnte sich vom Tessin nicht losreißen – Bellinzona, Locarno, Chiasso. Sie hatte Papier mit und Kreiden und zeichnete fast jeden Tag ein anderes Städtchen. Einmal – sie meint sich zu erinnern, dass es ein Sonntag war – fuhr Tatjana nach Porlezza, ein kleines Dorf in Italien, gleich hinter der Grenze. Ein Dutzend Steinhäuser, anderthalb Kirchen. Alles da: Wein, Platanen, Glockenläuten. Sie saß am Seeufer und zeichnete, als ein hübscher Bursche an sie herantrat. Groß, gebräunt und schwarzhaarig. Er schlug ihr einen Spaziergang vor, und Tatjana Alexejewna dachte: Warum auch nicht? Sie scherzten, er erzählte ihr die Geschichte des Dorfes, sie sprachen vom neuen Menschen. Nichts Spektakuläres – eine belanglose, aber nette Unterhaltung. Sie erzählte ihm von Russland, und er sagte, er sei noch nicht mal in Mailand gewesen. Sie verplauderten den ganzen Tag, und als Tatjana merkte, dass sie den letzten Dampfer nach Lugano verpasst hatte, nahm sie sich ein Zimmer in einer kleinen Herberge auf der winzigen Via San Michele.
Am nächsten Morgen gab es Frühstück. Kaffee und fabelhaftes Gebäck, für das man seine Seele dem Teufel verkauft hätte. Er sah ihr geradewegs auf die Nasenwurzel, und sie senkte verlegen den Blick. An diesem Tag nahmen sie aus dem Gasthaus trockenes Brot mit und fütterten damit die Schwäne, die auf die Uferwiese kamen. Sie betrachtete den See und versuchte, ihn sich für immer einzuprägen – sie hatte das Gefühl, sie würde niemals etwas Schöneres sehen. Am Abend, als am dunklen Himmel die Fledermäuse zu kreisen begannen, erschrak sie nicht einmal – hier war alles so friedlich.
Ein paar Tage verflogen. Die Verliebten streiften durch die Berge und fingen Fische, sprangen von Felsen ins Wasser und küssten sich. Tatjana wurde klar, dass dieser Italiener ihr erster Mann werden sollte, aber leider passierte an dem Abend, an dem sie es tun wollten, etwas Schreckliches – Tatjana Alexejewna Belaja nieste …
»Und im Sand, direkt vor unseren Füßen, ist etwas Schleimiges gelandet. Auf gut Deutsch, mir ist Rotz aus der Nase geflutscht, ein riesiger grüner Klumpen. Ich hab mich so geschämt! Ich wollte davonrennen, aber vor lauter Scham war ich wie versteinert. Kann man sich etwas Fürchterlicheres vorstellen? Überlegen Sie doch mal: ein verliebtes Mädchen, und schwupp – ein Riesenrotzklumpen!«
Romeo wollte ein Gentleman sein. Er trat darauf und rieb den Schleim in den Sandboden hinein, aber das machte alles nur noch schlimmer. Jetzt war der Rotz im Sand und an seiner Schuhsohle. Romeo lächelte, versuchte, sie aufzuheitern, fragte etwas in der Art, wie denn das auf Russisch hieße, doch Tatjana begann zu heulen. Nie zuvor hatte sie so erbärmlich geschluchzt. Romeo wollte sie umarmen, aber das Mädchen stieß ihn weg und rannte zum Hotel.
Ein paar Tage verbrachte Tatjana Alexejewna heulend in ihrem Zimmer. Romeo stand unter dem Balkon, doch Julia ließ die Fensterläden zu. Julia war erkältet, schämte sich zu Tode und hatte 39 Grad Fieber. Ein Arzt stattete ihr einen Hausbesuch ab, und in ihrer Verzweiflung hätte sie am liebsten alle Tabletten aus seinem edlen Lederkoffer auf einmal geschluckt. Als der Arzt weg war, klopfte der Portier. Der wildfremde, aber mitfühlende Italiener bat sie, den armen Romeo doch endlich hereinzulassen. Im Nachbarzimmer zog eine russische Familie ein. Weiße Emigranten, die stundenlang über die Rolle der ›hohen Literatur‹ debattierten. Dabei war ihnen in der Schweiz das Geld ausgegangen, weswegen sie die Aufgaben und Pflichten der russischen Literatur nun in dem kleinen italienischen Dorf durchkauten. Tatjana Alexejewna saß an die dünne Wand gelehnt da, putzte sich die laufende Nase und hörte: Die Aufgabe der russischen Schriftsteller besteht (zuallererst!) darin, die Möglichkeiten und den Reichtum ihrer großen Sprache zu demonstrieren. Vor ihrem geistigen Auge verschmierte Romeo Rotz im Sand, während die Frau hinter der Wand immer wieder betonte, dass der Schriftsteller seine Stimme – unter Wahrung der Tradition – universell und kraftvoll erheben müsse. »Es gibt keine großen Bücher mehr!«, stellte die Frau hinter der Wand fest. »Alle Romane, die von Papa ausgenommen, sind farblos