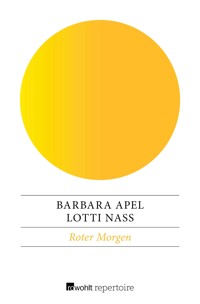
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem klirrend kalten Wintermorgen, in einem anderen Leben … Ost-Berlin, 1978. Von einem Tag auf den anderen verschwindet Annegret Sperber spurlos. Man munkelt, sie sei in den Westen geflohen. Berlin, 1990. Aus den USA zurückgekehrt, findet die Deutschamerikanerin Linda Oldham das Tagebuch ihrer eben verstorbenen Mutter. Sie fällt aus allen Wolken, als sie darin liest, dass sie eine Halbschwester hat – Annegret. Linda macht sich auf die Suche nach ihr, doch alle Spuren enden in einer maroden Klinik in einem Waldgebiet. Und es gibt jemanden, dem Lindas Nachforschungen nicht gefallen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Apel • Lotti Nass
Roter Morgen
Psychothriller
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
An einem klirrend kalten Wintermorgen, in einem anderen Leben
Ost-Berlin, 1978. Von einem Tag auf den anderen verschwindet Annegret Sperber spurlos. Man munkelt, sie sei in den Westen geflohen.
Berlin, 1990. Aus den USA zurückgekehrt, findet die Deutschamerikanerin Linda Oldham das Tagebuch ihrer eben verstorbenen Mutter. Sie fällt aus allen Wolken, als sie darin liest, dass sie eine Halbschwester hat – Annegret. Linda macht sich auf die Suche nach ihr, doch alle Spuren enden in einer maroden Klinik in einem Waldgebiet. Und es gibt jemanden, dem Lindas Nachforschungen nicht gefallen …
Über Barbara Apel • Lotti Nass
Barbara Apel, geboren 1951 in Berlin, arbeitete nach Abschluss der Schule zunächst in einer Werbeagentur; seit 1979 ist sie beim Hörfunk des SFB, inzwischen RBB, beschäftigt.
Lotti Nass, geboren 1950 in Schleswig-Holstein, studierte Design und arbeitete zeitweise als Cartoonistin. Neben ihrer Anstellung in einer Bibliothek widmet sie sich der künstlerischen Fotografie.
Inhaltsübersicht
Prolog
Ein modriger Geruch, durchsetzt mit einer unangenehmen Schärfe, hing in der Luft. Fast unmerklich zog ein Schauer durch den Körper des Mannes, als er mit der Hand nach dem Lichtschalter tastete. Sein Blick verfing sich in den getrockneten schmutzig braunen Rinnsalen, die alle auf ein gullyähnliches Loch im Boden der Kammer zuliefen. Auch die Glasur der Wandfliesen hatte die Ströme chemikalienhaltigen Wassers nicht unbeschadet überstanden und war porös und fleckig geworden. Die Neonröhre verbreitete ein trübes Licht in diesem fensterlosen Raum, der auf dem Plan, den der Mann in der Hand hielt, als Waschraum gekennzeichnet war.
Ein leiser Ekel überkam ihn, als ihm einfiel, dass die Hände, die den Türgriff einst bedienten, auch die Toten berührt hatten.
Der Mann machte sich auf den Rückweg, verschloss hinter sich eine Tür nach der anderen. Auch die oberen Räume des Hauses, auf seinem Plan als Sektions- und Laborbereich kenntlich gemacht, hatte offenbar lange niemand mehr betreten. Der große Bund mit den altertümlichen Schlüsseln wog schwer in seiner Hand. Einen Schlüssel hatte er herausgesucht. Er hatte den Raum gefunden, den er suchte.
1
Ein trockener Wind wehte von Westen herüber und bedeckte ihr Auto mit einer hellen Sandschicht. Sie öffnete den Kofferraum und verstaute ihren Einkauf, zwei voll bepackte braune Papiertüten. Die tief stehende Sonne brannte immer noch unerbittlich, versengte ihre Haut, blendete ihre Augen, als wollte sie ihr den Platz streitig machen. Linda beeilte sich, in ihr klimatisiertes Apartment zu kommen.
«Hi Linda!» Doorman Pete, dienstbeflissen wie immer, wenn sie das Foyer betrat, verließ seinen Tresen und drückte auf den Knopf, um ihr den Lift zu holen. Zweiunddreißig Stockwerke hatte das Hochhaus. Linda öffnete die Tür zu ihrem Apartment im fünfzehnten Stock. Sie ignorierte die Stille, die sie empfing, und lud ihren Einkauf in der Küche ab. Mit langsamen Bewegungen verstaute sie die Lebensmittel in den Schränken. Sie hatte wieder einmal zu viel eingekauft.
Sie ging in das Arbeitszimmer und schaltete den Laptop ein, ihre neueste Errungenschaft. Ein Auftrag musste unbedingt bis zum nächsten Tag fertig werden. Sie wusste, es wäre besser, endlich einmal zu pausieren. Heute hatte sie sich dabei ertappt, wie sie anfing, die Schriften auf Reklametafeln, die Schlagzeilen der Zeitungen ins Deutsche zu übersetzen. Sie konnte einfach nicht aufhören, ihre Arbeit zu tun. Sie war spezialisiert auf schwierige Texte. Sie war in ihrem Element, sie konnte den Arbeitsfluss nicht stoppen, er war ihr Lustgewinn.
Aber erst einmal musste sie unter die Dusche. Sie duschte immer zweimal am Tag. Auch wenn sie abends nichts mehr vorhatte. Sie verabscheute den klebrigen Film, der sich an heißen Tagen auf der Haut bildete. Minutenlang ließ sie das Wasser über ihren Körper laufen, ein lauwarmer Strom, der ihren Rücken hinabfloss und wie eine warme Hand über ihren Nacken strich.
Der Schminkspiegel lag auf dem Waschbecken, sie hatte ihn am Morgen dort liegen lassen. Linda blickte hinein. Ihre Haut zeigte eine kräftige Bräune und brachte ihre hellblauen Augen zum Strahlen. Der Schminkspiegel hatte zwei Seiten; eine Spiegelseite vergrößerte stark. Sie spielte ihr altes Spiel und drehte ihn um, sah ihre Poren, die Härchen, die Falten ihres Gesichts wie eine Landschaft. Mit den Fingern strich sie die Augenbrauen entlang und über den Fältchenkranz um ihre Augen, wie um sie zu glätten. Sie drehte den Spiegel wieder um.
Als es klingelte, warf sie sich hastig den Morgenmantel über und öffnete die Tür. Ein Bote hielt ihr ein Kuvert mit einem Telegramm entgegen.
Sie riss den Umschlag auf und starrte auf die Zeilen. Entsetzen flutete durch ihren Körper. Sie hielt die Nachricht vom Tod ihrer Mutter in den Händen. Gehirnschlag. Tante Edith, die Schwester ihrer Mutter, war die Absenderin des Telegramms. Lindas Beine versagten.
Der Bote griff nach ihrem Arm. Schweißgeruch zog Linda in die Nase und half ihr, wieder zu sich zu kommen.
«Eine traurige Nachricht?» Er schaute sie mitfühlend an. Linda nickte. Sie stand wieder auf eigenen Beinen, schwankte aber noch. Hastig bedeckte sie ihre Blöße, indem sie den Mantel wieder zuband. Der Bote verabschiedete sich, und sie schloss die Tür. Das Telegramm lag auf dem Boden, sie musste sich bücken, um es aufzuheben. Dann kamen die Tränen.
So früh? Dreiundsechzig Jahre alt war ihre Mutter geworden. Reichte es nicht, dass ihr Vater so früh gestorben war? Vor zwei Jahren war er bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Linda ging zum Telefon, um ihre Tante Edith anzurufen. Dann fiel ihr ein, dass es in Deutschland jetzt Nacht war. Sie wählte eine andere Nummer. Erleichtert hörte sie die Stimme, bis sie begriff, dass sie nur vom Band kam. Ihre Freundin Vivian war an diesem Abend nicht zu Hause. Enttäuscht legte Linda den Hörer auf. Sie brauchte jemanden, mit dem sie reden konnte. Sie dachte an ihren geschiedenen Mann. Unentschlossen ging sie in die Küche. Eine angebrochene Flasche Whisky stand im Regal. Linda goss sich ein Wasserglas voll.
Die Nacht schien kein Ende zu nehmen. Drei Gläser Whisky hatte sie getrunken und fand trotzdem keinen Schlaf. Linda setzte sich an ihren Laptop und starrte mit rot geweinten Augen auf den Bildschirm. Sie tippte so lange Zahlen ein, bis sie meinte, einen Sinn darin zu erkennen. Gab es für alles ein Raster, einen Code? Da! Ihre Lebensdaten. Man schrieb das Jahr 1990. Sie, Linda Oldham, seit einem Jahr getrennt von ihrem Mann Bill, Teilhaberin eines Übersetzungsbüros, lebte seit zwölf Jahren in den USA. Vorher hatte sie in Deutschland gelebt, in Berlin, bis Ende der siebziger Jahre; in jenen Jahren, als Linkssein für Leute wie Linda Pflicht war, als kommunistische Sekten, Mao-Anhänger, Anarchos und Alternative sich im westlichen Berlin tummelten. Die Stadt war geteilt, der Osten weit weg, weiter als die USA – so schien es damals. Dort, in den USA, wurde Linda 1952 geboren. Ihre Eltern hatten ein Jahr zuvor geheiratet. Kennen gelernt hatten sie sich in Berlin. Ihr Vater war dort als GI stationiert gewesen und ihre Mutter dorthin geflohen, nachdem die Familie in der Mark Brandenburg Haus und Hof verloren hatte. Gemeinsam zog man in die Staaten. Aber es war nicht gut gegangen mit der Ehe, die Eltern trennten sich, und die Mutter kehrte 1958 den USA den Rücken, um mit ihrer Tochter nach Berlin zu ziehen und sie dort einzuschulen. Linda hatte sich auf ein fremdes Land einstellen müssen. Seitdem konnte sie in zwei Sprachen sprechen, denken und träumen.
Linda gab die Zahl 63 ein. Sie hatte das Gesicht ihrer Mutter vor Augen, dann das ferne Berlin. Ihre Mutter hatte sich für Deutschland entschieden und ihre Tochter mitgenommen. Wenn man nicht weiß, wo man zu Hause ist, wenn man nicht weiß, ob das Zuhause dort ist, wo man geboren wurde, oder dort, wo man aufwuchs, oder dort, wo man zuletzt gelebt hat, ist man nirgendwo richtig zu Hause, dachte Linda.
Das Gelände der Klinik war bis auf die Straßenseite von Wald umgeben. Der Belag der Straße war von zahlreichen Ausbesserungen holprig geworden und hinterließ den Eindruck eines Flickenteppichs. Eine sandige Schicht bedeckte das Pflaster. Man ahnte, dass sich selten ein Auto hierher verirrte.
Die einzelnen Häuser der Klinik sahen noch immer stilvoll aus, es umwehte sie ein Hauch der Epoche, in der sie entstanden waren. Nach dem Krieg wurden sie, wie viele andere Gebäude in der Stadt, mit schmucklosen Fassaden versehen, die die Farbe des märkischen Sandes hatten. Im Laufe der Jahre verwischten dichtes Buschwerk und hoch gewachsene Bäume die Grenze zwischen Klinikgelände und Forst immer mehr. Die alte Mauer, die das Grundstück umgab, blieb seit Jahrzehnten sich selbst überlassen.
Der Wind hatte Blätter von den Bäumen geweht und überall verteilt. Würde jemand das Laub zusammenharken? Dachte der alte Mann darüber nach, der in sich versunken auf einer der Holzbänke saß?
Ab und zu stahlen sich einige Strahlen der tief stehenden Abendsonne durch die Wolken und ließen das Laub rötlich und gelb aufleuchten. Aber dieses Farbenspiel vermochte keine Heiterkeit in die Tristesse der Anlage zu bringen.
Die Wende, sie war auch hier zu spüren. Eine Atmosphäre des Übergangs hatte sich der Klinik bemächtigt. Es war die Zeit des Aufbruchs, des Neuen, doch viele konnten nicht begreifen, was das Neue war. Erst musste das Alte verschwinden oder sich wenigstens den neuen Gegebenheiten anpassen.
Die Laternen, die Wege, die Gebäude – ihnen blieb nur der Verfall. Ein Haus nach dem anderen wurde nicht mehr gebraucht, verlor seinen Sinn. Das Krankenhaus beherbergte nur noch alte gebrechliche Patienten, obwohl – man sollte besser Bewohner sagen, denn sie wohnten dort, und sie schienen auf etwas zu warten, so wie alles an diesem Ort. Auf dem neuen Schild, das den Eingang zum Gelände schmückte, prangte nur noch die Aufschrift Geriatrische Abteilung, alle anderen Bereiche waren inzwischen ausgelagert.
In der Ferne war die Sirene eines Krankenwagens zu hören, doch jeder wusste, hierher würde kein Krankenwagen mehr kommen, um einen Notfall zu bringen.
Eine Klingel ertönte aus dem Hauptgebäude. Siebzehn Uhr, Zeit fürs Abendbrot. Der Park leerte sich, und zurück blieben ein paar Saatkrähen, die auf dem laubbedeckten Boden umherstolzierten, um dann mit Geschrei in den Baumwipfeln zu verschwinden.
Schwester Else liebte die abendliche Stille auf dem Klinikgelände. Seit über zwanzig Jahren lebte und arbeitete sie hier und konnte nicht begreifen, dass nun alles zu Ende sein sollte. Sie fühlte sich wie ein ausrangiertes Möbelstück, das man zurückgelassen hatte, während alles andere fortgeräumt war.
Sie sollten abgewickelt werden. Was für ein Wort! Sie hatte es noch nie vorher gehört. Else machte sich keine Hoffnungen, dass sie die verbleibenden fünf oder sechs Jahre bis zu ihrer Rente an diesem Ort weiterarbeiten konnte. Wenig aufmunternd waren auch die Bemerkungen des jungen Mannes, der im Auftrag seiner Firma aus Stuttgart alles genauestens inspiziert hatte. Allein die Lage sei ja traumhaft, hatte er versichert, deshalb müsse man schnellstens mit vereinten Kräften durchstarten, damit die auch ordentlich Geld abwerfe. Gewiss, ein paar der alten – nein, verbesserte er sich schnell, so sei das nicht gemeint gewesen –, ein paar der langjährigen Mitarbeiter könnten vielleicht bleiben, schließlich seien sie doch diejenigen, die sich mit den hiesigen Strukturen am besten auskannten. Aber ob auch Schwester Else …? Dazu wollte er sich nicht äußern.
Wo sollte sie hin in ihrem Alter? Gehörte auch sie bald zu den Arbeitslosen, deren Warteschlangen früher immer die AktuelleKamera gezeigt hatte, als abschreckendes Beispiel für den Kapitalismus?
Es war schon ein Kreuz, fast nur noch Pflegefälle zu betreuen. An manchen Tagen wusste sie nicht mehr, was sie in den vielen Stunden ihrer Dienstzeit getan hatte. Seit Jahren fühlten sie sich mit den schweren Pflegefällen allein gelassen. Keiner ließ sich hier mehr blicken, um nach dem Rechten zu sehen. Nach der so genannten Wende waren immer mehr Patienten gebracht worden, aber neue Schwestern wurden nicht eingestellt. Ihr konnte keiner erzählen, dass jetzt alles besser werden würde. Ob Osten oder Westen, es war doch alles gleich.
Else war auf dem Weg zur Kantine. Sie hatte Dienstschluss, mochte aber noch nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Sie näherte sich dem Haus, in dem nur noch die Kantine in Betrieb war. Und diese sollte nun auch bald geschlossen werden, so hieß es.
Sie blieb abrupt stehen. Was treibt der denn hier, fragte sie sich, und was hat er mit dem Wachmann zu bereden? Else beobachtete die beiden. Der Wachmann sprach, der Arzt hörte zu. Als sie sah, wie die beiden auseinander gingen, setzte sie ihren Weg fort. Sie schaute sich kurz um, bevor sie die Tür zur Kantine öffnete. Offenbar hatte der Wachmann das gleiche Ziel. Er kam auf sie zu.
«Wenn Sie mich bitte vorbeilassen würden, ich habe jetzt nämlich Pause», sagte der Wachmann. Schwester Else stand in der Tür zur Kantine und rührte sich nicht vom Fleck.
«Dr. Jansen ist hier gar nicht mehr tätig. Dem haben sie schon vor einem halben Jahr gekündigt.» Else trat einen Schritt zur Seite, ließ aber nur so viel Platz, dass er sich an ihr vorbeidrängen musste. Sie folgte ihm an den Tresen der Kantine.
«Und außerdem, wenn Sie ihm was Wichtiges erzählt haben, dann sollten Sie es uns anderen auch erzählen!», sprach sie ihn von der Seite an. Der Wachmann erwiderte nichts. Er nahm sich ein Tablett.
Sie holte sich ein Getränk und suchte sich einen Platz. Die Kantine war nur noch spärlich besetzt. An einem der langen Tische erkannte sie den Pfleger Horst, der auf der gleichen Station Dienst tat wie sie. Ihm gegenüber saß die neue Stationsärztin, eine junge Frau in einem blütenweißen Arztkittel. Ja, Pfleger Horst hatte schon immer gewusst, an wen er sich halten musste.
Sie sah den Wachmann am Kopfende des langen Tisches Platz nehmen, an dem der Pfleger und die Ärztin saßen. Else setzte sich an den Nachbartisch, sodass sie wie immer alles im Blick hatte. Ein lautes Rasseln war plötzlich zu hören; der Wachmann hatte einen schweren Schlüsselbund auf den Tisch fallen lassen.
«Sie waren wohl in der alten Pathologie?», sprach ihn der Pfleger an.
Der Wachmann sah verblüfft aus. «Woher wissen Sie das?»
Horst weiß immer alles, dachte Else. Sie sah, wie er mit seinem dicken Zeigefinger auf einen der Schlüssel deutete.
«Dieses antike Stück ist der Eingangsschlüssel, nicht wahr?»
«Ja, mit dem Generaler kommt man da nicht rein.»
«Wie sieht’s da drinnen jetzt aus? Haben sich Fledermäuse eingenistet?»
«Fledermäuse nicht», entgegnete der Wachmann, «eher ein paar Geister.»
«Na ja, nicht mehr lange, und alles wird sowieso platt gemacht», meinte der Pfleger.
«Sind Sie sicher?» Die junge Ärztin schaute fragend von einem zum anderen. «Der Senat stellt doch alles unter Denkmalschutz, was aus kaiserlichen Steinen besteht.»
Der Wachmann zündete sich eine Zigarette an. «Ach, Sie sind aus dem Westen?», fragte er zwischen zwei Zügen.
«Ja. Das hier ist meine erste Stelle als Assistenzärztin.»
«Verstehen Sie das?», fragte der Pfleger den Wachmann. «Jeder von uns sieht zu, dass er im Westen arbeiten kann, weil man da mehr verdient, und die junge Frau», er lächelte der Ärztin zu, «kommt freiwillig hierher in den Osten.»
Typisch Horst, dachte Else, jetzt schmiert er ihr Honig um den Bart.
«Ganz so freiwillig war es nicht.» Die Ärztin schien unbeeindruckt. «Für uns Ärzte wird die Luft auch dünner, da kann man sich die Krankenhäuser nicht immer …»
«… aussuchen», beendete der Pfleger ihren Satz. «So landet man im Osten und weiß noch nicht einmal, für wie lange.» Jetzt wandte er sich wieder dem Wachmann zu. «Die Pathologie sollte man abreißen, das ist meine Meinung. Was soll daraus schon werden, ein Gästehaus vielleicht? Jetzt heißt es, das Ganze hier soll eine Tagungsstätte werden. Eine Stuttgarter Firma hat hier neulich schon ihre Statiker aufmarschieren lassen.»
«Aber das ist doch widersprüchlich», sagte die junge Ärztin. «Letzte Woche erst haben sie neue Patienten gebracht, es ist schon wieder richtig voll in Haus I. Ich kann mir nicht vorstellen … im Übrigen kommen dauernd irgendwelche Firmen. Da würde ich nichts drauf geben. – Hier draußen ist es schön ruhig. Mir gefällt es, ich würde gerne länger bleiben.»
«Ich könnte mir was Besseres vorstellen, verstehe selbst nicht, warum ich noch hier bin. Zwanzig Jahre sollten genug sein, oder?» Der Pfleger sah Schwester Else ins Gesicht. Sie war aufgestanden.
«Ja, so etwas gibt es. Etwas hält einen fest, und man weiß nicht, was es ist», hörte Else die Ärztin sagen.
«Keiner sagt uns, wie lange es noch so gehen soll. Ein unmöglicher Zustand!», mischte Else sich ein.
«Ich weiß, Sie können nichts dafür», sagte sie, an den Wachmann gerichtet, «aber die Patienten, die haben doch ein Recht darauf zu erfahren, wie es mit ihnen weitergeht. Was passiert mit dem ganzen Müll, der hinter Haus II liegt, das Zeug ist doch zum Teil noch zu gebrauchen! Die Geräte aus dem Entkeimungshaus – es verrottet doch alles, wenn es bei Wind und Wetter da rumliegt.»
«Else, das interessiert doch keinen mehr!» Pfleger Horst fixierte sie mit einem spöttischen Blick.
«Doch, mich! Oder kommen wir dann gleich mit auf den Müll?» Else schnappte sich ihr Glas.
Der Wachmann erhob sich und griff nach dem Schlüsselbund. «Die Schlüssel werde ich der Verwaltung zur Aufbewahrung geben, bis die Bauleute kommen. Bis dahin braucht sie keiner mehr.»
Else sah, wie der Pfleger die Hand ausstreckte. «Die können Sie mir geben», sagte er. «Ich muss sowieso gleich rüber ins Büro. Da haben Sie einen Weg gespart.»
«Wenn Sie meinen, danke!» Der Wachmann gab ihm den schweren Bund und verließ die Kantine. Else folgte ihm nach draußen.
Sie sah ihm nach, wie er davontrottete, und machte sich auf den Heimweg. Bevor sie in ihre Wohnung im Schwesternhaus zurückkehrte, wollte sie aber noch mit jemandem sprechen.
Dora. Ihre ehemalige Kollegin war schon immer eine geduldige Zuhörerin gewesen. Sie öffnete die schmale Tür der Telefonzelle neben dem Haupteingang.
«Dora, hallo, ich bin’s … kalt ist das hier drin, sag ich dir … hab ja immer noch kein Telefon. Wird wohl auch nichts mehr werden, so wie es jetzt aussieht … warte mal, ich muss das Licht wieder anmachen. In diesem Kabuff geht ständig das Licht aus. Hier ist so ein Schalter, auf den muss man immer wieder drücken, soll wohl so ’ne Art Automatik sein, Fortschritt à la DDR. Früher war er andauernd defekt, aber die Post hat einen Apparat eingebaut mit allen Schikanen, man kann sogar sehen, welche Nummer man gewählt hat, und das Schönste daran ist, dass man mit einer Karte telefonieren kann, man muss jetzt kein Kleingeld mehr sammeln, so wie früher … die gibt’s in dem kleinen Laden ganz in der Nähe, da kriegt man alles für den täglichen Bedarf. Ach Dora, ich hab dir ja so viel zu erzählen, du ahnst nicht, was sich in der letzten Zeit hier abgespielt hat … nein, das wird leider nicht klappen … ich find’s auch schade, aber ich komme hier nicht weg … weißt du, jetzt heißt es, wir sollen eine Tagungsstätte werden … eine Tagungsstätte! … was weiß ich, wahrscheinlich für Manager, so heißen doch jetzt alle, von denen man nicht genau weiß, was sie beruflich machen … Das ist ganz gespenstisch hier, die meisten sind schon weg, viele Häuser stehen leer. Letztens hat so ’n Neuer in der Verwaltung gesagt, dass auch meine Tage gezählt sind … ganz gewählt hat der sich ausgedrückt, so ein Lackaffe, einen Anzug hatte er an, also ich möcht nicht wissen, was der gekostet hat … nee du, das war keiner von uns, unsre sehen anders aus, auch wenn sie jetzt in Seidenhemden rumrennen … Ach übrigens, der Jansen taucht hier neuerdings wieder auf, obwohl er doch schon seit Jahren … ja, genau der, hat der nichts zu tun in seiner Poliklinik? Hoffentlich schließen sie die auch. Dann sitzt der auch auf dem Trockenen. Sobald ich ihn sehe, kommt mir die Galle hoch. Möchte mal wissen, was der mit dem Wachmann zu quatschen hatte … Na ja, ich ruf dich morgen wieder an … ja, um dieselbe Zeit.»
Auf ihrem Schoß lag die schwarze Schlafbrille, die man ihr während des Fluges gereicht hatte. In wohlige Schwärze hatte sie Linda getaucht, in einen angenehmen Schlaf sinken und sie für kurze Zeit vergessen lassen, dass vor wenigen Tagen ihre Mutter gestorben war. Jetzt umgaben Linda wieder die Geräusche des Fluges, das Gemurmel der Fluggäste. Sie fühlte sich einsam und dachte an Bill. Sie hatte ihm einen Brief geschrieben, weil sie sich nicht hatte überwinden können, ihn anzurufen. Wie sehr hätte sie ihn jetzt gebraucht. Hatte sie die Trennung nicht mitverschuldet und zu wenig getan, um ihre Ehe zu retten? Aber was hatte er getan? Mit Bitterkeit erinnerte sie sich, wie sie eines Abends heimkam, er am Küchentisch saß und sie anstrahlte.
«Linda, wir gehen in die Karibik.»
Linda glaubte, sich verhört zu haben. «Karibik?»
«Ja. Hier steht’s.» Er gab ihr den Brief. Stumm las sie, was ihm sein Arbeitgeber zu sagen hatte: Am 1. Februar sollte er die Leitung des Carribean Beach Hotels übernehmen.
«Du gehst», sagte Linda gedehnt. «Was soll ich da?»
«Linda, ich möchte nicht ohne dich gehen.»
«Aber dass du gehst, steht für dich fest?»
«Hm.»
«Ja oder nein?»
Er fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. «So gut wie.»
«Und wo bleibe ich? Hast du mich je gefragt, ob ich das möchte?»
«Linda», sagte er sanft «natürlich mache ich nichts ohne dich.»
«Nichts ohne mich? Du hast dich doch längst entschieden.»
Er bugsierte sie auf einen Stuhl, widerwillig ließ Linda es geschehen.
«Wann hast du das eingefädelt?»
«Was?»
«Deinen Karrieresprung.»
«Ich habe doch nichts eingefädelt, die haben es mir angeboten. Der bisherige Manager, ein Filipino, wird nach Hongkong versetzt.»
«Warum setzt du alles aufs Spiel?»
«Wieso?»
«Unsere Ehe, zum Beispiel.»
«Ich gehe doch nicht ohne dich!»
«Ich komme nicht mit.»
«Was spricht dagegen, mich zu begleiten?», wollte er wissen.
«Mein Übersetzungsbüro», sagte sie mit Nachdruck.
«Das kannst du auch in der Karibik …»
«Wie stellst du dir das vor?»
«Das kannst du überall auf der Welt machen.»
«Ein Jahr später wirst du dann nach Hongkong versetzt, dann nach Singapur und dann sonst wohin …»
«Wir werden ein Haus mit Blick aufs Meer haben. Das hat man mir zugesagt; da kannst du dir ein Büro einrichten.»
Nein! hatte Linda kategorisch gesagt. Er verstand sie nicht. Sie hatte sich etwas aufgebaut, hatte ein Zuhause gefunden. Sie wollte nicht schon wieder an einem anderen Ort ein neues Leben beginnen.
Sie setzte die Schlafbrille wieder auf und versuchte wieder in diese Schwärze einzutauchen, die sie alles vergessen ließ. Aber diesmal gelang es ihr nicht.
Mit einem Mal tauchten sie auf, Bilder aus ihrer Kindheit in Berlin – wie sie an der Hand ihrer Mutter über den Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz bummelte; oder später, als sie am Potsdamer Platz ein Stein um Stein wachsendes Ungetüm entstehen sah, die Mauer, die die Stadt in zwei Hälften teilte.
Sie sah das Haus ihrer Mutter vor sich, ein Landhaus aus den dreißiger Jahren, in einem der vornehmeren Bezirke Berlins gelegen. Linda würde es verkaufen und sich von dem Erlös ein Apartment kaufen.
Ihre Kindheit in Berlin war nicht unglücklich verlaufen, doch ihre ersten sechs Lebensjahre in Amerika hatten in ihrer Erinnerung eine Verklärung erfahren, die durch nichts mehr getrübt werden konnte, ein Paradies, das durch die Trennung ihrer Eltern schlagartig verloren ging.
Mit der Rückkehr ihrer Mutter nach Deutschland Ende der fünfziger Jahre hatte eine neue Phase in Lindas Leben begonnen. Sie war von einer Stadt empfangen worden, in der das Grau dominierte. Wo war das tiefe Blau des Himmels geblieben, wo waren die Farben, die sie aus Amerika kannte, deren Fröhlichkeit dem Leben die Schwere zu nehmen schien? Die Menschen wirkten so unnahbar, so hart in Berlin. Kaum einer verstand die Sprache, die sie mit ihrem Vater gesprochen hatte.
Nach ihrer Ankunft zogen sie zuerst in ein möbliertes Zimmer im Hochparterre eines Mietshauses. Im Vergleich zu den anderen Mietern des Hauses lebten Linda und ihre Mutter dort im Luxus, manche bewohnten solch ein Zimmer zu fünft oder zu sechst. Aber die Enge hatte auch Vorteile. Es gab Kinder in Scharen und in jeder Altersstufe. Man spielte auf der Straße, auf dem Hof, in den Ruinen und fand überall schnell neue Freunde.
Linda dachte bald nicht mehr an ihr Traumland Amerika. Sie gewöhnte sich an das vaterlose Dasein, die Kühle in ihrer neuen Heimat. Sie verlor ihren amerikanischen Akzent und sprach zunehmend ein echtes Berlinerisch, das die Mutter allerdings zur Verzweiflung trieb. Ihre Strenge nahm im Laufe der Jahre zu, als wollte sie ihrer Tochter den Vater ersetzen, einen Vater, den es so nie gegeben hatte. Als kleines Mädchen hatte Linda eher die Nähe ihres Vaters gesucht. Sie turnte auf ihm herum, als sei er ein großer Berg. Manchmal hob er sie mit gestreckten Armen in die Höhe, sodass sie die Welt von oben bestaunen konnte. In intensiven Bildern waren Linda diese Momente ihrer Kindheit erhalten geblieben. Ihr Vater war freundlich und geduldig, und wenn er Zeit hatte, spielte er mit ihr. Das tat ihre Mutter selten. Er war es auch, der ihr den Namen Linda gegeben hatte, was ihre Mutter noch in späten Jahren in Wallung bringen konnte. Sie hatte für ihre Tochter einen ganz anderen Namen vorgesehen. Sabine hatte sie heißen sollen, der Vater hatte sie zu einer Amerikanerin gemacht.
Hatten sich ihre Eltern viel gestritten? Linda wusste es nicht mehr. Sie entsann sich, dass zwischen den Eltern oft ein längeres Schweigen geherrscht hatte, wenn der Vater sie, was selten geschah, in Berlin besuchte. Linda meinte, sie dann stumm in ihrer jeweiligen Sprache weiterreden zu hören, den Vater auf Amerikanisch, die Mutter auf Deutsch.
In Lindas Erinnerung war das Berlin Ende der fünfziger Jahre geprägt von den schrecklichen Zerstörungen, die der Krieg hinterlassen hatte. Die zerschossenen Fassaden vieler Häuser, die Straßen, die oft ins Niemandsland führten, kündeten von unerklärlichen Dingen. Die grellen Reklameschilder, die bunten Autos mit ihren lauten Motoren konnten Linda nicht täuschen. Sie durchschaute schon als Kind das Bemühen der Menschen, sich mit Hilfe äußerlicher Dinge eine Welt zu erschaffen, die dem Idealbild Amerika ein wenig näher kam. Sie kannte das Original, auch wenn es in ihrer Erinnerung immer mehr verblasste.
Fasten seat belt! Linda erschrak über die blinkende Anzeige und schnallte sich an. Zu sehen war an diesem Oktobertag von Berlin nur eine graue Wolkendecke, bis das Flugzeug an Höhe verlor und sie die steinerne Stadt mit ihren grünen Schneisen erkannte. Das Flugzeug als Zeitmaschine, das sie zwölf, dreizehn Jahre zurück in die Vergangenheit transportierte, dieser Gedanke kam Linda, als die Maschine hart aufsetzte, um dann auf der Landebahn auszurollen.
«Endlich mal wieder ’ne Fuhre, die sich lohnt», meinte der Taxifahrer am Flughafen, als Linda das Fahrziel nannte. «Na, einen schönen Urlaub jehabt?», fragte er neugierig, nachdem er das Auto gestartet hatte. Es war eine Anspielung auf ihre sommerlich gebräunte Haut und ihre leichte Bekleidung.
«Nein, ich bin nur zu Besuch hier, ich komme aus Amerika.»
«Dafür könn’ Se aber jut Deutsch», stellte er anerkennend fest.
«Ich habe hier früher gelebt», antwortete Linda.
«Und? Wolln Se wieder hier leben?»
«Nein, ich bin wegen meiner Familie hier.» Linda schaute aus dem Fenster. «Wir sind wohl in der Rush-Hour?»
«Hör’n Se bloß uff», raunzte der Fahrer. «Ab mittags is hier stop and go. Seit wa keene Mauer mehr ham, kommse alle von drüben zu uns einkoofen. Die tun so, als ob se vierzig Jahre nüscht zu essen hatten.» Er wandte sich kurz zu ihr um. «Wissen Se, mich stör’n se ja nich, ick gloob ooch nich, det die uns wat wegkoofen. Aber statt se ihr Jeld in ihre Bezirke lassen, damit die ’n paar Mark einnehmen, schleppen se’s hierher. Westware is total anjesacht. Sie müssen die mal im Supermarkt erleben: Jede Büchse Karotten kieken die an, als wär’t ’ne Ausgrabung aus’m alten China», schimpfte der Taxifahrer.
Sie fuhren die Avus entlang. Der Grunewald war hier nur ein fahler grüner Seitenstreifen, der ihre Fahrt begleitete.
«Wie die mit ihre Trabbis und Wartburgs bei uns die Straßen verstopfen … und wie det stinkt – zum Himmel, sag ick Ihnen.»
Linda sagte nichts. Kaum in Zehlendorf angekommen, schimpfte der Taxifahrer wieder. «Ham Se det jeseh’n? Dieser Idiot is eben bei Rot noch rüberjefahr’n. Natürlich! Ostkennzeichen! So wat erleben Se heutzutage ständich. Keen Wunder, det die Unfallzahlen so steigen.»
Sie bogen in den Steinweg ein. Das Taxi hielt vor der Nummer 7. «So, hier isses. Da ham Se sich aber ’ne noble Ecke ausjesucht.»
Linda bezahlte und stieg aus.
Es war das Haus ihrer Kindheit, vor dem sie nun stand. Die Straße mit ihren hohen Bäumen, dem Kopfsteinpflaster und den gepflegten Vorgärten war ihr vertraut. Doch sie würde sich an das herbstliche Licht der Stadt gewöhnen müssen; vor Stunden noch hatte sie gleißenden Sonnenschein erlebt. Hier blieb die Sonne hinter Wolken verborgen und geizte mit ihren Strahlen.
Linda stellte ihr Gepäck im Vorgarten ab und ging zum Nachbarhaus, um den Schlüssel zu holen. Sie klingelte. Die Tür öffnete sich einen schmalen Spalt, dann erschien der Kopf eines alten Mannes, der sie fragend anschaute.
«Guten Tag, Herr Hedrich», begrüßte ihn Linda. Kein Wiedererkennen zeigte sich in seinem erstaunten Blick.
«Ich bin Linda, von nebenan. Erinnern Sie sich? Meine Mutter …»
«Entschuldigen Sie, ich sehe so schlecht.» Der Türspalt wurde größer. «Ihre Tante hat mir gesagt, dass Sie kommen würden.» Mit zittrigen Händen griff er hinter sich und reichte ihr den Schlüssel. «Ihre arme Mutter! Mein Beileid. Es war sehr schwer für sie in der letzten Zeit, mein Enkel hat ihr ein bisschen helfen können.»
Davon wusste Linda nichts.
«Ich werde Nico sagen, dass Sie da sind. Er kann Ihnen auch ein bisschen zur Hand gehen.»
«Danke, sehr lieb von Ihnen. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wenn ich Hilfe benötige, sage ich Ihnen Bescheid. Noch mal herzlichen Dank.»
Die Tür des Nachbarn schloss sich wieder.
Nach längerem Mühen und mit zwei Schlüsseln verschaffte sie sich schließlich Einlass in das Haus ihrer Mutter. Ein schweres Stangenschloss mit vertikaler Verankerung sicherte die Tür von innen. Staubige kühle Luft empfing sie. Sie stellte das Gepäck ab und ging zögernd durch den langen Flur. Vor der Flurgarderobe blieb sie stehen und wunderte sich über den Herrentrenchcoat, der dort hing. Hatte er nicht ihrem Stiefvater gehört, der schon vor Jahren gestorben war? Dann entsann sich Linda eines Fotos, auf dem ihre Mutter in dem Mantel zu sehen war, mit aufgeschlagenen Ärmeln und Sonnenbrille. Sie hatte seinen Mantel in Erinnerung an ihn getragen. Berthold, ihr Stiefvater, war von Beruf Richter gewesen. Und das Haus stammte aus seinem Familienbesitz.
Linda ertappte sich dabei, wie sie nach ihrer Mutter Ausschau hielt. Hinten, der letzte Raum, das war das Wohnzimmer. Die Tür war angelehnt. Linda ging hinein und stellte zu ihrer Verwunderung fest, dass sich seit der Beerdigung ihres Stiefvaters vor fünf Jahren kaum etwas verändert hatte. Nur die Couch war neu, die alte hätte wohl selbst ein versierter Polsterer nicht mehr aufarbeiten können. Auf dem runden Louis-quinze-Tisch stand eine Schale mit Obstresten, umschwirrt von kleinen Fliegen. Die Decke lag auf dem Ohrensessel wie gerade abgelegt. Alles sah aus, als sei es nur vorübergehend verlassen worden.
Auf diesem Sessel hatte ihre Mutter ihre letzten Lebensminuten verbracht. Ihr Herz war einfach stehen geblieben, «Herzkammerflimmern», hatte es geheißen. Wie schnell war der Tod eingetreten? Gab es einen Übergang, Schmerzen? Vielleicht das Gefühl von Lähmung, ein kurzes Erkennen des Endes, der Körper mit einem Mal wie Blei, der Blick, der sich verdunkelt, ein Gefühl wie von plötzlicher Stromunterbrechung. Das Herz schlug ein letztes Mal, dann Stille, im Körper, im Kopf. Linda schaute auf den Beistelltisch neben dem Sessel. Eine Zeitung lag auf dem Tischchen, aufgeschlagen auf der Seite mit dem Kreuzworträtsel. Sie erkannte die Schrift ihrer Mutter.
Linda verließ das Zimmer und ging in die Küche. Immerhin, dort stand kein Abwasch mehr herum. Irgendwer hatte den Kühlschrank geleert und abgeschaltet. Sie holte ihr Gepäck und brachte es in ihr früheres Zimmer im ersten Stock. Der kleine Raum war unverändert, er hatte noch immer den Anstrich eines Jugendzimmers. Selbst der weiße Fleck, den das Che-Guevara-Poster an der Wand hinterlassen hatte, war noch zu sehen. Ihre Mutter hatte es sofort entfernt, als Linda eine eigene Wohnung bezog.
Linda verspürte den Drang, in Bertholds Zimmer nachzuschauen, ob es noch seine Pfeifensammlung gab. Womöglich hatte ihre Mutter auch in diesem Raum alles unverändert gelassen. Linda hatte schon die Türklinke in der Hand, als sie sich eines anderen besann und die Tür nicht öffnete.
Neben seinem Zimmer lag das Bad. Hier sah es aus, als käme jeden Moment jemand herein. Nichts deutete darauf hin, dass die Frau, die hier jahrelang gelebt hatte, in wenigen Tagen zu Grabe getragen würde.
Am Ende des Flurs lag das Schlafzimmer ihrer Mutter. Linda verspürte Scheu, es zu betreten. Sie ging wieder ins Erdgeschoss hinunter.
Mit einem Tee setzte sie sich in den Wintergarten. Sie hatte ihn immer geliebt, diesen Raum, dessen hohe Fenster den Blick in die Natur gestatteten. Gedankenverloren blickte sie hinaus. Dieses Haus kam ihr vor wie ein alter Mantel, den man nicht mehr anziehen mochte, von dem man sich andererseits aber schwer trennen konnte.
Das Telefon klingelte. Linda lief in den Flur und nahm den Hörer ab. Es war ihre Tante Edith.
«Linda, bist du es? Schön, dass du da bist …»
Linda stellte sich vor, wie Edith, die Beine übereinander geschlagen, mit kerzengeradem Rücken im Sessel saß, den Telefonhörer in der beringten Hand. Den Berliner Tonfall, gepaart mit der tiefen Stimme ihrer Tante, hatte sie schon als Kind gern gehört.
«Ich hoffe, du hast den Flug gut überstanden, Linda. Da ich nicht genau wusste, wann du ankommst, habe ich dich nicht am Flughafen abgeholt.»
«Es ist alles okay, Tante Edith, mir geht es gut, nur mit der Zeitumstellung habe ich Schwierigkeiten. Ich wollte dich auch gerade anrufen.» Das stimmte nicht. Linda hatte sich Zeit lassen, in Ruhe ankommen wollen.
«Linda, Kind, wir haben morgen früh um zehn den Termin beim Bestatter. Du möchtest doch Abschied nehmen, nicht wahr? Ich möchte es natürlich ganz dir überlassen, mein Herz. Ich hab den Termin für die Trauerfeier auf den kommenden Freitag gelegt. Ist dir das recht? Weißt du, dass deine Mutter ein Urnenbegräbnis wollte? Es soll alles nach ihrem Willen geschehen. Wollen wir eine Anzeige in die Zeitung setzen? Ich habe schon den Text. Hör mal …»
Die Nacht in diesem Haus hatte viele Geräusche. Das alte Gebäude ächzte und stöhnte. Die Heizungsrohre meldeten sich durch gespenstisches Klopfen, ein Wasserhahn tropfte. Dann klapperte es irgendwo draußen. Sicher einer der alten Fensterläden, die zum Teil nicht mehr geschlossen werden konnten. Der Wind hatte hörbar an Stärke zugenommen, und Linda kroch tiefer unter ihre Decke.
Der Schlaf wollte nicht kommen. Ihr Körper war müde, aber ihr Kopf hellwach. Sie wälzte sich im Bett hin und her, nach einer Stunde gab sie auf. Die Uhr zeigte 0.38 an, bei ihr zu Hause war es jetzt noch hell. Sie könnte ihre Freundin Vivian anrufen oder Steve, der in ihrem Büro sicher wieder Überstunden machte. Aber sie war in dieser nächtlichen Atmosphäre nicht in der Stimmung zu telefonieren. Ein Drink täte ihr gut, aber es war bestimmt kein Whisky im Haus.
Sie stand auf und ging barfuß ins Erdgeschoss hinab. Das Licht des Mondes erleuchtete das Innere des Hauses, bis es vom künstlichen Licht der Deckenlampen vertrieben wurde. Im Wohnzimmer suchte sie nach etwas Trinkbarem, doch ohne Erfolg. Die Vitrinen bargen edles Geschirr und antike Gläser. Sie ahnte, dass einiges auf sie zukam, wenn in ein paar Tagen der Haushalt aufgelöst werden musste. Der Wunsch nach einem Drink war stärker als ihre bisherige Scheu, das Schlafzimmer der Mutter zu betreten. Dort würde sie das finden, was sie suchte. Sie erinnerte sich an die kleine Vitrine.
Zarter Parfumduft hing in der Luft. Auf dem Doppelbett lag ausgebreitet eine rosa Decke mit Blumenmuster. Lindas Blick fiel auf das große Ölbild, das mit leichter Neigung über dem Bett hing, als wollte es auf die Schlafenden hinabschauen. Immer hatte dieses Bild dort seinen Platz gehabt, es stammte aus dem Gutshaus in der Mark Brandenburg, in dem die Mutter aufgewachsen war. Früher hatte Linda es nie beachtet, jetzt weckte es ihre Neugier, und sie trat näher heran. Erschrocken zuckte sie zurück. Ihr Fuß war auf etwas Weiches, Warmes getreten. Ein Pantoffel mit Fellbesatz lugte unter dem Bett hervor. Auf einmal hatte Linda es eilig, das Zimmer wieder zu verlassen. Aber vorher öffnete sie das Schränkchen neben der Kommode, das wie erwartet Alkoholisches enthielt, zwar keinen Whisky, aber Weinbrand und Cognac. Linda entschied sich für einen Cognac und setzte sich im Wohnzimmer auf die Couch, eingehüllt in die warme Decke, die dort lag. Sie schaltete den Fernseher ein. Der Cognac wärmte sie, allmählich wurden ihr die Lider schwer.
Ein Geräusch ließ sie hochschrecken, sie musste eingeschlafen sein. Was war das? Ein Schuss, der im Film gefallen war? Sie schaltete den Fernseher aus. Da hörte sie das Geräusch wieder, es kam von draußen. Schnell holte sie von der Flurgarderobe einen Mantel und schlüpfte in ihre Schuhe. Draußen stürmte es. Sie ging hinaus auf die Terrasse und machte dort Licht. Wieder knallte es. Die Sträucher bogen sich im Wind. Zögernd trat sie in die Dunkelheit des Gartens, tastete sich vorwärts durch das weiche Gras. Dann entdeckte sie den Urheber der nächtlichen Störung. Die Tür des Geräteschuppens schlug gegen den Rahmen. Linda drückte sie zu, aber sie konnte die Tür nicht schließen, offenbar war sie verzogen. Sie machte Licht im Schuppen und griff nach einem Spaten. Den klemmte sie zwischen Tür und Rahmen. So hatte wenigstens das Knallen ein Ende. Beruhigt zog sich Linda ins Haus zurück. Sie ging wieder hinauf in ihr Zimmer. Irgendwann schlief sie ein.
Eine Stimme weckte sie. Draußen war es fast hell. Sie hörte die Stimme deutlich, sie schien von weit her zu kommen. Hastig erhob sie sich, nahm ihren Morgenmantel und zog ihn an. Sie öffnete die Zimmertür und spähte hinaus. Die Stimme tönte aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter:
«… Industriezeitalter verbarg seine Maschinenkünste noch phantasievoll: die Wasserpumpe für Sanssouci in der bunten Moschee mit seinem Minarett als Schornstein …», sagte eine Männerstimme, als Linda das Zimmer betrat. Das Radio am Bett der Mutter war der Übeltäter. Wer hatte es angestellt? «… das Pumpenhaus im Park Babelsberg in einer neugotischen Miniaturburg …» Linda schaltete das Gerät aus. Da entdeckte sie die Zeitschaltuhr. Sie zog alle Stecker aus der Dose. Eine solche Überraschung wollte sie nicht noch einmal erleben.
Mein Leben ist kein Leben, es ist eher wie ein Traum. Ich sehe nur weiße Wände, Farblosigkeit überall. Wenn grelle Farben dazukommen, erschrecke ich. Ich bin umhüllt von gestärktem Tuch, das sich rau und kratzig anfühlt. Die Matratze ist hart und voller Kuhlen. Es gibt nichts Weiches. Die Gerüche sind so konturlos wie alles, was ich sehe. Manchmal rieche ich etwas … und es kommt mir vor, als sei ich es selbst, die ich rieche. Einmal haben sie mir etwas vor meine Augen gehalten, das sie Spiegel nannten. Ich habe gelernt zu unterscheiden zwischen mir und den anderen. Ich weiß, dass die Haut meine äußere Grenze ist. Durch sie fühle ich, wenn ich an etwas stoße, wie die Bettdecke, die auf mir liegt und mich wärmt. Ich bin gefangen in einem Körper, der mir nicht gehorcht. Wie bewegen sich die Körper der anderen, wie werden sie gesteuert und vorwärts getrieben? Ich habe lange nachgedacht, dann habe ich meinem Körper Befehle gegeben. Aber es hat wenig genützt, meine Beine sind zu dünn und meine Füße wie Klumpen. Ich weiß, dass sie sich bewegen würden, wenn mein Körper sie nur ließe. Stattdessen geraten sie in Zuckungen, ohne dass ich es will. Dann sind die Menschen in Weiß ganz aufmerksam und reden auf mich ein, weil ich sehr wild wirke. Ich stoße Laute aus, die sie erschrecken. Es strengt mich an, wenn ich einen Laut formen will. Meist gelingt mir ein lang gestreckter Ton, wie ein Stöhnen. Sie denken, ich bin ein fremdes Wesen. Irgendwann hat einer ‹Tier› gesagt und mich gemeint. Andauernd reden die Menschen in Weiß über die Zeit. Aber was ist Zeit? Es gibt eine Zeit, die vergeht … davon sprechen sie. Aber ich weiß nicht, was sie damit meinen. Wenn etwas vergeht, muss es angefangen haben und irgendwann enden. Ich bin immer hier an diesem Ort. Ich spüre mich, meinen Körper, mein Herz, aber ich spüre sie nicht, die Zeit.
2
Linda roch den Duft der frischen Erde, die sie in der Hand hielt. Weich und glitschig fühlte sich der Boden unter ihren Füßen an. Sie stand am Rand der Grube, die für die Urne ausgehoben worden war. Die Erdkrumen rieselten aus ihrer Hand. Ihr kam alles unwirklich vor; warum durfte man das Grab nicht selbst zuschaufeln, warum nur dieser symbolische Akt? Die Urne – das sollte ihre Mutter gewesen sein?
Ihre Mutter war friedlich gestorben, ein Ausdruck, den man in Deutschland gern gebrauchte. Aber es musste wohl stimmen; Linda hatte minutenlang in das bleiche Antlitz ihrer Mutter gestarrt und den Frieden darin bewundert. Ihr waren wieder die Tränen gekommen. Sie war ausgefüllt gewesen mit dem Gefühl, ihrer Mutter ganz nah zu sein, so nah, wie sie es bis dahin nie gewesen war.
Als Linda nach der Beerdigung wieder heimkam, ging sie in die Küche und setzte Tee auf. Neben der Küchentür hing ein Jahreskalender. Die Geburtstage von Verwandten, auch von längst Verstorbenen, waren dort mit rotem Stift vermerkt. Von den Namen waren jeweils nur die Anfangsbuchstaben eingetragen, aber Linda wusste meist, wer gemeint war. Sie blätterte ihn sorgfältig durch. Da war ein Otto eingetragen, ein Cousin ihrer Mutter, genauso wie Onkel Max, den sie bei der Trauerfeier wiedergesehen hatte. Otto lebte nicht mehr, aber seine Frau Adelheid, die im August eingetragen war und ihren Lebensabend in Spanien verbrachte. Kaum einer war jünger als 60, 70 Jahre; in ihrer Familie gab es eben wenige Nachkommen, sie selbst war ja auch kinderlos geblieben.





























