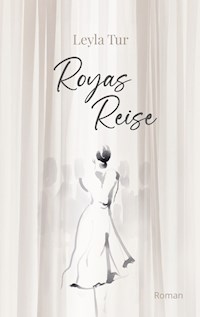
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt etwas besser machen Sechs Freunde, ein Wiedersehen und ein Versprechen: Die 36-jährige Roya, Ärztin in São Paulo, beschließt, sich auf die Suche nach ihren Freunden zu machen. Eine abenteuerliche Reise beginnt, die Roya nicht nur durch verschiedene Länder, sondern auch tief in ihr Inneres führt. Davon, was die Freunde verbindet, wie Schmerz geheilt werden kann und was es braucht, um Träume Realität werden zu lassen, handelt diese Geschichte. Wird Roya es schaffen, ihre Freunde zu finden und endlich das Versprechen von früher einzulösen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Den Weg zu studieren heißt, sich selbst zu studieren.
Sich selbst zu studieren heißt, sich selbst vergessen.
Sich selbst zu vergessen bedeutet, eins zu werden mit allen Existenzen.«
-Meister Dögen Zenji, 1200-1253
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Einleitung
Es ist Sonntagvormittag, als ich mit einem Kaffee in der Hand durch die Straßen von
Brooklin Paulista in São Paulo schlendere.
Vor ein paar Wochen habe ich dieses kleine Ritual eingeführt, spazieren gehen am Sonntag, wenn es meine Zeit zulässt. Es tut mir gut, mich einfach treiben zu lassen und meinen Gedanken nachzuhängen. Heute bin ich träge und irgendwie trübselig. Irgendetwas drückt mir auf die Stimmung. Der Kaffee schmeckt nicht und hat gegen die Müdigkeit nicht geholfen. Ich werfe den halbvollen Pappbecher in einen Mülleimer und überquere die Straße. Obwohl ich diese Strecke schon oft gegangen bin, nehme ich heute zum ersten Mal sehr bewusst den Park wahr.
Dicht und üppig breitet er sich vor mir aus.
Ich bleibe stehen und bewundere die mächtigen Ficus-Bäume mit ihren unregelmäßig geformten Stämmen und ihren weit ausladenden Ästen, die sich in der Höhe mit den Ästen der gegenüberstehenden Ficus-Bäume kreuzen. Ich gehe hinüber zu einem der Bäume und berühre behutsam den Baumstamm. Es ist still. Auf dem Weg, der unter dem Blätterdach und zwischen den Bäumen entlangführt, ist keine Menschenseele zu sehen. Es ist fast ein bisschen unheimlich. Ich gehe weiter und nach ein paar Minuten höre ich Stimmen, helle, fröhliche Stimmen, die mich magisch anziehen. Ich gehe in die Richtung, aus der ich sie zu vernehmen meine. Plötzlich erstarre ich und bleibe wie angewurzelt stehen.
Vor mir zwischen den Bäumen sehe ich Ambalika, Geleg, Salomo, Jandira, Lucas - und mich. Ich sehe uns als Kinder, als kleine Knirpse, die fröhlich miteinander spielen. Das kann nicht sein, das ist nicht möglich! Ich reibe mir die Augen, reiße sie auf und kneife sie zusammen, als könnte ich sie so scharf stellen und meinen Sinn austricksen. Aber die Kinder sind immer noch da. »Jetzt drehst du komplett durch!«, denke ich.
Langsam gehe ich zwischen den Bäumen hindurch auf die Gruppe zu. Hinter dem Park liegt eine Schule. Die Kinder haben ihre Schuluniformen an und müssen etwa zehn Jahre alt sein. Sie spielen auf dem Schulhof, sie lachen, wirken unbeschwert und frei. Ich bleibe vor dem Schultor stehen und beobachte sie. »Glück haben Kinder, denn sie haben keine schweren Gedanken«, denke ich. Ich gehe auf den Hof, niemand beachtet mich, bleibe bei Ambalika stehen und berühre sanft ihre Schulter.
Sie dreht sich um und ich schaue in die Augen eines anderen kleinen Mädchens, das mich etwas verstört anschaut und dann kichernd wegläuft. Erschrocken schaue ich mich um, das Bild von eben ist geplatzt wie eine Seifenblase.
Keine Ambalika, kein Geleg, kein Salomo, keine Jandira, kein Lucas.
Ich gehe zurück und setze mich unter einen Baum auf eine Bank. Ich bin ein bisschen verwirrt und zweifele an meiner Wahrnehmung. Was sollte das bloß bedeuten?! Dann wird mir klar, dass ich es tief in meinem Inneren eigentlich weiß. Mein Unterbewusstsein wollte mir nur ein bisschen auf die Sprünge helfen und mich an eine Sehnsucht erinnern, die ich lange erfolgreich verdrängt hatte. Es ist die Sehnsucht nach meinen Freunden.
Ein kurzer Stich fährt mir in die Brust, es tut weh. In diesem Augenblick taucht ein weiteres Bild aus meiner Kindheit auf. Es leuchtet vor mich hin, leuchtet in mich hinein.
Glasklar ist das Bild der Erinnerung, werden Konturen scharf, Farben kräfig und Stimmen laut.
Ambalika, Geleg, Salomo, Jandira, Lucas und ich.
Ich kann ihre Stimmen und meine eigene Stimme hören, erst ganz zart und dann immer klarer. Unsere Stimmen sind plötzlich nah, ich höre uns singen und sehe uns tanzen.
»Wir lieben unsere Mami, Mami, und wir lieben uns,
wir spielen immer such mich, such mich, und wir finden uns,
wir streicheln immer Katzen, Katzen, und wir freuen uns,
wir werden immer tanzen, tanzen, und zusammen singen, singen,
manchmal auch klatschen.« Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre.
Wir klatschten so fest und so laut wir konnten, wir nahmen uns bei den Händen und hielten sie ganz fest, wir bildeten einen Kreis und sangen unsere Kinderlieder. Nachdem wir fertig gesungen hatten, umarmten wir uns. Niemals hätten wir uns damals vorstellen können, dass wir uns einmal aus den Augen verlieren.
Zwanzig Jahre ist es her. Ich muss an unser Versprechen denken.
Als Kinder haben wir darüber gesprochen, als Jugendliche daran geglaubt.
Und als Erwachsene haben wir es vergessen. Oder verdrängt.
Wie konnte es dazu kommen? So ein Versprechen kann man doch nicht einfach übergehen.
Was hat das Leben aus uns gemacht? Haben wir uns auf die falsche Seite gestellt?
Wir, die kleinen Forscher hinter den Gräsern, so achtsam mit uns und mit anderen, neugierig und rein im Herzen, und immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Warum sind wir nicht mehr beisammen?
Und was ist mit unserem Versprechen, unserer Mission geschehen? Sie war das, wofür wir leben wollten. Sie sollte uns für immer begleiten und genau hier, in São Paulo, verwirklicht werden, in dieser Stadt der Gegensätze. São Paulo, für die einen ein extravagantes kulturelles Paradies, für die anderen ein nicht enden wollender Schrecken, ein Strudel aus Armut, Schmutz und Gewalt, für mich die Stadt,
die aus einer lockeren Freundschaft einen intensiven Bund geschmiedet hat. Wir wollten vor allem eins: etwas verändern.
Eine Welle der Schwermut überkommt mich. Ich sehne mich nach unseren farbenfrohen und unbeschwerten Kindertagen zurück. Nach heimlichen Unternehmungen, nach Ausgelassenheit und nach kühnen Einfällen, mit denen wir unsere Eltern regelmäßig auf die Palme brachten. Wir haben uns die Welt damals ein bisschen bunter gemacht. Wie konnten wir das, wie konnten wir uns vergessen?
Der traurige Gedanke, dass wir unser Wort nicht gehalten, unser Versprechen nicht eingelöst haben, nimmt mich plötzlich vollkommen ein.
Ein hupendes Taxi reißt mich aus meinen Gedanken. Ich fasse einen Entschluss.
Ich springe von der Bank auf, winke das Taxi heran, öffne die Tür und setze mich auf die Rückbank.
»Zum Flughafen bitte«.
Wenn die Traurigkeit überhandnimmt und ich mich im Gedankenkarussell gefangen fühle, muss ich an den einen Ort, an dem ich immer verstanden werde und zur Ruhe komme.
Mein Fluchtort. Mindestens einmal im Jahr mache ich mich auf den Weg dorthin, meistens spontan.
Dieses Jahr ist es mein erster Besuch. Ich brauche nicht viel, nur das, was ich bei mir habe, Kreditkarte, ein bisschen Bargeld, meine Papiere.
Mit dem Flieger bin ich in anderthalb Stunden dort. Als ich am Flughafen aussteige, nehme ich zum ersten Mal heute die Sonne wahr. Ihre beruhigende Wärme streichelt meine Haut und Haare.
Ich atme tief ein und inhaliere die zarte Sommerluft.
Ich habe Glück, für den Flug nach São Paulo Foz do Iguaçu sind noch Plätze frei.
Nachdem ich mein Ticket bekommen habe, setze ich mich auf eine Bank in der riesigen Flughafenhalle. Die knappe Stunde Wartezeit vertreibe ich mir damit, die vorbeilaufenden Menschen zu beobachten.
Welche Ziele sie wohl verfolgen? Ich lasse meinen Blick schweifen und fange hin und wieder den Blick eines anderen Menschen ein.
Ich sehe in lachende, traurige, nachdenkliche Gesichter.
Vielleicht bin ich nicht die Einzige, die nach Antworten sucht, denn in manchen Augen entdecke ich mindestens genauso viele Fragezeichen, wie in meinem Kopf umherschwirren.
In diesen Augen kann ich mich selbst erkennen.
Für einen Moment fühle ich mich nicht allein, sondern sehr verbunden mit anderen. Über Lautsprecher verkündet eine raue Stimme den Flug nach Foz do Iguaçu.
Ich spüre eine kribbelige Vorfreude und gehe mit meinem Ticket Richtung Gate.
Das Boarding verläuft reibungslos und kurze Zeit später sitze ich im Flieger. In zwei Stunden werde ich dort sein, wo es mich immer wieder hinzieht, am magischen Ort meiner Seele. Mein letzter Besuch ist fast ein Jahr her. Ich bestelle bei der freundlichen Stewardess einen Tomatensaft, den ich gerne mit Salz und Pfeffer trinke und schlage die Zeitung auf. Leider kann ich mich nicht ablenken und die Buchstaben tanzen vor meinen Augen. Irgendetwas ist heute anders als die letzten Male, als ich diese Strecke geflogen bin.
Eine Unruhe und eine innere Stimme, die mich einfach nicht in Ruhe lassen möchte. Was passiert gerade mit mir?!
Kurze Zeit später werden wir über Bordfunk aufgefordert, uns für den Landeanflug anzuschnallen. Nach der Landung kann es mir nicht schnell genug gehen, ungeduldig trete ich auf der Stelle und drängele mit den anderen Passagieren zum Ausgang.
Als endlich alle ausgestiegen sind, steuere ich direkt den Taxistand an.
Ich kenne mich aus, und nehme eine Abkürzung, um das Gedränge und die vielen Touristen zu umgehen.
Im Taxi denke ich an meinen letzten Besuch zurück.
Ich versuche mich an Details zu erinnern, aber wie schon im Flieger kriege ich sie nicht zu fassen, die Gedanken schwärmen in meinem Kopf aus wie aufgeregte Insekten. Das Taxi hält vor dem Eingang des Parque Nacional do Iguaçu.
Ich kaufe eine Eintrittskarte und steige am Besucherzentrum in den Doppeldeckerbus, der mich und die wenigen anderen Touristen ans Ziel bringen wird. Zu Fuß lege ich die letzte kurze Etappe zurück und werde ab und zu von einem zarten Sprühnebel erfrischt.
Mein Herz klopft wie wild und meine Atmung ist flach. Vielleicht habe ich Angst vor dem, was mich erwartet?
Ich strenge mich an, meine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren,
doch es will mir nicht gelingen. Dann geht mein Herz auf.
»Wie wunderschön«, denke ich.
Vor lauter Faszination beruhigen sich alle meine Sinne. Die Iguaçu-Wasserfälle sind für mich ein Traum und versetzen mich immer wieder aufs Neue in ein demütiges Staunen. Ein Wunder, das mir komplett den Atem raubt.
Stundenlang könnte ich mir dieses Schauspiel anschauen.
Sofort fühle ich mich leichter, frei von schweren Gedanken, und will diesen Zauber einfach nur auf mich wirken lassen.
Ich setze mich im Schneidersitz auf den Boden und lehne mich mit dem Rücken an das Geländer der Aussichtsplattform.
Überraschenderweise ist es heute ziemlich ruhig, nur wenige Touristen beobachten, so wie ich, das Spektakel.
»Niemandem kann ich mich so mitteilen wie dir.
Auch wenn ich meine Gedanken nicht laut ausspreche, sondern sie dir nur im Stillen verrate, du nimmst sie auf und strömst mit ihnen gewaltig weiter. Weißt du eigentlich, dass ich immer nur bei dir komplett loslassen kann? Du schaffst es, alle Emotionen aus mir herauszuholen.
Du verstehst mich. Mit dieser Wucht und Kraft, die du hast, gibst du mir immer ein gutes Gefühl.
Ja, es ist wahr: Du bist mein Gedankenleser, nur dir kann ich mein Herz komplett öffnen.
Deine unglaubliche Energie schenkt mir jedes Mal Erleichterung. Warum nennen dich bloß alle den Teufelsschlund? Für mich bist du ein Engel.«
Ich muss lächeln und vergesse für den Bruchteil an Sekunden die Schwere und die Traurigkeit, die mich heute in den Flieger haben steigen lassen.
Muss lächeln, weil von der Existenz meines geheimen Engels niemand sonst weiß.
»Heute möchte ich nicht schweigen und nur in Gedanken zu dir sprechen.
Heute möchte ich wirklich mit dir sprechen«, denke ich und spreche die nächsten Sätze leise aus:
»Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Freunde so sehr. Wir haben uns aus den Augen verloren.
Und wir haben unsere Mission nicht erfüllt. Heute wünsche ich mir, dass du mir antwortest. Niemals habe ich mich so sehr nach einer Antwort von dir gesehnt wie jetzt.«
Tränen fließen über meine Wangen, ich versuche erst gar nicht sie aufzuhalten.
Mein Weinen fließt durch die Wasserfälle, vermischt sich mit ihnen. Es fühlt sich an wie ein gewaltiges Beben,
das meinen ganzen Körper schüttelt. Ein stechender Schmerz macht sich in meiner Brust breit.
»Du musst etwas tun«, murmele ich vor mich hin.
»Nein, du wirst etwas tun!«
Ich habe einen Entschluss gefasst. Hier an meinem magischen Ort habe ich die Klarheit und die Antwort bekommen, die ich gesucht habe. Ich stehe auf, schnäuze mich einmal kräftig in mein zerknülltes Taschentuch, werfe einen letzten Blick auf die berauschenden Fälle und schlendere den Weg zurück. Ich fahre zum Flughafen und nehme den nächsten Flieger zurück nach Hause.
Nie zuvor war ich so geschafft von einem Ausflug zu den Iguaçu-Fällen.
Als ich zu Hause ankomme, schaffe ich es gerade noch, mich auszuziehen und aufs Bett zu legen.
Kurz darauf falle ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
1. Kapitel
Am nächsten Morgen erwache ich mit neuer Energie und fühle mich sehr gut.
Ich schwinge mich aus dem Bett, werfe meinem Ich vor dem Schlafzimmerspiegel ein Lächeln zu und mache mich fertig für den Tag.
Beim Frühstück blättere ich in der Zeitung.
»Darüber kannst du dir später Gedanken machen«, denke ich, während ich die Meldungen überfliege.
»Heute ist ein wichtiger Tag, heute fährst du zu Lalitja, zu Ambalikas Mutter.«
Nach dem Frühstück wasche ich mein Geschirr ab, schnappe meine Handtasche, setze mich ins Auto und fahre los.
Ich weiß noch genau, wo sie wohnt.
Die Straßen, auf denen wir als Kinder gespielt haben, haben sich wie ein Film in meinen Kopf eingebrannt.
Auch wenn die Freude überwiegt, Lalitja wiederzusehen, merke ich, dass ich sehr aufgeregt bin.
Ich knabbere auf meiner Unterlippe, mein Puls schlägt höher und meine Hände sind schwitzig.
Wie sie wohl auf mich reagieren wird? Ich nähere mich der Rua Francisco Dias Velho.
Als ich in die kurze Straße einbiege, kann ich an ihrem Ende schon das weiße Haus mit der großen Veranda und dem hellen Holzzaun sehen. Meine Hände kleben am Lenkrad, beim Einschlagen hinterlassen sie einen dünnen Schweißfilm auf dem Kunststoff. Ich parke direkt vor dem Haus, stelle den Motor ab und atme noch einmal tief durch. Kaum mache ich die Autotür auf, steigt mir ein himmlischer Duft in die Nase.
Beim Aussteigen werfe ich einen Blick in den gepflegten Garten und muss lächeln.
Wunderschöne, zierliche Rosen in zarten Rosa-und kräftigen Pinktönen schmiegen sich an den Zaun, die mutigsten und kräftigsten unter ihnen haben sich durch die schmalen Zwischenräume einen Weg auf die Außenseite zum Bürgersteig hin erkämpft.
Wie kostbare Schmuckstücke umschmeicheln sie den Zaun. Im Garten ist vor lauter Rosen kaum Wiese zu sehen. Nur hier und da gibt eine nicht bepflanzte Stelle den Blick auf ein wenig Grün frei, der geschotterte schmale Weg bis zum Haus ist rechts und links von hochgewachsenen weißen und roten Rosen flankiert. Lalitja hat ihre Rosen schon immer sehr geliebt. Auch daran erinnere ich mich noch gut.
Während wir Kinder draußen spielten, pflegte und hegte sie ihre Rosen mit einer Hingabe und einer Ruhe, die mich schon als Kind fasziniert hat.
Uns Kinder behandelte sie genauso. Sie war einfach sehr liebevoll.
Ich öffne das quietschende Holztor und stehe direkt in dem bunten Rosenbett.
Die betörenden Düfte begleiten meinen Weg zur Haustür. Mein Herz klopft schnell und mein Körper bewegt sich wie von allein. An der Tür angekommen, atme ich noch einmal tief ein und drücke auf die Klingel. Nichts passiert. Ich klingele noch einmal. Nichts. Als ich gerade zu einem dritten Versuch ansetzen will, öffnet sich die Tür.
Lalitja steht vor mir. Ich schaue ihr in die Augen, Lalitja schaut in meine. Dann lässt sie ihren Blick langsam an meinem Körper runter- und wieder hochgleiten, als ob sie sich vergewissern müsse, dass sie keiner optischen Täuschung erliegt, sondern ich wirklich in ganzen Stücken vor ihr stehe.
»Roya«, flüstert sie mit ihrer sanften, warmen Stimme. »Roya, du bist es wirklich.«
Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich falle ihr in die Arme und drücke sie ganz fest.
Sie lacht ihr warmes, herzliches Lachen und legt ihre rechte Hand auf meinen Kopf.
Kurz denke ich zurück an die kleine Roya, weil es sich gerade so anfühlt. Es ist schön, wieder mal einen so durch und durch vertrauensvollen Menschen zu sehen.
»Lass dich mal anschauen«, sagt sie und hält mein Gesicht mit beiden Händen vor ihres. Ich wische mir die Nase mit dem Handrücken ab und grinse.
»Hallo Chaachee«, sage ich, so wie ich es als kleine Roya oft gesagt habe.
»Was für eine Überraschung! Wie schön dich zu sehen!«, sagt Lalitja.
»Komm rein, mein Kind.«
Auch wenn ich mit meinen mittlerweile 36 Jahren vor ihr stehe,
bin ich für Lalitja noch immer das kleine Kind von damals.
Sie schiebt mich liebevoll durch die Tür in die Wohnung hinein.
»Komm, ich mache uns Tee«, sagt sie und geht mit schnellen Schritten in Richtung Küche.
Im Flur sieht noch alles so aus wie früher. An der Wand hängt noch immer der blaue Mandala-Teppich, auf der kleinen Kommode steht noch immer die schöne handbemalte Messingvase, ein wertvolles Familienerbstück, und auch die kleinen Elefantenfiguren sind, als direkter und etwas komischer Kontrast zu der dekorativen Vase, noch immer daneben aufgebaut.
Im Wohnzimmer bittet Lalitja mich, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Während sie in der Küche den Tee zubereitet, habe ich Gelegenheit, mich im Raum umzusehen.
Auch hier ist vieles noch so wie früher, als ich zum letzten Mal hier gewesen war.
Zum Beispiel das große senfgelbe Sofa unter mir mit den weichen Kissen, deren Muster an das eines Schachbretts erinnert, nur dass dieses hier kleinere Felder und eine Farbe mehr hat als ein Schachbrett.
Die Kästchen auf dem weichen Bezug sind abwechselnd in einem Creme-, Braun- und Bronze-Ton angeordnet.
Ich nehme eines der Kissen, drücke es leicht an meinen Bauch und umfasse es mit beiden Händen. Mein Blick fällt auf das Bild mit der schönen Tänzerin an der Wand gegenüber, das von zwei silbernen Wandleuchten, deren Schirme und Gestelle mit kunstvollen Ornamenten verziert sind, dezent angeleuchtet wird.
Auf der kleinen braunen Kommode etwas weiter rechts an der Wand bemerke ich etwas, was ich noch nicht kenne. Ein gerahmtes Bild. Ambalikas Opa. Lalitjas Vater. Das Bild hat früher noch nicht dort gestanden. Ein kleiner Stich fährt mir durch den Magen. Ich komme nicht auf seinen Namen, dafür schiebt sich unvermittelt die Erinnerung an einen bestimmten Tag in meine Gedanken.
Wir Kinder lümmelten im Wohnzimmer herum, genau hier auf dem großen, hellbraunen Teppich, der das Muster der Sofakissen hat. Wir spielten irgendetwas, ich glaube, es war Stille Post. Lalitja kam schnaufend herein und stellte zwei schwere, mit Wasser gefüllte Eimer mit jeweils einem kleinen Rosenstock ab. Ich hatte die Eimer schon im Flur gesehen.
Offenbar wollte Lalitja die Rosen nun im Garten einpflanzen. Wir konnten uns nicht einigen, was wir als nächstes spielen sollten.
Wir blödelten rum, Salomo ärgerte sich über etwas, das Geleg gesagt hatte und warf mit einem Kissen nach ihm.
Doch statt Geleg traf er versehentlich einen der Eimer, der daraufhin umfiel.
Eine braune Brühe aus Wasser,
Erde und Schmodder verteilte sich auf dem Holzboden und auf dem schönen Teppich. Lalitja, die zwischendurch verschwunden war, kam schimpfend zurück und schaute erst auf das Schlamassel am Boden und dann auf uns. Wir zeigten alle auf Salomo. Lalitja sagte nichts. Wortlos ging sie in die Küche und kam mit einem Kehrblech und einem Lappen zurück. Der Opa – ja, Raga hieß er! – saß auf dem braunen Sessel und winkte uns mit dem Zeigefinger zu sich.
»Ihr fünf«, sagte er mit seiner tiefen, aber sanften Stimme und schaute nacheinander Ambalika, Jandira, Geleg, Lucas und mich an,
»ihr habt alle gesehen, wie Lalitja die Rosen reingebracht habt.
Als Salomo das Kissen werfen wollte, hättet ihr ihn darauf aufmerksam machen können.
Es ist nicht nur seine Schuld. « Er machte eine kurze Pause und wir wagten nicht, etwas zu sagen oder uns zu rechtfertigen. »Dinge zu sehen und sie zu ignorieren«, fuhr Raga fort, »macht euch nicht automatisch zu Unschuldigen.
Ihr denkt, ihr könnt nichts dafür. Aber spätestens, wenn ihr Bekanntschaft mit Karma macht, werdet ihr merken, dass das nicht stimmt.
Hört bitte gut zu. Ihr seid noch sehr jung und das, was ich euch sagen möchte, ist wichtig: Ihr müsst gut aufeinander aufpassen.
Wenn ihr in Achtsamkeit, Liebe und Respekt euch und anderen gegenüber durchs Leben geht, werdet ihr starke Persönlichkeiten. Zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Es ist egal, wie andere sich verhalten.
Das könnt ihr nicht beeinflussen. Wichtig ist euer eigenes Verhalten. Vergesst das nicht.«
Ich habe damals nicht viel von dem verstanden, was Opa Raga sagte.
Aber das mit dem Aufeinanderachten hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. Und ich hörte mit zehn Jahren zum ersten Mal etwas von Karma.
Kurz darauf kommt Lalitja mit einem Tablett zurück, auf dem sie zwei Becher dampfenden Tee und eine kleine Schale mit Keksen balanciert. Sie stellt das Tablett auf dem Couchtisch ab und setzt sich auf das kleinere Sofa mir gegenüber. Ich setze mich aufrecht hin und lege das Kissen wieder an seinen Platz zurück.
Ich kann Lalitja ansehen, dass sie noch immer sehr überrascht ist.
»Roya, meine Liebe, wie geht es dir und was führt dich her?«, fragt sie.
»Ich … ich … also es ist …«, stammele ich.
Lalitja lächelt mir Mut zu.
»Ich habe den großen Wunsch
Ambalika wiederzusehen.
Lebt sie noch hier bei dir?«
»Ja«, sagt Lalitja. »Ja, sie lebt noch immer bei mir.
Sie wird sich bestimmt sehr freuen, wenn sie dich sieht. Und ich freue mich auch, dich zu sehen.
Ich vergesse diese wunderschönen Tage mit euch nicht und muss sehr oft an diese Zeit denken.«
»Wo ist sie denn gerade?«, frage ich.
»Sie ist auf der Arbeit.
Wenn du möchtest, kannst du hier auf sie warten.
Ich wollte gleich kochen und wir können nachher zusammen essen.«
Ich stimme zu und folge Lalitja in die Küche.
In der Küche riecht es nach Nelken und Zimt und ich weiß, dass es Chai gibt.
»Möchtest du ein Glas Chai?«, fragt sie und ich muss lachen.
Während sie aus den Küchenschränken die Zutaten für das Essen zusammensucht und sie zur Vorbereitung auf die Arbeitsplatte stellt, erzählt sie mir im Schnelldurchlauf, was in den letzten Jahren so los war.
Als sie alle Vorbereitungen getroffen und alle Zutaten, Töpfe und Pfannen zusammengesammelt hat, bindet sie sich die geblümte Schürze um und verkündet feierlich:
»Und heute koche ich Hähnchen mit Garam Massala und Peshwari Naan«.
Ich schmunzele.
Bei diesem Gericht wurden wir als Kinder irgendwie nie satt, weil sie es immer so lecker zubereitet hat.





























