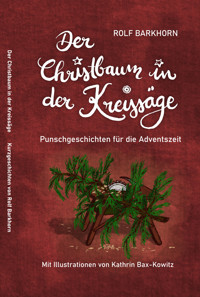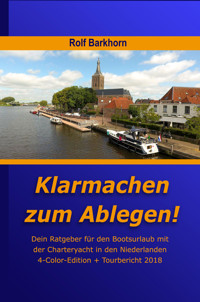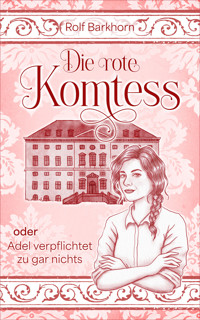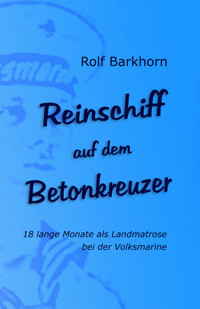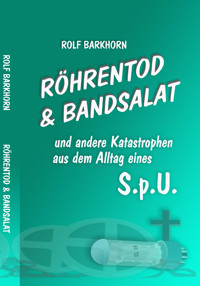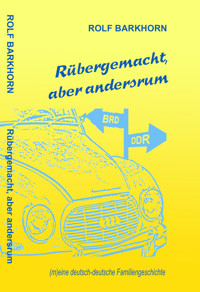
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eigenverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1967, fünfeinhalb Jahre nach dem Mauerbau, zieht es eine achtköpfige Familie von einem deutschen Staat in den anderen. Dafür muss sie keine lebensgefährlichen Selbstschussanlagen und auch keinen Stacheldraht überwinden. Sie wechselt ganz normal und unversehrt die Seiten - mit dem Auto. Denn ihre Reise führt vom Westen in den Osten - von der Bundesrepublik Deutschland in die Deutsche Demokratische Republik. Das autobiografisch geprägte Buch erzählt die Geschichte vom Grenzübertritt und dem daran anschließenden Aufenthalt im Aufnahmeheim Pritzier, das offiziell von der DDR-Innenbehörde geleitet und der Staatssicherheit dominiert wird. Der Autor berichtet in seinen persönlichen Erinnerungen von Erlebnissen der ersten Jahre in der Wahlheimat, von guten wie schlechten Erfahrungen im neuen Lebensumfeld, von Hoffnungen und Enttäuschungen und dem aus heutiger Sicht etwas bizarr erscheinenden Alltag im "real existierenden Sozialismus" der späten 1960er Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Rolf Barkhorn
Vorwort
Einleitung
Wir ziehen um
2. Kapitel
Reiseziel Berlin!
3. Kapitel
Lebensläufe
4. Kapitel
Das Prinzip Stuyvesant
5. Kapitel
Befristete Heimkehr
6. Kapitel
Rückkehr ins Neuland
7. Kapitel
Freundschaftsdienst
8. Kapitel
In der Preußen-Residenz
9. Kapitel
Am Rand der Welt
10. Kapitel
Kostbare Westware
11. Kapitel
Lernen in Filzpantoffeln
12. Kapitel
Doppelbock
13. Kapitel
Ganz auf Linie
14. Kapitel
Die Unkrautraucher
15.Kapitel
Kartoffelferien
16. Kapitel
Winterstrapazen
17. Kapitel
Das Referendum
18. Kapitel
Westbesuch
19. Kapitel
Motorschaden
20. Kapitel
Ein bisschen sesshaft
21. Kapitel
Heimatluft
Rolf Barkhorn
Rübergemacht,
aber
andersrum
(m)eine nicht ganz gewöhnliche
deutsch-deutsche
Familiengeschichte
Impressum
Texte: © Rolf Barkhorn
Lektorat: Jens Barkhorn
Umschlag: © Rolf Barkhorn
Coverzeichnung nach Fotovorlage
von: Michael Helsig
Überarbeitete Auflage
Edition 2023
ISBN E-Book: 978-3-9820941-5-1
Verlag: Eigenverlag Rolf Barkhorn
Wittholz Ring 4
18225-Kühlungsborn
Vorwort
Ich habe die erste Auflage dieses Buches im Frühjahr 2019 verfasst und im Eigenverlag veröffentlicht – mit gewissem Erfolg, über den ich mich freue. Vier Jahre später sah ich mich nun veranlasst, das Manuskript zu überarbeiten. Am Inhalt des Buches hat sich damit nichts Grundlegendes geändert. Nur im letzten Kapitel wurde eine interessante Episode hinzugefügt. Bei Lesungen bin ich mitunter über Satzkonstruktionen gestolpert, die mir nicht mehr gefielen. Das ist jetzt mit der überarbeiteten Version behoben.
Kühlungsborn, September 2023
Ich widme dieses Buch
meinen Eltern,
Heinrich Barkhorn (*1930 - † 2011)
und
Irmgard Barkhorn (*1930 – † 2013)
sowie meiner Schwester,
Amke Wegner,
geborene Barkhorn (*1953 - †2018)
Einleitung
Die Geschichte meiner Familie und damit auch meine eigene, die hier erzählt wird, begann wie für viele andere auch im Zwei-Staaten-Deutschland und setzt sich heute im vereinten Deutschland fort. Trotzdem ist und bleibt sie etwas ungewöhnlich für unsere Zeit. Denn wir waren eine von sehr wenigen Ausnahmen, als meine Eltern mit uns sechs Kindern im Frühjahr 1967 „rübergemacht“ sind.
Das Besondere bestand in der Richtung, in die wir uns für immer begaben, und das war keine ganzen sechs Jahre nach dem Mauerbau!
Denn wir mussten nicht wie andere Deutsche bei ihrer Flucht in den Westen noch todbringende Selbstschussanlagen und Stacheldraht überwinden. Bei uns ging die Reise in die entgegengesetzte Richtung. Wir fuhren mit dem Auto und offiziell, ganz freiwillig und körperlich völlig ungefährdet und unversehrt „in die Deutsche Demokratische Republik“, um fortan dort zu leben. Für mich als Kind war es nichts Schlimmes.
Nur die Trennung von meinen Großeltern tat weh. Ansonsten begegnete ich all dem Neuen mit einer großen Portion Neugier und ebenso viel kindlicher Naivität. Diese Naivität auch in Bezug auf die DDR mag man dann auch aus den Erzählungen immer wieder mal herauslesen. Aber ich habe alles so aufgeschrieben, wie ich es damals erlebt und auch gesehen habe, so authentisch wie möglich.
Die Kritik am System mag manch einem damit zu kurz kommen. Aber dessen Bewertung steht nicht im Vordergrund.
1. Kapitel
Wir ziehen um
Ich nehme es gleich vorweg, weil sonst oft an irgendeiner Stelle danach gefragt wird: Meine Eltern waren keine Kommunisten oder sonst irgendwie politisch aktiv. Sie waren sehr aufgeschlossene Menschen, die beide aus einfachen Verhältnissen stammten und die sich für keine harte Arbeit zu schade waren. Mit ihnen zusammen konnte man wunderbar feiern und gemeinsam lachen.
Aber man konnte sich mit beiden ebenso über Politik unterhalten und manchmal auch leidenschaftlich streiten. Jedoch politisch in einer sturen Richtung festgelegt waren beide nicht. Auch wenn meine Mutter gelegentlich mit etwas Stolz erzählte, dass ihr einst Wilhelm Pieck, der erste und einzige Präsident der DDR, im Jahr 1949 nach einem Arbeitseinsatz der Freien Deutschen Jugend in der Prignitz als Auszeichnung die Hand geschüttelt habe. Mutter stammte aus dem Osten, sie wurde in Pritzwalk geboren und wuchs dort bis zu ihrem 20. Lebensjahr auf.
Ihre Begegnung mit dem Kommunistenführer Pieck hatte sie dann auch nicht davon abhalten können, dem Ruf ihres älteren Bruders an die Nordsee zu folgen. Noch im selben Jahr setzte sie sich in den Zug und reiste in den Westen. Dort blieb sie und lernte meinen Vater, einen gebürtigen Bremerhavener, kennen. Wenn man es genau nimmt, begann mit dem Kennenlernen der beiden im Krankenhaus in Bremerhaven-Lehe unsere deutsch-deutsche Familiengeschichte.
Was für unsere Eltern stets wichtig war: Sie waren immer sehr stolz auf ihre sechs Kinder, ihre zehn Enkelkinder und ihre ersten Urenkel, die sie noch kennenlernen durften. Der enge Zusammenhalt, der uns Kinder über viele Jahre prägte, beeindruckte sie besonders. Uns selbst war es manchmal sehr peinlich, wenn mein Vater gegenüber Nachbarn oder Kollegen davon schwärmte, was für gut geratene und erzogene Kinder wir doch wären.
Mutter konnte das aber genauso gut. Im Grunde aber hatten sie ja Recht. Denn wir waren schon eine großartige Truppe und sind es im inzwischen veränderten und längst größeren Rahmen auch heute noch.
Sechs Kinder – Junge und Mädchen je dreimal hintereinander – das muss man erstmal hinbekommen. Aber die Kinderschar, die Mutter und Vater zu versorgen hatten, war mit einer der Gründe für den Umzug in die DDR. Denn wirtschaftlich ging es uns nicht gut. Mitte der 60er Jahre war auch das viel gepriesene Wirtschaftswunder im Westen längst wieder abgeflaut.
Das war in Bremerhaven, wo wir wohnten und unsere Eltern als Pächter einer Brauerei eine Gaststätte betrieben, nicht anders. Zur allgemeinen äußeren Krise gesellten sich bei uns noch andere Probleme hinzu. Die Brauerei, der die Kneipe gehörte, meldete Insolvenz an. Um das marode Gaststättengebäude selbst zu kaufen und zu sanieren, fehlte meinen Eltern das Kapital.
Dann erkrankte Mutter, sie war damals 36 Jahre alt, an einem schweren Nierenleiden. Die Ärzte diagnostizierten einen komplizierten Bakterienbefall. Angeblich hätte man den nur mit einer kompletten Entfernung der Niere beseitigen können. Für die teure Operation aber wollte die Krankenkasse meines Vaters, über die sie mitversichert war, nicht aufkommen. Das brachte das Fass zum Überlaufen.
Wir Kinder bekamen von all dem Ungemach anfangs nur Bruchstücke mit. Bis unser Vater uns eines Morgens alle um sich versammelte und uns erklärte: „Wir ziehen um – nach drüben, wir fahren noch heute los. Das Wichtigste packen wir sofort ein und nehmen es mit, den Rest lassen wir uns nachschicken.“
Dann bläute er uns Kindern noch ein, dass wir ab sofort zu „drüben“ nicht mehr „Ostzone“, sondern künftig nur noch „DDR“ sagen sollten und das jetzt schon mal üben könnten. Zu groß war seine Angst, gleich bei denen, die im Osten das Sagen hatten, anzuecken.
2. Kapitel
Reiseziel Berlin!
Wir hatten die hintere Ladefläche unseres „De-Ka-Wupptich“, wie wir unseren himmelblauen DKW-Kombi aus dem Baujahr 1958 liebevoll nannten, schon bis unters Dach vollgepackt, als wir uns dann noch zu acht in das Innere des Fahrzeugs quetschten.
Für Familienausflüge, die wir vorher oft unternommen hatten, hatten wir meistens eine andere Sitzordnung. Da saßen mein älterer Bruder Peter und ich hinten auf der Ladefläche und unsere vier Geschwister teilten sich die hintere Sitzbank. Wenn dann Polizei in Sicht kam, pfiff Vater und wir Brüder duckten uns. Das ging dieses Mal auf der Umzugsfahrt in den Osten nicht, weil die Ladefläche bis oben vollgepackt war.
Meine älteren Geschwister, Peter (fast 15) und Amke (13, die übrigens wirklich mit „m“ geschrieben wird) nahmen die Lütten, Jörg (fast 6) und Sigrid (fast 4), außen auf ihren Schoß und meine Schwester Monika (9) und ich (11) quetschten uns in die Mitte.
Wir Kinder hätten uns gewünscht, dass wir vor unserer Abreise nochmal zu unseren Großeltern fahren würden, um uns zu verabschieden. Ein großer Umweg wäre es nicht gewesen. Sie wohnten in einem kleinen Bremerhavener Vorort, direkt hinter dem Deich an der Wesermündung. Aber die Situation, in der unsere Eltern damals wirtschaftlich und mental steckten, war so angespannt, dass sie darauf bewusst verzichteten.
Dazu fehlte ihnen wohl auch der Mut. Und wer weiß, vielleicht hätte der große Umzug, der unser aller Leben beeinflusste, dann gar nicht erst stattgefunden. So aber rollten wir mit unserem Kombi in Richtung Osten. Die Fahrt dauerte schon ein paar Stunden. Denn mit voller Ladung konnte nicht so schnell gefahren werden.
Statt der Autobahn – sie begann damals erst kurz vor Bremen – wählte unser Vater eine alternative Strecke in Richtung Osten über Bundes- und Landesstraßen.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir in Lauenburg, kurz vor der Grenze, an eine Tankstelle fuhren und unser Auto ein letztes Mal im Westen vollgetankt wurde. Den Preis für einen Liter Benzin, der damals an der Zapfsäule stand, sehe ich heute noch vor meinen Augen: 48 Pfennig!
Es muss später Nachmittag gewesen sein, als wir am Grenzkontrollpunkt Lauenburg, also auf westlicher Seite der deutsch-deutschen Grenze, eintrafen. Denn es war Anfang April und es war noch recht hell.
Was sich dann dort abspielte, mutet vielleicht etwas abenteuerlich an. Es hatte sich aber tatsächlich so zugetragen. Denn wir hatten ein riesiges Problem! In der ganzen Eile beim Einpacken hatte meine Mutter ihren Personalausweis nicht finden können. Den hätte sie aber gebraucht, um über die Grenze zu kommen.
Denn meine Eltern hatten vor, auf westlicher Seite anzugeben, dass wir auf der Transitstrecke nach Berlin (West) unterwegs seien. Aber ohne Ausweis konnten sie das vergessen.
Ob mein Vater das, was er dann tat, genauso plante oder spontan den Einfall dazu hatte, konnte er selbst später nicht mehr genau erklären. Aber clever und auch ein bisschen wagemutig war es allemal!
Denn er hatte den DKW bis knapp vor den Schlagbaum gefahren, als er anhielt. Der westdeutsche Grenzbeamte kam an die Fahrerseite und fragte routiniert: „Wo wollen Sie hin?“.
Dazu gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Entweder man fuhr über die Transitstrecke B5 (in der DDR F5) nach West-Berlin, in eher seltenen Fällen weiter in Richtung Polen. Oder man fuhr zu einem Verwandtenbesuch in die DDR.
„Wir wollen nach Berlin“, betonte unser Vater deutlich. Der Beamte schaute ins Wageninnere und sagte: „Dann bitte die Ausweise von Ihnen und Ihrer Frau!“
Vater reichte ihm in aller Ruhe sein Dokument hin, zeigte auf Mutter und meinte betont leger: „Das Problem ist: Ihr Ausweis liegt hinten zwischen all den Sachen.“
Mit dieser Ausrede hoffte er, einfach durchgewunken zu werden. Der Grenzbeamte blieb jedoch hartnäckig. „Dann müssen sie den jetzt raussuchen. Den Ausweis oder einen Reisepass brauchen Sie nachher sowieso, sonst kommen Sie da drüben in der Zone keinen Meter weiter“, erklärte er.
Danach öffnete er entgegen allen Dienstregeln den Schlagbaum, weil schon ein weiteres Auto hinter uns stand und sagte in forderndem Ton: „Sie fahren da jetzt rechts ran und dann suchen Sie ihren Ausweis!“.
Im Glauben, diesen Fall fürs Erste geklärt zu haben, wandte sich der Beamte dem nächsten Fahrzeug zu. Diesen Moment nutzte mein Vater auf etwas riskante Weise aus. Er machte nicht einmal den Versuch, anzutäuschen, dass er nach rechts ranfahren würde. Weil auf westlicher Seite des Grenzüberganges außer dem schon geöffneten Schlagbaum kein anderes Hindernis mehr im Weg war, gab er einfach nur Gas und fuhr, so schnell es ging, davon.
Die Grenzbeamten unternahmen aber nichts. Sie sahen nur verblüfft hinterher!
Wir Kinder, selbst überrascht von der Aktion unseres Vaters, schauten etwas ängstlich nach hinten, um zu sehen, ob uns jemand folgt. Aber erstens sahen wir nichts, wegen des Gepäcks und zweitens war die Aufregung unnötig. Es kam niemand.
Bis zum DDR-Kontrollpunkt waren es noch ein paar hundert Meter oder mehr. Mir kam die Strecke unendlich lang vor. Dann kamen am rechten Straßenrand ein paar hohe Fahnenmasten in Sicht, mit auffällig großen Flaggen dran. Und ein großes Schild machte uns darauf aufmerksam, dass wir uns jetzt in der Deutschen Demokratischen Republik befinden würden.
Vater hatte es bei seiner riskanten Aktion so eilig gehabt, dass es auch den Grenzern auf östlicher Seite nicht verborgen blieb. Wie mag es aus deren Blickwinkel ausgesehen haben, dass sich ein voll beladenes Auto mit rasantem Tempo auf den eigenen Kontrollpunkt zu bewegte?
Die Reaktion fiel entsprechend aus: Als Vater den DKW endlich verlangsamte und auf den ersten von insgesamt drei Schlagbäumen des DDR-Grenzüberganges Horst (nahe Boizenburg) zurollte, stellten sich uns mit eiserner Miene drei Soldaten entgegen. Jeder von ihnen trug eine Maschinenpistole – zwar nicht im Anschlag, aber entschlossen mit beiden Händen haltend.
Und ein Offizier, der seine rechte Hand auffällig in der Manteltasche stecken ließ, ging mit eiligen Schritten auf die Fahrerseite zu und herrschte meinen Vater durch das inzwischen geöffnete Wagenfenster an: „Aussteigen! Alle!“
Dass er Deutsch sprach, wunderte mich. Denn in ihren langen Uniformmänteln und mit ihren Pelzmützen auf dem Kopf hatte ich die Grenzsoldaten für Russen gehalten. So hatte ich sie mir immer vorgestellt.
Unseren Eltern war schnell klar, dass die rasante Fahrt über die Grenze etwas provokant gewirkt haben muss. Zügig erklärte meine Mutter deshalb dem Offizier: „Wir wollen hierbleiben – in der DDR!“ Danach wurden die Grenzer freundlicher.
Wir wurden alle in eine Baracke des Kontrollpunktes geführt. Der Raum war gut geheizt und es roch auffallend nach Malzkaffee, landläufig als „Muckefuck“ bekannt.
Draußen ließ sich derweil ein in Zivil gekleideter Mann von Vater die Gangschaltung des DKW erklären. Dann fuhr er allein mit unserem Auto, mit all den Sachen drin, davon. Vater kam in die Baracke und blieb einen Moment stehen, bevor er sich zu Mutter setzte.
Sie hatte indes die Lütten mit ein paar Keksen versorgt, die zuvor einer der Grenzsoldaten gebracht hatte – zusammen mit einer Kanne Malzkaffee und einem Tablett voller Tassen.
In diesem Raum verbrachten wir Kinder eine lange Zeit, während unsere Eltern nebenan erst einzeln und dann nochmal zusammen von einem Grenzoffizier und einem Mann in Zivil ausgefragt wurden. Inzwischen war es draußen stockfinster geworden.
Dann wurden die Stimmen im Nachbarraum lauter. Es wurde auch mal gelacht.
Die Tür von draußen ging auf und ein kräftiger Mann in Zivil, bekleidet mit einer dicken schwarzen Lederjacke mit Pelzkragen, betrat die Baracke. Er blieb im Türrahmen stehen und sagte: „Es geht los! Alle mitkommen!“.
Inzwischen waren unsere Eltern zurück. Und so folgten wir dem großen Mann nach draußen, wo ein Kleinbus der Marke „Robur“ mit laufendem Motor stand. „Alles einsteigen!“, hieß es und dann setzte sich der Bus in Bewegung.
Ich wurde müde vom gleichmäßigen Dröhnen des Motors und der angenehmen Wärme im Bus. Aber ich bekam noch mit, dass wir eine Allee entlangfuhren, deren Bäume am Stamm auf eineinhalb Meter Höhe weiß angestrichen waren.
Etwas gespenstisch wirkte es auf mich, wie das Licht der Scheinwerfer von den weiß getünchten Baumstämmen reflektiert wurde. Dann schlief ich ein und wachte erst wieder auf, als der Robur vor einer grün gestrichenen Holzbaracke hielt. Wir waren im Aufnahmeheim in Pritzier, einem kleinen Ort nahe der Kleinstadt Lübtheen im damaligen Kreis Hagenow angekommen.
3. Kapitel
Lebensläufe
Baulich hatte das mit Maschendraht eingezäunte Gelände des Aufnahmeheimes eher den Charakter eines Lagers. Es befanden sich dort drei bis vier Holzbaracken, zwei mehrstöckige Häuser und eine Mehrzweckhalle. Neben dem bewachten Eingangstor stand ein Betonneubau. Darin war die Verwaltung untergebracht.
Errichtet worden war es bereits Ende der 1950er Jahre, also vor dem Bau der Mauer. Einerseits diente es dazu, um zuvor geflohene DDR-Bürger als reumütige Rückkehrer wieder aufzunehmen. Andererseits eignete es sich dazu, Leute wie uns, die aus dem Westen stammten und freiwillig in die DDR umziehen wollten, erst einmal genau unter die Lupe zu nehmen.
Die Vermutung, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR solche Lager nutzte, um eigene Agenten zurückzurufen und nach kurzen Instruktionen wieder gen Westen zu schicken, liegt nahe. Aber das zu beweisen, ist allenfalls eine Aufgabe für Historiker. Offiziell hieß die Einrichtung, so ist es heute nachzulesen: „Zentrales Aufnahmeheim des Ministeriums des Innern“1 und wurde im Amtsgebrauch mit AH Pritzier abgekürzt.
Für die ersten Tage und Nächte wurde uns als Familie ein einziger großer Schlafraum zugeteilt. Darin spielte sich unser Leben ab. Denn die Baracke, an deren Giebelseite sich neben dem Haupteingang eine kleine Wachstube befand, die Tag und Nacht besetzt war, durften wir vorerst nicht verlassen. Als Neuangereiste standen wir unter „Quarantäne“.
Eine durchaus übliche Praxis in Einrichtungen dieser Art. So werde vermieden, dass durch Neuankömmlinge mögliche ansteckende Krankheiten verbreitet würden, hieß es. Die Abgeschiedenheit diente jedoch auch dazu, die Neuen ausgiebig zu befragen, sie genau zu „durchleuchten“, bevor Kontakt zu anderen Bewohnern entstehen konnte.
Die Verwaltung sorgte dafür, dass zumindest bei allen über 14 Jahren keine Langeweile aufkam.
Sie bekamen Stift und Papier in die Hand gedrückt mit der Aufforderung, so ausführlich wie möglich, den eigenen Lebenslauf aufzuschreiben.
Das geschah mal einzeln unter Aufsicht von Heimmitarbeitern in der Wachstube, ein anderes Mal allein in der Unterkunft. Die Lebensläufe wurden dann gleich mehrmals eingefordert. Von uns Kindern musste mein ältester Bruder Peter mit ran und seine eigenen bis dahin noch wenigen Lebensstationen aufschreiben.
Ein großer Teil der persönlichen Habe war ebenfalls der Heimleitung zu übergeben. Dazu zählten neben Ausweisen, Urkunden, Zeugnissen und anderen Dokumenten auch Fotosammlungen. Ob diese sortiert in Alben eingeklebt waren oder lose in Kartons lagen, spielte dabei keine Rolle. Klar war: Die Leitung des Aufnahmeheimes wollte einen genauen Einblick in das Leben derer haben, die vorhatten, ihre neuen Mitbürger zu werden.
Die Lebensläufe wurden dann vermutlich von den „Experten“ der Heimleitung nach Abweichungen zwischen den verschiedenen Fassungen oder inhaltlichen Differenzen unter Familienmitgliedern untersucht.
Das war nicht alles. Mit „persönlichen“ Gesprächen wurde das Prozedere fortgesetzt. Gab es Abweichungen in den Lebensläufen, wurden diese angesprochen. Dazu hatten sich die Verfasser dann zu rechtfertigen.
Das offen zur Schau gestellte Misstrauen der Heimleitung kratzte an den Nerven so mancher Einreisewilliger. Das war bei unseren Eltern nicht anders. So erinnere ich mich, wie Vater eines Tages einen Schwächeanfall erlitt und ärztlich behandelt wurde. Zu bewundern war in dieser Zeit unsere Mutter. Hatte sie doch mit ihrem Nierenleiden damals ohnehin genug Probleme. Dagegen bekam sie vom Arzt des Heimes Tabletten, die das Leiden zumindest abzumildern schienen.
Drei Tage nach unserer Ankunft aber wurde die erzwungene Enge etwas gelockert. Wir Kinder konnten die Schule besuchen, die in der Nachbarbaracke eingerichtet war. Und frei bewegen innerhalb der Einzäunung des Heimgeländes durften wir alle uns tagsüber nun auch. Nur schlafen mussten wir weiter in der Quarantäne-Baracke. Dafür bekamen wir einen Raum dazu. Und unsere Mahlzeiten – denn es gab für alle kostenlose Vollverpflegung – nahmen wir jetzt wie andere Heimbewohner im großen Speisesaal des Kulturhauses ein.
Die neuen kleinen Freiheiten verbesserten die Gemüts- und Stimmungslage bei unseren Eltern. Sie kehrten dann abends mal in die Gaststätte ein, die sich auf dem Heimgelände befand. Dort lernten sie andere Bewohner des Aufnahmeheimes kennen.
Für uns vier älteren Kinder kam mit dem Schulalltag etwas Abwechslung hinzu, obgleich es keine Schule war, wie wir sie bisher kannten.