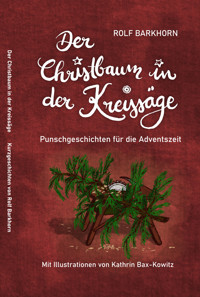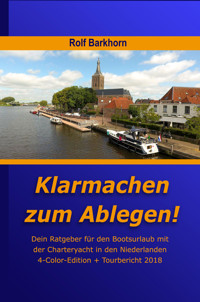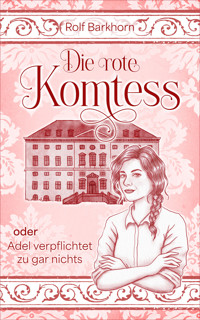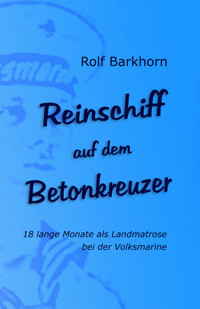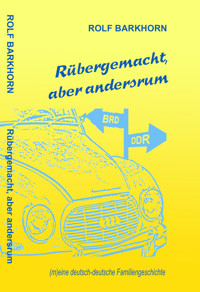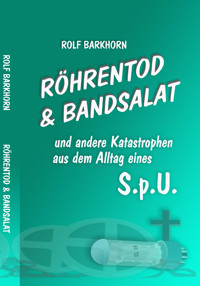
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eigenverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schallplattenunterhalter (kurz: S.p.U.), wie die Diskjockeys in der ehemaligen DDR offiziell hießen, mussten gut organisieren und improvisieren können. Ihre Kreativität war aber auch gefragt beim Ausfüllen der AWA-Titellisten. Dabei wurde gelogen, dass sich die Balken bogen. Denn das staatlich verordnete Verhältnis von 60:40 (Ostmusik:Westmusik) wurde allenfalls in der Prüfungsdisco für die Lizenz-Einstufung real umgesetzt. Auch das Ostpublikum tanzte lieber nach Westmusik. Der Autor war selbst seit 1974 als „S.p.U.“ im Einsatz und erzählt in seinem autobiografisch geprägten Buch aus dem Alltag auf und hinter der Discobühne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Rolf Barkhorn
Röhrentod
& Bandsalat
und andere Katastrophen aus dem Alltag eines
S.p.U.
Rolf Barkhorn
Röhrentod
& Bandsalat
und andere Katastrophen aus dem Alltag eines
S.p.U.
Impressum
Texte: © Rolf Barkhorn
Umschlag: © Rolf Barkhorn
Auflage: on-demand
Verlag: Eigenverlag Rolf Barkhorn
Wittholz Ring 4
18225-Kü[email protected]
Über den Autor:
Rolf Barkhorn
Jahrgang 1955
Freier Autor und Journalist
lebt an der Ostsee in
Mecklenburg-Vorpommern
Danke
Bei der Ausübung meines schönen Nebenberufes als „Diskotheker“ in vier Jahrzehnten durfte auch ich so manches Mal für meine Musikauswahl nach einer gelungenen Party den Applaus des Publikums einheimsen. Das war sehr nett von den Gästen, aber nicht verdient.
Denn dieser Lohn gehörte anderen. Die wahren Helden auf den Bühnen waren, sind und bleiben für mich immer noch die unzähligen Musiker, die ihren Instrumenten mit eigener Hand die schönsten Rhythmen und Harmonien entlocken können.
Sie sorgen mit ihren Kreationen dafür, dass wir Diskjockeys überhaupt etwas „zum Auflegen“ haben.
Deshalb gilt mein persönlicher Dank an dieser Stelle allen Musikern, Komponisten, Textern, Sängern und Produzenten dieser Welt. Nichts passt dabei besser als Zitat, als der wunderschöne Song von ABBA:
Thank You For The Music!
Einleitung Die bildliche Vorstellung des westlich geprägten Begriffes vom „Diskjockey“ mutet schon kurios an. Ein Jockey, der auf einer großen runden und schwarzen Scheibe reitet – welch lustiger Gedanke!
Aber das wird von der alternativen ostdeutschen Wortschöpfung, des „Schallplatten-Unterhalters“, die dann auch noch mit S.P.U (gesprochen ES-PE-U) ihre offizielle Abkürzung erhielt, noch getoppt. Ein Jockey mag es noch schaffen, auf einer Disk zu reiten. Aber wie unterhält man eine Schallplatte?
Der von DDR-Kulturstrategen Anfang der 1970er Jahre eiligst erfundene Name traf die Tätigkeit des Alleinunterhalters, der dem Publikum Musik „aus der Konserve“ auf die Ohren gab, schon deshalb nicht genau, weil nur die wenigsten SPUs auf den Bühnen der Kulturhäuser und Dorfgaststätten gern mit Schallplatten arbeiten mochten. Zum einen hielt sich das musikalische Angebot, das offiziell in den Läden des VEB Deutsche Schallplatte zu haben war, in Grenzen.
Zum anderen wollte man, wenn man doch mal ein Prachtstück ergatterte, nicht riskieren, dass die kostbare Scheibe im Einsatz vielleicht noch zerkratzt oder gar in einem Moment der Unaufmerksamkeit geklaut würde.
Nach meinem Buch „Rübergemacht, aber andersrum“, das vom Umzug meiner Familie vom Westen in den Osten (1967) und den ersten Jahren in der neuen ungewohnten Heimat, handelt, möchte ich meine Leser nun mitnehmen in den Backstage-Bereich der unteren Ebene der ostdeutschen Unterhaltungsbranche.
Als DJ, Diskomoderator oder wie wir es anstelle von SPU nannten, als „Diskotheker“, hatte ich nebenberuflich so manche Partygemeinde und tanzfreudige Jugendliche und Junggebliebene in Diskotheken und Bars unterhalten – behördlich genehmigt und offiziell als Amateur eingestuft mit einer Lizenz.
Auch nach der Wende übte ich das Hobby, jedoch dann unter weitaus besseren Bedingungen in vielerlei Hinsicht, noch lange aktiv aus und hatte dabei selbst immer noch viel Freude daran.
Wie die Jungfrau zum Kinde
Meine Karriere als DJ im Osten, die dann knapp vier Jahrzehnte andauerte, startete ich im Frühjahr 1974. Aber nicht etwa, weil ich das schon lange so geplant hätte, ich oder andere mich für außerordentlich talentiert hielten. Ich kam zu diesem Hobby, das anfangs nur selten auch ein einträgliches Geschäft war, wie die sprichwörtliche Jungfrau zu ihrem Kinde. Das passt dann wenigstens zu meinem Sternbild. Fast aus dem Nichts heraus, oder treffender formuliert, aus der Not geboren, übernahm ich zögernd diesen Job. Der Grund dafür: Ich wollte mich mit der Tristesse, die mich nach einem Standortwechsel umgab, nicht so schnell abfinden.
Ein halbes Jahr zuvor, im September 1973, hatte ich das Lehrerbildungs-Institut, an dem ich eine Fachschulausbildung absolvierte, gewechselt. Nach zwei Jahren Studium in der belebteren Bezirksstadt Potsdam, landete ich in einem beschaulichen Städtchen auf Rügen. Landschaftlich vortrefflich gelegen und auch städtebaulich eine Perle war und ist dieser Ort immer noch ein beliebtes Ziel bei Touristen.
Aber zu meiner Zeit ging es dort in der Zeit von Oktober bis April eher trist zu, zumindest anders, als ich es aus Potsdam kannte, wo schon in unserem eigenen Studentenclub einiges los war.
Das heißt nicht, dass in meinem neuen Studienort kulturell alles mausetot war. In der HO-Gaststätte, die über einen großen Saal verfügte, legte zwar nur selten jemand Schallplatten oder Tonbänder auf.
Dafür spielten regelmäßig Livebands zum Tanz, vielleicht mehr, als es heute außerhalb der Saison in vielen Seebädern der Fall ist. Aber im Vergleich zu meinem bis dahin gewohnten Stadtleben war es mäßig.
Bei den Tanzabenden in den Gaststätten wurde meistens zu nachgespielten englischen Titeln das Tanzbein geschwungen. Die beliebtesten Songs von Creedence Clearwater Revival (CCR) und anderen angesagten westlichen Bands hatten die Jungs schon ganz gut drauf. Nur kannte man nach drei Abenden die Titelliste der Combo schon auswendig. Es fehlte an Abwechslung. Wenigstens waren die Preise, die wir in der Gaststätte für Eintritt und Getränke zahlten, recht moderat.
Der Eintritt kostete 1,60 Mark. Wegen 50 Pfennig Ermäßigung lohnte es eigentlich nicht, beim Einlass den Studentenausweis zu zücken. Das taten wir dann doch ab und zu, denn ein Viertel Liter Bier kostete 51 Pfennig. Da konnte man sich dann fast eines mehr leisten.
Kurz nach Erhalt des monatlichen Stipendiums, von dem bei mir nach Abzug der Kosten für Unterkunft und Vollverpflegung netto noch 110 Mark übrigblieben, ging man halt öfter aus.
Da wir uns auch unter der Woche gern mal ein Bierchen und zum Essen ein Schnitzel für 3,90 Mark oder ein „Bauernfrühstück“ für 2,30 Mark in der Gaststätte gönnten, war jedoch relativ schnell wieder Ebbe in der Kasse. Den Jugendlichen, die in der kleinen Stadt oder dem Umland lebten, ging es nicht anders.
Außerdem wollte man nicht länger abhängig sein von Veranstaltungen, Öffnungszeiten und Preisen der Gaststätte. Zusammen mit Jugendlichen aus dem Ort und anderen Studenten aus dem Institut gelang es schließlich, die Stadtverwaltung zu überzeugen.
Eine Baracke, die auf einem Hügel und nicht so dicht an Wohnhäusern stand, sollte als neuer Treff für die Jugend zur Verfügung gestellt werden. Das war in kurzer Zeit mehr, als zu erwarten gewesen war. Wir bekamen sogar noch etwas Geld aus der Stadtkasse, mit dem wir die Räumlichkeiten, unseren „Jugendtreff“, in Eigenregie etwas aufhübschen konnten. Damit war das Raumproblem gelöst, aber nicht die Frage, wer sich um die Musik zu kümmern hat.
Um alles andere, was organisatorisch zu regeln war, sorgte sich eine Kommilitonin aus meiner Seminargruppe, die nicht wie wir anderen Studenten im Internat wohnte, sondern von der Insel stammte und bei ihren Eltern im Nachbarort wohnte.
Als Einheimische gehörte Claudia *1 zur Ortsleitung der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und sie hatte beste Kontakte ins Rathaus und in die Kreisstadt.
Aber sie wusste auch, dass es sich der neu gegründete Jugendtreff nicht leisten konnte, einen der mobilen DJs, die es damals noch in sehr geringer Zahl gab, für jede Veranstaltung einzukaufen.
Solche Leute mussten entsprechend ihrer Lizenz bezahlt werden. Transportkosten kamen meistens noch oben drauf. Es sollte für unseren neuen Treff eine eigene Lösung her. Die hing aber vor allem auch mit technischen Fragen zusammen. Über eine eigene Discoanlage verfügte der Treff anfangs noch nicht.
Mitten in der Renovierungsphase trafen wir uns mindestens zweimal wöchentlich zur „Krisensitzung“ - wie wir fortan die Zusammenkünfte unseres neu gebildeten Clubrates nannten - um das weitere Vorgehen zu beraten.
Natürlich traute mir unsere Clubchefin es zu, den Partybetrieb irgendwie in Gang zu bringen. Hatte ich ihr doch reichlich vorgeschwärmt, wie bunt mein Jugendleben zuvor in Potsdam gewesen sei. Aber die Idee, dass ich selbst als DJ in Aktion treten könnte, verwarf ich erst einmal.
Ich besaß zwar ein paar Dutzend Magnettonbänder mit Musik, die für mehrere Tage Party gereicht hätten. Aber das Philips-Tonbandgerät meiner Eltern, mit dem sie aufgenommen wurden, existierte längst nicht mehr.
Das hatte ich schon in unserem Studentenkeller in Potsdam kaputtgekriegt und nach dem Versuch, es selbst zu reparieren, war es dann Totalschrott.
Selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, mir ein neues Bandgerät der damals begehrten tschechischen Marke Tesla zu kaufen, hätte das noch Monate gedauert. Denn für die Geräte, von denen im Laden für „Radio und Fernsehtechnik“ (RFT) in der Kreisstadt sogar eines in der Auslage präsentiert wurde, gab es eine lange Warteliste. Das war trotzdem kein Grund aufzugeben. Probleme löste man im Osten Deutschlands am besten mit Vitamin B, was vor allem als Abkürzung für das Wort „Beziehungen“ stand. Gute Beziehungen zum RFT-Laden hatte ich da noch nicht, aber manchmal reicht es auch, jemanden zu kennen, der das hat, was man selber nicht besitzt.
So einen kannte ich und das sagte ich unserer Clubchefin: „Udo hat ein Tonbandgerät! Der muss herkommen und Musik machen“, war meine Lösung, die ich ihr vorschlug. „Wer ist Udo? Kann der das?“, wollte Claudia wissen.
Udo war ein gleichaltriger Freund aus dem Ort, hatte aber mit unserem Institut nichts zu tun. Er war Schüler der Erweiterten Oberschule, ein ruhiger anständiger und schüchterner Typ, auf den die Mädchen flogen.
Ich hatte ihn bei einer privaten Party kennengelernt, zu der er sein Tesla B57 mitgebracht und damit die Musik abgespielt hatte. Um das Tonbandgerät beneidete ich ihn. Aber nicht um die Musik auf seinen Bändern. Da hatte ich bessere! Allerdings war das Equipment damit noch lange nicht komplett. Uns fehlten noch eine Verstärkeranlage, ein Mischpult – und ganz wichtig: ein Mikrofon! Schließlich wollten wir in unserem Club nicht einfach so eine Non-Stopp-Mugge*2 abfackeln, sondern, wie es damals üblich war, die Titel auch ansagen, dem Publikum Informationen geben und es unterhalten.
Theoretisch jedenfalls musste das nach unseren Vorstellungen genauso ablaufen.
Als ich Udo das nächste Mal traf, ließ ich ihm keine lange Bedenkzeit, ich machte ihm klar, dass es ohne ihn im Jugendtreff gar nicht weitergehen würde.
Das gefiel ihm offensichtlich. Er sagte sofort zu. Ich bekam sein Wort und seinen Handschlag. Das zählte damals viel auf der Insel. Wegen der anderen Geräte fragten wir bei einem der Musiker aus der Liveband nach, die regelmäßig im „Deutschen Haus“ aufspielte.
Mathias, der von allen nur „Matze“ genannt wurde, versprach, uns für unsere erste Party einen Verstärker vorbeizubringen und gab uns den Tipp, doch auch mal bei Roland nachzufragen.
Das war ein damals schon umherreisender DJ, einer der ersten mit einer Amateur-Spielerlaubnis auf der Insel. Auch er wohnte in unserem Studienort. „Roland hat bestimmt noch etwas an Technik für Euch rumliegen. Außerdem arbeitet der als Elektroniker bei RFT. Der hat Vitamin B“, betonte Matze. Roland kannte ich bis dahin noch nicht persönlich. Aber ich wusste, dass er am folgenden Sonntagnachmittag im Deutschen Haus zum „Tanztee“ in Aktion sein würde. Die Plakate, die überall im Ort hingen, waren nicht zu übersehen. Also machten Udo und ich uns sonntags auf ins Deutsche Haus.
Draußen war es ungewöhnlich warm, so als wollte der Sommer schon etwas zeitiger vorbeischauen. Der Saal war trotz des Werbeaufwandes fast leer, obwohl es drinnen angenehm kühl war. Nur an einem Tisch saßen vier Mädchen, alle aus dem Internat unseres Institutes.
Auf der Bühne langweilte sich DJ Roland sichtlich als Unterhalter des Nachmittags. Das war für uns eine gute Gelegenheit, ihn anzusprechen, fand ich. Wir gingen die seitlichen Stufen zur Bühne hoch und begrüßten den groß gewachsenen Mann. „Was wollt Ihr hören?“, freute er sich über die vermeintlichen ersten Musikwünsche.
Wir winkten aber ab. Denn Musikwünsche wollten wir ihm nicht vortragen. Ich erzählte dass wir dabei wären, einen Jugendtreff einzurichten und erklärte ihm kurz unser technisches Problem. Seine Reaktion war unerwartet hilfsbereit.
Er versprach, sich unseren Treff anzusehen und bot auch gleich an, für „kleine Gage“ dort selbst mal aufzutreten. Mehr war an dem Tag für uns auch nicht zu erreichen.
Zuvor hatten Bekannte aus dem Ort und auch Mädchen aus dem Institut Roland als eingebildet beschrieben. Das konnte ich so nicht bestätigen. Udo teilte mit mir die Einschätzung, dass der RFT-Techniker uns gewiss weiterhelfen würde.
Claudia blickte dennoch skeptisch drein, als wir ihr von dem Gespräch mit dem erfahrenen Diskjockey erzählten. So recht traute sie ihm wohl doch nicht über den Weg.
Dafür hatte auch sie eine gute Nachricht für uns. Im Clubraum lagen ein paar große Faserplatten bereit, die wir für den Bau unseres Discopultes auf die Materialliste gesetzt hatten. Auch Töpfe mit Lackfarben hatte sie schon für uns besorgt.
Als Handwerker bin ich zwar eher mit den sprichwörtlich zwei linken Händen gesegnet. Udo war nicht viel talentierter als ich. Aber das Diskopult in den Maßen zweieinhalb Meter lang, einen Meter hoch und einen Meter breit, bestehend aus zwei Zentimeter dicken Spanplatten wurde unser handwerkliches Meisterstück. So fühlten wir uns jedenfalls. Wir zeichneten, sägten, hämmerten und schraubten drei Tage lang an dem Pult.
Dabei darf man nicht vergessen, dass wir damals weder Kreuzschrauben noch Akkuschrauber zur Verfügung hatten. Unsere Holzschrauben hatten Schlitze und wurden alle mit der Hand und einem normalen Schraubenzieher ins Holz gedreht.
An einigen Stellen kamen auch Nägel zum Einsatz, die sich allerdings beim Reinhämmern zu schnell verbogen.
Das fertige Prachtstück aber konnte sich sehen lassen! Durch Metallwinkel, die wir im Inneren mit den Platten verschraubt hatten, wurde es eine stabile Konstruktion, da hätte man auch drauf tanzen können. Auch konnte man als Erwachsener drauf schlafen. Das hatte ich später selbst ausprobiert.
Zu guter Letzt griffen wir noch zu Farbe und Pinsel und verpassten unserem Musiktresen ein auffälliges buntes Dekor aus roter und schwarzer Lackfarbe und übertünchten damit so manchen krumm geschlagenen Nagel.
Als das Kunstwerk fertig war, avancierte es sofort zum Hingucker im ganzen Raum. Als wir dann jedoch das einzige Stück unserer technischen Ausstattung, Udos B57, auf dem großen Tisch abstellten, sah es darauf schon etwas verloren aus.
Das erinnerte uns daran, dass wir unbedingt noch einiges zu besorgen hatten. Bandmusiker Matze kam uns zuvor. Er hielt sein Versprechen und brachte einen Nachmittag vor unserer Eröffnungsparty persönlich seinen Verstärker vorbei.
Es handelte sich um einen Regent 30H, mit den Maßen eines großen Reisekoffers. An das Gerät, einem sogenannten „Mischverstärker“ aus DDR-Produktion, schloss man gewöhnlich eine Gitarre und ein Mikrofon an, beides über Klinkenbuchsen. Auch der Klang ließ sich etwas regeln. Die Zahl 30 stand hierbei für 30 Watt Musikleistung. Kein üppiges Kraftpaket. Dieser Wert wird heute von jedem einfachen Küchenradio übertroffen.
Elektronisch betrachtet waren es sogar nur 25 Watt, die von den beiden 12,5 Watt starken Lautsprechern zusammen an Leistung aufgebracht wurden.
Interessant an diesem Gerät war das „H“. Es stand für die Möglichkeit, dem ausgehenden Ton noch so etwas wie einen Hall-Effekt dazuzugeben.
Für die Gesangsmikrofone der Livemusiker war das eine wichtige Komponente.
Das schonte ihre Stimme etwas. Denn mit Verstärkern dieser Leistung machten tatsächlich auch kleinere Bands Musik in gar nicht mal so kleinen Räumen.
Einen kleinen Raum zu beschallen aber hatten wir. Das dachte sich auch Matze, der Musiker, und sah amüsiert zu, wie wir das erste Mal mit seinem Gitarrenverstärker hantierten. Wir stellten die Kiste im Querformat auf unseren DJ-Tresen, steckten den Netzstecker in den Verteiler und warteten eine Weile. Immerhin wussten wir bereits, dass es sich bei dem Gerät um einen Röhrenverstärker handelte, der seine Kraft von Röhren bekam, ähnlich wie sie damals auch in den Fernsehgeräten steckten. Röhren brauchten einen Moment, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach ein paar Minuten drehte Udo die Regler voll auf, wir hörten ein monotones Brummen.
Das Brummen wurde immer lauter und unangenehmer. Dann war es still im Jugendtreff.
Na klar doch! Wir hatten noch gar keine Musik angeschlossen. Udo hatte ein Adapterkabel für den Klinkenanschluss mit, das er sich ausgeliehen hatte.
Er verband sein B75 schnell und direkt mit dem Verstärker. Doch so viel er auch an den runden Knöpfen drehte, die Kiste gab keinen einzigen Laut mehr von sich – nicht mal ein leises Brummen.
Matze ahnte sofort, warum: „So ein Mist, anscheinend der Röhrentod! Ich wette, eine der beiden EL34 ist hinüber – Oder beide. Ihr habt den Verstärker aufgedreht, ohne ihn zu belasten. Das können die Dinger gar nicht ab. Aber woher solltet Ihr das auch wissen?“, erinnerte er uns daran, dass wir in Sachen Musiktechnik reinste Greenhorns waren.
Aber wo sollten wir jetzt einen Tag vor der Eröffnung unseres Clubs Ersatzröhren herbekommen? „So etwas hat man dabei!“ belehrte uns Matze und holte aus einer Seitentasche der großen Hülle, in die der Verstärker eingepackt war, ein kleines Etui.
Darin lagen zwei Glasröhren, so groß wie Einlegegurken. Mit ein paar Handgriffen und einem Schraubendreher hatte der Musiker das Gehäuse des Verstärkers geöffnet.
Er betrachtete aufmerksam das Innere und zog mit etwas Kraft zwei etwas angestaubte Glasröhren aus ihren Sockeln.
Matze hielt nacheinander beide Teile vor seinen Augen gegen das Licht, so als könnte er ihr Inneres durchschauen, meinte dann aber: „Das sehe ich jetzt nicht, ob die andere auch durchgebrannt ist. Aber schaut mal, diese hier ist von innen an der einen Stelle ganz schwarz. Das ist der Röhrentod! Die ist nicht mehr zu gebrauchen.“
Ich erkundigte mich noch bei Matze, was denn so eine EL34 kosten würde, die wir ihm dann natürlich zu ersetzen hätten.
Doch er winkte ab. „Die kostet im RFT-Laden um die 20 Mark das Stück. Und manchmal auch gar nichts. Wenn unsere Urlauber aus Mühlhausen kommen, bringen die mir immer eine Kiste voll mit. Die stellen die Dinger da bei sich her. Sonst hilft Roland auch schon mal aus. Der sitzt ja bei RFT an der Quelle“, bemerkte Matze.
Während er uns erzählte, dass die Röhre für ihn zum Glück keine Mangelware und dieses Teil in fast allen Verstärkern verbaut sei, steckte er die vermeintlich heil gebliebene Röhre in einen der leeren Sockel und an den anderen Platz kam eine neue.
Aber er fasste die Glasteile jetzt nicht wieder mit bloßen Händen an. Er benutzte ein Taschentuch, mit dem er beide Röhren vorher nochmal gründlich von außen abgewischt hatte. „Wenn Du die beim Einsetzen mit schwitzigen Fingern berührst, ist das nicht gut. Dann bleibt Schweiß auf dem Glas und das verkürzt das Leben der Röhre gewaltig“, wurden wir belehrt.
Der Musiker schaltete den Verstärker wieder ein, als das Gehäuse noch offen war. So konnte er besser sehen, ob die Röhren anfingen zu glühen.
Als beide im Inneren ein kleines rotes Licht von sich gaben, schraubte er den Kasten wieder zu, drehte beide Lautstärkeregler auf null zurück und gab Udo ein Zeichen, dass er das Tonbandgerät starten könnte. Die Spulen auf dem Tesla begannen sich zu drehen und Matze drehte leicht an einem Regler.
„Ohh my sweet Lord…“ tönte es laut genug und so angenehm vertraut durch den Raum. Wir strahlten. Es geht doch!
Der Amateurmusiker erklärte uns dann noch, dass wir es leichter hätten, wenn wir an dem einen Eingang noch ein Mischpult anschließen könnten. Von dem wäre dann die Tonausgabe von zwei Bandgeräten zu regulieren.
Alternativ ginge als Zweit- oder als Drittgerät auch ein Plattenspieler, erläuterte er uns. „Wozu nutzen wir den zweiten Eingang am Verstärker?“, fragte ich neugierig nach. Matze griff noch einmal in die Seitentasche der Verstärkerhülle und kramte ein schwarzes Plastikmikrofon hervor.
„Hierfür“ sagte er und steckte den Klinkenstecker, der sich am anderen Ende der Mikrofonschnur befand, in die Buchse. Langsam drehte er den Regler auf, bis der Lautsprecher unerträglich quietschte. „Ich habe es zu dicht an den Lautsprecher gehalten. Also bleibt damit am besten hinter der Box, Hall muss auch nicht so viel dabei sein“, half uns unser Förderer noch mit ein paar Tipps, dann sah er kurz auf seine Armbanduhr und verabschiedete sich eilig.
Damit hatten wir für unseren ersten Auftritt, alles, was wir brauchten.
Auf das Zweitgerät verzichteten wir erst einmal, denn ein Mischpult ließ sich sowieso nicht gleich auftreiben. Wir waren ohnehin schwer davon überzeugt, dass die Lieder auf unseren Bändern sehr perfekt hintereinander passten. Wozu also ein Zweitgerät?
Die Titelfolge zu ändern, wäre doch gar nicht nötig, fanden wir. Wir frisch gebackenen Diskjockeys ließen uns von Claudia den Schlüssel für die Baracke geben und blieben noch allein bis kurz vor Mitternacht dort, um unser Equipment zu testen. So ganz ohne Publikum wurden wir mutig, probten ein bisschen, wie man Titel von T-Rex, The Sweet und Co am besten ankündigen sollte und berauschten uns an unserem Tun und ein paar Flaschen Bier, die Udo vorsorglich mitgebracht hatte.
So dämlich stellten wir uns bei unserem ersten gemeinsamen halb öffentlichen Auftritt dann auch gar nicht an. Bevor wir aber loslegen konnten, wurde der neu eingerichtete Treff erst einmal offiziell eröffnet. Dazu hatten sich auch Gäste eingefunden.
Der Bürgermeister war gekommen, hat unseren bunten Discotresen bewundert und gelobt und fand, dass wir technisch doch schon ganz gut und vor allem so modern ausgestattet wären. Ich wäre ihm am liebsten gleich ins Wort gefallen. Aber ich musste mich noch etwas gedulden.
Von der Kreisleitung des Jugendverbandes war ein Funktionär gekommen. Er lobte die Initiative der Jugendlichen und beglückwünschte uns zu unserem neuen Jugendtreff. Nach dem offiziellen Teil kam er zu uns und klärte uns darüber auf, dass wir uns bei öffentlichen Veranstaltungen nicht einfach so hinter ein Pult stellen und Musik abspielen könnten – ohne Lizenz. „Ihr kennt doch sicher Roland aus Eurer Stadt. Der hat die B-Stufe. Wenn der hier auftritt, könnt ihr sogar Eintritt nehmen. Aber ohne Lizenz und dann vielleicht noch den ganzen Abend Westmusik abspielen, das geht nicht auf Dauer“, belehrte er uns und riet, doch mal im Kreiskulturhaus anzufragen, wann der nächste Lehrgang für neue Schallplattenunterhalter starten würde.
Der Vortrag des Funktionärs hatte unsere anfangs gute Stimmung getrübt. Trotzdem suchten wir zusammen mit Claudia noch schnell das Gespräch mit dem Bürgermeister, der zuvor schon ein paar Mal nervös auf die Uhr gesehen hatte.
Wir erwischten ihn noch am Ausgang und klärten ihn darüber auf, dass das am Pult nur geliehene Technik sei. Damit erklärten wir dem Rathauschef auch, dass wir noch etwas Geld für die Anschaffung einer Anlage bräuchten.
Erst nach langem Zureden, bei dem unsere Clubchefin Claudia ihren weiblichen Charme versprühte, meinte er: „Gut, versucht mal so einen Kasten wie ihr jetzt dort habt, zu bekommen. Dann geht ins Rathaus und holt Euch in der Abteilung Finanzen einen Verrechnungscheck ab. Kauft nicht so teuer ein, aber was Ordentliches!“, mahnte er noch. Wir hatten also grünes Licht für den Kauf eines eigenen Verstärkers. Das Gespräch hatte sich gelohnt. Als die offiziellen Gäste weg waren, wurde es gemütlich. Wir hatten diesmal noch nicht plakatiert und wollten erstmal in kleinem Rahmen anfangen.
Aber immerhin wurde auch fleißig nach der Musik unserer Tonbänder getanzt. Ob dabei vereinzelt auch Musiktitel abgespielt wurden, die aus DDR-Produktion stammten, weiß ich heute nicht mehr.
Aber ich bezweifle es, denn weder ich noch Udo hatten Ostschlager auf unseren Bändern und der damals oft zu Unrecht verpönte und heute dafür zu Recht auch mal gepriesene „Ostrock“ steckte noch in seinen Kinderschuhen.
Ab und zu trauten wir uns sogar, eine Ansage zu machen. Unsere hochroten Köpfe, die wir dabei anfangs bekamen, konnten wir gut hinter dem Verstärker verstecken, denn wir blieben, wenn wir das Mikrofon in die Hand nahmen, einfach sitzen. So konnte man uns von hinten aus dem Publikum gar nicht sehen.