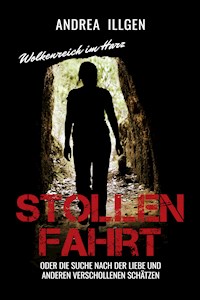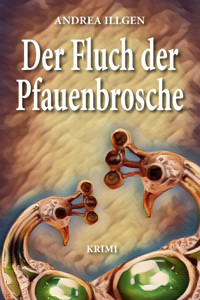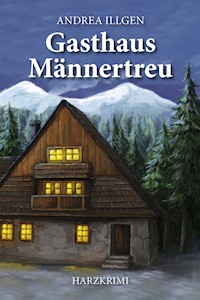Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henriette steht an einem Wendepunkt ihres Lebens. Das Scheitern ihrer Ehe stürzt die sonst so selbstbewusste Frau um die fünzig in eine tiefe Sinnkrise. Um einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden, verordnet sie sich selbst eine Auszeit. In den Tiefen der schottischen Highlands hofft sie, die Zeit und Ruhe zu finden, um ihre Gedanken zu ordnen und sich die Selbstzweifel von der Seele zu schreiben. Eine Autopanne verschlägt sie in den kleinen Ort Falconcross, wo sie an der Wand einer schlichten Wanderherberge ein Foto von Cleo Hildebrand entdeckt, die sich vor vielen Jahren umgebracht hat. Henriette und Cleo waren Schulfreundinnen, hatten sich aber nach dem Studium aus den Augen verloren. Nun macht sich Henriettes Gewissen bemerkbar. Hätte sie den Selbstmord verhindern können? Hat sie ihre Freundin gar im Stich gelassen? Sie beschließt, Cleos Weg, den diese seit ihrer Trennung zurückgelegt hat, nachzuzeichnen und den Grund für ihren Freitod herauszufinden. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit erfährt sie neben üblen Machenschaften, Ablehnung und bitteren Erkenntnissen auch alte Freundschaft, trifft auf skurrile Gestalten und lernt, was Vergebung heißt. Ihre Nachforschungen führen sie dabei von Schottland in den Harz – und zurück nach Falconcross. Denn neben all den spannenden Ereignissen begegnet sie auch einer unerwarteten Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Illgen
Meiner Freundin Renate gewidmet,
die ich nicht vergessen werde.
Anstelle eines Vorwortes
Wer sich für Schottland interessiert, wird viele Fakten und Orte wiedererkennen. Die hochdramatische Geschichte des Robert Bruce und seine Verbindung zum Douglas-Clan sind historische Tatsachen, auch die Geographie um Loch Ness, Drumnadrochit und Invergarry habe ich mir nicht ausgedacht. Falconcross aber und das Schloss Dun Alainn sind meiner Fantasie entsprungen, so wie alle Orte, die unmittelbar mit der Geschichte zu tun haben.
Zwar ist die gesamte Handlung, sowohl was die Personen als auch die Ereignisse betrifft, vollständig fiktiv, doch kann ich einige autobiographische Züge nicht leugnen. So wird dieses Buch vielleicht dazu beitragen, eine offene Geschichte endlich zu Ende zu bringen.
Impressum
Rückkehr nach Falconcross
ISBN 978-3-947167-73-9
ePub Edition
V1.0 (08/2019)
© 2019 by Andrea Illgen
Abbildungsnachweise:
Aquarell Tower House (Umschlag) © Jean-Marc Viglino
# 731921 | pixabay.com
Schattenriss (Innentitel) © inlitestudio
# 170338638 | depositphotos.com
Porträt der Autorin © Ania Schulz
as-fotografie.com
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected] · Web: wolkenreich-im-harz.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Titelseite
Widmung
Anstelle eines Vorwortes
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Über die Autorin
Mehr von Andrea Illgen
Kapitel 1
Die nächste Werkstatt
Schottische Namen haben etwas Lyrisches: Kinross, Torlundy, Morar und Glenshee klingen hochromantisch mit genau der richtigen Prise Tragik. Man denkt sofort an die unglückliche Maria Stuart und Balladen von Robert Burns.
Henriette von Schroeder hatte ihren eigenen Namen ihr Leben lang verabscheut. Bürgerliche und adelige Elemente in einem kurzen Begriff zusammenzufassen, war an Stillosigkeit wohl kaum zu überbieten.
Warum fing der Motor plötzlich an zu singen? Sie hielt die Luft an und lauschte. Ja, eindeutig, da war ein Geräusch. Das verhieß nichts Gutes. Wurde es lauter? Nein.
Wie schön war es doch, dass man mit zunehmenden Lebensjahren milder auf Unvollkommenheiten der eigenen Person blicken konnte. Wozu unter anderem das Altern an sich gehörte, fand Henriette. Sie war nicht weit über 50, und die Folgen, der fast unmerklich voranschreitende körperliche Verfall, waren unmissverständlich wahrnehmbar. Dabei war ihr durchaus bewusst, dass in dieser Darstellung ein Paradox lag. Alter ist eigentlich Mist, aber es macht ehrlich und duldsam dem Mist gegenüber.
Es wurde doch lauter. Ein sirrendes Geräusch. Hätte sie Öl auffüllen müssen? Wasser für den Kühler? Vielleicht hatte sich ein Laubblatt in der Ventilation verfangen, und sie brauchte sich nicht zu beunruhigen. Sie sah auf die Benzinanzeige. Genug drin. Fuhr sie zu hochtourig? Sie schaltete trotz der Kurven einen Gang höher. Kaum Veränderung. Das Fahrverhalten war zwar normal, aber sie nahm sich vor, an der nächsten Tankstelle alle Funktionen überprüfen zu lassen. Vorausgesetzt natürlich, es fände sich in dieser recht menschenleeren Gegend und um diese Zeit ein Automonteur.
Der Gedanke, dass fortschreitendes Alter erfreulicherweise mit wachsenden Einsichten verbunden ist, war nicht neu, aber er erfüllte sie wie auch die vorigen Male mit einer Form von Euphorie – was bin ich schlau, so in der Art. Sie griff in die Bonbontüte auf dem Beifahrersitz. Es war leider der Letzte. Sie biss auf die eine Seite des Einwickelpapiers und zog mit der freien rechten Hand kräftig am anderen Ende. Der ovale Karamellbonbon fiel in ihren Schoß. Nach drei Lutschbewegungen erfüllte der Geschmack ihren ganzen Mund. Das Wohlbehagen zog sich darauf durch ihren Körper, fast hatte sie das Gefühl, dass er die Kraft hatte, die Falten auf ihrer Stirn zu glätten.
In dem Moment brach das sirrende Geräusch schlagartig ab. Erleichtert gab sie Gas und fuhr die nächsten Kilometer voller Erleichterung im tiefen Genuss der wilden schottischen Landschaft um sich herum. Selbstreparatur, dachte sie, irgendwer schwor doch immer auf selbstreparierende Verhaltensweisen unserer alten Autos. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass eins der Lämpchen ihres Armaturenbrettes leuchtete. Lieber Himmel, die Lichtmaschine. Der Keilriemen musste es gewesen sein, das Singen, nun war er wohl gerissen, und sie hatte noch ...
Zusammen mit diesem Gedanken gab der Motor seinen Geist auf. Geistesgegenwärtig ließ sie ihren Wagen in eine Lücke zwischen zwei Bäumen auf den Seitenstreifen rollen, bremste ab und drehte den Zündschlüssel. Sah sie Rauch irgendwo? Nein, nichts. Schwer atmend lehnte sie sich in ihrem Sitz zurück. Und jetzt? Wo bekam man um fast sechs Uhr abends mitten im schottischen Hochland einen Abschleppwagen her? Wen konnte sie anrufen?
Das Handy. Hatte es noch genug Strom? Nein, natürlich nicht, so was passierte natürlich mitten in der Wildnis. Sie hatte Wildnis gewollt, jetzt hatte sie Wildnis. Wie weit war es bis Falconcross? Es konnte eigentlich nicht mehr sehr weit sein. Drei, vier Kilometer? Das wäre eine Stunde zu Fuß. Würde sie dort eine Werkstatt finden? Wenn nicht, gäbe es aber hoffentlich Leute, die genügend Mitgefühl und Hilfsbereitschaft entwickeln würden, um ihr weiterzuhelfen.
Na gut. Sie griff ihre Umhängetasche, überprüfte, ob alles Wichtige darin verstaut war, verschloss ihr Auto und machte sich auf den Weg. Linksverkehr bedeutete, dass sie wohl auf der rechten Seite der Straße gehen sollte. Ein kräftiger Marsch bei kaum Verkehr.
Ein Auto hielt. Die Frau fragte, ob sie helfen könne. Doch leider fuhr sie in die falsche Richtung. »Falconcross ist nicht mehr weit, noch eine Viertelstunde. Viel Glück!«, rief sie aus dem Fenster, das sich bei ihren letzten Worten fast schon wieder geschlossen hatte.
Die Schotten sprechen ein merkwürdiges Englisch, dachte sie. Es ist eine Art Starksprache, nachdrücklich, mit Kehllauten und einem außerordentlich rrrollenden R. Ich mag´s, dachte sie.
Da waren die ersten Häuser von Falconcross und – dem Himmel sei Dank – das Wort Garage in roter Schrift auf weißem Grund. Jack´s Garage, gleichbedeutend mit Jacks Autowerkstatt, davor zwei vorsintflutliche Tanksäulen ohne Überdachung.
Sie öffnete die Tür zur hell erleuchteten Werkstatt. Leise Musik, niemand zu sehen. Eine Drehbuchszene, dachte sie. In jedem ordentlichen Film ist das so: man ruft und der Monteur kriecht ölverschmiert unter einem Auto vor. Ich probier´s mal. Sie rief, und tatsächlich kroch ein Monteur ölverschmiert unter einem Auto vor.
Er wischte seine Hände in einem fleckigen Lappen ab. »Kann ich Ihnen helfen?«
Er sieht aus wie ein Hühnerdieb, dachte sie. Groß, breitschultrig, unrasiert, mit tief liegenden dunklen Augen in einem kantigen Gesicht, die schwarzen Haare leicht gewellt bis auf die Schultern fallend ohne eine erkennbare Frisur. Etwas fettig. Aber selbst wenn er tatsächlich Hühner stiehlt, brauche ich ihn.
Sie erklärte ihr Problem. »Okay, fahren wir.« Er zog seinen ehemals blauen Overall aus und knüllte ihn auf einen Stuhl mit schiefer Sitzfläche.
Sie ging natürlich zur falschen Seite des roten Kombis. »Wollen Sie fahren?«, fragte er.
»Nein, tut mir leid.«
Er räumte mit einer großen Bewegung den Beifahrersitz leer. »Stellen Sie Ihre Füße bitte nicht auf die CDs.« Während der Fahrt sagte er kein Wort.
Das Seil war schnell befestigt. Anscheinend setzte er voraus, dass sie wusste, wie man sich in einem abgeschleppten Auto verhält, denn sie erhielt weiter keine Anweisungen als: »Fahren Sie mir möglichst nicht drauf.«
»Es ist der Keilriemen«, sagte er, als beide in der Werkstatt vor der geöffneten Motorhaube standen. »Muss ich bestellen, wird dauern.«
Henriette starrte ihn an. Was sollte sie jetzt machen? Schweigsame Menschen hatten sie schon immer nervös gemacht. Könnte er nicht ein Hotel anbieten, oder eine Pension, oder einen Leihwagen, oder wenigstens Bedauern äußern?
»Nebenan ist ein Hostel. Versuchen Sie´s da. Und lassen Sie Ihre Telefonnummer da, falls was ist.«
Na, immerhin. Sie schrieb ihre Handynummer auf ein loses Blatt Papier und zerrte den großen Rucksack von der Rückbank. »Wie lange wird es dauern?«
Er war schon auf dem Weg in das abgeteilte Büro auf der Rückseite des hohen Raumes. »Fragen Sie morgen Abend nach«, rief er über die Schulter und war verschwunden.
Schotten, dachte sie, und schulterte ihren schweren Arc‘teryx, 1700 Gramm Leergewicht, der Rolls-Royce unter den Rucksäcken. Sie sind mürrisch und unzugänglich, schwer zu beeindrucken. Na ja, ich hab´s gewollt.
Draußen atmete sie tief die laue Abendluft ein. Lau mit einem Stich Kühle, genau richtig für kurzärmelige T-Shirts, die sie am liebsten zu ihren langen Baumwollröcken trug.
Das Haus nebenan, einstöckig wie die gesamte Bebauung, soweit sie sehen konnte, hatte einen hellgrünen Holzbeschlag und setzte sich dadurch unangenehm ab von den folgenden Bruchsteinhäusern beidseits der gewundenen Straße. Im Abendlicht zeigten sich die scharfen Konturen der einzelnen Steinblöcke in allen Schattierungen von hellgelb bis dunkelgrau, bunt und lebendig unter den ernsten Schieferdächern.
Hiker´s Hostel stand auf einem weißen Schild mit dunkelgrüner Schrift, Wanderers Herberge, na gut. Hoffentlich gab es Wasser aus der Leitung, und sie musste sich nicht im Fluss waschen, der den ganzen Weg hier herauf parallel zur Straße talabwärts geplätschert war. Strom und Telefon gab´s wohl den Leitungen nach zu urteilen, die unter dem Giebel ins Haus führten.
Das niedrige grüne Gebäude hatte durchaus Barackencharakter. Eine Stufe zur kaum nennenswerten Holzveranda, von der zwei Türen im rechten Winkel zueinander abgingen. Schlafräume stand auf der einen, Willkommen auf der anderen. Der quadratische Windfang schien aus einer Hausecke herausgeschnitten zu sein, das überstehende Dach wurde gehalten von einem dicken Balken, weißlich-grün gestrichen wie das Haus.
Willkommen ist wohl die richtige Tür, dachte Henriette. Sie drückte auf die Klinke und stand in einem recht großen Raum, der durch die niedrige Decke und seine Holzverkleidungen an eine Skihütte erinnerte. Ein langer Tisch mit hölzernen Bänken auf beiden Seiten, zur Innenwand des Raumes hin zwei Sitzgruppen aus kleinen Sesseln, ein Tisch voller Prospekte in der Ecke. Plakate und Aquarelle an den Wänden, die sich alle auf Botanik oder das schottische Tierleben bezogen. Auf der rechten Seite ein breiter Kamin, in dem Torf vor sich hin glimmte. Das schwache Feuer sonderte wenig Wärme ab, dafür aber den unverwechselbaren Geruch von brennendem Torf.
Nur ein paar Leute bevölkerten den Raum. Vier Personen saßen hinten am langen Tisch, eine Frau weiter vorn mit der Nase im Buch, den Löffel in der Hand über einem Suppenteller schwebend. Außer dem leisen Gespräch der beiden Paare war der Raum still. In der Luft hing ein leichter Geruch nach gebackenen Bohnen.
In der hinteren Ecke neben einer weiteren Tür eine Art Verschlag aus zwei halbhohen Holzwänden mit einer breiten Thekenoberfläche. ›Anmeldung‹ stand auf einem Schild über dem rothaarigen Kopf der Frau dahinter. Sie saß vor einem Bildschirm und sah ihr über eine Lesebrille auf der Nase entgegen. Henriette steuerte auf sie zu.
»Ja?«
»Ich suche ein Zimmer für heute Nacht, vielleicht auch länger.«
Die Frau rührte sich nicht, sah sie nur an. »Hm«, sagte sie dann auf Deutsch. »Du kommst aus Deutschland, stimmt´s?« Sie sprach mit dem schwachen Akzent der Leute, die seit Langem im Ausland leben. »Ich heiße Bella, du kannst in der Fünf wohnen.« Sie legte einen normalen Zimmerschlüssel auf die Theke mit einem Schildchen dran. »Badezimmer am Ende des Flures, Toiletten in der Mitte. Die Außentür ist immer offen, halte dein Zimmer deshalb verschlossen. Das Formular hier ausfüllen. 40 Pfund Anzahlung. Abrechnung am Morgen des Abreisetages. Brauchst du Handtücher?« Die beiden Schlingen des roten Bandes, an dem die Brille in Ruhestellung um ihren Hals hing, schwangen beim Reden hin und her.
Henriette war müde und mürrisch. Wahrscheinlich wunderte sie sich deshalb nicht weiter über die Tatsache, eine Landsmännin hier oben als Hostelwirtin vorzufinden. Sie versuchte sich daran zu erinnern, dass Müdigkeit unleidlich machte und zur Folge hatte, dass man alles schwarz sah. Morgen sieht alles anders aus, dachte sie, ich will erst mal schlafen.
»Die Küche ist hier«, Bella zeigte auf die Tür links von ihrem Verschlag. »Meine Gäste verpflegen sich selbst. Hast du Lebensmittel mitgebracht?«
»Ich hatte eine Autopanne. Mein Wagen steht in der Werkstatt hier nebenan, ich hatte nicht damit gerechnet ...«
»Du kannst ein Fertiggericht bei mir kaufen, Brot, Tee und was du sonst brauchst morgen früh im Laden schräg gegenüber.«
»Nein, danke, ich bin völlig hin, ich werde schlafen. Und ja, ich brauche bitte Handtücher.«
Die Außentür mit der Aufschrift ›Schlafräume‹ ließ sich leicht aufstoßen. Der schmale Korridor dahinter bekam sein Licht aus zwei Fenstern in der Wand rechts von ihr, an seinem Ende die erste Zimmertür. Hier machte der Gang einen scharfen Knick nach links und verlief im Weiteren an den Zimmern entlang.
Henriette blieb stehen. Das hatte sie noch nie gesehen. Neben jeder Tür leitete ein Fenster das letzte Licht des Maiabends durch die kleinen Zimmer hindurch bis in den Korridor. Tür wechselte sich mit Fenster ab, teils waren Gardinen davorgezogen, um den Einblick ins Innere zu verhindern, teils standen sie offen.
Sie öffnete die Nummer fünf und staunte. Viel mehr als vier Quadratmeter konnte die Grundfläche nicht betragen. Links stand ein Etagenbett, das nur wenig Platz zum Fenster ließ, durch das der Korridor sein weniges Licht erhielt. Geradeaus unter dem Außenfenster ein Holzstuhl, daneben an der Wand ein Hakenbrett. Klosterzellen sind wahrscheinlich größer und komfortabler, dachte sie, stellte ihren Rucksack auf den Stuhl, von dem er sofort halb herunterrutschte, und ließ sich auf das untere Bett fallen. Gut, dass ich die Kekse noch nicht aufgegessen habe, aber jetzt bin ich zu müde. Hoffentlich ist mein Auto bald fertig. Sie zog die Bettdecke über ihre Schultern und schnipste die Schuhe von den Füßen. Der letzte Gedanke, bevor sie einschlief, war tröstlich: es gab ja Leihwagen. Mehr als eine Nacht musste sie hier nicht überstehen.
Mitten in der Nacht wachte sie auf. Von rechts hörte sie lautes Schnarchen durch die dünne Wand, in einer größeren Entfernung diskutierten zwei Stimmen. Fröstelnd ging sie zum Fenster. Was sie sah, war so schön, dass sie kaum zu atmen wagte. Der große helle Vollmond ergoss sein weißes Licht über ein kurzes Stück Wiese, die zu einem schmalen Fluss abfiel. Sein klares Wasser sprang glitzernd über Geröll und dicke Steine. Büsche, Bäume und Hügel waren nicht mehr als dunkle Silhouetten vor dem Licht des Mondes, eine unendliche Variation in schwarz, blau und weiß, atemberaubend schön. Henriette stand an ihrem Fenster und dachte zum ersten Mal seit ihrer Autopanne: Es ist in Ordnung, dass ich hier bin, es wird alles gut werden.
Die Stimmen hatten aufgehört zu streiten, das Schnarchen war leiser geworden. Henriette dachte schuldbewusst an Waschen und Zähneputzen, zog endlich ihren Rock aus und kroch in das noch etwas warme Bett. Morgen, dachte sie, morgen mache ich alles, was ein zivilisierter Mensch eigentlich vor dem Schlafengehen tut.
Kapitel 2
Das Foto
Neue Erfahrungen: waschen in einem Gemeinschaftsbad, vor dem Frühstück einkaufen, Teekochen auf einem Gasherd, dem Henriette zutraute, unter ihren Händen zu explodieren. Aber auch: Tee und Käsebrot im Gras unter der warmen Maisonne am Ufer des kleinen Flusses. Naturgeräusche: das Gluckern des schnellen Wassers, das Rauschen des Windes in den Hügeln, Vogelgesang und in der Ferne ein krähender Hahn.
Henriette beschloss, sich mit ihrem Schicksal abzufinden. Die Autoreparatur würde dauern, ein Leihwagen teuer werden, wenn sie die Preise dieser armseligen Behausung bedachte. Aber Geld war nicht das Problem. Sie hatte sich ein Ziel gesetzt: Sie wollte eine Pension finden, ein Zimmer mit einem wunderbaren Ausblick auf die herrliche Landschaft Schottlands, und da wollte sie ein Buch schreiben. Ideen hatte sie reichlich. Eine geistige Metamorphose sollte es werden, die Erleuchtung einer Frau, die sich gejagt fühlt.
»Meinst du dich damit?«, hatte Theo gefragt an dem Abend, als sie ihm erklärt hatte, dass sie ihn und das gemeinsame Haus ganz und gar verlassen würde. Seine Frage hatte nicht herablassend geklungen, sie war ernst gemeint.
Ehrlicherweise konnte sie darauf keine Antwort geben. Es war ihr Geburtstag gewesen, den sie denkbar unerfreulich allein mit Theo begangen hatte. Er war lange vor ihr im Reinen mit sich und der Welt, Zweifel gab es nicht. In der ersten Nacht in der neuen Wohnung im Oberharz hatte sie mit ihren Erinnerungen gekämpft und versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum man Schlimmes besser im Gedächtnis behielt als Gutes. Ich kann die Leute nicht vergessen, die ich verletzt habe. Warum erinnere ich mich nicht ähnlich intensiv an die, für die ich gut gewesen bin? Bei heftigstem Nachdenken fällt mir niemand ein, dem ich ausdrücklich Gutes getan habe. Zu vielen war ich nett, aber nicht in dem Maß nett, wie ich andere verletzt habe. Weiter: Was fange ich mit dieser Erkenntnis an? Leute verletzt – ja, Leuten genützt – nein?
An dieser Stelle war der Gedanke mit dem Buch aufgetaucht. Es ging ja darum, Erinnerungen und Gedanken zu ordnen, zu klassifizieren. Könnte ein Niederschreiben eventuell dabei helfen? Der Inhalt vielleicht: Beispielhaft für das eigene Leben widerfährt einer Frau in ähnlicher Situation eine Art Katharsis, ein gigantisches Aha, bedeutend eine Befreiung von seelischen Konflikten allein durch die Kraft möglicherweise sehr schmerzhafter Gedanken und Erinnerungen. Klang ganz schön abgedreht, dachte sie. Katharsis ist ein großes Wort, aber wer Gedanken deutlich machen will, muss zuspitzen.
»Und was machst du so lange mit deinem Beruf? Wirst du nach einer so langen Pause noch singen können?« Wieder war kein Vorwurf in seiner Stimme gewesen. Sie hatte schon vor der finalen Diskussion gewusst, dass sie keine Beschimpfung oder Beleidigung zu erwarten hatte. Er würde nicht aus Enttäuschung ihre Verfehlungen aufzählen wollen. Theo lebte und ruhte in sich; was ihm widerfuhr, sah er als schicksalhaft. Und ein Narr, das war seine feste Überzeugung, der mit dem Schicksal hadert. Heute ist heute, gestern ist vorbei und nicht zu ändern, und morgen – was sein wird, wird sein.
Henriette hatte für seine Form des Fatalismus nicht viel übrig. »Eine praktische Weltanschauung. Du vergisst dabei, dass das, was du heute tust, immer auch das fortsetzt, was du gestern getan hast.«
Was den Gesang anging, hatte er ohne Zweifel Recht. Eine ausgebildete Stimme wie ihre braucht regelmäßiges Training, um ihre Schönheit und Elastizität zu bewahren. Aber es war ihr auch klar, dass nur eins ging: das große Aha oder Singen. Ihre Wortwahl amüsierte sie, theatralischer ging es wohl kaum.
Invergarry, am Kaledonischen Graben gelegen, etwas südlich vom Loch Ness, war ihr vorläufiges Ziel gewesen. Von dort aus wollte sie sich zum Loch Kilmannock durchschlagen, ein See oben in den Highlands, an dem es eine Pension geben sollte ohne viel zivilisatorischen Schnickschnack, nur Landschaft und Himmel. Dort oben, dachte sie, sollten genug Ruhe und Frieden herrschen, um ein Buchprojekt zu beginnen. Jetzt war ihr Auto defekt, was bedeutete, dass der ganze Plan durcheinandergeraten war.
»Bleibst du noch eine Nacht?« Bella stand in der Hintertür, die zur Küche führte.
Henriette rappelte sich hoch und streckte die Glieder. »Ich muss erst in der Werkstatt nachfragen, reicht es, wenn ich es dir nachher sage?«
Bella hatte die Hände in die Hüften gestemmt. Sie sah wehrhaft aus mit ihrem Schopf rotgelockter Haare, die zu allen Seiten dem Gummiband entkommen waren und wie eine rote Glorie um ihren Kopf standen. Ihr kräftiger Oberkörper steckte in einer weißen Bluse, über der sie eine blau-grau-karierte Weste trug, der gleiche Stoff, aus dem auch ihr Faltenrock genäht war. Sie stand dort in Licht gebadet wie eine schottische Kriegerin. Es fehlte, dass sie in der Hand die Streitaxt schwang.
»In Ordnung, bis zwölf muss ich es wissen.«
Die Autowerkstatt war menschenleer. In Henriette stieg der Ärger hoch. Hätte er nicht Bescheid sagen können? Na gut, sie sollte ja erst abends nachfragen. Sie setzte sich auf den dünnbeinigen Stuhl, der vor der Werkstatt in der Sonne stand. Was für eine Idylle. Seit sie wach war, hatte sie kein Motorengeräusch gehört. Jenseits der Straße stieg das Land sanft an zu einem grasbewachsenen Hügel, dahinter war der nächste zu sehen, dahinter wieder einer. Die Hänge zeigten große Flecke brauner Heide – sie würde erst später grün werden. Aus früheren Schottlandreisen wusste sie, dass es hier möglich war, ohne Weg einfach querfeldein zu gehen, denn es gab wenig Baumbestand. Die eingeschlagene Richtung konnte man immer im Auge behalten. Aufpassen musste man an den moorigen Stellen; jede noch so kleine Senke barg nassen Boden, zu erkennen an der hellgrünen Farbe.
Der Anblick machte Lust zu laufen. Kurzentschlossen stand sie auf und ging zurück zum Hostel. Noch eine Nacht in der kargen Zelle war nicht gerade das, was sie sich wünschte, es schien aber im Moment die einzige Lösung zu sein.
Auch der – was? Tagesraum? Aufenthaltsraum? – war menschenleer. Die Tische saubergewischt, kein Krümchen am Boden, die Fenster weit offen, um Vogelgesang und die warme Maisonne hereinzulassen. Henriette wollte auf Bella warten. Sie bummelte herum, betrachtete die Plakate an der Wand, informierte sich über seltene Tiere des Hochlands, erfuhr, dass es sogar Orchideen zu entdecken gab, nahm Warnungen vor offenem Feuer in der Natur zur Kenntnis und landete schließlich am Empfangstresen. Eine ganze Horde von Einhörnern in unterschiedlichster Gestaltung bevölkerte ein langes Regal an der Rückseite. Porzellan, Wachs, Horn, Plastik, Holz, Messing; kitschig, stilisiert, realistisch, jedes nur denkbare Material und jede nur mögliche Stilrichtung waren vertreten. Das Einhorn als Wappentier Schottlands, Bella im Schottenkaro – dazu passte ein großes Stickbild mit dem Wappen des Douglas-Clans: unter einer Sternenreihe prangte ein gekröntes Herz. Bella schien viel von schottischer Folklore zu halten.
Rechtwinklig dazu eine Reihe gerahmter Fotografien. Henriette hatte sich schon immer dafür interessiert, welche Art Fotos sich die Leute an die Wand hängten. Schnappschüsse oder kunstvoll retuschierte Porträtaufnahmen, die eigene Person mit im Bild oder bescheiden abgeschnitten. Bella prangte auf fast allen Fotos. Hier hielt sie eine Art Preisschale in den Händen, dort posierte sie mit anderen Personen im gleichen Karomuster, Clanangehörige offenbar. Henriette vermutete, dass das blau-graue Karomuster der Douglas-Tartan war, das Muster, das diesen Clan repräsentierte.
Daneben das Foto einer recht zerschlissenen Fahne. Henriette holte ihre Lesebrille aus der Umhängetasche. Raibreart a briuis – sollte das vielleicht Robert Bruce bedeuten? Henriette hatte eine Menge über Schottland gelesen, Robert Bruce stand durchaus in Verbindung mit dem Douglas-Clan. Sie nahm sich vor, Bella zu fragen, ob sie eine besondere Verbindung zu Robert Bruce und den Douglases hatte.
Ein größerer blauer Bilderrahmen umschloss eine Reihe Fotos, die zu einem Herz angeordnet waren, mittendrin in roter Schrift Mum zum 54. von Merlin. Sie zeigten einen immer weiter heranwachsenden Jungen neben Bella, mit und ohne schwarz-weißem Border Collie, später neben einer jungen Frau im schwarzen Kostüm. In seinen jungen Jahren in Kinderkleidung, als Teenager dann im vollen Schottenwichs mit Barrett und Messer am Knie. Als erwachsener Mann trug er einen Anzug. Wahrscheinlich war er Bellas Sohn. Gab es einen Vater? Henriette suchte, fand aber niemanden, der in diese Rolle gepasst hätte.
Weiter rechts ein Foto mit fünf Personen. Henriette rückte näher. Umgeben von hohen schneebedeckten Tannen stand die kleine Gruppe vor einem holzbeschlagenen Haus, einer Skihütte vielleicht. Alle waren jung, maximal 30, zwei Männer und drei Frauen. Da war Bella und neben ihr ..., das war ... , das war Cleo. Unverkennbar.
Henriette machte im Zeitlupentempo zwei Schritte rückwärts und setzte sich auf eine Bank. Cleo Hildebrand. Gefühle stürmten von allen Seiten auf sie ein, nahmen ihr fast die Luft. Schlechtes Gewissen als allererstes, dann Reue, schließlich Ärger, Wut, Verletzung und Trauer. Dazwischen – wie Blitze – helle Flecke wie Zuneigung, Behaglichkeit, Sicherheit und viel Sehnsucht.
»Hast du dich entschieden?« Bella ging an ihr vorbei hinter ihre Theke. »Willst du noch eine Nacht bleiben?«
Sollte sie Bella fragen, sollte sie den Namen Cleo erwähnen? Was würde er auslösen? Wollte sie überhaupt was über Cleo erfahren? Erst nachdenken, dann reden. »Ja, ich bleibe, wenn das geht.«
»Okay, noch 40 Pfund bitte.«
Henriette setzte alles Verlangte in Gang, stopfte die Quittung in ihre Umhängetasche und ging nach draußen ins grün-goldene Sonnenlicht. Nicht handeln, erst denken. Wieso um alles in der Welt wurde sie ausgerechnet jetzt an Cleo erinnert?
Sie schlug einen Bogen um den Laden des Dorfes und begann den Anstieg zum Gipfel des Hügels. Nach einem kurzen Stück auf einer geschotterten Straße bog ein schmaler steiniger Weg nach links ab und wand sich zwischen Heide und Moosen, niedrigen Blumen in vollerblühter Schönheit und weiten Wiesenflächen bergauf. Auf halber Höhe endete er. Henriette drehte sich um. Weit unten lag Falconcross; die wenigen Häuser folgten dem Lauf des Flusses, ebenso wie die schmale Straße, die weiter nach Nordwesten führte. Sie atmete schwerer, als ihr lieb war. Aus der Übung, dachte sie, aber darüber denke ich jetzt nicht nach, keine Kohlen auf mein Haupt.
Fest entschlossen machte sie sich schwitzend und keuchend an den weiteren Anstieg. Das Gras war jetzt kurz, auf dem weichen Boden fiel das Gehen leicht. Jeder Schritt brachte sie weiter nach oben, wo eine herrliche Aussicht lockte, geknüpft an die Genugtuung, es bis oben geschafft zu haben. Vielleicht ergab sich dort auch eine neue Sicht auf ihr Problem. Denn Cleo war schon lange tot, und das Gefühl, an ihrem Tod beteiligt zu sein, hatte Henriette zwar verdrängen, aber nie ganz abschütteln können.
Oben auf dem Berg saß sie lange im warmen Gras und betrachtete die Landschaft unter und um sich, ihre Veränderung im wandernden Licht der Sonne. Sie horchte auf die Geräusche um sich herum, das leise Rascheln des Windes im Gras, summende Käfer, knisternd wandernde Insekten, in der Ferne Kuhgebrüll, Vogelgesang, das Gluckern
einer Quelle, ein Hund bellte, Schafe blökten, vereinzelt Motorengeräusch. Dann machte sie die Augen zu und versuchte, sich zu erinnern, was sie gerade gesehen hatte. Armselig, kaum etwas stimmte. Merkwürdig, dass sie nicht besser darin wurde, obwohl es eine ihrer bevorzugten Konzentrationsübungen war.
Sie zog ein Tuch aus ihrer Tasche, breitete es aus und legte sich lang hin. Wenn es stimmt, dachte sie, dass ich an meine Versäumnisse stärkere Erinnerungen habe als an das, was ich an Wohltaten verteilt habe, hat das möglicherweise einen Grund. Wen hatte sie am stärksten verletzt? Das, musste sie sich eingestehen, konnte sie gar nicht beurteilen. ›Was den einen umwirft, rutscht dem anderen den Buckel runter‹, war eine Einsicht, die sie früh gelernt hatte. Was sie aber genau wusste, war, dass sie am Ende der Freundschaft mit Cleo alle Regeln gebrochen hatte. Ihre eigenen Regeln natürlich, Cleos Regeln waren andere gewesen, das wusste sie. Aber nur mit dieser scharfen Formulierung kann ich mich dem Thema überhaupt nähern, dachte sie. Nichts weichspülen, Licht in die Gedanken hineinlassen, vielleicht kann ich so später mit ihnen abschließen.
Sie entdeckte, dass der überraschende Anblick von Cleo auf dem Foto sie mehr aufgewühlt hatte, als sie noch vor kurzem bereit gewesen wäre, sich einzugestehen. Das hängt mit meinem Buchvorhaben zusammen, dachte sie. Cleo ist das perfekte Beispiel für unbewältigte Dinge der Vergangenheit und mein schlechtes Gewissen.
Mit dem Blick in die ziehenden Wolken war ihr plötzlich klar, was sie als Nächstes tun würde. Erleichtert über die – wahrscheinlich vorläufige – Entwirrung eines gedanklichen Knotens und auf diese eine Weise mit sich im Reinen, setzte sie sich ein Ziel. Parallel zu ihrem Buchprojekt oder sogar stattdessen würde sie alles daran setzen, um herauszufinden, warum Cleo sich umgebracht hatte. Wenn ihr das gelänge, durfte sie vielleicht einen Haken setzen an die Erinnerungen, und die Erinnyen gäben Ruhe.
Meine Güte, was für eine Theatralik, war fast ihr letzter Gedanke, bevor sie in tiefer Zufriedenheit einschlief, weil sie die notwendige Distanz zu sich und ihren Gedanken nicht verloren zu haben schien.
Kapitel 3
Jack und ein paar gebratene Fische
Jonathan Michael Munro, genannt Jack, war auf dem Rückweg von seiner kleinen Fischerhütte oben am See. Auf der Ladefläche seines roten Kombis stand ein großer Eimer voller Seeforellen.
Er pfiff leise vor sich hin, denn sein Abendessen war gesichert, sie hatten heute gut gebissen.
Jack war ein Mann, der nicht viele Worte machte. Undurchschaubar nannten ihn die Bekannten, die ihn nicht mochten; nachdenklich die, die ihn besser kannten. Eine neutrale Betrachtungsweise würde vielleicht eine gewisse Schüchternheit zutage fördern, sowie ein sicherndes Abwarten in gespannten Situationen, denn man wusste ja nie, wie die Dinge sich entwickelten.
Als er mit ordentlich Schwung um eine der letzten Kurven vor Falconcross bog – je schneller, desto weiter bleibt der aufgewirbelte Staub hinter einem zurück – sah er auf dem Wanderweg von rechts oben die Frau herunter kommen, die gestern ihren roten Renault bei ihm abgeladen hatte. Wie praktisch, er konnte ihr gleich hier wegen ihres Autos Bescheid sagen. Er bremste und beugte sich aus dem Fenster. Noch mehr Staub stieg auf und wurde vom leichten Wind verwirbelt. Wie gestern trug sie einen langen blauen Rock. Er musste laut sprechen, um das Geräusch des Motors zu übertönen. »Kommen Sie gegen sechs vorbei, dann weiß ich, wann Ihr Auto fertig ist.«
Zu seiner unterentwickelten Fähigkeit, mit Leuten Kontakt aufzunehmen, gehörte auch, dass Jack kein Sprachkünstler war. All das sowie eine gesunde Selbstverteidigung hatten schließlich zu einer grundsätzlich abwartenden Haltung Touristinnen gegenüber geführt. Diese legten in der Mehrzahl großes Interesse an Einzelheiten über schottische Verhältnisse an den Tag, wozu einige auch ihn selbst zählten. Ihre unmissverständlichen Angebote hatte er ein paarmal wahrgenommen, sah sich aber regelmäßig danach enttäuscht.
Seine Schwester Sheila, die seine Schüchternheit missverstand und in ihm einen grundsätzlichen Frauenhasser vermutete, hatte ihm mehrmals kräftig eingeheizt. »Du findest nie was Vernünftiges, wenn du nicht hier und da mal was ausprobierst.« Dabei bezog sie sich allerdings auch auf seine einzige längerfristige Verbindung, die katastrophal geendet hatte.
Folgerichtig stob er, ohne auf eine Antwort zu warten, in einer neuen Staubwolke davon. Henriette hustete, wischte sich übers Gesicht und sah hinter ihm her.
Als sie Punkt sechs seine Werkstatt betrat, herrschten Ruhe und Frieden. Jack hatte seine Hände geschrubbt und eine Bierdose aufgemacht. Als Henriette hereinkam, saß er auf dem schiefen Stuhl mit dem Bier in der Hand.
Sie ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Hallo, ich heiße Henriette, gestern Abend war ich zu müde, um mich ordentlich vorzustellen. Und vorhin warst du schnell weg.« Sie dankte dem Himmel für das englische you, das eine Entscheidung zwischen Du und Sie überflüssig machte.
Er stand halb auf und griff ihre Hand. »Ich heiße Jack. Dein Auto ist morgen Mittag fertig. Die Teile kommen heute Abend noch.« Eigentlich war ihm Anonymität im Umgang mit seinen Kunden lieber, trotzdem lächelte er schmal, als er ihr die Hand gab. Ihre Höflichkeit erforderte eine gewisse Gegenleistung. Eine ansehnliche Frau stand ihm gegenüber, 50 Jahre alt vielleicht. Braunrotes Haar, auf Kinnlänge geschnitten und kluge dunkelblaue Augen in dem weich gezeichneten Gesicht. Sie wirkte nicht hungrig nach lokaler Folklore oder handfesten Schotten. Alles zusammen gefiel ihm, was ihn veranlasste, an seine Schwester Sheila zu denken. »Du wirst Frauen erst verstehen, wenn du dich mit ihnen abgibst. Sei doch nicht das ewige Opfer, mach was.« Er rief sich in Erinnerung, dass – wie, Henriette? Harriet auf Englisch, oder? – auf der Durchreise war, er war also auf der sicheren Seite, falls es schief ginge, gab sich einen Ruck und fragte: »Willst du ein Bier?«
Ihr Mund war vielleicht etwas zu groß, durch seine Beweglichkeit aber reizvoll. Ihre Stimme klang überraschend voll und tief. »Gern. Können wir draußen sitzen?«
Einträchtig saßen sie darauf im Gras hinter der Werkstatt und betrachteten das springlebendige Wasser. Auch nebenan war das Leben ausgebrochen. Vater, Mutter und vier Kinder hatten auf einer großen Decke ihr Picknick ausgebreitet. Zwei Kinder spielten am Wasser, zwei hatten Federballschläger in der Hand und liefen hinter Bällen her.
Jack, dem die schweigsame Henriette zunehmend gefiel, beobachtete sie von der Seite und sah, wie ihr angesichts der Schinkenscheiben, die auf geschnittenes Weißbrot verfrachtet und mit Tomaten und Kresse belegt wurden, das Wasser im Mund zusammenlief. »Hast du Hunger?«
Sie drehte sich mit einer leichten Bewegung zu ihm um und lachte. »Das sieht man mir leider immer an. Manchmal fühle ich mich wie ein Vogeljunges, das auf einem Ast sitzt und den Schnabel aufsperrt. Irgendwer kommt hoffentlich und stopft etwas hinein. Ja, ich habe Hunger, aber keine Lust auf Bellas Fertiggerichte aus der Dose.«
»Oh ja, die. Nein, aber ich kann Fisch braten.« In dem Moment, als der Satz heraus war, hätte er ihn gern zurückgenommen. Sie würde eine Einladung in seine Wohnung vielleicht falsch deuten.
»Kannst du oder wirst du?«
»Ich werde, wenn du willst. Das heißt ...« Jetzt lachte er auch etwas, still, nur mit einem Schnauben durch die Nase. »Ich werde auf jeden Fall Fisch braten, du kannst aber welchen mitessen.«
Sie schien keine Vielrednerin zu sein. Dankbar dafür und ohne sich Gedanken über seine unaufgeräumte Wohnung zu machen, ging er voran. »Komm.«
Von dem kleinen Büro stieg eine schmale eiserne Wendeltreppe in die obere Etage. Sie führte zum ausgebauten Dachgeschoss mit Fenstern in beiden Giebeln zwischen den langen Schrägen.
Er zeigte auf eine Sitzecke aus rotem Plüsch. »Stoß dir nicht den Kopf.« Dann ging er ganz nach vorn, vorbei an seinem breiten Bett, auf dem sich Decken und Kissen türmten. In voller Breite nahm eine Küchenzeile den Raum der Giebelwand ein.
Es dauerte, die Fische auszunehmen, sie in Mehl zu wälzen, zu salzen und nacheinander zu braten.
Henriette saß auf dem Sofa, leicht nach vorn gebeugt, eine Hand umfasste das Handgelenk der anderen. Sie dachte über Cleo nach. Der Vorsatz, ihrem Tod nachzuspüren, war so neu, so sensationell, dass er jeden Gedanken an ihre gegenwärtige Situation verdrängte. Dass Cleo nicht mehr lebte, war auf einem Klassentreffen zur Sprache gekommen, an dem Henriette nicht hatte teilnehmen können. Die ehemalige Klassenkameradin, bei der die Nachricht gelandet war, informierte sie später darüber. Alle hätten dagesessen wie vom Donner gerührt. »Es hat jemand im Laden meiner Eltern angerufen, als ich nicht da war, eine ›Unbekannt‹-Nummer. Ich konnte nichts weiter erfahren, auch nicht über ihre Eltern, denn die waren schon tot. Ich hatte mit ihr ja auch wenig zu tun. Nein, niemand wusste mehr, und Einzelheiten hat der Anrufer nicht hinterlassen.«
Diese ehemalige Klassenkameradin wäre also eine Sackgasse. Wo sollte sie demnach ihre Suche anfangen und mit welcher Cleo? Mit der lebenslustigen, die mit dem Lockenstab in der Hand vor Henriettes kleinem Spiegel stand, kurz bevor sie sich zusammen aufmachten zum Zug durch die Clubs? Cleo, die Fischdose in der rechten, die Gabel in der linken Hand, Tomatensoße auf der gewölbten Oberlippe? Oder sollte sie sich zuerst an die Cleo erinnern, die zusammengesunken auf ihrem Bettrand saß: »Ich musste es wegmachen lassen.« Oder später: »Henri, ich brauche Geld, wie viel kannst du mir leihen?«
Wer hatte eigentlich in wessen Schatten gestanden? Hatte sie, Henriette, nicht immer die Richtung vorgegeben? Hatte Cleo deshalb auf irgendwas verzichten müssen? Cleo war es doch gewesen, die glänzte und umschwärmt war. Nie war Henriette bis zu diesem Zeitpunkt in den Sinn gekommen, dass Cleo ihr zuliebe auf Dinge verzichtet hatte. Hatte sie denn? Sprach die bittere Trennung nicht dafür? Dann plötzlich tat sich ein Gedankenweg auf, den sie bisher nie gewagt hatte zu gehen: Hätte Cleo sich umgebracht, wenn sie sich nicht getrennt hätten? Ja, dachte Henriette, das ist ganz genau der Punkt. In klaren Worten: Bin ich schuld an ihrem Tod? Großer Gott.
Jack betrachtete sie, während die Fische in der Pfanne brutzelten. Sie sah nicht froh aus, die Deutsche da auf seinem Sofa, dachte er. Hoffentlich überhäufte sie ihn jetzt nicht mit Einzelheiten oder – noch schlimmer – erwartete Ratschläge. Darin war er sehr schlecht, das wusste er aus Erfahrung. »Wir können essen. Willst du noch ein Bier?«
Oh ja, das wollte sie. Er sah ihr beim Essen zu. Sie hantierte sehr geschickt mit Messer und Gabel, löste das Fleisch von den Gräten und kaute mit ihren kräftigen Zähnen. Dann hielt sie an, die Gabel in der Luft. »Wenn du mir nur zusiehst, wirst du nicht satt. Er schmeckt, dein Fisch.«
»Er ist frisch.«
»Trotzdem könnte man ihn sicher mit ein bisschen Geschick beim Braten verderben.«
»Du hast Ärger?« Nun hatte er doch gefragt.
Henriette sah ihn überrascht an. »Sieht man das? Nein, eigentlich nicht. Selbstgewähltes Gedankenchaos.« Es fiel ihr etwas schwer, den Sachverhalt richtig auf Englisch darzustellen. »Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem, deshalb bin ich nach Schottland gekommen. Ich will hier ein Buch schreiben.« Warum sagte sie das? War die Idee nicht lange überholt von der Realität?
Jack war es lieber, an dieser Stelle abzubiegen. Was sollte man zu Leuten schon sagen, die unbedingt ein Buch verfassen wollten. Es würde lange und ungebetene Erklärungen geben. »Willst du Musik hören?«
»Ja, was hast du?«
»Klavierkonzerte und Sinfonien, etwas Jazz.«
Sie sah ihn groß an. »Im Ernst?«
»Ja, meine Mutter war Pianistin.«
»Und du bist Automechaniker.«
»Das ist eine lange Geschichte.« Die er nicht erzählen wollte.
»Kann es sein, dass ich einen leichten amerikanischen Akzent höre, wenn du sprichst?«
»Mmm.« Auch darüber wollte er nicht reden.
»In Ordnung, wie ist es mit Beethovens Siebter?«
»Ja, gut.« Ein schmaler Blick zu ihr. »Du magst klassische Musik?«
»Ich bin Sängerin.«
»Oper oder Pop?«
»Konzertsängerin, ich singe ...«
»Ich weiß, Oratorien, Liederabende.« Jetzt musterte er sie intensiver. »Ich hätte bei dir auf irgendwas Künstlerisches getippt, das schon, vielleicht kunstgewerblich, aber auf Sängerin wäre ich nicht ... dabei verrät es eigentlich deine Sprechstimme.«
»Ich weiß. Voll und tief.«
»So etwa.« Zum ersten Mal sahen sie sich voll ins Gesicht. Dann lachten beide. Nach ein paar Sekunden entzog er sich der plötzlichen Intimität und stand auf. »Beethovens Siebte also.«
Das dritte Bier verschwand zusammen mit den letzten Takten. Sie hatten weitgehend schweigend zugehört. Henriette lag in die Sofaecke gekuschelt mit dem Kopf auf der Lehne. Durch das schräge Dachfenster sah sie helle Wolken über den dunkler werdenden Abendhimmel ziehen. Als der letzte Ton verklungen war, stand sie mühsam auf und strich sich den Rock glatt.
»Ich gehe jetzt, sonst schlafe ich hier ein.« Sie lachte dabei und wusste, dass er nicht auf die Idee käme, sie wäre vor Langeweile gestorben.
»Ja, sicher.« Er stand auf, ging vor ihr die enge Treppe hinunter, schloss die Werkstatttür auf und blieb vor ihr stehen.
Er ragt vor mir auf, dachte sie. Und er riecht weder nach Fisch noch nach Motorenöl. Er riecht nach Zitrone und ... Wärme.
Sie hat wirklich schöne Augen, dachte er, eine sinnliche Stimme und ein schönes Gesicht.
»Bis morgen«, sagte sie.
»Ja, bis morgen. Mittags sollte ich fertig sein.«
Im Tagesraum ihrer Herberge war noch Licht. Henriette hoffte, dass sie nicht der Grund dafür war. Es wäre ihr unangenehm gewesen, wenn die Hostelwirtin auf sie gewartet hätte.
Bella saß hinter ihrem Klapprechner wie eine Königin auf dem Thron ohne Volk, denn der große Raum war ansonsten leer. Ihr rotes Haar leuchtete im Licht der Lampe über ihrem Kopf. »Du warst lange unterwegs«, sagte sie.
Henriette zog die Augenbrauen hoch. »Ja, hab viel erlebt.«
»Das glaube ich. Mit Jack in seiner Werkstatt?« Das klang so schräg, dass Henriette hellhörig wurde. Bella sprach schnell weiter. »Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. Schön, dass es dir hier gefällt.«
Henriette konnte ihre Augen nicht sehen, weil sie im Schatten ihres dichten Haarschopfes lagen. »Danke. Gute Nacht.« Was sollte die Frage eben?
Jack Munro stand in seiner Dachwohnung und fand, dass er seit längerer Zeit keinen Abend mit einer Frau so angenehm verbracht hatte. Sheila würde sagen, das ist doch sicher, weil du wusstest, dass sie wieder wegfährt. Vielleicht war es so. Trotzdem. Es war eine schöne Zeit mit Harriet gewesen, ganz ohne Übergriffe.
Auf dem Weg zu ihrer Zelle sprangen Gedanken durch Henriettes Kopf wie Grashüpfer. Vom Empfangstresen der Wandererherberge aus war die eine Giebelseite der Werkstatt durch ein Fenster gut zu sehen. Bella hatte von dort aus auch den Überblick über ein Stück Straße und den Vorplatz der Werkstatt. Zwangsläufig musste sie also gesehen haben, wie sie, Henriette, aus der Tür gekommen war. Wenn es nun Eifersucht gewesen war, und die Frage hatte ganz danach geklungen, hatte Bella also was mit Jack oder war stramm hinter ihm her. Henriette schnaubte und fischte ihren Zellenschlüssel aus der Handtasche. Lokaler Kleinkram. Morgen war sie weg, auf dem Weg – aber wohin eigentlich?
Zwei der Fenster zum Korridor waren hinter zugezogenen Gardinen noch erleuchtet, aus einem der Zimmer hörte sie leise Kinderstimmen, aus dem anderen nichts. Die ganze Raumanordnung hier erinnerte sie an amerikanische Krankenhausverhältnisse, wo zwischen den Betten einfach Gardinen zugezogen werden, um Privatsphäre vorzutäuschen.
Sie lag lange wach und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Auf der einen Seite stand ihr Wunsch, ein Buch zu schreiben. Dieser Plan lag auf der Fensterbank wie ein verschrumpelter Luftballon, der darauf wartete, aufgeblasen und losgelassen zu werden. Sie hoffte, dass sie dann mitfliegen konnte. Dass Inhalt und Zielrichtung noch keine klaren Konturen besaßen, störte sie nicht. Sie verließ sich darauf, dass sie bei weiterer Beschäftigung mit dem Thema deutlich würden. Wenn sie an diesem Plan festhielt, galt es im Vorfeld einen passenden Ort zu finden, der ausreichend Einsamkeit und Stille zur Verfügung stellen konnte. Alles dies hoffte sie am Loch Kilmannock zu finden. Ein sehr verlockender Plan, von dem sie sich ungern verabschieden wollte. Er war ihr Trost in den vergangenen Jahren gewesen, wenn sich dunkle Wolken um sie gesammelt hatten.
Der Nachteil dieses Planes war, dass, würde er nicht funktionieren, sie nichts mehr hätte, um sich gegebenenfalls aus einem der schwarzen Löcher herauszuwinden, die es ab und zu in ihrem Leben gab. Das Buch war ihr Joker gewesen für schlechte Zeiten, der aufzublasende Luftballon. Jetzt, mit dem Geld aus der Erbschaft, hatte sie Gelegenheit und große Lust, ihn umzusetzen. Aber wie gesagt, einmal angefangen, gab es keinen Joker mehr. Aus diesem Dilemma könnten sie die Nachforschungen über Cleos Schicksal befreien. Also kein Loch Kilmannock?
Sie lag eine ganze Weile wach in ihrem Bett und betrachtete im Mondlicht die Unterseite der Matratze des Bettes über ihr, die mit ihrem geblümten Muster in regelmäßigen Abständen aus dem Lattenrost hervorquoll. Sie hatte größte Lust, sich in das Cleo-Projekt zu stürzen, Spuren von ihr zu suchen; selbst wenn es bedeutete, dass sie kaum eine Woche, nachdem die Fähre sie auf die Britischen Inseln verfrachtet hatte, auf den Kontinent zurückfuhr. War dieses Vorhaben zu absurd? Jeder vernünftige Mensch würde ihr den Vogel zeigen. Man tat sowas nicht, es war eine Geldverschwendung und zeigte ein bedenkliches Maß an Unstetigkeit. Rauf auf die Insel, runter von der Insel. Aber warum nicht. Ihr Rucksack wäre schnell gepackt. Vielleicht konnte sie ja mit dieser Unternehmung bei der toten Cleo Abbitte leisten dafür, dass sie sich nicht mehr um sie gekümmert hatte. Vielleicht würden dann all die anderen Menschen, die sie verletzt hatte im Laufe ihres Lebens, zurücktreten und sie nicht mehr bedrängen. Und nebenbei – vielleicht würde es ein wundervolles Abenteuer werden. Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen war die Frage, was Bella wohl mit Cleo verband.
Als der Plan, den sie spätabends gefasst hatte, sich am nächsten Tag im nüchternen Morgenlicht vor ihr ausbreitete, überlegte sie noch einmal kurz. Die Euphorie der vergangenen Nacht war zwar verschwunden, aber, ja, sie würde es tun. Und sie würde mit ihren Nachforschungen über Cleos weiteren Lebensweg im Handarbeitsgeschäft anfangen – in Braunschweig, wo sie zusammen zur Schule gegangen waren. Cleos Eltern hatten den Fischladen gegenüber betrieben, und Geschäftsleute, die viele Jahre so dicht nebeneinander Handel treiben, kennen sich. Vielleicht konnte sie dort auch etwas erfahren über Cleos Bruder Pelle, den einzigen Verwandten, von dem Henriette wusste. Denn Cleos Eltern waren ja lange tot.
Kapitel 4
Fräulein Liebig und der Bundeskanzler
Braunschweig, Celler Straße, kurz vor der schmalen Einfahrt zum ehemaligen Ina-Seidel-Gymnasium, lag gleich rechts ein Handarbeitsladen: Stickbilder, Wolle, Häkelnadeln, Leinen und Kurzwaren aller Art. Ein älteres Fräulein, so bezeichnete sie sich selbst, führte ihn allein, nachdem ihre Schwester, »so eine alte Schachtel wie ich«, vor einem Jahr gestorben war. Fräulein Liebig ließ sie sich nennen und wurde ärgerlich, wenn jemand, dem Zeitgeist entsprechend, Frau Liebig zu ihr sagte. Sie war hageldürr, krumm, mit papierner Haut und verblichenen Augen. Ein kleiner Knoten im Nacken hielt die dünnen weißen Haare aus dem Gesicht. Ihr Gehör war noch in Ordnung, allerdings musste sie sich, was das Sehen anging, immer häufiger auf ihren Tastsinn verlassen.
Natürlich erinnerte sie sich an die Hildebrands. »Der Fischladen gegenüber. Die beiden kamen doch aus Schlesien, oder? Zu Weihnachten haben wir immer Heringshäckerle bei ihnen gekauft.« Ihre Stimme war brüchig vom Alter, sie sprach langsam und leise, lachte aber jetzt und entblößte dabei ein schlecht sitzendes gelbliches Gebiss. »Der Vater war ein schöner Mann und schäkerte mit uns herum.«
Henriette hatte sich vorgenommen, Cleos Bruder Paul, genannt Pelle, ausfindig zu machen. Er würde wissen, wohin seine Schwester gegangen war, nachdem der Kontakt zwischen Cleo und ihr abgebrochen war.
»Ja, ich erinnere mich natürlich auch an Pelle. So haben sie ihn doch alle genannt. Paul hieß er eigentlich, wie sein Vater. Er war ihm sehr ähnlich, so wie auch Cleo. Sie hatten alle drei diese breiten grünen Augen, nie wieder habe ich so schöne ...«
Henriette erinnerte sich gut an Cleos Eltern. Der Vater, Fräulein Liebig lag völlig richtig, war ein gutaussehender Mann mit frühzeitig verblichenen Haaren, Cleos Augen und einem kleinen nervösen Zucken des linken Auges gewesen, das sich in einer leichten Kinnbewegung fortsetzte. Obwohl er sicher mittelgroß gewachsen war, wirkte er neben seiner großen Frau mit dem bemerkenswerten Busen kleiner.
Cleos Mutter war eine stattliche Frau gewesen, fest und energisch, mit ausgeprägten Wangenknochen, einem Kopf voller natürlicher Wellen in den dicken bläulich-grauen Haaren und einer sehr lauten, etwas schrillen Stimme. Eine schöne Frau und ein gutaussehender Mann. Beide waren grundsätzlich gut gelaunt und besaßen viel Humor. Henriette hatte nie Vorhaltungen, Tadel, Beleidigungen oder Vorwürfe gehört, weder in Richtung ihrer Kinder noch untereinander.
Cleo und Henriette hatten zu Weihnachten im Laden geholfen. Obwohl die Kunden bis auf die Straße hinaus standen, war nie eine Ungeduld zu spüren gewesen, weder bei der Kundschaft noch bei Familie Hildebrand. Hinten im Laden wurden die Fische geschuppt und ausgenommen, die Mutter verkaufte die Filets und Salzheringe. Henriette und Cleo waren für die sogenannten Delikatessen zuständig: Heringssalat, Krabbenmayonnaise, Hering in Gelee, Schillerlocken und geräucherter Heilbutt. In den eineinhalb Stunden Mittagspause gab es aufgewärmten Eintopf im Hinterzimmer, und alle hatten die Beine hochgelegt. Henriette hatte sich oft gewünscht, die Zeit hätte länger gedauert als nur die paar Tage bis Weihnachten und noch ein paar bis Silvester.
Henriette kehrte zurück in die Gegenwart. »Wissen Sie vielleicht, was Pelle nach der Schule machen wollte?«
»Nein, meine Liebe, das weiß ich nicht. Aber seine Mutter hat oft davon gesprochen, dass er so künstlerisch begabt ist. Warten Sie, vielleicht weiß eine Freundin mehr, sie hatte den Zeitungskiosk neben Hildebrands.«
Sie schlurfte zum Telefon, hielt sich ein schwarzes Adressbuch dicht vor die Augen, wählte sorgfältig und stand gebeugt, den Kopf den Regalen voller Wolle zugewandt, während sie wartete, dass sich jemand meldete. »Moni? Hier ist Sigrid. Ja, ich weiß. Nein ... hier steht eine junge Frau«, Henriette zuckte zusammen. Meinte Fräulein Liebig etwa sie? »Die will wissen, was aus Pelle geworden ist ... Nein, Pelle.« Sie sprach überdeutlich. »Paul, der Sohn von den Hildebrands neben dir, der Fischladen. Ja, ganz richtig. ... Oh, ja, und das weißt du genau? Ja, das ist nett. Ja, das tue ich. Danke, Moni, bis bald.« Sie legte sorgfältig den Hörer auf die Gabel und drehte sich langsam um zu Henriette.
»Sie sagt, er ist auf die Kunsthochschule gegangen, hier in Braunschweig. Sie hätten ihn nicht gleich genommen, aber dann doch. Was danach war, das weiß sie auch nicht.«
Henriette dankte ihr lebhaft und überlegte schon gleichzeitig, wie sie auf der Hochschule für Bildende Kunst jemand davon überzeugen konnte, ihr etwas über Paul Hildebrands weiteren Werdegang mitzuteilen.
Im nahen Kaufhaus besorgte sie sich einen großen Schreibblock, setzte sich auf einen schattigen Platz des nächsten Straßencafés und bestellte einen schwarzen Tee mit Milch. Es stellte sich jetzt grundsätzlich die Frage, wie sie weitermachen sollte. Wahrscheinlich hätte sie doch besser gleich mit Bella gesprochen. So richtig war ihr nicht klar, was sie davon abgehalten hatte. Vielleicht dieser diffuse Eindruck von Distanz oder besser Abschottung, Unzugänglichkeit, fast Feindseligkeit, den die Herbergswirtin auf sie gemacht hatte.
Nach Hause zurück in den Oberharz zu fahren, kam nicht in Frage, denn was sollte sie da? Sie war doch gerade weggefahren, um ihre Gedanken zu ordnen. Also eine weitere Nacht im Braunschweiger Hotel. Darauf freute sie sich fast.
Nachdem sie Theo verlassen hatte, war sie mit den wenigen Dingen, die sie aus der Beziehung behalten wollte, in die Behausung einer Kollegin gezogen, die gerade für längere Zeit verreist war.
Die umgebaute Bergmannskapelle lag im Oberharz, angebaut an die Rückseite eines Zechenhauses neben einem hohen Förderturm auf dem Gelände einer stillgelegten Zeche mitten im Wald. Dort fühlte sie sich bestens versorgt mit der notwendigen Ruhe und Abgeschiedenheit. Nach mehreren wundervollen Wochen in dieser Einsamkeit waren Ferien für sie so wie dies hier: Straßencafés, Leute, Kino, Konzert, Altstadthäuser und viele fremde Leute, die man bestaunen konnte. Ein seitenverkehrter Urlaub sozusagen. Für ein paar Tage sensationell, danach schnell überflüssig.
Sie suchte ein Schreibwerkzeug in ihrer weitläufigen Tasche und wurde fündig. Wenn sie ihr Ziel ernst nehmen wollte, musste sie zweierlei tun: zum einen sich Notizen machen. Zum anderen nicht jetzt schon am Anfang die Segel streichen. Also, welche Fakten hatte sie denn? Was wusste sie über Cleos Leben bisher? Sie schrieb und fühlte sich großartig, wie eine Herrscherin über ihre Gedanken.
1. Cleo lebt mit Eltern und dem kaum zwei Jahre jüngeren Bruder in einem Braunschweiger Vorort. Sie geht mit mir in eine Klasse. Eine enge Freundschaft ergibt sich erst im letzten Schuljahr.
Musste sie hier den Grund nennen? Nein, Vorgeschichte war unnötig.
Zusammen machen wir im Jahr 1981 Abitur.
Henriette seufzte. Das war wirklich schon sehr lange her.
Während dieses gemeinsamen Schuljahres schlafen wir immer häufiger abwechselnd zusammen im jeweils anderen Elternhaus. Wenn wir bei mir übernachten, gehen wir abends auf Tour durch Kneipen und Clubs, weil meine Familie in der Innenstadt wohnt. Meistens kehren wir erst spät zurück. Wir sind oft verliebt, aber weder sie noch ich fangen bis zum Abitur eine engere Beziehung mit einem Jungen an. Es gibt kein Thema, über das wir nicht sprechen. Wir haben keine anderen Freundinnen und keine Geheimnisse voreinander.
War das wirklich so? Henriette kaute an ihrem Kugelschreiber, fand den Geschmack widerlich, setzte ihn ab und nahm einen tiefen Schluck vom mittlerweile abgekühlten Tee. Was wusste sie denn noch?
2. Wir studieren zusammen, erst eine Weile in Göttingen, dann gehen wir nach Braunschweig zurück und beziehen gemeinsam eine kleine Wohnung. Ich bestehe mein erstes Lehramtsexamen ein halbes Jahr vor ihr und gehe trotz starker Zweifel an meinem Lehrberuf nach Zeven ins Referendariat. Bis hierhin haben wir praktisch alles zusammen gemacht, gewohnt, gefeiert, sogar -
Henriette zögerte, aber wenigstens sich selbst gegenüber wollte sie ehrlich sein.
mit Jungen geschlafen. Nicht oft, aber doch einige Male. Cleo bleibt am Ort. Nach zwei Monaten kriege ich Besuch von ihr. Sie wirkt gedrückt. »Ich weiß nicht, ob ich mein Examen beim 2. Mal schaffe. Ich versuche es ja.« Sie wohnt jetzt bei einem Maler. »Ich musste abtreiben, aber es geht mir wieder besser.« Später: »Nein, mir macht das nichts aus.«
An dieser Stelle rührte sich etwas in Henriettes Brust, denn hier war das erste schwarze Loch in Cleos Leben. Gibt es das überhaupt, dass jemandem eine Abtreibung nichts ausmacht? Es bedeutet ja neben dem moralischen Aspekt nicht nur, etwas für immer zu verlieren, unwiderruflich wegzugeben, sondern oft auch einen Disput mit dem Vater des Kindes. Wenn man ihn kennt. Und wenn man es ihm überhaupt erzählt. Doch, die Tatsache, dass sie zu ihm gezogen war – war sein Name nicht Karl gewesen? – zeigte doch, dass Cleo sich auf ihn einlassen wollte, dass sie Nestwärme suchte, und dass sie meinte, sie bei ihm finden zu können.
Henriette machte dem Rest des Tees in ihrem Glas mit einem großen Schluck den Garaus. Wieso hatte sie Cleo damals nicht mehr unterstützt, sie beraten, ihr geholfen? Dann gleich der zweite Gedanke: Wenn sie sich jetzt schon so mies und schuldig fühlte, wie sollte es denn später werden, wenn es wirklich ans Eingemachte ginge? Sie bestellte noch einen Tee und schrieb weiter. Viel war es ja nicht mehr.
3. Etwa 1984 ein Brief von ihr: »Ich habe mein Examen geschafft und bin seit zwei Monaten in Gifhorn an der Hauptschule. Ich habe einen Hund namens Fiete. Leider war es ziemlich teuer, meine Wohnung einzurichten. Könntest Du mir Geld leihen?« Wir telefonieren. Ich will das nicht, ich will ihr kein Geld leihen. Ich habe zwar etwas, weil ich ja schon ein ganz ordentliches Gehalt beziehe, erinnere mich aber an den Satz meiner Mutter: Geld verdirbt die Freundschaft. Möglich ist, dass ich denke, dass von unserer Freundschaft ohnehin nicht viel übrig ist. Dass es infolgedessen auch nichts zu verderben gibt. Ich schicke ihr jedenfalls Geld, nicht wenig, ohne genau zu wissen, wofür sie es wirklich braucht. Es gibt kein Vertrauen mehr zwischen uns. Unsere Lebensformen unterscheiden sich stark, und keine von uns beiden versucht, die andere zu verstehen.
Henriette setzte den Stift ab. Hatte sie Cleo eigentlich vermisst? War sie traurig gewesen über die Trennung? Nein, nicht die Bohne. Eine Rolle spielte dabei sicher, dass sie es gewesen war, die fortging, und so alle Vorteile auf ihrer Seite hatte. Denn sie hatte eine neue Umgebung vorgefunden, dazu eine neue, in gewisser Hinsicht faszinierende, auf jeden Fall aber arbeitsintensive Tätigkeit, sie fand schnell neue Freunde, verliebte sich. Der zurückbleibenden Cleo blieb nichts als das Loch, das die Freundin hinterlassen hatte, und die Notwendigkeit, alles neu aufzubauen.