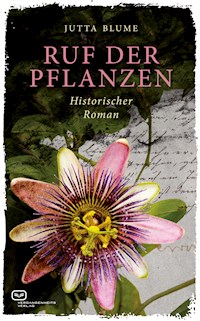
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Außer "Sugar Creek", der Zuckerrohrplantage, auf der sie aufgewachsen ist, mitten im Urwald von Guyana, kennt die Sklavin Ife nicht viel. Als 1761 der schwedische Forschungsreisende Sandquist sie für eine botanische Expedition kauft, wird sie mit der Ideenwelt der Aufklärung konfrontiert. Für die heilkundige Ife sind Pflanzen etwas Spirituelles und Heilbringendes, Teil einer Welt, in der alles miteinander verwoben ist. Doch der Wissenschaftler Sandquist gibt den Pflanzen komische Namen, systematisiert sie und presst sie in Bücher. Durch ihn lernt sie lesen und schreiben - und stellt seine Sicht auf die Dinge infrage. Diese Begegnung mit der Wissenschaft verändert Ifes Leben für immer und ist der Anfang ihres Abenteuers, das sie bis nach Europa am Vorabend der Französischen Revolution führen wird. "Der Ruf der Pflanzen" ist ein packender historischer Roman über eine starke Frau, die aller Widerstände zum Trotz nach Selbstbestimmung sucht in einer Welt im Umbruch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JUTTA BLUME
RUF DER PFLANZEN
Historischer Roman
Erster Teil
Zuckerrohr
Guyana, 1761
1
Durch den Spalt konnte Ife sehen, wie ein Busch schwerfällig an der Hütte vorüber zog. Kurz darauf folgte ein weiterer. Das Pochen in ihrem Schädel übertönte das dazugehörige Rascheln. Sie hielt sich an dem Spaltbreit Realität hinter der rohen Bretterwand fest, ihrer einzigen Verbindung zur Außenwelt. Hier drinnen waren ihr Schmerz, die Angst, entdeckt zu werden, das Pochen in ihrem Kopf, die immer wieder verschwimmende Sicht. Es war an der Zeit aufzustehen und ihr blutiges Lager zu verlassen. Nur noch einen Augenblick.
»Warum hast du nichts gesagt?«, hatte Coba gefragt, als es Ife schon fast die Beine weggezogen hatte und sie nur noch aus Reißen und Ziehen bestand. Nun konnte sie sich nicht mehr erinnern, wie viele der Samen sie sich hastig in den Mund gesteckt und geschluckt hatte. Je mehr, desto besser, hatte sie gedacht, bevor sie nichts mehr dachte. Coba hatte sie auf ihren winzigen, gebeugten Körper gestützt und in die Hütte gebracht, sie auf ein spärliches Lager aus Stroh gebettet. Dann hatte sie immer wieder denselben Satz in ihrer Zeremoniensprache gemurmelt: »A ben de bifo, bifo ben-de ben de, di tro ben-de tide.«
»Ich kann nicht bei dir bleiben«, hatte Coba gesagt, als sie sich wieder erhob. »Nicht jetzt, ich habe Kranke zu behandeln. Mögen die Ahnen dich beschützen. Doch strapaziere sie nicht zu sehr. Sobald du gehen kannst, verschwinde und lass niemanden sehen, was hier geschehen ist.« Coba war gegangen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ein untrügliches Zeichen, dass Ife durchkommen würde.
Ife wusste nicht, wie viel Zeit seitdem vergangen war. Sie wusste überhaupt nicht, ob sie noch dieselbe Person war oder vielleicht schon längst ein Geist geworden war. Ihre Schmerzen ließen sie vermuten, dass sie noch Mensch war. Vor ihrem Spalt zur Welt zogen nun in umgekehrter Richtung die Männer vorbei, die gerade noch Büsche gewesen waren. Doch Männer mochte man sie auch nicht nennen, sie waren formlose Lumpenpakete mit zerschnittenen Pranken und gehetzten Augen. »John«, schoss es ihr beim Anblick des zweiten durch den Kopf, und sie war froh, ein weiteres Stück ihres Lebens greifen zu können. Es war das schlechteste Leben, in das sie die Geister ihrer Vorfahren hatten entsenden können, doch sie war noch nicht bereit zu sterben.
Sie rollte sich zur Seite, ging dann auf alle Viere und schob mit den Händen zusammen, was nicht hatte leben sollen, einen kleinen blutigen Klumpen, verklebt mit Pflanzenfasern. Sie spähte zwischen den Brettern ihrer Hütte in alle Richtungen, um dann gebückt, in den Armen die gewichtlose Last, in die Felder zu rennen. Nach zwanzig Schritten meinte sie, sofort auf den Boden fallen und vergehen zu müssen, doch sie musste weiter. Sie verstreute das befleckte Stroh inmitten des reifen Zuckerrohrs, achtlos würden die anderen Sklaven später darauf herumtrampeln, wenn sie kamen, um das Rohr zu schneiden. Sie waren nicht weit von hier, schon morgen könnten sie hier sein. Ife lauschte auf das leise Flüstern des Baches, der sie schon oft gerufen und ihr Geschichten von einer anderen Welt erzählt hatte. An seinem Ufer würde sie sicher sein. Die Aufseher waren mit den anderen Sklaven auf den Feldern. Es war nicht leicht, die Geräusche des Baches hinter dem lauten Rauschen in ihren Ohren zu erkennen. Sie reinigte ihre dreckigen Hände notdürftig an den Blättern des Zuckerrohrs. Direkt floss frisches Blut über ihre Finger, gut so, es übertünchte das alte und ließ die Hände nach Arbeit aussehen. Sie vernahm ein Rascheln. War es ein Tier oder ein Mensch, oder nur die Blätter, die ein letztes Mal miteinander spielten, bevor sie den Macheten zum Opfer fielen? In gebückter Haltung arbeitete sie sich weiter durch das Feld hindurch.
Dann stand sie an der Grenze zur Freiheit, dort, wo der Bach gleichgültig an den Steinen nagte. Die Sonne ließ seine unruhige Oberfläche glitzern, als hätte jemand flüssiges Gold darüber gegossen. Zwei blaue Schmetterlinge jagten ihren eigenen Schatten hinterher, blind für die menschliche Gestalt, die langsam ihre Füße ins Wasser tauchte. Der Bach war seicht, das Wasser reichte kaum bis an ihre Kniekehlen. Der Länge nach legte Ife sich in sein Kiesbett, noch mit ihrem Rock bekleidet. Sie war eine Alge in der Strömung, die sich geschmeidig dem Wasser anpasste. Das Wasser war angenehm, die Kälte durchdrang den Unterleib und betäubte den Schmerz. Sie zwang sich, nicht abzutauchen, nicht die Augen zu schließen, nicht gierig das Wasser zu trinken, bis sie selbst zum Bach wurde. Sie war nahe daran, wieder das Bewusstsein zu verlieren. Über die Grenze gehen, warum nicht? Warum nicht auf die einfache Art?
Dann war da wieder deutlich das Plätschern des Wassers, das im leichten Wind raschelnde Zuckerrohr, der ferne Ruf eines Aufsehers, und Ife wusste, dass sie auf die Plantage zurückkehren musste, wobei das Zurückkehren schwieriger sein würde als das Fortlaufen.
Der einzige Weg zurück führte über die Krankenbaracke. Coba würde erklären, dass sie Ife gerufen hatte, falls jemand fragen würde. Coba würde schon etwas einfallen.
Noch einmal ließ Ife ihren Blick auf die andere Seite des Baches schweifen, von wo der Wald ihr ein Lächeln schickte. Wenn ein undurchdringliches Dickicht lächeln konnte, so war es ein verschlossenes Lächeln, dessen Hintergedanken niemand erraten konnte. Die Götter und Geister allein konnten ihr helfen, dieses Lächeln zu verstehen. Doch keiner von ihnen war gekommen, ihr den Weg zu weisen, der einzige Winti, der sich in ihrem Inneren regte, war Leba mit ihrem Ekel vor Spinnen und Würmern. Leba flüsterte ihr zu: Geh nicht dort hin, dort verbirgt sich Getier, das du nie gesehen hast. Bleib auf der Plantage, bleib bei den Ratten, bei den Schlangen und Spinnen, die du schon kennst, aber geh nicht in dieses Dickicht.
Langsam zog Ife ihre Beine aus dem Bach und entfernte sich mit wackeligen Schritten. Dabei löste sich in ihr ein grollender Seufzer wie ein lang gestreckter Furz. Da wusste sie, dass das Yorka des Kindes endgültig gegangen war und sie nunmehr wieder allein in ihrem Körper wohnte.
Sie tauchte erneut in das hohe Zuckerrohr ein, das keinen Blick auf die Plantage erlaubte. Ihre Ohren übernahmen die Führung, doch so sehr Ife lauschte, sie konnte aus keiner Richtung die vertrauten Geräusche vernehmen, weder die Rufe: »Nun macht schon! Schneller! Schlaft ihr?«, noch das Knallen der Peitsche in der Luft oder auf nackter Haut, auch nicht die monotonen Gesänge der Sklaven, mit denen sie sich aus ihren Körpern heraus sangen, um Zeit und Schmerz zu vergessen. Nicht einmal das Schnauben eines Pferdes war zu hören, nur die Rufe der Vögel über der Plantage.
Als sie das erntereife Feld durchschritten hatte und die unbefestigten Pfade, die Lagerhäuser und Ställe sowie den Schornstein der Zuckermühle überblicken konnte, sah sie keine menschlichen Gestalten, weder die Aufseher noch die wandelnden Büschelberge der Sklaven. Sie lief nun so schnell sie konnte über die schon abgeernteten Felder. Die Krankenbaracke war das erste Haus im Lager der Sklaven. Von den übrigen Schlafbaracken unterschied sie sich nur dadurch, dass sie viel kleiner war. Wie alles hier war sie aus rohem Holz schnell und schlecht zusammengezimmert, zwischen den Brettern klafften finger- bis dreifingerbreite Lücken. Das Dach war mit gebündelten Palmwedeln gedeckt. Fenster gab es nicht, eine verschließbare Tür ebenso wenig.
Ife näherte sich leise. Von innen war nichts zu hören. Sie hatte gehofft, die singende Zeremonienstimme von Coba zu hören. Wenn jemand in der Krankenbaracke war, musste die Person Ife durch die Lücken in der Bretterwand längst gesehen haben. Sie trat daher direkt in die Türöffnung und verharrte dort einen Moment, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten.
In dem Raum lagen vier Strohsäcke, zwei waren mit reglosen Gestalten belegt. An der rechten Wand lag ein Mann, der nur durch sein schweres Atmen verriet, dass er am Leben war. In der Frau auf der anderen Seite glaubte Ife sich selbst zu erblicken. Vielleicht war es ihr eigener Körper, der dort lag, während ihr Kra nun hier in der Tür stand und überlegte, ob es noch bleiben sollte, oder ob es doch Zeit war zu gehen und zum Yorka zu werden. Das Tuch um die Hüften der Frau war getränkt von frischem Blut, sie lag reglos auf dem Rücken, nicht einmal ihr Brustkorb schien sich zu bewegen. Ihre Augen starrten zur Decke. Nein, diese Frau würde nicht mehr auf die Plantage zurückkehren. Ife kannte die Sklavin nicht. Sie musste frisch angekommen sein.
Ife verließ die Hütte und stieß den Pfiff aus, mit dem sie nur Coba rief. Es kam keine Antwort. Coba mochte gegangen sein, um den Tod der Sklavin zu melden. Die Stille auf den Feldern deutete darauf hin, dass noch etwas anderes Schlimmes geschehen war.
Von den Sklavenbaracken führte ein breiterer Pfad auf die Wirtschaftsgebäude zu, jeden Morgen und Abend ausgetreten von Dutzenden Sklavenfüßen, schwer von Schmerz und Erschöpfung. Der Pfad war schnurgerade angelegt, sodass er von den Aufsehern gut überblickt werden konnte, sich niemand hinter einer Biegung verstecken konnte. Vor der Zuckermühle hatte sich eine Menschentraube gebildet. Gezwungene Zuschauer einer Strafzeremonie. Wenn es Ife gelang, unbemerkt in diesen Pulk zu gelangen, war sie gerettet. Sie dachte nicht darüber nach, wen es diesmal getroffen hatte, alles, was sie sah, war die Gelegenheit unbemerkt zu den anderen zu stoßen.
Tatsächlich nahm niemand Notiz von ihr. Sie wurde fast erschlagen von der Wolke aus Schweiß und Süße zwischen den Körpern. Sie erkannte Johns Rücken vor sich. Sie stieß ihn an, und John schob sie wortlos vor sich, ohne ihr auch nur einen Blick zuzuwerfen, der Zeremonie die Aufmerksamkeit schenkend, die die Herrschaften verlangten. Dennoch spürte Ife, wie seine unausgesprochene Frage sie durchdrang: Wo bist du gewesen, wie kannst du es nur wagen?
Auch sie ließ sich zu keinem Wort hinreißen, und im selben Moment sah sie, worauf sich alle Augen richteten. Entsetzen klammerte sich wie ein verängstigter Affe an ihrem Herzen fest, dass sie fast aufschrie. Sie spürte zwei Arme, die sie von hinten hielten, sodass weder ihre blutleeren Beine noch der Affe sie zu Boden bringen konnten.
Sie hatten Coba.
Coba, deren Körper normalerweise vom Alter gekrümmt war, war mit dem Rücken an einen Pfahl gebunden, während ihre Beine in der Luft baumelten. Ife spürte am eigenen Leib, wie sich Cobas Bauchdecke langsam schmerzhaft dehnte. Sie erinnerte an ein Beutetier, das man an einen Stock gebunden hatte und das hilflos seine dünnen Ärmchen und Beinchen von sich streckte. Ihr Bestien!, wollte sie am liebsten schreien. Natürlich waren sie Bestien, es würde ihnen nicht wehtun, wenn man es ihnen sagte. Aber warum ausgerechnet Coba? Es war wohl wegen der blutigen Frau in der Krankenbaracke, die sich in die Welt der Geister aufgeschwungen hatte, noch bevor sie den Preis abarbeiten konnte, den der Mister für sie gezahlt hatte.
Ife wollte nach vorne stürmen und sagen, dass sie es ganz allein getan hatte, was auch immer es sein mochte. Sie wollte und doch wusste sie, dass sie es niemals tun würde, nicht einmal für Coba, und dann waren da immer noch Johns Arme, die sie eisern von hinten umklammerten. Was die ganze Szenerie noch unwirklicher machte, war der fremde weiße Mister, der dort neben Mister Baxter stand und so leise auf Coba einredete, dass es unmöglich war, seine Worte zu verstehen. Er trug eine lächerlich kurze Weste und darüber einen schweren blauen Rock, wie es Ife noch nie gesehen hatte. Er sah im Ganzen nicht aus wie ein Pflanzer. Dennoch konnte sie sich nicht vorstellen, was ein weißer Mann sonst in dieser Gegend suchen sollte.
Weder der Fremde noch Ifes Mister waren es, die den Fragen mit Peitschenhieben Nachdruck verliehen. Diese Aufgabe kam Pieter zu, einem einarmigen Sklaven, der dafür bekannt war, mit dem verbleibenden Arm nur zu gerne von der Peitsche Gebrauch zu machen. Ansonsten führte er das Regiment in der Zuckermühle. Für beides ließ sich Pieter mit Rum entlohnen, je mehr Rum ihm der Mister zukommen ließ, desto weniger Mitgefühl kannte er.
Der Fremde, für den Pieter die Peitsche sprechen ließ, hatte die Haut eines neugeborenen Babys. Ife spürte einen Würgereiz, als sie diese Haut betrachtete. Sie war nicht zart und strahlend, sondern rot und runzlig mit weißen Schuppen. Sie versuchte, sich ein Land vorzustellen, in dem nur solche Leute herumliefen – nein, das wäre zu viel, die Augen der Götter würden es nicht ertragen, und sie würden in sie fahren und schlangengleich diese rosigen Gestalten häuten, bis sie wieder glatt und ansehnlich wären. Der Fremde sah auch nicht wie die Missus aus. Sie war stets so weiß wie die Maden unter der Rinde des Quina-Baumes. Doch dieser Herr sah, soweit sie das aus der Entfernung beurteilen konnte, auch in anderer Hinsicht merkwürdig aus. Da waren seine zu Locken aufgewickelten weißen Haare. Niemals hatte sie bei einem Mann solche Haare gesehen. Seine Haut im Gesicht war orangerot, seine Nase spitz und klein, als hätte sie vergessen, mit ihm mit zu wachsen, denn ihn konnte man ohne Übertreibung als Riesen bezeichnen. Überhaupt waren seine Gesichtszüge für einen Mann dieser Größe puppenhaft – wie bei den unantastbaren Gestalten, die rosawangig in Missus’ Vitrine saßen. Missus sagte, sie wären ein Spielzeug für die Kinder, und da die Missus bisher kinderlos geblieben war, waren die Puppen wohl zum Warten verdammt. Es sei denn, man hätte sie den Kindern des Misters gegeben, denen, die in den Hütten aufwuchsen und sich nicht in die Nähe des Hauses begeben durften, damit die Missus keinen hysterischen Anfall bekam.
Die Folterzeremonie endete damit, dass Coba in Ohnmacht fiel. Ihr Kopf sank einfach auf die Brust hinab, und ihre Füße hörten auf, die Luft nach einem Halt abzutasten. Der Mister bedeutete Pieter von der Ohnmächtigen abzulassen und sie loszubinden. Ife sah sie noch schwer zu Boden sinken, dann wurde die Menge schon auseinander getrieben, formierte sich in ihren Arbeitskommandos und eilte auf die Felder und in die Mühle.
Wie gerne hätte Ife sich jetzt um Coba gekümmert, hätte sich ihren schlaffen Körper über die Schulter gelegt und ihn zu ihrer Hütte getragen, wo sie ihren Schweiß abgewischt und ihre Wunden abgerieben hätte. Aber sie musste Cobas Körper Pieter überlassen und konnte nur hoffen, dass sein Peitschenarm nun ermüdet und zufrieden war.
Während die Männer das Rohr schnitten und sich auf die Schultern luden, pressten andere Männer und Frauen seinen süßen Saft heraus. Tag und Nacht liefen die Mühlen und brannten die Feuer der Siedereien. Der Berg geschnittenen Rohrs vor der Mühle durfte nicht mehr als einen Fuß über die Köpfe der Sklaven hinauswachsen. Wenn dies geschah, musste die Frau, die hinter den Ochsen auf einem Flügel der Mühle saß, die Tiere noch härter antreiben, damit sich die Mühle schneller drehte und die Stopfer das Zuckerrohr noch schneller zwischen die Mühlräder schieben konnten.
Johanna hieß die Frau, die auf dem Brett hinter den Ochsen saß, ihre plumpe Gestalt erinnerte ein wenig an die überarbeiteten Zugtiere. An ihrem Hals hing ein Beutel loser Falten, genauso wie unter den hängenden Köpfen der Ochsen. Jeden Tag drehte sie mit den Tieren unzählige Runden im Kreis, begleitet vom Knarren der Mühle. Abends klagte Johanna über ein Schwindelgefühl, das nicht aufhören wollte. Ife mochte Johanna nicht, vielleicht, weil sie das Peitschenknallen, mit dem sie die Ochsen antrieb, zu sehr an die Aufseher erinnerte.
In der Mitte der knarrenden und knallenden Formation stand der Stopfer. Er tat nichts anderes, als das geschnittene Rohr zwischen die Zähne der Mühle zu stopfen. Auf der anderen Seite zog ein zweiter Mann die ausgelutschten Halme wieder heraus. Nach dem ersten Durchgang reichte er das Rohr zurück an den Stopfer, denn noch war ihm nicht genügend Saft abgerungen. Eigentlich reichte er das Rohr nicht direkt zurück, neben ihm stand den ganzen Tag ein kleiner Junge, der immer wieder die drei Schritte zwischen den beiden ging.
Der Stopfer musste schnell und wach sein, denn die Mühle unterschied nicht zwischen Rohr und menschlichen Fingern und Armen, wahllos zerquetschte sie alles zwischen ihren hölzernen Kiefern. Bis der Schrei des Stopfers die Ochsenführerin und ihre mechanisch trottenden Tiere zum Stillstand gebracht hatte, konnte schon ein Arm bis zur Schulter in der Mühle verschwunden sein.
Die faserigen Reste, die nach dem zweiten Durchgang übrig blieben, sammelten ein noch kleineres Kind und eine alte Frau, nur wenig jünger als Coba, auf. Sie stopften die sogenannte Bagasse in Körbe, die die Frau auf ihrem Kopf etwa zwanzig Meter weiter balancierte. Dort legte sie die Bagasse zum Trocknen aus. In wenigen Tagen würden damit die Kessel der Siederei befeuert.
Der zuckrige Saft hingegen floss durch eine steinerne Rinne ins Innere der Siederei, einem lang gestreckten Bau aus Ziegeln. Zwischen Mauern und Dach drang dicker weißer Dampf heraus. Der Saft sammelte sich hier in einer Zisterne, in die wohl so mancher gerne einmal die hohle Hand gestreckt hätte, um einen Schluck zu kosten. Natürlich wagte es niemand. Dennoch nahm die Versuchung mit den Tagen und Wochen, die die Sklaven in der Siederei verbrachten, nicht ab. Vielmehr wurde der Durst mit jedem Tag schlimmer.
Ife war diejenige, die den Durst von zwanzig Sklavinnen und Sklaven zu stillen hatte, indem sie eimerweise Wasser herbeitrug. Früher einmal hatten die Sklaven nur in der Frühstücks- und Mittagspause trinken dürfen, doch zu viele waren in der Hitze entkräftet zusammengebrochen, sodass Mister Murray, der in der vergangenen Erntesaison die Oberaufsicht über Sugar Creek übernommen hatte, diese Neuerung einführte. Es war nicht so, dass Murray Mitleid empfand. Mister Murray war vor allen Dingen ein Rechner. Das Rechnen in den Größen Sklaven und Zucker hatte er auf der Insel Tobago gelernt. Er kalkulierte ganz und gar sachlich, wie sich aus den zur Verfügung stehenden Sklaven ein Maximum an Leistung herausholen ließ. Und wenn sich herausstellte, dass weniger durstige Sklaven besser arbeiteten, dann bekamen sie Wasser. Lagen aber mehr als vier Schwerkranke in der Krankenbaracke, wurde Ife abkommandiert, um Coba bei ihrer Behandlung zu helfen. Wenn sie von dort zurückkehrte, bekam sie nicht selten den Ärger der Sklaven in der Siederei zu spüren, die sie für die Kranken im Stich gelassen hatte.
Während sich Ife das Joch mit den Wassereimern über die Schultern legte, dachte sie an die blutige Frau in der Krankenbaracke, und ob sie nicht besser daran täte, sie fortzuschaffen, bevor die Fliegen kamen. Denn Coba würde sich in nächster Zeit nicht um die Kranken kümmern können, vielleicht würde sie dort selbst auf ein Lager geworfen. Mit einem Mal war sich Ife nicht mehr sicher, ob sie die Frau wirklich gesehen hatte, oder ob ihr ein Geist mit dem nur Geistern eigenen Humor etwas vorgespielt hatte. Ife spürte, wie sie Johannas vorwurfsvoller Blick traf, der sich mit dem Lauf der Ochsen wieder von ihr wegdrehte. Johanna konnte nicht wissen, wo Ife am Vormittag gewesen war, niemand außer Coba wusste es. John hätte es ahnen können, wenn er von solchen Dingen etwas verstünde.
Johanna war nicht die, die bei der Arbeit den schlimmsten Durst litt. Sie konnte es einfach nicht ertragen, dass Ife Privilegien besaß, die ihr erlaubten, nicht zur Arbeit in der Siederei zu erscheinen. Was Ife in der Krankenbaracke tat, war für Johanna, deren Tage einer kreisenden Monotonie folgten, keine Arbeit. Darüber hinaus konnte sie es nicht ertragen, Dinge nicht zu wissen.
Ifes Beine fühlten sich an wie die einer Spinne, die den Körper kaum zu halten vermochten, hatte sie doch, anders als eine Spinne, nur zwei davon.
Das hölzerne Rad der Mühle rief ihr ein »Ach-Was-Ach-Was« zu. Gerieten die Ochsen aus dem Takt, lag die Betonung mehr auf dem Ach. Unter der tiefen Stimme des Rades knurpste und schlurfte das Rohr. Sie lief schnell fort von der höhnischen Stimme des Rades, um die Eimer am Brunnen zu füllen, auch wenn sie kaum glaubte ihre Last heute tragen zu können. Eine schwache Stimme in ihrem Kopf trieb sie an, wenn die Spinnenbeinchen wegzuknicken drohten, flüsterte »Nicht aufhören, noch nicht!« So lief Ife hin- und her, bis das Denken aussetzte. Sie sah die Welt in Schemen, im dampfvernebelten Inneren der Siederei wie in der gleißenden Sonne. Das einzige, was sie noch spürte, war der forschende Blick Johannas, jedes Mal, wenn sie die Mühle passierte.
»Ach-Was-Ach-Was-Ach-Was«, endlose »Ach-Was-Ach-Was-Ach-Was« später ließ Pieter mit dreimaligem Knallen seiner Peitsche die Arbeit beenden, das heißt, die derjenigen, die nicht drinnen an den Kesseln standen. Die Kessel mussten die ganze Nacht unter Feuer bleiben. Johanna torkelte von ihrem Mühlenflügel und hängte sich Ife um den Hals, die sich selbst kaum noch auf den Beinen halten konnte.
»Warte, bis ich die Ochsen ausgespannt und versorgt habe, dann gehen wir zusammen zum Yard.«
Ife fühlte sich zu schwach, um zu widersprechen.
»Nicht dein Tag heute, was?«, setzte Johanna hinzu. Sie sprach einen Dialekt, den Ife nach den zwei Jahren, die sie gemeinsam auf der Plantage waren, noch immer nur schwer verstehen konnte. Er enthielt seltsame Klicks und Schnalzer mit der Zunge, die die Worte zerstückelten. Johanna war auf einer Plantage in Tobago geboren und aufgewachsen, bis ihr Mister sie verkauft hatte. Ihre Sprache war eine Mischung aus dem, was ihr ihre Mutter beigebracht hatte und dem Kauderwelsch der Plantage.
Ife sagte noch immer nichts, sondern hockte sich auf den Boden und sah der anderen beim Ausspannen der verschwitzten Tiere zu. Die Ochsen waren so müde, dass sie sich nur widerwillig zu ihrer kleinen Weide ziehen ließen, die sich unmittelbar an Mühle und Siederei anschloss, auch wenn sie dort frisches Gras und Wasser erwartete.
»Bring mir doch noch einmal Wasser für die Ochsen«, rief Johanna, und Ife ergriff ein letztes Mal das Joch, trug die Eimer zur Weide, wo sie das Wasser in einen Trog leerte. Es bedeckte gerade einmal den Grund, sodass sie noch zweimal gehen musste, während sich nun Johanna von den Strapazen des Tages ausruhte. Es war inzwischen stockdunkel, nur aus der Siederei flackerte noch der Schein der Feuer herüber.
Als die Ochsen versorgt waren, hakte sich Johanna bei Ife unter, obwohl sie deutlich größer war, und die beiden Frauen nahmen den schnurgeraden Weg, der zu den Behausungen der Sklaven führte.
»Ich hätte nicht gedacht, dass sie Coba so etwas antun«, bemerkte Ife, die das Gespräch unter keinen Umständen auf sich selbst lenken wollte.
»Sie ist nicht die Erste, der das passiert«, entgegnete Johanna ungerührt.
»Sie ist alt. Und sie ist unsere Heilerin, nicht irgendeine Feldsklavin. Und wer ist überhaupt dieser Mister, oder wer glaubt er, dass er ist?«
Joanna hielt in ihrem schleppenden Gang inne und starrte sie mit hochgezogenen Brauen an. Ife begriff, dass sie etwas Falsches gesagt hatte. Sie war bei der Bestrafung nicht von Anfang an dabei gewesen. Vielleicht war der fremde Mister den Sklaven also doch vorgestellt worden.
»Ich meine«, fuhr Ife fort, »wer glaubt er eigentlich zu sein? Hier einfach so aus dem Nichts aufzutauchen und dann die Älteste und Weiseste von uns vor allen vorzuführen. Es ist mir egal, wer er in seiner Heimat ist.«
Johanna hatte ihre Brauen wieder sinken lassen, ihre Augen waren aber noch immer vom Misstrauen geschwärzt.
»Wo bist du eigentlich den ganzen Vormittag gewesen? Du müsstest doch am besten über alles Bescheid wissen. Coba ist keine Heilerin, sie ist eine Hexe, das hat sie heute bewiesen.«
»Was interessiert es dich schon, ob Coba eine Hexe ist«, gab sie nur trotzig zurück. Bloß nicht auf die Frage eingehen.
Die beiden fielen wieder in ihren schleppenden Gang.
»Sie ist schuld, dass die Neue gestorben ist.«
Ife biss sich auf die Lippen, doch die Worte mussten raus. »Schuld, ja? Wenn hier jemand eine Schuld trägt, dann sind es diejenigen, die die Frau hierher verschleppt haben. Der Mister, der sie gekauft hat, um sie in dieses Elend hier zu stecken. Wie kannst du davon sprechen, dass Coba Schuld hat, nur weil ihre Heilkräfte nicht stark genug waren?«
»Du redest wie eine aus dem Wald.«
Lag da eine Warnung in Johannas Stimme? Vielleicht werde ich bald eine von denen aus dem Wald sein, sparte sich Ife zu sagen.
Johanna redete weiter. So sehr Johanna Ife auf die Nerven ging, war sie in diesem Moment froh, dass die andere ihren Mund nicht halten konnte.
»Also, ich würde die Frucht meines Leibes nicht gewaltsam herausreißen, wie es jene getan hat. Und wenn ihr Coba am Ende dabei geholfen hat, dann ist sie an ihrem Tod schuld, da gibt es nichts dran zu rütteln.«
»Und wenn sie einfach eine Fehlgeburt hatte? Das passiert doch ständig. Ich weiß nicht, in welcher Gang die Neue gearbeitet hat, aber vielleicht war es einfach zu hart für sie.«
Johanna schnaubte ungläubig.
Selbst auf die Toten muss sie noch eifersüchtig sein, dachte Ife.
Die Tote hatte etwas mit ihr zu tun, sollte ihr etwas sagen, da war sich Ife sicher. Es mochte ja sein, dass Coba und andere Sklaven sie auch gesehen hatten, aber das musste nicht bedeuten, dass sie ein Mensch war. Sie konnte ein Geist sein, der gekommen war, um von Ife abzulenken und das Schlechte auf sich zu ziehen. Sie konnte aber auch ein Mensch sein, und Coba hatte das Interesse Ananan Keduaman Keduampons, des höchsten Wesens, Herrn über alle Geister und alle Lebenden, von Ife auf diese andere gelenkt. Sie wusste noch immer nicht, ob und wie Coba die Tortur überstanden hatte. Sie musste unbedingt nach ihr sehen, wenn sie im Yard angekommen waren.
Es hatte keinen Sinn mit Johanna zu diskutieren, es konnte am Ende sogar gefährlich werden, weil sie gerne zu viel redete. Doch der Geist der Toten zwang Ife dazu, die Fremde zu verteidigen: »Wenn sie es mit Absicht getan hat, hat sie das Kind vor einem großen Leid bewahrt. Auf keine andere Art hätte sie ihm mehr Liebe geben können.«
»Die Götter entscheiden, wer lebt und wer stirbt, nicht wir. Unsere Kinder gehören in die Kette der Ahnen, sie werden sich einmal um unsere Geister kümmern, ihnen Speise und Trank und ein Zuhause geben. Was sollen wir machen, wenn wir keine Angehörigen mehr in der Welt haben?«
»Ach Johanna, das alles gilt hier nicht. Das Kind gehört dem Herrn, auf dessen Plantage es geboren wurde. Wenn du Glück hast, behält er es, wenn du Pech hast, verkauft er es, sobald es groß genug ist, und du siehst es nie wieder. Das Kind wird niemals wissen, wenn du in die Welt der Geister übergetreten bist.«
Der Geruch des Essens beendete ihre Diskussion. Glücklicherweise schliefen sie nicht in derselben Baracke. »Wir reden morgen weiter«, sagte Johanna und ging zu ihrer Baracke.
Die heutige Ration bestand wie immer aus Maniok mit einem Löffel wässriger Bohnen. Ife nahm ihre Portion in Empfang und ließ sich außerdem Essen für den Patienten in der Baracke und für Coba geben.
Sie war so hungrig, dass sie alle drei Portionen hätte verschlingen können. Wenn sie Glück hatte, war der Kranke zu schwach, um zu essen. Coba hingegen würde sie niemals ihre spärliche Mahlzeit vorenthalten. Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, hockte sie sich zwischen die anderen vor eine der Hütten.
Das ohrenbetäubende Quaken der Frösche erfüllte den Yard. Während des Essens waren alle zu erschöpft, um nur ein Wort zu sagen. Erst als die Näpfe leer waren, begann hier und dort eine gemurmelte Unterhaltung, so gedämpft wie die Stimmung nach diesem Tag, an dem die Herrschaften wieder einmal ihre Willkür gezeigt hatten. Es war an der Zeit, Coba ihr Essen zu bringen. Ife hatte Angst vor der Krankenbaracke, Angst noch einmal dem Geist der Toten zu begegnen. Sie wollte erst zu Cobas Hütte gehen, vielleicht war die Alte ja aus ihrer Ohnmacht erwacht und hatte sich aus eigener Kraft zu ihrer Hütte geschleppt.
Sie ging an den schemenhaften Baracken vorbei, hinaus in die absolute Dunkelheit. Cobas Hütte lag noch hinter den Baracken, die sich zwanzig oder dreißig Sklaven teilten, schon ganz nah an den dichten Körper des Waldes gedrängt, gefährlich nah an der Freiheit. Aus der Dunkelheit wehte ein schwerer, erdig-feuchter Duft herüber, mischte sich mit dem süßen Geruch der Pflanzen, die hier und dort an den Barackenwänden standen, um die bösen Geister fernzuhalten.
Ife stampfte beim Gehen auf, um die Schlangen zu verscheuchen. Erst vor einem Monat war ein Sklave auf eine Viper getreten und erblindet, weder Coba noch der indianische Medizinmann hatten ihm helfen können. Mit einem blinden Sklaven konnte der Mister allerdings wenig anfangen. Er hatte ihn bei seiner nächsten Reise in die Stadt mitgenommen, und niemand wusste, was aus ihm geworden war.
Coba lebte in der ehemaligen Hundehütte von Sir Henry, einem großen wolligen Tier, das in der feuchtwarmen Hitze eines Tages einfach die Zunge herausgestreckt und nie wieder zurück ins Maul genommen hatte. Das war es mit Sir Henry, und offenbar hatte die Missus die Hundehaltung aufgegeben. Nun lebten nur noch die Hunde auf der Plantage, die nachts mit den Wachen patrouillierten, kurzhaarige braune Tiere mit hängenden Lefzen und furchterregenden Eckzähnen. Sir Henry war dagegen ein gutmütiges und träges Tier gewesen, das die Missus hinter einen Zaun gesperrt hatte, um es vor den anderen Hunden zu beschützen.
Nach seinem Ableben hatte die Missus die Hütte von Sir Henry in die hinterste Ecke der Plantage zwischen die Sklavenunterkünfte tragen lassen, um nicht mehr an ihn erinnert zu werden. Am ersten Tag hatte niemand recht etwas mit ihr anzufangen gewusst, beinahe schon hätten die Männer sie zerkleinert und ins Feuer geworfen. Doch dann kam jemand auf die Idee, hinein zu kriechen, was ihm aber nicht gelang. Und andere folgten seinem Beispiel, es wurde ein absurdes Schauspiel, bei dem die erwachsenen Sklaven auf einmal die Rolle des adeligen Hundes einnahmen. Manche stießen sich Kopf und Schultern und fluchten, andere brachen bei dem Versuch, sich durch das Loch zu winden, in unbändiges Gelächter aus. Coba stand mit verschränkten Armen daneben und gab keinen einzigen Kommentar von sich. Die Menge feuerte die jeweiligen Hunde an: »Noch ein bisschen die Luft einziehen!«, spotteten sie, »An dir ist ein englischer Hund verloren gegangen« oder: »Mach Platz, so ist’s brav, Henry!«. Als sie sich genug amüsiert hatten, kam Coba mit ihrer Strohmatte, kroch ohne Schwierigkeiten durch das Loch, und niemand hat seitdem versucht, ihr Sir Henrys ehemaliges Haus streitig zu machen.
Ife stieß einen Pfiff aus, als sie die Hütte erreichte. Coba antwortete nicht wie gewöhnlich mit einem leisen Glucksen, sondern flüsterte kaum hörbar: »Ja, ich bin zu Hause.« Stockfinster wie es war, konnten sich die beiden Frauen nicht ansehen, und so wusste Ife nicht, wie arg sie Coba zugesetzt hatten. Sie hockte sich hin und tastete mit einer Hand ins Innere der ehemaligen Hundehütte. Coba antwortete mit einem leichten Druck ihrer kleinen, knochigen Hand.
»Iss«, sagte Ife und schob die Schale durch das Loch.
»Nein, sie haben mir den Appetit verdorben. Iss du lieber, du hast heute sehr viel Kraft verbraucht. Mir sagt meine Mutter Dyodyo, wir bräuchten heute nichts essen. Schlafen muss ich, das ist alles.«
»Hat sich jemand um deine Wunden gekümmert?«
»Nein, sie haben keine Ahnung.«
»Aber du musst gesalbt werden, durch deine Wunden können die bösen Geister eintreten. Warte, ich besorge Limonensaft und Pfeffer.«
»Ach lass, ich will einfach nur hier in der Dunkelheit liegen, die Augen schließen, vergessen. Ich will vergessen, wie oft ich überlebt habe und dass ich zu heilen begann, um nichts als meine eigene Haut zu retten, nicht weil mir ein Winti zu helfen geboten hatte.
Ich will vergessen, dass dieser Mister und diese Missus elendige Würmer sind, Maden, denen niemals Flügel vergönnt sein werden. Ich will die Schwestern vergessen, die mir genommen wurden und die eine, die fortgegangen ist und von der ich nie wieder gehört habe. Ich will alles vergessen, was ich gelernt habe, damit sie nie wieder das aus mir herauszupressen versuchen, was ich nicht in Worte fassen kann. Lasst mich als dumme Närrin sterben, nutzlos für die Arbeit und auch sonst unbrauchbar. Wieso sollte mir dann noch jemand zu essen geben? Lasst mich über Nacht alles vergessen, was ich je gesehen und erfahren habe, auch meinen Namen, und dann nehmt dieser armen Irren das Letzte, und alles wird gut sein.«
Ife erschrak. So hatte Coba noch nie geredet, die zähe Coba, die schon so viel erlebt hatte, weit Schlimmeres als heute, von dem sie aber nie reden mochte. Wieso brachte sie ausgerechnet der rotgesichtige Herr dazu, ihren Lebensmut aufzugeben?
»Du darfst so nicht reden. Deine Winti sind erschöpft, aber schon morgen werden sie dich wieder mit Leben erfüllen und den Herrschaften ins Gesicht lachen, du wirst sehen. Lass mich nur schnell alles holen, um deine Wunden zu waschen.«
»Nein, ich verbiete es dir. Du brauchst Ruhe.«
»Nein, es geht schon wieder besser. Warte, ich bin gleich zurück.« Ife wollte schon forteilen, doch dann erinnerte sie sich, dass die benötigten Dinge in der Krankenbaracke waren. Sie hielt inne. »Was ist heute in der Krankenbaracke geschehen?«
»Am Morgen brachten sie einen Patienten im Fieberwahn, der nicht mehr alleine gehen konnte. Ich habe ihm einen Sud aus Quinarinde aufgesetzt, dann hörte ich dich plötzlich nach mir rufen. Also bin ich losgegangen und habe dich bei der Siederei gefunden, du warst farblos geworden wie eine Weiße und ich dachte, ich würde dich verlieren. Während ich noch bei dir war, hörte ich schon wieder eine andere Stimme aus der Krankenbaracke. Die Frau lag ganz zusammengekrümmt auf ihrem Lager und hat geschrien, bis ihre Stimme schließlich immer schwächer wurde. Ich habe versucht, herauszufinden, wie sie es getan hat, aber der Schmerz erlaubte ihr nicht zu sprechen. Ich habe ihre Geister und Ananan Keduaman Keduampon angerufen, doch mitten in der Zeremonie haben sie mich schon wieder unterbrochen und mich ohne eine Erklärung fortgeschleift. Ich bin nicht schuld, dass sie fortgegangen ist, wie sie sagen. Ananan Keduaman Keduampon und ihre Geister haben sich getroffen, und die Geister haben sich entschieden, mit Ananan Keduaman Keduampon zu gehen. Sie wollten nicht an diesem unbarmherzigen Ort bleiben.«
»Ich verstehe nicht, was dieser fremde Mister damit zu tun hat.«
»Gar nichts. Er war auf einmal da und stellte mir alle möglichen Fragen, in einer seltsamen Sprache, sodass ich fast gar nichts verstand. Er kam erst später dazu, und ich glaube, dass es dem Mister gar nicht recht war. Der Mister war wütend, hatte er doch gerade erst ein Pack Sklaven gekauft, zu einem völlig überhöhten Preis, wie er meinte, und schon nach einer Woche verweigert sich die erste, indem sie den Weg zu ihren Ahnen wählt.
Sie konnte er ja nicht mehr strafen, also hat er sich eine andere Schuldige gesucht. Damit die anderen aus dem Pack nicht denselben Weg gehen, damit sie sehen, es wird jemand dafür büßen müssen, sagte er. Und wie er so dabei war, mich auspeitschen zu lassen, kam dieser andere Herr, fragte ihn, was geschehen sei, und wer ich sei und so weiter. ›Die vermaledeite Heilerin, die zu nichts taugt‹, hat er gesagt und ihm von der Toten erzählt, und dann wollte der Fremde wissen, mit welchen Pflanzen ich sie behandelt habe, und ob ich sie vorher schon behandelt habe, also ob ihre ›Kondition‹, wie er es nannte, erst durch meine Behandlung gekommen ist. Damit hat er den Mister glauben machen, ich hätte sie nicht nur nicht retten können, ich hätte sie vielleicht sogar absichtlich vergiftet mit meinen Kräutern. Obwohl das ja gar nicht stimmt, sie war vorher nicht bei mir, sie hätte mal besser zu mir kommen sollen. Nein, sie hat keine Kräuter genommen, sie hat an sich selbst Hand angelegt.
Aber der Mister wollte gar nichts mehr von mir wissen, sein Urteil stand fest. Dieser Fremde, der hat ihn immer wieder unterbrochen und gesagt, er müsste mich wichtige Dinge fragen, und dann hat er mich nach Pflanzen gefragt, aber er gab ihnen Namen, die ich noch aus keinem Munde gehört habe, weder von den Medizinmännern noch von uns, von den Herrschaften sowieso nicht, denn sie kennen keine Pflanzen außer dem Zuckerrohr. Er dagegen nannte jede Pflanze mit zwei Namen, so als wären sie feine Leute, die einen Vornamen und einen Familiennamen haben. Und weil ich nicht verstand, wovon er redete, wurde auch er wütend und dachte, die Peitsche würde mich schon verstehen machen.«
Das war die seltsamste Geschichte, die Ife jemals von Weißen gehört hatte. »Was ist es, was er wissen will? Ich verstehe es noch immer nicht.«
»Wenn ich es verstehen würde, würde ich dir deine Frage beantworten, so viel ist sicher. Seine Fragen würde ich nicht mal beantworten, wenn ich es könnte.« Ein Frohlocken war in Cobas Stimme eingekehrt, das Ife aufatmen ließ.
»Ich denke, er weiß gar nicht, was er wissen will«, fuhr Coba fort. »Er fragte alles und nichts und dann schrieb er alles in ein dickes Buch. Weil ich ihn nicht verstand, hat er ein anderes dickes Buch geholt, in dem Bilder von Pflanzen waren. Er hat dann auf die Bilder gezeigt und mich gefragt, ob ich die Pflanze kenne, ob sie hier wächst und ob ich sie bei Krankheiten gebrauchen würde. Aber ich hatte schon gar keine Lust mehr zu antworten, und so habe ich nur noch den Kopf geschüttelt und darauf gewartet, dass mir endlich das Bewusstsein schwindet.«
»Glaubst du, dass sie mich auch unter Verdacht haben?«
»Sie haben nicht von dir gesprochen, aber du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann jetzt nicht viel für dich tun.«
»Liegt die Tote noch in der Baracke?«
»Mach dir keine Sorgen, sie werden sie weggebracht und irgendwo verscharrt haben.«
»Dann gehe ich jetzt hin.«
»Ich habe doch gesagt, du sollst das lassen und schlafen.«
Doch Ife hörte nicht. In der Krankenbaracke roch es nach dem Schweiß des Fiebernden und getrocknetem Blut. Rasch zerstieß Ife Limetten und Pfefferschoten mit einem Mörser und kehrte mit dem Saft zu Coba zurück. Aus der Hütte drang der schwere Atem des Schlafs. Ife konnte an Cobas Arm rütteln wie sie wollte, die alte Frau weigerte sich aufzuwachen. Schließlich gab sie auf und stellte den Limettensaft vorne in die Hütte.
»Komm mit mir in die Wälder«, flüsterte sie der Schlafenden zu, doch die wollte einfach nicht antworten.
2
Ich werde mich von John verabschieden gehen, dachte Ife schon zum zwanzigsten Mal an diesem Vormittag. Und wie die neunzehn Male davor, verwarf sie den Gedanken sogleich. Wissen war Schuld, eine Bürde, die Ife niemandem zumuten wollte. Erst recht nicht John, der nur versuchte, aus dem Schlimmsten das Beste zu machen. Der von ihr nie mehr verlangt hatte, als alles zu vergessen, wenn er sie in seine Arme schloss. Der neben ihrer Haut den Rauch des Tabaks liebte. Für diese beiden Dinge konnte er leben, hatte er ihr einmal gesagt. John existierte außerhalb von Vergangenheit und Zukunft. Er trug die Qualen des Tages mit Gleichmut, einzig die Erwartung des Tabakrauchens am Abend ließ ihn den Tag durchstehen.
Sie hätte ihn bitten können, mit ihr zu fliehen. Aber sie wusste, dass es falsch wäre. Er war es nicht, den sie für einen gemeinsamen Weg wählen würde. Er war einer unter vielen, jung und kräftig, mit einer tiefen und weichen Stimme, wenn er zu ihr sprach. Er hatte ein glattes Gesicht, das manchmal lächelte, wobei seine Augen stets ernst blieben. Er hatte noch alle Zähne, bis auf den linken oberen Eckzahn, den er sich versehentlich mit dem Griff der Sense ausgeschlagen hatte. John sprach den Dialekt ihrer Eltern, was ihm den Geschmack eines heimischen Herdfeuers verlieh. John war warm und samtig, nur manchmal war der Samt seiner Haut von gar zu vielen Furchen durchzogen.
Manchmal sehnte sie sich nach seiner Berührung wie ein einsames Tier, und so hatte Ife manches Mal die Vorsicht vergessen. John dachte sowieso nicht darüber nach, wie er überhaupt nie an die Zukunft dachte. Seit sie wusste, dass es geschehen war, hatte Ife alleine versucht, sich die Zukunft dieses Kindes vorzustellen. Seine ersten Worte wären in Johns und ihrem Dialekt erklungen, was für ihre Eltern eine große Freude gewesen wäre. Dann hätte es weitere Worte gelernt, den üblichen Kauderwelsch, und bald hätten sich die Befehle in seine Sprache gemischt. »An die Arbeit!« und »Schneller!« hätte es zu sagen gelernt. Sobald es laufen konnte, hätte es gelernt, nützliche Dinge zu tun. Je älter es geworden wäre, desto weniger hätte sie von ihm gesehen. Das Kind wäre nicht ihres geblieben. Brauchte man die tatkräftigen Hände des Heranwachsenden und wäre er von guter Gestalt, so behielt man ihn auf der Plantage. Dafür musste ein Kind die ersten Jahre überstehen. Genauso wie die frischen Sklaven, weigerten sich viele Kinder einfach, an diesem Ort unter den Lebenden zu bleiben.
All dies war nicht die Geschichte von John und Ife, vielleicht würde es einmal die Geschichte Johns und einer anderen sein. Sie hätte ihm gerne gesagt, dass er ihre Flucht nicht persönlich nehmen sollte. Johns Gesicht mischte sich in ihrer Vorstellung mit den Gesichtern anderer: zerfurchter Gesichter, selten lachender Gesichter, leerer Gesichter, leidender Gesichter; es war keines dabei, das Bestand hatte. Das einzige, das ihr klar erschien, war das runzlige Gesicht Cobas, ihrer großartigen Lehrerin.
Ife dachte an die Schlangen und die Schlingpflanzen im Wald, und es ließ sie schaudern. Sie hatte vor einiger Zeit ein altes verrostetes Hackmesser unter ihrer Matte versteckt. Es schien ihr kaum geeignet, um sich gegen wilde Tiere zu verteidigen. Am meisten Angst hatte sie vor den Pekaris, weniger vor den Jaguaren, von denen sie noch nie einen zu Gesicht bekommen hatte. Die Weißen hatten am meisten Angst vor den Indianern, obwohl sie offiziell ihre Verbündeten waren. Ife wusste nicht, ob sie Angst vor den Indianern hatte, aber sie hatte Angst, in den Wald zu gehen.
Man erzählte sich in Sugar Creek die Geschichte des Paters, der auf der Durchreise auf der Plantage Quartier bezogen hatte, das ihm der Mister nur sehr widerwillig gewährt hatte, denn der Mister hasste die katholischen Missionare, die mit ihrem Eifer selbst bei den Plantagensklaven nicht Halt machten. Wenn es nach ihm ginge, hätten die Holländer die Pater aus dem Hinterland jagen sollen, zumal sie alle dem Lager der Feinde, der Spanier, angehörten. Aber es gehörte sich nicht, einen weißen Reisenden abzuweisen, nicht hier in der Wildnis. Jener Pater war am Abend, bevor er sich schlafen legte, von einem Giftpfeil mitten in die Brust getroffen worden. Wer den Pfeil geschossen hatte, ließ sich nie herausfinden, die einen sagten, es wären die Indianer gewesen, die die Soutanenträger mehr hassten als alle anderen Fremden, weil sie ihnen nach den Seelen trachteten. Andere behaupteten, es wären die entflohenen Sklaven aus dem Wald gewesen, die einen Überfall auf die Plantage geplant hatten, und die der Pater dabei gestört hatte. Ein paar fehlende Schweine untermauerten diese Theorie. Niemand machte sich die Mühe, den Tod des Paters aufzuklären, auch nicht der verängstigte junge Geistliche, der die Leiche drei Tage später mit zwei schwarzen Helfern abholte, um sie in der geweihten Erde bei der Mission zu bestatten.
Am Abend hakte sich Ife auf dem Weg von der Arbeit bei Azuka unter, um sich vor weiteren neugierigen Fragen von Johanna zu schützen. Azuka sang leise, mehr für sich selbst, aber sie konnte dennoch hören, dass es das Lied von der Mutter war, deren Kinder wie leichte Samen in alle Himmelsrichtungen verstreut worden waren. Neben ihnen trottete Elise stumm und müde vor sich hin, wie Ife schaute sie nur auf den Boden vor ihren Füßen. Doch Ifes Müdigkeit war nichts gegen den Aufruhr in ihrem Inneren.
Vor Ifes Baracke brannte Feuer, dessen Schein hin und wieder das Gesicht eines Vorübergehenden erhellte. Es qualmte stark und roch leicht nach Sirup. Die Köchin hatte den Topf bereits vom Feuer genommen und schöpfte daraus mit geübtem Augenmaß in die Schalen der Sklaven. Es war ein wässriger Eintopf, in dem Maniok- und Bananenstücke schwammen. Gierig verbrannte Ife sich an den ersten Bissen, trotzdem war ihr der heiße Maniok eine Wohltat auf der Zunge. In der Hocke löffelte Ife ihre Schale leer, ohne ein einziges Mal aufzusehen. Erst danach betrachtete sie die Gesichter der am Feuer Sitzenden. Sie suchte John. Er saß auf der anderen Seite des Feuers, sein Gesicht wurde nur manchmal erhellt. Mit zwei anderen Männern rauchte er, und sie waren ganz und gar darin versunken. Fast war er um diese Versunkenheit zu beneiden, um diesen einen Moment des Tages, der nur ihm gehörte. Ife war sich nun ganz sicher, dass ihm gegenüber kein einziges Wort, auch nicht die leiseste Andeutung ihre Lippen verlassen würde. Sie warf Azuka und Elise ein »Gute Nacht« zu, dann zog sie sich zurück in die Baracke, wobei sie ein paar Mal innehielt, um zu lauschen, ob ihr niemand folgte.
Sie rollte sich auf ihrer Matte zusammen und tastete mit einer Hand in den Spalt zwischen dem Stroh und der Bambuswand. Dort bewahrte sie das schwarze Wasser auf, nur eine kleine Pfütze, gesammelt in einer Nussschale. Sie tauchte ihren Zeigefinger hinein und rieb die Flüssigkeit über ihr Gesicht und ihre Arme. Ihre Haut kribbelte, als der dünne Film trocknete, ein Kribbeln, das in sie hineinzog und sie in noch stärkere Aufregung versetzte. Dann griff sie nach dem Amulett, das Coba ihr gefertigt hatte. Auch dieses lag nicht erst seit gestern bereit. Sie umschloss es fest in ihrer Hand, fühlte die getrockneten Bohnen, die in die 15 Kräuter hineingewoben waren, kleine, feste Knubbel, die für die Kraft eines jeden ihrer Winti standen. Von den Bohnen sollten sich die Winti auf ihrem beschwerlichen Weg ernähren und sich im Notfall, wenn ihnen unterwegs jemand nach dem Leben trachtete, darin einkapseln können. Die 15 Kräuter würden bewirken, dass kein Tier sie riechen konnte und dass menschlichen Wesen die Sicht vernebelt wurde, sodass sie unbemerkt an ihnen vorbeihuschen konnte und dass keine Machete und keine Gewehrkugel sie treffen konnten. Sie drückte das Amulett so fest, dass es ihr in Fleisch und Blut überging, die kleinen, schwarzen Bohnen nun Knoten in ihrer Hand waren, die schon bald auf Wanderschaft durch ihren Körper gehen würden. Sie öffnete die Hand und betrachtete ihre leere Handfläche.
Sie schnürte kein Bündel, da sie keinen Besitz hatte. Das verrostete Hackmesser versteckte sie unter ihren Kleidern. Sie besaß ein Paar Füße, ein Paar Augen und Ohren, ein Paar Nasenlöcher und alles, was sie in ihrem Kopf aufbewahren konnte. Sie ging.
3
Der flaumige grüne Überzug der Felswand erwies sich bei genauerem Hinsehen als Mosaik von Grüntönen: graublaugrünes Geflecht, maigrüne zartblättrige Fächerpflanzen, Miniaturen mit kaum sichtbaren Blüten, freischwebende, dickblättrige Sterne. Das Geflecht nahm einen Moment ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie zeichnete mit dem Auge die Formenvielfalt nach, bis sie sich entsann, wo sie war – wenn sie das nur genau wüsste! Sie war in der Nacht in den Wald gelaufen, wo kein Mond ihren Weg erhellte. Sie hatte versucht, geradeaus zu gehen, so weit die Ranken ihr Durchlass gewährten. Sie hatte sich die Hände an dornigen Baumstämmen aufgerissen. Stimmen hatten sie begleitet, das Gebrüll einer Affenhorde in der Ferne, das Fiepen nächtlicher Kleintiere oben im Geäst, ein Grunzen aus dem Unterholz, das ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Sie hielt zur Verteidigung ihr Messer umklammert, hauptsächlich, um ihr rasendes Herz zu beschwichtigen. Sie war gelaufen, bis es nicht weiter ging.
Ob sie sich nun nach rechts oder links wandte, überall schnitt ihr die grün gepolsterte Felswand den Weg ab. Schließlich hatte sie sich davor gelegt. Die Erschöpfung erlaubte ihr nicht länger, sich am Fels entlang zu tasten und gleichzeitig ihre Beine aus der stetigen Umarmung der Schlingpflanzen zu reißen. Sie musste sich ausruhen, und wenn es nur für eine Stunde war. Aber sie fiel in einen tiefen Schlaf, und als sie erwachte, herrschte die grüne Helligkeit des vollen Tages. Sie hatte keine Zeit zu verlieren und doch konnte sie nicht anders als zu stehen und zu staunen. Nie war sie so tief im Wald gewesen. Der Wald hatte immer dort hinter den Hütten und Feldern gelegen, greifbar nahe, und doch war er kaum mehr als der grüne Hintergrund ihrer Welt gewesen.
Ein paar Mal hatte sie Coba in den Wald begleitet. Coba hatte die Erlaubnis, weil sie eine Heilerin war und ihre Kräuter im Wald suchen musste, doch weit ins Dickicht wagte sich auch Coba nicht vor. Gerne ließ man sie nicht gehen. Immer wieder forderten die Herrschaften und die Wächter sie auf, ihre Kräuter im Garten anzupflanzen. Wieso sollten sie schließlich hundert Meter außerhalb des Waldes nicht wachsen, auf diesem Land, auf dem ohnehin alles wucherte, ob man nun wollte oder nicht? Coba brauchte Baumrinden und Pilze, die an den Wurzeln der Bäume und oben auf ihren Ästen wuchsen. So erhielt sie die Erlaubnis, hin und wieder in den Wald zu gehen. Ife hatte Coba begleiten dürfen, weil sie ihre Schülerin und Helferin war. Niemals hätte Ife auf einem dieser Ausflüge weglaufen können, weil sie Coba zu sehr liebte und Coba für Ifes Entkommen hätte büßen müssen.
Ife atmete. Die Luft war bis in ihre Lungen hinein grün gefärbt. Die Angst der letzten Nacht hatte sich unter dem Blätterdach aufgelöst. Der Wald war unglaublich ruhig, so als wäre sie das einzige Lebewesen weit und breit. Es war so ruhig, dass sie ihre Verfolger von Weitem hören würde. Sie sah an den geraden glatten Baumstämmen hoch, schwindelerregend und astlos verloren sie sich in der Höhe und boten keine Möglichkeit, sich vor Spürhunden zu retten.
Sie schlängelte sich durch die brusthohen Gewächse mit den riesigen Fächerblättern am Fuß der Felswand. Sie war nicht geübt im Klettern, aber gegen die Baumstämme war die Felswand ein Kinderspiel. Sie war ungefähr dreimal so hoch wie sie selbst. Von oben hingen Gewächse an Fäden hinunter, trügerische Seile, zu schwach für das Gewicht eines Menschen. Sie hakte ihre nackten Füße in eine Felsspalte, während ihre Hände nach Vorsprüngen tasteten. Einmal trat sie auf ihrem Weg nach oben auf etwas Weiches und sie glaubte, ein schwaches Fiepen zu hören.
Das Schwierigste war die Kante, denn den Pflanzen darauf war nicht zu trauen. Dann hing sie da, die Beine noch in der Tiefe baumelnd, der Oberkörper in der Waagerechten auf einer Moosschicht gebettet. Die Anstrengung der Kletterpartie war nicht groß und dennoch fühlte sie sich wieder unendlich erschöpft. Sie zog die Beine herauf, erhob sich auf alle Viere und schaute sich um. Hier oben war der Wald lichter, auch auf dem Boden wuchsen nur niedrige Polster und Kräuter. Dazwischen krabbelten unzählige schwarze Ameisen, jede so lang wie ihr halber kleiner Finger. Eine verlief sich zwischen ihren Zehen, fühlte sich bedrängt und biss beherzt zu. Ife rutschte ein winziges »Au« heraus und sofort presste sie strafend die Lippen zusammen, als könnte sie das kleinste Geräusch verraten.
Gehen, einfach gehen. So gerade wie möglich, wenn es schon keine Sonne gab, an der sie sich orientieren konnte. Etwas beunruhigt nahm sie zur Kenntnis, dass sich der Boden unter ihren Füßen wieder sanft nach unten wölbte. Sollte die Hürde, die sie genommen hatte, an anderer Stelle ganz bequem zu umgehen sein? Zumindest konnten die Hunde ihrer Spur nicht geradewegs folgen, würden bellend vor der steilen Wand stehen, bis ihre Halter sie um das Hindernis herumführten. Bald wurden die Pflanzen um sie herum wieder höher, standen aber nicht allzu dicht. Bei Tageslicht war der Wald erstaunlich durchlässig, Wurzeln, Lianen und andere Hindernisse waren nun sichtbar, und sie konnte ihnen aus dem Weg gehen. Die Pflanzen reckten sich nach oben, einer allzu fernen Sonne entgegen, die nur spärlich nach unten durchdrang. Trotzdem hatte sich auf Ifes Haut ein klebriger Film gebildet und sie sehnte sich nach einem erfrischenden Bad.
Auch nach Stunden hatte sich Ife nicht an die Stille gewöhnt. Ihr fehlten mit einem Mal das Knarren der Mühle, das Krachen von berstendem Holz in den Feuern, das anschwellende Rauschen der Siedekessel, das Rascheln von Zuckerrohr, der Gesang der Sklaven, selbst das Knallen der Peitsche. Stattdessen vernahm sie überdeutlich, wenn ein Stock unter ihren Füßen knackte, und das Bersten drang tief in den Wald hinein. Ganz selten hörte sie hoch über sich das Flügelschlagen oder den Schrei eines Vogels. Sie schien das einzige Lebewesen mit Beinen in einer Welt aus Pflanzen zu sein. Nicht ganz, da waren die Ameisen und andere lautlose Krabbeltiere.
Normalerweise hätte sie singen mögen, um sich zu vergewissern, dass sie Mensch und nicht Baum war. Doch ihr war es noch nicht gestattet, Mensch zu sein, zu nah war sie an der Plantage, und so musste sie sich in einen Baum oder Strauch verwandeln. Statt absichtlich laut zu sein, musste sie sich darauf konzentrieren, möglichst leise zu sein. Als Kind hatte sie es manchmal geübt, aber ihre Mutter hatte es ihr verboten, weil sie keine Indianerin war. Sie hatte dann heimlich Indianermädchen gespielt. Wenn sie die großen Wäschekörbe auf dem Kopf vom Fluss zum Haus balancierte, war sie ein Indianermädchen, das sich unbemerkt an Krokodilen und Jaguaren vorbeischlich. Krokodile waren in ihrer Fantasie die gefährlichsten Tiere der Welt. Wenn man sie weckte, sperrten sie ihr großes Maul auf, um ein Menschenkind mit einem einzigen Schnappen zu verschlingen. Jaguare schlichen sich unhörbar an, doch wenn man noch leiser ging als der Jaguar, dann hatte man gewonnen, und der Jaguar durfte einen nicht fressen. Sie erzählte ihrer Mutter nie von ihrer Indianerwelt. Ihre Mutter interessierte sich weder für Jaguare noch für Indianer. Dennoch gefiel der Mutter nicht, wie sie sich bewegte: »Dass du bloß nicht so an den Herrschaften vorbeistolzierst. Guck gefälligst zu Boden, wenn du ihnen begegnest. Wer hat dir eigentlich beigebracht, so mit den Hüften zu wackeln? Von mir hast du das nicht.« Und mehr zu sich selbst fügte sie hinzu: »Das wird ein schlimmes Ende nehmen mit diesem Kind, gütige Mutter, mach sie unsichtbar für die Augen der Gierigen.«
Ifes Mutter wusste natürlich nicht, dass sie, wenn sie erhobenen Hauptes daher stolzierte, kein Sklavenmädchen war, sondern eine frei geborene Indianerin.
Ife hatte selten Indianer zu Gesicht bekommen, auch wenn es hieß, dass sie dort draußen in den Wäldern lebten. Manchmal kam ein alter Mann auf die Plantage, der geheime Dinge mit dem Mister beredete. Seine Kleidung war ähnlich schlicht wie die der Sklaven, aber weniger zerlumpt. Er war mit allerlei Schmuck behangen, und sein Gesicht war mit roter Farbe bemalt. Die Sklaven betrachteten ihn stets voller Misstrauen. Es hieß sogar, dass die Indianer entflohene Sklaven jagten und sie zurückbrachten, manchmal tot, manchmal lebendig. Ihre Mutter hielt Ife bei den Strafzeremonien Augen und Ohren zu. Sie konnte sich aber nicht erinnern, dass die Entlaufenen von Indianern zurückgebracht wurden, auch wenn so einige nach kurzer Zeit wieder aufgetaucht waren.
Mutter, wenn du wüsstest, dachte Ife, du hast mich das hier nicht gelehrt. Mit deiner Ergebenheit. Wer den Kopf einzieht, wird von den Prügeln verschont bleiben. Ich hoffe, dass es dir geholfen hat. Es war merkwürdig: Wenn sie ihre innere Stimme an die Mutter richtete, blieb das Bild, das sie von ihr hatte, verschwommen, eine schwarze Fläche mit einer tiefen Narbe auf der Stirn, von einem Moment, als ihr das Kopfeinziehen nicht geholfen hatte. Ihr Mund, ihre Nasenflügel, der Schwung ihrer Augenbrauen blieb formlos. Ihre leise, ein wenig holprige Stimme war das, woran sich Ife am besten erinnern konnte, und daher fiel es ihr auch leichter, innere Zwiegespräche mit ihrer Mutter zu führen, als ihr Bild heraufzubeschwören. Wenn sie ihrer Mutter heute über den Weg liefe – nein, natürlich nicht im Wald, hier hätte man Mutter kaum in Ketten herschleifen können –, würde Ife sie überhaupt erkennen? Oder würde sie nur eine fremde gealterte Sklavin sehen, eine Frau mit faltiger Haut, hochgezogenen Schultern und gesenktem Blick? Wenn Mutter überhaupt noch am Leben war.
War es bereits Nachmittag, als Ife das Grün um sie herum lästig wurde? Sie liebte Pflanzen, sie hatte sich mit ihnen meistens besser verstanden als mit Menschen. Aber hier standen sie vor ihr als eine abweisende Armee von Fremden, die sie skeptisch beäugten, die ihr zuflüsterten: »Wir werden mal sehen, ob du hier durchkommst. Wo willst du denn eigentlich hin so alleine?« Es klang nicht bösartig, eher unbeteiligt. Ja, es störte Ife am meisten, dass ihr Schicksal ihnen ganz und gar egal war.
Irgendwann kam der Hunger, um ihr Gesellschaft zu leisten. Die Aufregung und die Erschöpfung hatten ihn erstaunlich klein gehalten, aber jetzt begann er in ihrem Magen zu rumoren und setzte sich über das Gebot der Stille einfach hinweg. Vielleicht wäre es klug gewesen, einige Handvoll Maniok zu stehlen, ein paar Stücke Zuckerrohr, es hätte ihr wenigstens über die ersten Tage geholfen. Der Hunger war zum Glück kein Fremder, sie traf ihn täglich, morgens beim Aufstehen, wenn sie vor dem Frühstück an die Arbeit musste und später, wenn sich der Tag dem Ende neigte.
Zum Hunger gesellte sich Durst. Gierig schaute Ife in die Hohlräume zusammengerollter Blätter, ob sich nicht hier und da ein paar Tropfen finden würden, aber es war zu lange trocken gewesen. Oft glaubte sie in einem Land ewigen Regens zu leben, aber wenn man den Regen brauchte, hatte er nicht einmal Spuren hinterlassen. Sie strengte ihre Ohren an, irgendwo in der Ferne das Plätschern eines Baches zu hören, und der Wunsch brachte erstaunlich realistische Töne hervor, doch Wasser konnte er nicht herbeizaubern. Ife besann sich der Kraft des Amuletts, das sie in sich trug. Würde sie an seiner Kraft zweifeln, wäre sie seiner auch nicht würdig. Ihr Körper war stark genug, nun musste ihr Geist wach genug sein, um ihre neue Welt zu finden. Leise, ganz leise, fast nur in ihrem Kopf hörbar, sang sie:
»Mi Aisa, mi aisa … «
Die Luft färbte sich erst dunkelgrün, dann graugrün und Ife wusste, dass nun innerhalb von Minuten die lange Nacht hereinbrechen würde. Es war die Stunde, zu der die Mücken ihr abendliches Mahl suchten.
In dieser Nacht ging sie nicht weiter, da sie niemanden auf ihren Fersen wähnte. Sie fand keinen besonders geeigneten Platz für ein Nachtlager und so rollte sie sich dort auf dem Boden zusammen, wo nicht zu viele Wurzeln in ihren Rücken drückten. Wie der Wald ihr tagsüber seine Stille entgegengeworfen hatte, so überschüttete er sie in der Nacht mit Geräuschen. Über ihrem Kopf begann es zu schreien und zu fiepen, Flügel wurden geschlagen, kleine Krallen kratzten an Baumstämmen. Auf dem Boden raschelte es mal schnell und leicht, mal knackte ein Holz, ja selbst das Atmen eines Tieres war zu vernehmen. Wenn sie die ganze Nacht auf die Geräusche hören wollte, würde sie kein Auge zutun.
Wie sollte sie die harmlosen von den gefährlichen Tieren an ihrem Blätterrascheln unterscheiden? Wie sollte sie wissen, ob sich in der Ferne ein Gürteltier oder ein Spürhund durch das Dickicht bewegte? Es gab so viel über diese fremde Welt zu lernen, doch aus Fehlern würde sie kaum klug werden. Sie musste das Kunststück bewerkstelligen, ohne Fehler zu lernen und im Schlaf wachsam zu sein.
Ife erwachte schon in der Dämmerung, wieder hatte sie tief und fest geschlafen, hatte sich unbedarft an die Nacht ausgeliefert. Direkt über ihr saß ein Vogel. Sein Lied klang vergnügt, und er zeigte keine Angst vor ihr. Selbst als sie ihren Körper stöhnend entrollte, bewegte er sich nicht von seinem niedrigen Ast. Er wackelte ein paarmal mit seinem Kopf, betrachtete sie mal mit dem einen, mal mit dem anderen Auge und setzte seinen Gesang unbeirrt fort.
Ife kratzte sich ausgiebig an Armen und Beinen, dann sah sie die haarige Spinne nur wenige Zentimeter von der Stelle, wo ihr Kopf gelegen hatte. »Du musst auf den Bäumen schlafen«, ermahnte sie sich. »Wie es die Indianer tun.« Die Indianer flochten sich Hängematten aus den Fasern des Waldes. Kein Indianer würde sich jemals wie die Sklaven in ihren Hütten auf ein ebenerdiges Strohlager legen. Doch sie hatte keine Zeit, sich eine Hängematte zu flechten. Jetzt noch nicht, sie musste noch weiter weg von der Plantage und möglichen Sklavenjägern.
Sie ging langsam und schaute immer wieder nach oben, ob in den Bäumen nicht irgendwelche Früchte hingen. Sie suchte nach den Früchten der Papaya und der Guayaba. Sofia-Bada liebte diese Früchte. Es war wichtig, die Winti bei Laune zu halten, am besten, indem man ihnen ihre Leibspeise gab. Loko mochte lieber irdene Gewächse wie den Maniok, füllte sich Ife den Magen mit seinem mehligen Brei, rieb er sich versonnen den Bauch. Aber Maniok musste man pflanzen, das wusste Ife, und man musste ihn kochen, wenn man sich nicht den Magen verrenken wollte. Maniok kam nicht infrage, Loko musste auf seine Leibspeise verzichten.
Die Dinge, die die Sklaven auf ihren eigenen Feldern und zwischen den Baracken des Yards anbauten, gab es hier nicht. Es gab andere Dinge im Wald, Dinge, die die Vögel aßen, wie Würmer und Ameisen. Coba hatte manches Mal ein Stück lose Rinde von einem Baumstamm abgehoben und sich die weißen, sich windenden Würmer in den Mund gesteckt. Ife hatte es mit Abscheu beobachtet.
»Was denn? Das ist besser als das, was sie uns auf der Plantage geben«, hatte Coba gesagt. »Greif zu, so etwas Gutes bekommst du so schnell nicht wieder.«





























