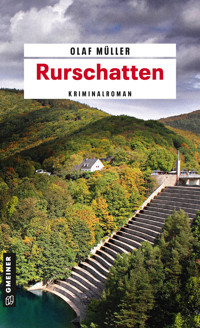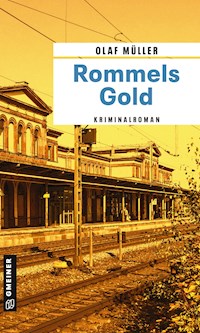Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Fett und Conti
- Sprache: Deutsch
Ein Toter liegt an der Musikschule in Düren. Wer ist der Mörder? Die Kommissare Fett und Conti suchen ein Motiv. Dabei stoßen sie auf junge Wissenschaftler in Aachen und Jülich, die ein neues Medikament gegen Denguefieber und Malaria erfunden haben. Es könnte im Kongo Tausende Menschen retten und ist wertvoller als Gold und Kobalt. Das weiß auch der Professor der Studenten. Die Jagd nach der geheimen Formel beginnt. Werden die jungen Wissenschaftler überleben? Und welche Rolle spielt der Tote?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olaf Müller
Rurfieber
Kriminalroman
Zum Buch
Das Fieber steigt Ein ermordeter Ex-Legionär liegt in Düren auf dem Parkplatz der Musikschule. Wen wollte er dort spät in der Nacht treffen? Die Kommissare Fett und Conti finden zunächst kein Motiv. Währenddessen entdecken junge Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts in Aachen und des Forschungszentrums Jülich ein neues Medikament gegen Denguefieber, Ebola und Malaria. Es könnte vor allem im Kongo Tausende Menschen retten und ist wertvoller als Gold, Kobalt und Coltan. Das weiß auch Professor Schopen, der Chef der Studenten, der in finanziellen Nöten steckt. Die Jagd auf die geheime Formel beginnt. Werden die jungen Wissenschaftler überleben? Wer zieht die Fäden in Deutschland und in den USA? Was hat der Prinz von Katanga vor? Und welche Rolle spielt der Tote? Die Polizei in Aachen erhält ständig Alarmmeldungen: Großlage für alle Einheiten. Es droht eine explosive Woche in Aachen.
Olaf Müller wurde 1959 in Düren geboren. Er ist gelernter Buchhändler und studierte Germanistik sowie Komparatistik an der RWTH in Aachen. Seit 2007 leitet er den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. Sprachreisen führten ihn oft nach Frankreich, Italien, Spanien sowie Polen und Austauschprojekte in Aachens Partnerstädte Arlington (USA), Kostroma (Russland) und Reims (Frankreich). Als junger Segelflieger erlebte er die Eifel aus der Luft, als Wanderer heute vom Boden. »Rurfieber« ist sein zehnter Kriminalroman im Gmeiner-Verlag.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Norbert Kirchhoffhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klinikum_Aachen,_Top.jpg
ISBN 978-3-7349-3234-2
Zitate
Mir war, als hörte ich den geflüsterten Schrei: »Das Grauen! Das Grauen!«
Aus: Joseph Conrad (1857-1924), »Herz der Finsternis« (1911)
*
Fünfzehn Mann auf des toten Mannes Kiste –Jo-ho-ho, und ne Buddel voll Rum!
Aus: Robert Louis Stevenson (1850-1894), »Die Schatzinsel« (1883)
1 DER ANFANG VOM ENDE
Die grüne Volvo Sattelzugmaschine vom Typ Torpedo donnerte vom Alexianergraben auf den Aachener Theaterplatz. Der Fahrer nahm mit quietschenden Reifen scharf die Kurve zum Theater – dort, wo jahrzehntelang die Parfümerie Monheim Düfte an die Frau brachte und nun ein 24-Stunden-Automatenkiosk bedienungslos das Genusshimmelreich anbot. Dann schoss die Zugmaschine auf die dritte Säule von rechts des Theaters Aachen zu, nagelte vier Fahnenmasten und die Tribüne der Aachener Zeitung um, von der aus Robert Esser, gestandener Journalist und Moderator, live den Rosenmontagszug kommentieren sollte. Die fünf Stufen der Theatertreppe hielten den Sattelschlepper nicht auf. Ein lauter Knall, Gäste im »Motel One« fielen aus dem Bett, Staub, Qualm, die Säule brach zusammen, ein Riss im Dach über dem Eingang des Theaters. Im Foyer kippte die Kuchentheke mit einem Schlag nach hinten. Käsekuchen, Muffins und Aachener Reisfladen trudelten durch den Raum und verzierten die Tapete. »Der fröhliche Hengst«, die Pferdeskulptur vor dem Theater, verschwand in einer Wolke von Staub – wie die Kutschen bei der Geländefahrt des Aachener Reitturniers in der Soers.
Ben Gunn kam hinter dem Airbag zu sich, stemmte mit den Füßen die Fahrertür auf, rutschte aus der Kabine und sprang völlig verdreckt auf die Pflastersteine. Die Taxifahrer Franz-Josef Reisen und Horst Obladen standen mit offenem Mund vor ihren Taxen. Dann sagte Hotte Obladen, gebürtig aus Köln-Nippes: »Leck mich en de Täsch.«
Ben Gunn, Sturmhaube über dem Kopf, lief zum Hintereingang des Theaters. Dort wartete Flint mit einer BMW R 1300 GS. Das Hinterrad drehte durch, Qualm, es roch nach Gummi. Die BMW machte einen Satz. Sie rasten die Theaterstraße hoch und waren weg. Sechs Uhr und fünf Minuten am Rosenmontag 2024. Da laufen normalerweise die Vorbereitungen. Nun war bereits alles vorbei – am Theater. Die Sterne funkelten durch die Wolkenlöcher, der Mond blickte ab und an traurig auf den Musentempel. Dunkelheit umhüllte das Chaos, wie ein schwarzer Theatervorhang die Hinterbühne.
Stille auf dem Theaterplatz, der auf die Neugestaltung 199 Jahre nach der Eröffnung des Theaters wartete. Oder gehörte das zur Neugestaltung? Ruhe, Staub, ungläubiges Staunen der Passanten, jemand stemmte sich von innen gegen die mittlere Tür des Theaters, stand vor der völlig zerrissenen und qualmenden Kühlerhaube des Volvo, zwängte sich in Richtung »Leonidas« Geschäft, hustete: Ella Schumpeter, Putzfrau, schrie auf: »Jesus, Maria und Josef! Dat jibt et doch nich!«
Reinigungspersonal drängte nach. Einen Moment standen sie ungläubig auf den Stufen. Als ein weiterer Stein vom Dach krachend auf den Vorplatz polterte, wurde ihnen die Gefahr bewusst, sie rannten los. Vor dem »Motel One« standen erste Gäste. Busse der ASEAG bremsten scharf ab, Steinbrocken lagen auf der Straße.
Alarmmeldung in der Leitstelle der Feuerwehr in der Stolberger Straße. Ein Zug rückte aus in Richtung Theater. Personenschaden nicht bekannt. Trotzdem gab die Leitstelle: »Einsturzgefahr, Evakuierung Stadttheater«. Krankenwagen, Notärzte und schweres Gerät machten sich auf den Weg zum Theater. Das Technische Hilfswerk wurde alarmiert. Aus der Kasernenstraße trafen zwei Ford Galaxy der Polizei ein. Absperrung, Befragung. Für den Prinzenabschied mit Entthronisierung am Veilchendienstag sah es schlecht aus.
Das alles hatte eine Vorgeschichte. Und die begann 2023.
2 DER PRINZ VON KATANGA
Frühjahr 2023. Die Sonne kachelte glühend heiß vom wolkenlosen Himmel. Dienstbesprechung im Camp »Vie Allemand« der Bundeswehr in Niger. Spezialkräfte des Heeres mit erweiterter Grundbefähigung waren seit 2021 dort im Einsatz. Die Einheiten rotierten im Sechsmonatsrhythmus. Fallschirmjäger aus Seedorf waren an der Reihe, schützten den Flugplatz in Niamey, der als Lufttransportstützpunkt für den Abzug der Bundeswehreinheiten aus Mali die Drehscheibe bildete. Oberste Priorität: medizinische Evakuierung verletzter Soldatinnen und Soldaten. Dafür stand Tag und Nacht eine Transall C-160 bereit.
Heißer Wind, Sand, kein Regen, Jahresdurchschnittstemperatur fast 30 Grad. Gemeinsam mit den Kampfschwimmern aus Eckernförde trainierten die Fallschirmjäger Spezialkräfte des nigrischen Militärs im Rahmen der Mission »Gazelle«. »Kampfschwimmer in der Wüste« titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung – als die Bundeswehr in Niger noch willkommen war. Etwas abseits vom Hauptquartier stand das Zelt der Offiziere vom Militärischen Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst. Offiziell bestand eine gesunde Abneigung. Aber Major Engels vom BND und Hauptmann Stobbard verstanden sich prächtig. Gemeinsame Laufbahnerfahrungen, beide früher Truppenoffiziere – kein Mangel an Gesprächsthemen. Das erleichterte die Arbeit für Oberstleutnant Egold, Kontingentführer in Niger.
»Wie haben einen Sonderfall. Der Prinz von Katanga.« Egold, Berufsoffizier, Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung, war vom Auswärtigen Amt und dem Militärischen Abschirmdienst auf einen besonderen Gast hingewiesen worden. Egold mochte das Klima nicht, die Hitze, den Sand, den Staub. Er dachte an seine Familie in der Nähe von Bremen, den Kampf um den Kindergartenplatz, die Auswahl der Grundschule. Alles musste seine Frau arrangieren. Er konnte ab und an über Satellitentelefon mit ihr sprechen. WhatsApp und Messenger waren verboten. Sie konnten seinen Standort verraten. Er blickte in die Gesichter seiner Offiziere. Spezialkräfte, alle dienten Deutschland, alle kannten Afghanistan, Kosovo, Irak. Egold wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine wachen Augen fuhren über den Kartentisch. Er verglich die Projektion auf der Leinwand mit der Tischkarte. Zu hell im Zelt, er musste auf die Tischkarte zeigen. Der Beamer war zu schwach. Egold bat um Ruhe. Er zeigte auf einen Punkt auf der Karte von Niamey. »Hier, Ortsrand Ost, liegt die Villa eines ermordeten Geschäftsführers einer nigrischen Uranmine. Dort ist der Prinz von Katanga, Julius Mabutu, mit Gefolge und rund 20 Personenschützern offiziell untergekommen. Stammt aus dem Kongo, Sohn eines Ex-Ministers, Oberhaupt der Partei ›Patriotischer Kongo‹. Jedenfalls soll er von Niger aus seinen Wahlkampf planen. Gefahrenlage: Attentatsversuche seiner politischen Gegner, Verunsicherung der nigrischen Behörden, Flüge zum Kongo und retour. Er wird von den nigrischen Kollegen beobachtet, CIA und französischer Geheimdienst haben ihn auf dem Schirm. Auch unsere italienischen Kameraden haben mich bereits auf ihn angesprochen. Bei Kontakt auf politische Implikation achten. Wir wollen und dürfen nicht in innerkongolesische Angelegenheiten reingezogen werden. Wir haben genug mit Niger und Mali zu schaffen. Hier ist die Drehscheibe für den Abzug der Kameradinnen und Kameraden aus Mali. Diese Drehscheibe muss funktionieren.«
Hubschrauberlärm übertönte die letzten Worte. Zwei Kampfhubschrauber vom Typ Tiger der Heeresflieger setzten zur Landung an, die Planen des Zeltes knatterten.
Egold ließ unter den Offizieren das Foto des Prinzen von Katanga kreisen, der so genannt wurde, weil er stets wie ein junger Adliger in Katanga aufgetreten war, solange sein Vater das Amt eines kongolesischen Ministers bekleidete. Je näher der Wahltag rückte, umso mehr häuften sich Attentatsversuche und Bedrohungen. Zuletzt hatte der Prinz Unterschlupf in der Nähe der »Malaika Lodge« im Osten Kongos gefunden, eine Gegend, die im Kongo »La Petite Suisse« genannt wurde; blühende Landschaft mit Käseindustrie, darum »La Petite Suisse«, die kleine Schweiz. Dicht daneben Flüchtlingslager mit Flüchtlingen aus besetzten Dörfern der Grenzregion und aus Ruanda.Von dort fiel die Rebellengruppe M23 immer wieder in den Kongo ein. Schluss mit Frieden in »La Petite Suisse«. Der Prinz von Katanga wechselte das Quartier. Zusammen mit seiner Entourage zog er in die Villa in Niger ein.
»Fragen?« Egold blickte seine Männer an.
»Informationen zur Bewaffnung der Leibwächter?« Leutnant Hartmann, Zugführer 3. Zug der 2. Kompanie.
»Leichte Waffen, Kalaschnikow, Pistolen, Handgranaten. Mehr wissen wir nicht.«
»Warum ist er in Niger und nicht im Kongo?« Heizer, Leutnant und Chef des Fallschirmjägerspezialzugs.
»Unruhen im Kongo, Attentatsversuche der politischen Gegner. Vor den Wahlen wird die Luft bleihaltig, meine Herren. Der Prinz soll nach Auskunft des AA, des Auswärtigen Amtes, eher demokratisch eingestellt sein. Er möchte sein Land befrieden und die Armut bekämpfen. Darum ist er unbeliebt bei den politischen Gegnern. – Sonst noch Fragen?«
Die Hitze stand im Zelt, alle warteten auf Ablösung. Die Sicherheitslage in Niger verschlechterte sich täglich – wie in Mali. Die nigrischen Offiziere verbündeten sich mit Russland, Wagner-Söldner zogen durch das Land, der Hass richtete sich auf Frankreich, die Europäische Union, die USA. Aus dem Einsatzführungskommando in Potsdam war für Niger und Mali höchste Sicherheitsstufe befohlen worden. Niemand verließ das Feldlager ohne scharfe Waffe.
»Da war mal was mit Katanga-Gendarmen.« Leutnant Amann, schwerer Pionierzug, fragte in die Runde.
»Katanga-Gendarmen, so hießen die Militärs, die Anfang der 60er-Jahre den Unabhängigkeitsputsch der Region Katanga vom Kongo durchführten. Blauhelmtruppen schlugen sie später zurück. Katanga verlor die Unabhängigkeit. Die Gendarmen flohen in Nachbarländer, verdienten dort als Söldner verschiedener Herren ihren Lohn. Oft durchsetzt von Ex-Fremdenlegionären, Raufbolden, Kriminellen aus Europa, die ihr Glück in Afrika suchten. So mein Stand. Katanga ist übrigens eine der Regionen mit den meisten Bodenschätzen im Kongo. Früher Kupfer, heute Kobalt und in geringen Mengen Coltan. Das steckt in jedem Handy. Ein strategischer Rohstoff. 80 Prozent der weltweiten Coltan-Vorkommen liegen in der kongolesischen Provinz Kivu. Und dann gibt es noch die Blutdiamanten und das Gold. – Meine Herren, wir sind in Niger. Unser Job: alles für den Rückzug der Kameraden aus Mali vorbereiten und sichern. Weitere Fragen?« Egold nahm eine Aspirin.
»Abtreten.«
Die Lagebesprechung endete. Die friedlichen Tage auch. Das nigrische Militär putschte im Juli 2023, sperrte den Luftraum, verlangte den Abzug aller UN-Truppen und verbündete sich mit Russland. Zeitenwende in Afrika. Nur anders. Kein Soldat der Bundeswehr verließ mehr ohne Befehl das Lager; scharfe Waffe immer am Mann.
3 KONGO – HERZ DER FINSTERNIS
Abgehackte Hände. Überall lagen abgehackte Hände. Von Kindern. Und von Frauen. Im Herz der Dunkelheit das Grauen. Damals im Kongo. Kommissar Michael Fett atmete tief. Seine Ohren rauschten. Wut stieg in ihm auf, eine Wut, die zu einem Schrei werden möchte, einem Schrei, oder der Suche nach einer Waffe, einer Pumpgun; um die Täter in Klump zu schießen.
Er blickte in die Gesichter der Kinder, denen eine Hand fehlte, ein Fuß, in die Gesichter der Frauen, die stummen Augen, als seien sie von einem anderen Stern. Wie können Menschen das Menschen antun? Fett nahm einen großen Schluck Sidi Brahim. Chantal scrollte am Laptop durch die Bilder ihrer Heimat. War es ihre Heimat? War der Kongo noch ihre Heimat? Chantal Kalumba, Kriminaldirektorin und Leiterin der Police Fédérale in Lüttich, legte Bücher über den Kongo auf den Tisch. Mit ihr war er vor Jahren in Paris gewesen. Gemeinsam hatten sie viele grenzüberschreitende Fälle gelöst. Geboren in Kinshasa, war sie nach dem Abitur von ihren Eltern nach Brüssel geschickt worden. Jura sollte sie studieren. Sie hospitierte bei der Polizei, brach das Studium ab und wurde Polizistin in Belgien. Ihre Urgroßeltern wuchsen ohne die rechte Hand auf. So erzählten es die Großeltern mit Tränen in den Augen ihrem Enkelkind Chantal. Die Eltern hörten damals stumm zu. Ihr Entschluss, das Kind nach Belgien zum Studium zu schicken, stand fest.
»Wer hat das gemacht?«
»Der König der Belgier. Leopold II. Auch wenn er nie im Kongo war.« Chantals Stimme klang monoton.
»Wer noch?«
»Lemaire, sein Statthalter, der nicht genug Kautschuk lieferte. Das besorgte Fiévez, sein Nachfolger. Sie befehligten die ›Force Publique‹, eine Kolonialarmee: schwarze Soldaten, weiße Offiziere. Die privaten Kautschukbesitzer hielten sich disziplinlose kongolesische Bewacher. Wer einen Schuss abgab, der musste, um den Gebrauch der Munition zu rechtfertigen, die rechte Hand der Leiche abhacken. Zuerst auspeitschen mit der Nilpferdpeitsche, der Chicotte, wenn nicht genug Kautschuk geerntet wurde. Dann ein Schuss. Dann die rechte Hand. Es heißt, man habe Fiévez an einem Tag 1.308 Hände gebracht.«
Fett atmete schwer. Die Bilder arbeiteten in seinem Kopf.
»Leopolds Kongo war 74-mal größer als Belgien. Privatbesitz des Königs von 1885 bis 1908, danach wurde es Belgisch-Kongo bis 1960. Ein Land, so groß wie Westeuropa oder zwei Drittel von Indien. Das einzige Land in Afrika mit zwei Zeitzonen. – Und ab 1890 haben sie den kleinen Kindern die kleinen Hände abgehackt. Und den Frauen. Wenn nicht genug Kautschuk geerntet wurde. Oder einfach so.« Die Tränen liefen über Chantals schwarze Wangen.
Fett fasste sie an der Schulter.
»Völkermord?«, fragte er.
»Ein Blutbad von Psychopathen. Der Kongo war ein Schlachthaus, ein Spielplatz für Geistesgestörte, Sadisten, kleinbürgerliche Vandalen. Sie konnten sich austoben, Allmachtsfantasien ausleben. Teufel, weiße Schwerverbrecher, Sadisten, Mörder. Herrscher über Leben und Tod im Dschungel. Selbst waren sie hilflos gegenüber Malaria, Tropenkrankheiten, Schlaffieber. Ihre Aufgabe: Kautschuk für Reifen, die der schottische Tierarzt Dunlop damals erfunden hatte. Kautschuk war wie heute Kobalt, Coltan, Seltene Erden. Leopold wurde reich, verschönerte Brüssel, Belgien und glaubte nicht, was er über die Massaker, das Schlachthaus, die Grausamkeiten las. Wer über den Kongo spricht, muss auch über Leopold sprechen. Über die Profitgier des weißen Mannes, der nie satt wurde, der dieses Land ausbeutete, der die Menschen benutzte und sie einfach wegwarf.«
»Und über Lumumba«, sagte Fett, der den Namen in seiner Kindheit aufgeschnappt hatte, lange bevor sich der Name des Getränks über den des Politikers schob.
»Und über Patrice Lumumba, den ersten Ministerpräsidenten des unabhängigen Kongo«, sagte Chantal und wischte die Tränen von der Wange. »Erschossen nach gut zwei Monaten an der Macht am 17. Januar 1961 im Beisein von Präsident Tschombé und belgischen Offizieren. Er war von Léopoldville nach Katanga gebracht worden. Sein Leichnam wurde später exhumiert, zerteilt und mit Schwefelsäure aufgelöst. Nur ein Zahn mit Goldkrone blieb von ihm übrig. Den nahm der verantwortliche Polizeioffizier als Trophäe mit nach Belgien. Am 20. Juni 2022 wurde Lumumbas Zahn, 61 Jahre nach seiner Ermordung, von Belgien in die Demokratische Republik Kongo gebracht. Seine erwachsenen Kinder kamen nach Brüssel, um den Zahn des Vaters abzuholen, der in einem Sarg durch Kinshasa in ein eigens für ihn gebautes Mausoleum überführt wurde. Die Wunde ist noch nicht verheilt. – Überall Blut an den Händen. Übrigens war es angeblich nicht allein die CIA, die hinter seiner Ermordung stand. Es waren ebenfalls die Belgier. Andere sagen, auch der britische Geheimdienst sei beteiligt gewesen. – Okay, Lumumba war nicht vorbereitet auf seine Aufgaben, ein wenig kopflos. Aber er gab dem Kongo Hoffnung. So sagten es meine Eltern und Großeltern. Das alles löste sich in eine Abfolge von Kämpfen und Massakern auf. Am 30. Juni 1960 fand das Feuerwerk zur Unabhängigkeit statt, doch plötzlich verschärfte sich die Lage des Landes. Das Militär putschte, Lumumba versuchte zu retten, die Belgier flüchteten aus dem Kongo, alles brach zusammen: die Verwaltung, die Armee, einfach alles. Es war die berühmte Kongo-Krise. Und es ist nicht vorbei. Nach dem Fund der Seltenen Erden sind die Profitgeier wieder da: Amerikaner, Russen, Chinesen und die Europäer. Es hört nie auf. – Schade. Ein wundervolles Land. Das zweitgrößte in Afrika nach Algerien. Leider kommt es nicht zur Ruhe. Immer sind Reisewarnungen aktuell. Ich würde es dir gerne einmal zeigen, nur nicht jetzt.« Ihr Blick wanderte irgendwohin, weit weg aus Lüttich, als sei sie im Land ihrer Eltern, als sehe sie die Geschichte Kongos vor ihrem geistigen Auge ablaufen.
Fett blickte aus dem Fenster von Chantals Wohnung in Lüttich auf die Maas. Jeder hat eine Heimat, eine Herkunft, ein Land der Kindheit, der ersten Erinnerungen, der Spiele mit Freunden, Geschwistern, Erinnerungen an die Großeltern. Manchmal sind es gute Erinnerungen, manchmal schlechte. Sie prägen die Gefühle für das, was man Heimat oder Herkunft nennt. So richtig verlassen sie einen nie, kommen im Alter wieder näher, wenn man in die Abendröte des Lebens einbiegt. Er dachte an seine Zeit in den Feldern am Ortsrand von Düren, an seine Spielkameraden aus der Baby-Boomer Generation. Sie waren viele Kinder damals in den 60er-Jahren. Kein Fernsehen, keine Handys, keine Computer. Lange Sommerabende, Schnee im Winter, Stoppelfelder, Zuckerrüben. Frieden im Land. Und Chantal. Im Grunde wusste er nichts über ihre Kindheit. Sie sprach nicht darüber. Bis zu diesem Abend in Lüttich, als sie nach dem Essen auf ihre Herkunft zu sprechen kamen und sie einige Bücher über den Kongo auf den Tisch legte und ihren Laptop öffnete.
Ein dunkler Dezemberabend. Ihr Couscous war ein Gedicht, danach hatte er sie über den Kongo befragt. Nun schwiegen sie. Er dachte an seinen Vater, der im Dezember 1944 mit 17 Jahren bei Budapest gegen die Rote Armee gekämpft hatte. Bis ihn drei Schüsse trafen, er überlebte schwerverletzt. Währenddessen kämpften die Truppen der »Force Publique« des Kongo auf der Seite der Alliierten gegen die Deutschen und gegen die Japaner im Pazifik. Überall in den Familien: Narben der Vergangenheit.
»Michel, lies Eric Vuillard und David Van Reybrouck. Beide haben über den Kongo geschrieben. – Ich glaube, wir machen Schluss für heute. Morgen ist wieder ein Arbeitstag und wir beide müssen fit sein. Du in Aachen und ich hier an der Maas, in der feurigen Stadt Lüttich, in der die Community aus Afrika wächst. Vielleicht gehen wir das nächste Mal in ein kongolesisches Restaurant? Nun kommen die Weihnachtstage und Silvester. – Frag mich nicht. Ich bin weg. Weihnachten und Silvester bin ich in Brüssel bei Freunden und Verwandten.«
»Schade. Das kongolesische Restaurant klingt gut. – Ich hätte nicht nach dem Kongo fragen sollen. Biafra schoss mir durch den Kopf. Als ich klein war, da wurde über den Biafra-Krieg berichtet. Damals dachte ich, so, nun muss die Menschheit daraus lernen. Das wird nie mehr vorkommen. Als junger Polizeianwärter spendete ich regelmäßig für die Welthungerhilfe. Nichts wurde besser. Alles wurde schlimmer. Ich hätte nicht fragen sollen.«
»Doch. Du bist der einzige Mann, der danach fragt und zuhört. Das mag ich an dir. Auch das.« Sie gab ihm zwei Wangenküsse. Er spürte ihre warme Haut, das zarte Eau de Toilette. Bilder aus dem gemeinsamen Wochenende in Paris tauchten auf. Er wollte sie festhalten. Sie löste sich sanft.
»Falls dein Wagen nicht anspringt, ich habe ein Klappbett.« Sie lachte.
»Okay, ich bete zum Gott der Autobatterien, dass meine Batterie leer ist.« Beide lachten.
Die Batterie tat ihm nicht den Gefallen. Chantal winkte von ihrem Balkon, Fett fuhr am Denkmal für das Lütticher Original Tchantchès in Richtung Autobahnzubringer. Das Radio blieb aus.
»Gut angekommen?« Eine WhatsApp-Frage von Chantal um Mitternacht.
»Nein. Du fehlst«, schrieb er zurück. Er setzte »Bis bald« hinzu. Vielleicht etwas direkt, dachte er beim Zähneputzen. Ihm war danach.
In den nächsten Tagen bestellte Fett die Bücher, die Chantal erwähnt hatte. Er würde sie in der Weihnachtszeit lesen. Den Dauerregen über Weihnachten und die freien Tage bis Silvester nutzte er dazu. Das Grauen in Israel saß ihm in den Knochen. Der Anschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023. Ein Pogrom von hasserfüllten Terroristen an Frauen, Kindern, Greisen. Nichts war besser geworden. Im Gegenteil. Migranten feierten in Deutschland den Anschlag. Die Angst unter Juden wuchs. An deutschen Hochschulen kam es zu antisemitischen Protesten. Die linke Kulturszene schwieg. Die Bekenntnis-Musiker, -Maler, -Schauspieler, -Schriftsteller, sie schwiegen so laut wie nie zu dem Massaker an Israelis. Sie wurden erst vernehmbar, als Israel die Terrororganisation Hamas in Gaza angriff. Da standen viele auf: gegen Israel.
Silvester stand vor der Tür. Feuerwerk – trotz Klimanotstand, Krieg in der Ukraine, den immer noch entführten israelischen Geiseln.
4 SAKKO MIT LITSCHISUPPE
Silvester war für Michael Fett stets zweischneidig. Früher, als er jung und schön war, feierte er im Jakobshof in Aachen, wo der Eintritt niedrig und das Buffet nach 20 Minuten geplündert war. Da stürmten die Salonbolschewisten auf das Essen los, das glaubst du nicht. Eine Band schrammelte auf der Bühne irgendwas mit Liebe, Amour, Amore, aber erst kam das Essen, dann die Getränke und dann die Musik. 2000 war er auf dem Drehturm am Lousberg. Drehte sich der Turm? Er konnte sich nicht erinnern. Er war mit Freunden dort, wieder alleine, ohne eine Zufallsbekanntschaft. Die Erde drehte sich nach Mitternacht weiter, obwohl Nostradamus, Madame Teissier oder wer auch immer den Untergang, das Paradies oder weiß der Teufel was prophezeit hatten. Jetzt wieder Silvester. Der lange Morgen des Silvestertags, am Abend Theater Aachen mit »La Bohème« und Silvesterparty. Kollegin Conti war auf die Idee gekommen. Richtig bürgerlich, dachte er und kramte in seinem Kleiderschrank. Fett wäre vermutlich vor der Glotze mit »Dinner for One« eingeschlafen. Passte ihm mit Anfang 60 sein Anzug noch? Schwarze Schuhe, Krawatte, weißes Hemd? Auf wen würden sie treffen? All die feinen Leute. Silvester, Fett fremdelte seit langer Zeit mit dem Jahreswechsel, denn nichts änderte sich, auch wenn alle darauf warteten, daran glaubten. Gute Vorsätze. Ende Januar schon vergessen. Gerne hätte er mit Chantal gefeiert, doch sie war in Brüssel bei Freunden und Verwandten.
Er ging in die Küche, blickte auf die Türme des Rathauses. Krawall in der Silvesternacht. Die Einsatzhundertschaft durfte keinen Urlaub nehmen. Köln brauchte Verstärkung. Das Kriminalkommissariat hatte frei. Endlich. Nächstes Jahr wieder Bereitschaft.
Das Streuselbrötchen war trocken. Der Nescafé fast aufgebraucht. Der Sturm brauste. Seit zehn Tagen Sturm, Regen. Er flog mit seinem Klapprad durch die Straßen, wenn er es denn benutzte. Von Schnee keine Spur. Wie oft hatte es ausgerechnet in der Silvesternacht geschneit? Immer, in seinen Erinnerungen immer: Schnee, Frost, kalte Füße, verfluchte Ledersohlen.
Er holte am Abend Conti in der Promenadenstraße ab. Ihm stockte kurz der Atem. Sie sah umwerfend aus. Eben italienische Gene, dachte Fett und sparte nicht mit Komplimenten. »Ich geh als Ihr Bodyguard. Sie sehen umwerfend aus.« Conti im kleinen Schwarzen lächelte. Sie kaufte ihre Mode bei den Besuchen in der alten Heimat ein: Italien. Beide wünschten den Kollegen im Streifenwagen am Synagogenplatz eine ruhige Nacht und trafen gegen 19.30 Uhr am Theater ein. Gelbe Bändchen markierten sie als Partygäste nach der Oper, sie legten die Garderobe ab und nahmen die Treppe hoch ins Spiegelfoyer. Fett holte zwei Gläser mit lauwarmem Sekt.
»Salute, auf Sie und die letzten Stunden des alten Jahres. Danke für die Idee mit dem Theater.« Fett hob sein Glas und Conti lächelte ihn an.
»Auf Ihren Ideenreichtum. Erst der zweite Toast geht auf Ihre Schönheit. So machen es die Russen.«
»Darf man das noch?«
»Was?«
»Anstoßen wie die Russen?«
»Warum nicht?«
»Wegen Putin.«
»So war es vor Putin und so wird es nach Putin sein. Er hat den Toast nicht erfunden.«
»Da bin ich beruhigt.« Ein bisschen werde ich den Fett aufziehen, sagte sie sich. Aufziehen, nicht ausziehen.
Die Gläser stießen aneinander. Eine Dramaturgin betrat das Podest im Spiegelfoyer, richtete ihren Sprechzettel, ergriff das Mikro und erklärte den Inhalt der Oper inklusive Schlussszene.
»Jetzt wissen wir bereits, dass Mimi stirbt und Musetta ein leichtes Mädchen ist.« Conti fand die Vorwegnahme nicht gut.
»Wie im richtigen Leben, Kollegin.« Wieder eine von Fetts Redewendungen, die ihm eine Denkpause verschaffte. So richtig hatte er den Inhalt der Oper nicht verarbeitet. Dass er Opern nicht mochte, war sein Geheimnis. Er war bei Brechts »Dreigroschenoper« stehengeblieben.
Nach langem Applaus verließen beide um 23.10 Uhr das Parkett und gingen wieder hoch ins Spiegelfoyer. Der Andrang war enorm. Drei Buffetstationen wurden hergerichtet, Publikum mit und ohne Partyeinlass drängte in den Raum, rasch reservierte Fett einen Stehtisch für sich und Conti, denn das Gewusel wurde ihm zu viel. Die Damen waren schick, die Herren oft in unübersichtlicher Garderobe, irgendwas zwischen Businessanzug und Rotary-Mittagessen. Manche völlig von der Rolle in Westernstiefeln oder weißen Turnschuhen. Die Ansagen waren kaum zu verstehen, irgendwas von »Buffet« und »Bändchen«. Litschisuppe sippte bereits über das graue Sakko eines älteren Herrn, der im Sessel des Spiegelfoyers wie ein Toter im Moor versank. Alles geriet durcheinander.
»Ich besorge rasch zwei Sekt, bevor es Mitternacht schlägt.« Fett quälte sich durch die Reihen, gelangte zur Theke, wo der Sekt bereits abgefüllt, dementsprechend warm und prickelfrei stand. Keine Sekunde zu früh. In dem Durcheinander achtete niemand vom Organisationsteam auf die Uhr. Plötzlich war es Mitternacht.
»Auf ein gutes Jahr, Frau Conti.«
»Salute, Herr Fett, auf uns und das Leben.«
Ein Abend ohne Gedanken an abgehackte Hände, die ihn seit der Erzählung von Chantal verfolgten. Als die Top-Schlager der 70er- und 80er-Jahre endlich aufgelegt wurden, hielt es Fett nicht mehr am Stehtisch. Er zog Daniela Conti zu »Hot Love« von T. Rex auf die Tanzfläche. Zu den Bässen von Madonnas »Papa Don’t Preach« tanzten sie eng umschlungen und sangen beide: »You always taught me right from wrong.« Es folgten Noddy Holder, Leadsänger von Slade mit »Coz I Luv You« sowie Golden Earring mit »Radar Love« und Gianna Nannini auf Wunsch von Daniela Conti.
5 JULISCHKA AUF DIE HAUS
»Tu mir noch einen Julischka.« Mirko brachte einen. Nummer acht. In der Balkan-Grotte war alles so wie in jeder Balkan-Grotte. Eben Höhle. Weiße Ziegelsteine aus Kunststoff, Stroh aus Kunststoff, Dreschflegel, Wagenräder, Flokatis auf den Sitzbänken, undefinierbare Blumenarrangements zwischen den Essnischen, Spiegel, die eine Unendlichkeit der Grotte vortäuschten. Irgendwann muss Josip Broz Tito, antifaschistischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und Staatspräsident Jugoslawiens von 1953 bis 1980, auf die Idee mit diesem Exportschlager gekommen sein. Balkan-Grotten, die Erinnerung an einen Adriaurlaub im schönen Jugoslawien, bevor sich das Land Anfang der 90er-Jahre in einem Strudel von Brudermord, ethnischen Säuberungen und unterdrücktem Nationalismus auflöste.
Die Balkan-Grotten riefen die Erinnerung an das blaue Wasser vor Split, das preiswerte Essen in Dubrovnik, die Segeltörns mit leichter Bekleidung in der Adria wach. Liebesnächte vor und auf der Insel Krk. Da machte es Krk.
»Salat an die Salatbar«. Immer Salatbar: Mais, rote Beete, Tomaten, ein zwiebelreicher Kartoffelsalat, Kidneybohnen, riesige Salatblätter, geraspelte Möhren, Krautsalat, Cocktailsoße wie bei den Krabben aus dem Discounter. Die Balkan-Grotte in Düren war eine von tausend Balkan-Grotten. Auch in der Silvesternacht wurde kulinarisch der Balkan serviert. Kein Silvesterzirkus, normale Küche, länger auf, Sekt um Mitternacht.
»Eine Julischka auf die Haus.« Mirko strahlte in seinem eng anliegenden Kellnerkostüm. Stets sagten die Kellner in den südeuropäischen Gasthäusern »Auf die Haus.« Dann kam so ein Julischka-Fläschchen oder ein Ouzo-Stamperl. Julischka und Ouzo – allein der Vokalreichtum der geistigen Nahrung südlich der Donau ließ die Gäste schmunzeln. »Auf die Haus.« Das erfreut den deutschen Gast. Auf die Haus nimmt er gerne. Und aus dem Küchenfenster lugte die Köchin mit rotem Gesicht vom heißen Grill, auf dem Cevapcici und Filetsteaks brutzelten.
»Danke, Mirko. Auf die Haus!« Zack, da war das Fläschchen leer. Es sah aus wie eine Schrumpfflasche für Balsamico. Draußen knallten die Raketen. Mitternacht. Die Gäste in der Grotte stießen an.
»Gute neue Jahr, Burger.« Mirko kam mit einem Glas Schaumwein.
»Mirko, das wird ein Bombenjahr. Hoch die Tassen, in Afrika ist Muttertag.« Burger stieß mit Mirko an. Wie oft hatte Burger mit den Kameraden angestoßen? Unzählige Male. Erinnern konnte er sich kaum, schließlich endete es stets in einem grandiosen Besäufnis. Burger war gut in Form. Mitte 40, kurze Haare, Schrammen im Gesicht vom Kampf Mann gegen Mann, stahlblaue Augen, die Nase etwas zu lang, die Koteletten ebenfalls.
Burger wartete auf einen Anruf. Empfang in dieser Grotte? Ja, hatte er gecheckt. Sein Kontaktmann für diese spezielle Operation hatte ihn erreicht. Irgendein Käpt’n suchte einen Afrikaspezialisten mit Sprengstofferfahrung. Burgers Spezialität. Burger wollte mitmachen. Das hatte er auch seinen alten Kumpels Alain Tournier und Leonid Iwanow gesagt. Zwar sollte er unbedingt schweigen, aber die Kameraden, die brauchten Geld für die Zeit nach der Legion. Tournier und Iwanow waren bereit. Das hatte er seinen Kontaktmann wissen lassen, der etwas säuerlich reagiert hatte. Burger wollte das heute klarmachen. Burger musste aufstoßen. Neun Julischka, zwei halbe Liter rheinhessische Liebfrauenmilch, ein Balkanteller mit diesem Reis, dessen Namen er nie aussprechen konnte: Djuwitsch- oder Djuwätsch-Reis oder so ähnlich. Wenigstens »Dame Blanche«-Eisbecher kannte er. Aus der Kindheit. Bevor der Vater weggesperrt wurde und die Mutter diesen Horst heiratete. Mit siebzehn stach der Fritz dem Horst die Leber weg. So ein Arsch. Sein Vater schickte ihm eine Postkarte aus dem Knast: »Jut jemacht, Großer!« Es folgte Jugendknast für Fritz. Dieser Scheiß. Als er rauskam, da stand die Czernatzke auf ihn, als er im Club Hansemann die Puppen tanzen ließ. Ja, die Czernatzke, die war ein heißer Feger. Die wollte den Burger sogar heiraten. Und was passiert mit ihr? Sie kam unter den Betonmischer. Hatte wieder zu viel Piccolo getrunken. Die Czernatzke. Der Betonmischer-Arsch aus Belgien wurde von Burger perforiert. Auch mit dem Messer. Voll die Promille. Mildernde Umstände. Wieder Knast. Sah man ihm an. Was willste mit so einem Scheißleben anfangen? Lager einräumen beim Discounter oder Türsteher an der Jugenddisco? Fritz Burger verdingte sich bei der Fremdenlegion. Eines Tages schritt er mit einer Sporttasche und 5.000 Francs in Aubagne auf die Kaserne der Légion Étrangère zu. Die Aufnahmetortur schaffte er mit links. Im Knast war er täglich in der Muckibude. Mit dem Képi blanc meldete er sich für die Fallschirmjäger, kam zuerst nach Französisch-Guyana zur Spezialausbildung und später nach Korsika. Seine Tattoos erinnerten an Einsätze. Afrika war sein Spezialgebiet. Zuletzt Mali, diese Scheiße. »Operation Barkhane«, so lautete der Name. Unterstützung für die UN-Truppe, darunter das deutsche Kontingent, das in Goa im Rahmen der UN-Mission MINUSMA stationiert war. Wenigstens sind wir früher raus als die Bundeswehr, dachte Burger. Wir hatten genug Verluste in der beschissenen Wüste mit den durchgeknallten Islamisten. Burger nahm Abschied aus der Fremdenlegion, er wollte nicht als Legendenerzähler im Altersheim der Legion enden. Er war fit genug für die privaten Sicherheitsfirmen. Die zahlten Extraprämie für Spezialisten wie ihn.
»Tu mir noch einen, Mirko!«
Das Handy brummte. »Ja?«
»Komm raus. Parkplatz der Musikschule. Dunkler Van an der Ausfahrt Lessingstraße.«
»Klar.«
»Nüchtern!«
»Logo.«
»Mirko, wir machen die Zehn voll. Ich zahle. Verstanden? Nix mehr auf die Haus. Haus am Arsch sonst.« Burger lachte. Bald wird es ernst. Das spürte er. Er dachte an all die Julischkas seines verpfuschten Lebens. Hunderte, ach was, Tausende, sagte er sich und setzte das Balsamicofläschchen an seine spröden Lippen in der Neujahrsnacht. Dazu der Pastis in den Bistros der Garnisonsstädte der Fremdenlegion.
Burger legte einen Hunni auf den Tisch.
»Stimmt so, Mirko. Immer schön sauber bleiben. Verstanden?«
»Immer sauber, Burger.« Mirko lächelte das letzte Lächeln für Burger.