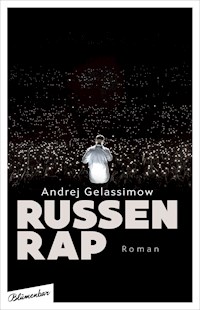
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wahres Rap-Märchen aus Russland. Tolja und seine Freunde wollen rappen und damit richtig viel Geld machen. So wie ihre Vorbilder in den USA. Denn auch ihr eigener Alltag in Rostow am Don ist Mitte der 1990er Jahre von Armut, Drogen und Kriminalität geprägt. Bei Toljas erstem großen Konzert ist unter seinen Fans auch Lena, ein Mädchen, das anders ist als alle anderen. Doch als sie ihn aufspürt und ihm helfen will, von den Drogen wegzukommen, ist Tolja erst gar nicht begeistert. Dennoch ist es der Beginn einer ganz großen Liebe. Und auch seine musikalische Karriere nimmt weiter Fahrt auf. Andrej Gelassimow erzählt mit literarischem Furor und unvergleichlicher Authentizität vom märchenhaften Aufstieg eines Mannes, der Russlands wohl einflussreichster Superstar Basta sein könnte. Und von der Sehnsucht nach dem Flow – in der Musik und im Leben. Andrej Gelassimow erzählt mit literarischem Furor vom märchenhaften Aufstieg eines Mannes, der Russlands wohl einflussreichster Rap-Superstar Basta sein könnte, und setzt dabei einer ganzen Generation russischer Rapper ein Denkmal. „Dies ist das beste ernstzunehmende Buch über verrückte Menschen.“ FRÉDÉRIC BEIGBEDER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Nach einem Konzert in Dortmund begegnet der international erfolgreiche Rapper Toja seiner Jugendliebe Maika wieder. Mitte der 1990er Jahre waren sie beide Teenager in Rostow am Don, der erste Tschetschenienkrieg war in vollem Gange, die wirtschaftliche Lage in Russland schlecht. Tolja und seine Freunde, zu denen auch die selbstbewusste Maika gehörte, wollten damals eigentlich Musik machen, aber sie versanken immer tiefer in den Drogen. Auf dem Höhepunkt seiner Sucht setzt ihm seine Mutter, eine gelernte Krankenschwester, einen letzten Schuss. Nur so kann Tolja sein erstes großes Konzert durchstehen. Es wird ein Riesenerfolg und sein Song „Mama“ zu einem großen Hit. 1986: Tolja hat eine Entziehungskur hinter sich und geht in ein Kloster, um wieder ins Leben zurückzufinden. Dort spürt ihn Lena auf, die etwas exzentrische Tochter eines neureichen Geschäftsmanns. Lange glaubt Tolja nicht an ihre Liebe und eine gemeinsame Zukunft. Doch mit viel Geduld und über so manches Zerwürfnis hinweg vermag sie ihn zu überzeugen. Und auch Toljas Karriere als Rapper nimmt nun Fahrt auf.
Über Andrej Gelassimow
Andrej Gelassimow, geboren 1965 in Irkutsk. Philologiestudium in Jakutsk, promovierter Philologe, später Besuch einer Regieklasse am Moskauer Theaterinstitut. Einer der wichtigsten russischen Erzähler seiner Generation. Seine Romane wurden verfilmt und preisgekrönt. 2011 erschien sein Roman „Durst“ auch in Deutschland.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andrej Gelassimow
RussenRap
Roman
Aus dem Russischen von Thomas Weiler
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil — Pistoletto
November 2016, Dortmund
Mai 1996, Rostow am Don
November 2016, Dortmund
Mai 1996, Rostow am Don
November 2016, Dortmund
Mai 1996, Rostow am Don
November 2016, Dortmund
Mai 1996, Rostow am Don
November 2016, Dortmund
Sommer 1996, Rostow am Don
November 2016, Dortmund
Zweiter Teil — Tolja
Sommer 1998, Gebiet Pskow
Frühjahr 1997, Rostow am Don — Psychotherapeutisches Gespräch Nr. 1
Sommer 1998, Gebiet Pskow
Frühjahr 1997, Rostow am Don — Psychotherapeutisches Gespräch Nr. 2
Sommer 1998, Gebiet Pskow
Frühjahr 1997, Rostow am Don — Psychotherapeutisches Gespräch Nr. 3
Sommer 1998, Gebiet Pskow
Dritter Teil — Booster
November 2016, Dortmund
Winter 2001, Moskau
November 2016, Frankfurt am Main
Winter 2001, Moskau
November 2016, Frankfurt am Main
22. April 2017, Moskau, — Olympiahalle
Anmerkungen
Danksagung
Impressum
Erster Teil
Pistoletto
November 2016, Dortmund
Beim Soundcheck rückte die Polizei mit einem großen Hund an. Mitja wollte noch protestieren, aber die Deutschen hörten gar nicht auf ihn.
Der Schäferhund beschnüffelte unsere Boxen und Cases. Ljoscha Jay kicherte nervös und schlug vor, ihm den blanken Arsch zu zeigen. Sascha drosch auf seine Drums. Anja sang sich ein. Die Deutschen warteten darauf, dass das Vieh etwas fand.
Der Schäferhund gefiel mir natürlich. Als Kind hatte ich genau so einen gewollt. Aber jetzt platzte mir echt der Kragen.
»Habt ihr den Arsch auf?«, fragte ich den Boss dieses herrlichen Hundes ganz unschuldig. »Wir haben in zwei Stunden Konzert. Das Abschlusskonzert der Tournee.«
Der schmächtige Jay, allzeit bereit, für die Freiheit zu sterben, brüllte fies-fröhlich von hinter dem Pult. In den Sechzigern hätte er garantiert mit Che Guevara und seinen Jungs Bolivien aufgemischt, aber er war eben zu spät geboren und kämpfte jetzt allein gegen die weltweite Tyrannei.
»Wortwörtlich übersetzen?«, fragte das Mädel, das Mitja unter den Russen hier aufgetan hatte, ihn höflich.
»Nein«, antwortete er. »Der Spur nach.«
Gerufen hatte die Polizei, wie sich herausstellte, die Eigentümerin des Saales.
»Wie jetzt? Wieso?«
»Ist ihr gutes Recht«, erklärte der Polizist über die Dolmetscherin. »Der Laden gehört ihr.«
»Mitja«, sagte ich in aller Deutlichkeit. »Haben wir sie irgendwie geärgert? Oder hat sie die Musiker mit Stoff gesehen?«
»Wenn sie was gesehen hätte«, antwortete er sinnig, »hätte der Hund schon was gefunden.«
Dem konnte man kaum widersprechen. Der Riese saß ruhig mitten auf der Bühne und grinste über sein ganzes Schäferhundgebiss.
»Dann auf zu der guten Frau«, sagte ich. »Soll sie das Theater hier mal erklären.«
Die gute Frau saß in einem Büro, das eher etwas von einer Garage hatte. Jedenfalls stand neben ihrem Tisch ein schickes Superbike. Ein weiteres Motorrad war hinter ihr geparkt. Sah aus, als wäre sie mit ihnen direkt hier reingefahren. Die Hälfte der Wand zu ihrer Rechten nahm ein extrabreites Garagentor ein. Überall hingen Fotos von Boxern und MMA-Kämpfern mit zerkloppten Visagen. Auch vor ihr auf dem Tisch stand ein Foto. Darauf strahlte ein vielleicht achtzehnjähriger Bursche, den Championgürtel über den Kopf gestemmt.
»Mitja, treten wir in einem Boxclub auf, oder was?«
Er erklärte hastig: »Weißt du, sie ist selber auf uns zugekommen. Wir haben Säle gesichtet, ein paar Eigentümer angerufen, aber dann hat sie ihren angeboten.«
»Und?«
»Der Preis war absolut oberhammer.«
»Mal langsam«, sagte ich. »Die gute Frau will, dass ich bei ihr rappe, gibt uns fetten Nachlass bei der Miete und holt dann selber die Bullen?«
»Tolja, ich versteh schon, das hakt ganz gewaltig. Fragen wir sie doch einfach.«
Ich sah mir die Frau an, die mit verschränkten Armen geduldig abwartete, dass wir fertig wurden und in ihrer Sprache mit ihr redeten.
»Also gut«, sagte ich.
»Frau Steinbach«, fing Mitja mit Blick zur Dolmetscherin an. »Offenbar liegt hier ein Missverständnis vor …«
»Schick sie raus«, sagte die Deutsche, die mich durch ihre riesige dunkle Brille betrachtete, plötzlich auf Russisch, bevor die Dolmetscherin auch nur den Mund aufbekam.
Mitja und ich wechselten einen Blick, ich nickte. Als sie draußen waren, steckte sich die russische Deutsche hinter dem Tisch eine Zigarette an und fixierte mich wortlos weiter.
»Und?«, fragte ich nach einigen Sekunden Schweigen.
»Was ›und‹?«
»Vielleicht erklären Sie mal Ihre Blackouts.«
Sie blies grinsend den Rauch aus.
»Was hab ich denn zu erklären? Du bist doch zu mir gekommen. Du bist dran.«
Ich schnaubte bloß und ließ mich in den breiten Sessel ihr gegenüber fallen.
»Also gut. Springen Sie mit Ihren Musikern immer so um?«
»Wie?«
»Polizeikontrolle vor dem Konzert.«
Sie dachte kurz nach und schüttelte dann den Kopf.
»Nein, nur mit dir.«
»So? Und warum, wenn ich fragen darf?«
Sie zuckte die Achseln.
»Weil du der erste Musiker bist, der hier auftritt. Ich hab eigentlich einen Boxclub, falls du das noch nicht bemerkt hast.«
Sie zeigte auf die Fotos an der Wand.
»Jetzt hören Sie mal zu«, fing ich an. »Mitja hat mir grade gesagt, Sie wären selber …«
»Ich hab gehört, was er gesagt hat«, fiel sie mir ins Wort. »Tolja, ich bin nicht taub. Aber du bist anscheinend blind.«
Sie setzte die dunkle Brille ab, die ihr halbes Gesicht verdeckt hatte, und legte den Kopf leicht schief.
Da sah mich jemand aus einer so fernen und so unmöglichen Vergangenheit an, dass wohl nur ein komplett zugedröhnter Junkie nicht irritiert gewesen wäre.
»Bist du clean?«, fragte sie. »Die Polizei hab ich nur deinetwegen gerufen. Ärger kann ich hier keinen gebrauchen.«
»Maika …«, brachte ich heraus. »Du hier? Wie kommst du hierher?«
Damals in Rostow, vor über zwanzig Jahren, ist wegen Maika der Karren richtig vor den Baum gekracht. Jede Erinnerung an sie hatte ich über die Jahre ausgemerzt. Jetzt kam alles hoch.
Das alte, abgelebte Herz muckte wieder auf.
Deshalb verging das Konzert wie im Nebel. Wir leisteten ganze Arbeit, alles lief nach Plan, aber ich hatte nicht nur die wippenden Arme all der Leute in der Fanzone vor Augen.
Ich sah wieder Maikas schwachsinnigen Bruder Djoma vor mir, den mit fremdem Blut besudelten Wadik, die Rostower Bande der Neunziger, die Piranhas im Stadtbad und meine Mutter mit der Spritze in der Hand.
Dazwischen kamen ständig Bilder der neuen deutschen Maika, mit Motorrädern, Boxern und dem Foto ihres Sohnes auf dem Schreibtisch. Sie musste sehr stolz sein auf ihn. Das war mir klar. Maikas Sohn: ein Champion. Das war es, was sie immer vom Leben verlangt hatte: Championship.
Und wir waren Loser für sie.
Aber die Bullen hier hatte sie natürlich nur gerufen, um sich zu rächen. Was ich ihr damals angetan hatte, war unverzeihlich. Niemand würde das verzeihen.
»Fuck! Halt ihn!«, brüllte Michael links aus den Kulissen.
Da war ich zurück in der Realität. Ein dicker Deutscher im weißen T-Shirt lief über die Bühne auf mich zu, Michael schnitt ihm den Weg ab. Der Deutsche, mit einem seligen Grinsen, wähnte sich kurz vor dem Touchdown.
Arschlecken! Unserem Michael entkommt keiner. Der hat schon ganz andere abgefangen.
Wumm! Ein Zusammenstoß wie von zwei richtigen Rugbyspielern. Der Saal tobte.
Könnte man auch extra loslassen ab und zu, so eine Wildsau. Die Leute mögen es, wenn’s kracht. Und Michael kann da keiner was. Wie viele hat er abgeräumt, bis er sitzen musste wegen Totschlag.
»Sorry, Tolja, kommt nicht wieder vor!«
Kein Ding. Weiter im Text. Ich war nicht mal aus dem Takt geraten. Wenigstens musste ich nicht mehr an Maika und an Rostow denken.
Die Fanzone hatte kapiert, dass das der letzte Track war, sie skandierte: »Boo-ster! Boo-ster! Boo-ster!«
Also Abgang. Die Startrakete hatte ihren Dienst getan.
Auf dem Weg von der Bühne verfranzten wir uns noch. Mitja verpasste einen Abzweig, und wir landeten in einer Sackgasse mit riesigen Kisten.
»Mitja! Ein schöner Sussanin bist du, echt!«
Draußen war es kühl, fast schon Dezember. Die frische Luft in der Tür wirkte nach der Schwüle wie ein Schluck Wodka.
»Schaffen wir das noch?«
»Aber sicher, Tolja. Ich hab dem Fahrer gesagt, er soll zweihundert fahren.«
»Und die Blitzer?«
»Die Strafen zahlen wir, kein Ding. Abflug ist in anderthalb Stunden. Müsste reichen.«
Ich ließ mich in den Rücksitz fallen. Unser Litauer am Steuer warf mir einen Blick im Rückspiegel zu.
»Was ist, Schuhmacher?« Ich zwinkerte ihm zu. »Komm, Bruder, drück auf die Tube. Zu Hause warten sie auf mich.«
Und er drückte. Nach fünf Rennminuten auf den nächtlichen Straßen meldete sich das Telefon in meiner Tasche.
»Hallo, Papa!« Auf dem Display leuchtete das Gesicht meiner Tochter. »Wie geht’s dir?«
»Gut, Liebling. Wieso bist du noch auf?«
»Ich war schon im Bett, aber dann hab ich mir einen neuen Namen für dich ausgedacht. Den wollte ich dir sagen.«
»Echt? Dann sag mal.«
»Du bist der Skype-Papa.«
»Wow.«
»Und der FaceTime-Papa.«
»Nicht schlecht …«
»Und der WhatsApp-Papa!«
Sie sieht so glücklich aus, ein Geburtstagsstrahlen. Klar … hat sie sich selber ausgedacht.
»Also ich find die Namen super.«
»Echt? Gefallen sie dir?«
»Hammer!«
»Ich texte auch, genau wie du!«
»Nein, meine Liebe, du kannst das viel besser. Ich würde nie im Leben auf so was kommen. Ich bin doof, weißt du doch.«
Sie lachte, drückte einen Kuss auf ihre Hand und die Hand auf das Display.
»Tschüss, Papa! Wir warten auf dich.«
»Schlaft schön. Morgen früh bin ich da.«
Ich steckte das Telefon ein, drehte mich zum Fenster und musste wieder an Maika denken. Unmöglich, jetzt nicht mehr an sie zu denken.
Und an Rostow.
Mai 1996, Rostow am Don
In Tschetschenien ging es damals schon langsam zu Ende, aber in den Krankenhäusern in Rostow lagen noch haufenweise Jungs, die es erwischt hatte. Als wir aus dem Verbandzimmer kamen, warteten vor der Tür bestimmt fünfzehn Mann. Bis sie dran waren. Einer mit Arm, einer mit Bein, der Dritte mit sonst was. Vor meinem Vater traten sie wortlos beiseite, niemand grüßte vorschriftsmäßig. Bei uns erzählte man sich, wie die Offiziere in Tschetschenien mit den Soldaten umsprangen. Kein Wunder, dass Sterne auf den Achselklappen hier nicht sonderlich beliebt waren.
»Wo willst du hin?«, brummte er, als er sah, dass ich nach rechts wollte. »Da geht es nicht raus.«
»Noch auf einen Sprung zu Tahir. Hab ich versprochen.«
»Auf einen Sprung!« Er packte mich am Ärmel und zerrte mich nach links den Gang hinunter. »Ich geb dir gleich, auf einen Sprung! Dann kannst du die andere Schulter auch noch versorgen lassen. Hab ich mich klar ausgedrückt?«
Die Jungs vor dem Verbandzimmer schielten zu uns herüber, aber ich konnte in ihren Blicken weder Neid noch Mitleid erkennen. Ein Offizierssöhnchen war für sie genauso ein Arschloch wie der Offizier selber, wenn nicht noch schlimmer. Einen Hauptmann der Strategischen Raketentruppen wünschte sich hier garantiert niemand als Vater. General wäre wahrscheinlich noch gegangen, aber auch Generalskinder waren nach 94 in Tschetschenien reihenweise gefallen.
Vor der Krankenhaustür erwarteten den Genossen Hauptmann und mich ein ganzes Rudel Soldatenmamas. Einige hatten Kinder dabei. Die Kleinen hatten sie aus allen Winkeln der »Ruhmreichen« angeschleppt, offenbar, um die aus dem Krankenhaus kommenden Offiziere zu erweichen. Vielleicht konnten sie sie auch einfach nicht allein zu Hause lassen. Wer wusste schon, was mit den Papas dieser angeschlagenen Jungs war? Mama bleibt Mama, die wartet auf jeden Fall und rennt dir auf den Eisenbahnschwellen nach, von Tjumen bis Rostow. Papa hat sich die Kante gegeben, und ab dafür. Sohn hin oder her. Ob sie ihn einberufen haben, die verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen oder nicht, ist schließlich sein Problem. Ist halt zur Unzeit geboren, hätt er mal vorher seinen Kopf angestrengt.
Männer waren in dem Rudel also praktisch nicht vertreten.
Aber meinem Genossen Hauptmann ging die ganze Gesellschaft sowieso komplett an der Achsel vorbei. Er hatte sich längst an diese Mamas gewöhnt in seinen langen, harten Dienstjahren. An welchem Kontrollposten gab es sie nicht?
»Sag mal«, meinte er zu mir und stoppte mich brüsk mit der Hand am Ärmel, »wer ist denn dein Vater?«
Ich stand vor ihm und dachte mir: Guck an, jetzt hapert es also auch schon mit dem Gedächtnis.
Im Bierkiosk nebenan sang Jura Schewtschuk vom Herbst.
»Du solltest aufhören zu saufen, Genosse Hauptmann. Jetzt bist du schon daneben, wenn du gar nicht besoffen bist.«
Darauf er zu mir: »Mund halten! Denk im Zweifel dran, wer dein Vater ist.«
Und ich: »Ich weiß schon. Wir alle hier sind Kinder Rostows. Im Zweifel.«
Dafür wollte er mir eine schallern, aber da kamen ihm die Mamas über den Hals. Eigentlich waren sie auf ihn losmarschiert, sobald wir aus der Tür getreten waren, aber da den Genossen Hauptmann die Vaterschaftsfrage so beschäftigt hatte, war ihm der Anmarsch der weiblichen Streitkräfte entgangen.
Sie waren bewaffnet mit rotzenden Kleinkindern, Essenstüten und Fotos ihrer Jungs, die aus dem Krankenhaus nicht zu ihnen gelassen wurden. Schewtschuk sponn nebenan das lyrische Herbstthema weiter.
»Genosse Offizier! Genosse Offizier!«, machte sich die überschaubare, aber in ihrer Not fest zusammengeschweißte Armee bemerkbar.
Hätte mich die Nikolajewna nicht von klein auf mit Musikunterricht und ihrem dämlichen Akkordeon zugeknallt, wäre ich garantiert unter die Maler gegangen. Vor allem, wenn ich noch hätte zeichnen können. Hier vor dem Krankenhaus umringten uns nämlich solche Mamaschas, solche Gesichter, dass der olle Rembrandt oder sonst wer in seinem Holland sich vor Neid die Kugel gegeben hätte.
Dörfler und Städter, Junge und Alte, Hübsche und Hässliche, und alle dermaßen auf Zack, dass der Genosse Hauptmann nicht mal die Chance hatte, Luft zu holen, geschweige denn die Kurve zu kratzen. Sie kamen echt aus sämtlichen Altersklassen. Bei manchen schmorte hier schon der dritte oder sogar vierte Junge im Krankenhaus, bei anderen hatten sie, scheint’s, den ersten einkassiert. Und nicht bloß einkassiert, sondern gleich in den Krieg geschickt. Solange er sich noch an die eigene Kindheit erinnern konnte, als das Gewehr aus Holz gewesen war, der Stab hip, der Feind der Deutsche, als »Krieg« etwas völlig anderes bedeutet hatte. Und lustig gewesen war. Jedenfalls ohne Säuberungsaktionen, abgeschnittene Köpfe und von Panzern platt gewalzte Körper. So weit hätte die Phantasie der Jungs hinter den Garagen niemals gereicht. Das Leben hatte wohl noch viel krassere Spiele auf Lager.
Die schlichteren Mamas waren besonders lebhaft. Sie belagerten meinen Genossen Hauptmann in einem engen Ring, so dass den intelligenteren Damen nichts anderes übrigblieb, als ihre Fotos zwischen deren Köpfen und Schultern hindurchzustrecken. Das passte den Vordermamas nicht unbedingt, deshalb landeten die Jungs auf den Bildern aus der zweiten Reihe immer wieder mal im Rostower Staub.
Der Genosse Hauptmann konnte noch froh sein, dass ihn nur Zugereiste umzingelt hatten. Hätte sich vor dem Krankenhaus dieselbe Menge hiesiger Frauen versammelt, um ihre ramponierten Kinderlein zu Gesicht zu bekommen, hätte hier nicht nur ein einsamer Offizier, sondern der komplette Kontrollposten einen mitbekommen fürs restliche Leben. Wenn sie ihn nicht gleich ganz eingerissen hätten, den Leuten drin gründlich den Kopf gewaschen hätten sie auf jeden Fall. Wenigstens war das Krankenhaus nicht weit, da hätte man sie notfalls gleich wieder zusammenflicken können. Von einem Assist der Rostower Babuschkas wollen wir gar nicht erst anfangen. Die müssten natürlich zu Hause bleiben. Und dürften nicht hier nach den Enkeln sehen. Kämen die Babuschkas, wäre der Heldentod für alle Beteiligten garantiert.
»Genosse Offizier! Wolodja Sinitschkin, Brigade Maikop! Wie geht es ihm?«
»Senja Smirnow! Regiment Petrokow!«
»Ljoscha Potapenko! Darf man zu ihm?!«
»Tolja! … Tolja! … Tolja! …«
Die Mamas brüllten so laut, dass Toljas Nachname aus den hinteren Reihen einfach nicht durchdringen konnte, so dass nichts als sein Vorname überliefert ist.
»Frauen!!!«, brüllte mein Genosse Hauptmann schließlich zurück. »Hört auf zu drängeln, Frauen! Schluss mit dem Basar!«
Sie verstummten.
»Also: Mit dem Krankenhaus hier habe ich überhaupt nichts zu tun! Ich weiß nichts über eure Söhne, kann euch aber versichern, dass sie von den besten Fachleuten versorgt werden.« Er maß die augenblicklich still gewordene Menge mit einem hauptmännischen Blick. »Noch Fragen?«
Eine der Frauen meldete sich wie ein Schulmädchen und sah ihn ängstlich an, befürchtete, er würde sie gleich zusammenstauchen.
»Ich höre«, sagte er großmütig.
»Die erzählen uns ja nichts«, begann sie hastig. »Und lassen uns nicht zu den Jungs. Wir wissen gar nicht, wie und was. Fehlt nur noch, dass sie uns hier von der Tür verscheuchen. Und Sie haben doch Schulterstücke …«
Damit hatte sie ihn. Er schlug gleich einen menschlicheren Ton an.
»Sehen Sie, gute Frau, ich war ganz privat im Krankenhaus. Eine familiäre Geschichte …«
»Wir haben hier alle eine familiäre Geschichte, Genosse Offizier. Familiärer geht es gar nicht. Schauen Sie, da, mein Sohn, erkennen Sie ihn wieder? Haben Sie ihn drinnen gesehen? Ich muss wenigstens wissen, ob er laufen kann oder nicht.«
Sie hielt ihm ein Foto hin, und wie auf Kommando zogen alle anderen nach.
»Nein.« Er schüttelte den Kopf und nahm die Mütze ab. »Den hab ich nicht gesehen, tut mir leid.«
Als wir ein Stück weiter weg waren, setzte er sich den Deckel wieder auf. Vorher hatte er ihn schön in der Hand gehalten und sich am Kopf gekratzt. Das mit den Müttern war ihm sichtlich an die Nieren gegangen. Auch als Hauptmann. Der sich eigentlich zusammenzureißen hatte.
Da musste ich natürlich einhaken.
»Da hast du’s«, sagte ich zu ihm. »Du faselst was von wegen Vater, von Sohn. Dahinten liegen reihenweise herrenlose Söhne im Krankenhaus. Such dir einen aus. Sind halt schon ein bisschen runter.«
Er blieb stehen und sah mich an.
»Sag mal, spinnst du?«
Ich zu ihm: »Klar spinn ich. Fragt sich nur, von wem ich das hab.«
Er antwortete kopfschüttelnd und mit einem schiefen Grinsen: »Na, von Tahir ganz bestimmt nicht.«
Danach wechselten wir den gesamten Heimweg über kein Wort mehr.
Meinen Vater sah ich das erste Mal mit sieben. Davor gab es den Tschetschenen Tahir. Wie es dazu kam und wie er zwischen Vater und Vater aufgetaucht ist, hat Mama mir nie erzählt. Mein Bruder und ich haben auch nicht so richtig nachgefragt. Von Tahir musste man einfach begeistert sein, man musste ihn mögen, und wenn du jemanden magst, wirst du ihn kaum fragen: Was willst du hier?
Als mein Vater zurückkam, stand Tahir ohne ein Wort auf und ging. So war er eben. Klar und bestimmt. Hundertprozentig. Was habe ich nach ihm gesucht – ohne Chance. Kein Ninja kann so verschwinden. Kein normaler Ninja und keine Schildkröte. Mein Bruder und ich hatten drei Turtles. Die waren auch immer mal weg. Mal Raphael, mal Michelangelo. Sie fanden sich jedes Mal wieder. Aber hier – vergiss es.
Und heute im Krankenhaus plötzlich: Tahir. Kommt mir so auf dem Gang entgegen, strahlt. Erst hab ich gedacht, das ist nur Einbildung, von den Schmerzen. Oder von ihren Pills. Aber von wegen, kein Stück. Er hat mich vorsichtig in den Arm genommen, sogar meinem Vater die Hand geschüttelt und gesagt: »Schau nach dem Verbinden in meinem Zimmer vorbei.«
Und ich hab nicht vorbeigeschaut. Der Genosse Hauptmann hat mich nicht gelassen.
»Hör mal«, begann er auf den Treppenstufen zum Haus. »Mir über deine Schusswunde irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen ist das eine, aber was machst du mit der Nikolajewna? Glaubst du, die kauft dir den Mumpitz von der Waffe auf der Datsche bei einem Freund ab?«
Da hatte er recht. Daran hatte ich auf dem Rückweg vom Krankenhaus auch selber schon herumgehirnt. Mit der Nikolajewna war nämlich nicht zu spaßen. Die Wahrheit kam natürlich nicht infrage, aber sie durchschaute jeden Bluff sofort. Die harten Jungs aus den CIA-Thrillern sollten sich nicht drüben in Langley rumtreiben, sondern bei uns im Treppenhaus und sie anwerben. Dann könnten sie ihre Lügendetektoren einmotten. Sensoren, Psychologen, Analytiker – verglichen mit ihr war das alles Kinderkram. Die Nikolajewna hatte den Riecher. Sie erkannte Lügen am Geruch. Also saß ich in der Zwickmühle. Die Wahrheit konnte ich nicht sagen, und lügen – das ging gar nicht.
»Wird schon«, sagte ich zum Genossen Hauptmann auf dem Weg ins Treppenhaus. »Hauptsache, du wirkst möglichst natürlich.«
Mein Vater nickte und stieg hinter mir die Treppe hinauf. Er wollte die Wohnung nicht als Erster betreten.
Nach seiner siebenjährigen Abwesenheit und der unangefochtenen Herrschaft der Nikolajewna über das Leben von uns Brüdern hatte er zwar nicht direkt Angst vor ihr, ging aber kritischen Situationen lieber aus dem Weg. Sie war nicht nur in unserem Hinterhof gefürchtet. Eigentlich wusste das ganze Viertel, ganz Rabotschi Gorodok, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen war.
Die Nikolajewna, Babulja, Big Ba – sie hatte die verschiedensten Namen bei uns im Viertel, und sie trug jeden einzelnen weit würdevoller als der Genosse Hauptmann seine Sterne. Sie hatte ziemlich bescheidene Maße, kaum anderthalb Meter über dem Boden, nahm das »Big Ba« aber nie als Spottnamen. Erstens war sanfte Ironie in Rostow ein Zeichen für aufrichtige Liebe und allgemeine Anerkennung, zweitens war sie im Innern ihres winzigen Körpers eine wahre Titanin. Ein Herkules des Greisenreiches. Diese Diskrepanz zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem konnte unvorsichtige Unglücksraben irreführen, mit verheerenden Folgen.
Vor fünf oder sechs Jahren hatte die Nikolajewna vom Balkon aus gesehen, wie ein Trio lokaler Zombies ein gleichaltriges Mädchen von vierzehn Jahren aus dem Nachbarhaus hinter die Garagen zerrte. Zusammen spielen wollten sie ganz offensichtlich nicht. Die Babulja schnappte sich den Kartoffelstampfer und zerkloppte damit kurz darauf das Gesicht eines der wissbegierigen Wollüstlinge zu einem blutigen Brei. Ihre Methode bestand in der Auslassung jeglicher Vorspiele. Nie brüllte sie, drohte, warnte oder versuchte den Übeltäter von seinem Plan abzubringen. Sie tauchte einfach aus dem Nichts auf und schlug dann kräftig und gezielt ins Gesicht. Wie Batman, bloß mit dem Stampfer. Das machte Eindruck.
Als am selben Abend die Mutti des Unglücklichen mit saftigen Forderungen bei uns aufschlug, empfing die Nikolajewna, die gerade für meinen Bruder, für mich und das betroffene Mädchen Bliny buk, sie mit aller Freundlichkeit. Sie konnte nicht gleich einordnen, wen sie vor sich hatte. Als es ihr klar geworden war, packte sie die Weißblondierte mit ihren mehligen Händen, schleifte sie kreuz und quer durch die Diele und zischte: »Du bist also die Drecksau, die so einen Bastard in die Welt gesetzt hat.«
Damit war die Sache gegessen. Die beschämte Zombieverteidigerin hatte ihre Forderungen vergessen und überlegte nur noch, wie sie selbst unbeschadet davonkam, während wir in der Küchentür standen und die Wrestling-Giganten bestaunten, jeder von uns einen der leckersten Bliny von ganz Rostow in der Hand – ich mit Honig, mein Bruder mit Butter und das Mädchen mit Himbeerkonfitüre. Butter und Honig, sagte sie, würden sie dick machen.
Kurzum, ich konnte der Nikolajewna nicht die Wahrheit über meinen Schulterdurchschuss erzählen. Sie wäre sofort losgezogen, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, und das hätte wer weiß wie enden können. Beziehungsweise, ich wusste, wie, aber beim Gedanken daran wurde mir erst recht ganz anders. Lügen war auch sinnlos. Verarschen ließ sich Big Ba nicht. Da blieb nur eins.
Ich musste es so machen, wie sie es mochte.
November 2016, Dortmund
Am Flughafen war fast nichts los. Entweder hatte der Schuhmacher es übertrieben und wir waren zu früh dran, oder die Deutschen hatten Schiss, nachts zu fliegen. Jedenfalls gab es bis zum Boarding nicht so richtig was zu tun, so dass meine Gedanken wieder bei Maika landeten. Wäre sie nicht gewesen, hätten sie mir damals in den Neunzigern wohl kaum durch die Schulter geschossen.
Im Café lief leise das Lied von Mackie Messer auf Deutsch. Zu komisch, wie die Amis in aller Welt die fettesten Ohrwürmer zusammenklauen und dann sich selber zuschreiben, als wären sie von dort. Das Stück war ja tatsächlich ursprünglich deutsch. Das war verdammt noch mal in deutscher Sprache geschrieben worden. Und jetzt? Louis Armstrong rauf und runter. Und die Deutschen gucken in die Röhre.
»Das macht acht Euro fünfzig«, sagte die Bedienung fast akzentfrei auf Russisch zu mir.
Die haben’s raus, uns Brüder zu erkennen.
Die Nikolajewna hat diese Musik geliebt. Als sie mir Opas Akkordeon in die Hand drückte, sollte ich unbedingt die Dreigroschen-Songs lernen. Dabei war Sommer. Die Gardine an der Balkontür gebläht. Und ich zehn. Unterm Balkon rufen die Jungs: »Tolja! Komm runter!« Aber ich übe diesen Kurt Fucking Weill. Babulja sitzt mit ihren nimmermüden Augen daneben, und es juckt sie überhaupt nicht, was es da für ein Leben draußen auf dem Hof gibt. Klar, die rufen ja auch nicht sie. Während ich die Tasten drücke und wünschte, sie würden herausfallen, denke ich: Mann, wann bist du endlich mal tot?
Und sie antwortet auf meine Gedanken: »Tolja, du wirst im Leben immer einen Kanten Brot haben.«
Sie hatte in Kiew während des Krieges einiges mitgemacht. Gehungert. Und sicher auch einiges mit ansehen müssen. Und trotzdem hat sie mich deutsche Musik üben lassen. Hat den Deutschen, scheint’s, vergeben. Aber vielleicht mochte sie die Dreigroschenoper auch nur wegen der Dinge, die sie unter den Deutschen in Kiew mit angesehen hat. Banditen und Ganoven hatten damals freie Bahn, logisch. Die Fritzen und die Leute um sie herum plattzumachen ging damals quasi als gute Tat durch. Da wurdest du zum Helden fürs Vaterland, ob du wolltest oder nicht.
Daher die romantische Verklärung, die Gaunerromantik. Und dann noch die geniale Banditenmusik von diesem Kurt Weill. Einem Deutschen. Pech für Tolja.
Der darf jetzt seinen Mackie Messer üben.
Big Ba hätte überhaupt das Zeug zu einem amtlichen MC gehabt. Und sie war bei Weitem nicht die Einzige hier im Viertel. Wer schon mal auf dem Markt in Rostow war, weiß, dass hier jede Oma ihren Flow hat. Eminem und 2Pac hin oder her, aber jede Babulja aus Rostow steckt die heutige Rapperjugend locker in die Tasche. Im Gegensatz zu den dummen Jungs haben die Babuljas nämlich ein ganz handfestes Ziel: dir nicht nur eine Handvoll Sonnenblumenkerne zu verkaufen, die du eigentlich wolltest, sondern noch einen Eimer Äpfel und einen Sack Kohl obendrauf. Daher dieser Flow, dass es kein Halten mehr gibt.
In ihrer Begeisterung für die Banditen ihrer heftigen Kiewer Jugend hatte meine MC Babulja den abgebrühten Gangster Pistoletto für mich erfunden. Ihre Ganoven, die damals die Faschisten niedergemacht haben, waren nur mit Taschenkanonen unterwegs gewesen, und diese Knarren hatten bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jedenfalls konnte Big Ba meine Pistoletto-Tracks kaum erwarten und lauschte ihnen immer besonders hingebungsvoll. Sie mochte den Typen. Je krasser, desto lieber. So hatte mich Pistoletto schon manches Mal gerettet. Das harte Herz der Nikolajewna schmolz bei seinen Banditengeschichten dahin.
Mai 1996, Rostow am Don
Das Treppenhaus betrat mein Genosse Hauptmann also noch mit dem angeschossenen Booster, oder nicht einmal Booster, sondern Booster Grunz, weil mein Zimmer zu jeder Zeit ein einziger Saustall war, aber auf unserer Etage kam er mit dem Kommentator Pistoletto an. In seiner ganzen Scheißschönheit. Und der gute Pistoletto war bereit zu kommentieren, was das Zeug hielt. Die Mutation war schneller durch als bei Sensei Hamato Yoshi, als der sich in die mächtige, weise Ratte Splinter verwandelte. Und ganz ohne Mutagene. Schade nur, dass der Genosse Hauptmann nicht zur Ninja-Turtle wurde. Sonst wären wir so richtig abgegangen.
Aber auch so lief es mächtig gewaltig. Pistoletto hat’s drauf, Pistoletto klärt alles ordentlich auf. Räumt alles ordentlich ein wie im Supermarkt. Startet smart, mit einer taktischen Finesse. Redet vom weißen »Benz«, wegen dem im Kiez schon so mancher krasse Typ umgelegt worden ist. Weil, welcher Macker will nicht in so ’ner Karre seine Dinger drehen. Eben – will doch jeder. Und so schaffen sie die Macker auf den Gottesacker, einen nach dem andern. Und flicken die Löcher im Benz. Aber davon klettert die Kiste nur weiter im Kurs. Willst du Respekt im Kiez, hol dir den weißen Benz. Und so geht der Tod um in Rostow, weiß und schön wie ein Ozeandampfer. Steig ein, und er trägt dich fort, weiter fort als der weiße Wal Käpt’n Ahab. Und unter den unteren Mackern geht’s ebenfalls rund. Noch keine Knarre, um mitzumischen, aber wenigstens ne Minute in der Wunderkarre zu sitzen wär schon ein Traum.
Und Pistoletto steigt ein.
Weil die komplette Gang, weil Shora, weil Bangkok und sogar Coupé einmütig krakeelen, der Benz hätte magische Kräfte. Kung-Fu kannst du dann vielleicht nicht, aber kleinere Dinger kriegst du durchaus gedeichselt. Zum Beispiel machst du Kohle ohne Ende. Und die coole Polina aus der Musikschule lässt dich endlich ran.
Krakeelen können sie, aber die Eier, in den verfluchten Benz zu steigen, die haben sie nicht. Nur Pistoletto bringt’s. Pistoletto muss an seinen Status denken. Und an Polina. Wer nämlich Polina flachlegt, hat eine Sonderstellung im Kiez. So kommt das Ganze in Gang. So spitzt das Ganze sich zu.
Pistoletto geht morgens gemütlich spazieren, er achtet auf seine Gesundheit, und sieh mal an, was steht denn da? Direkt vor dem Bierkiosk. Als könnt es kein Wässerchen trüben. Als wär das vollkommen normal. Richtig, es ist der Rostower Moby Dick. Der weiße Wal von Rabotschi Gorodok. Und wen sehen wir drinnen? Drinnen sehen wir niemanden. Die Besatzung ist von Bord gegangen, in wichtiger Besatzungsmission. Na fein. Wir brauchen doch keine fünf Minuten. Uns reichen auch vier.
Pistoletto langt nach dem Griff und … die hintere Tür geht auf. Wie in dem Märchen mit dem Mädel, das statt der Kutsche den Kürbis bekam und für die es so richtig mies lief davor. Pistoletto setzt sich aufs edle Polster. Pistoletto atmet das richtige Leben. Pistoletto ist glücklich. Jetzt lädt er sich auf mit der nötigen Energie, wie ein Wasserglas, das der gute Doktor Alan Tschumak aus dem Fernseher auflädt. Und dann, Polina, pass auf!
Aber was kommt da anstelle von guter und nützlicher Energie? Zwei sympathische, kernige Brüder im strammen Adidasgewand. Und ihre Mienen verraten, dass ein Pistoletto auf der hinteren Bank nicht eingeplant ist. Sie haben anderes vor.
Sie steigen in ihren Benz und fingern nach ihren Kanonen. Sie müssen durch die Polizeikontrolle, ohne dass sie auffliegen mit ihren Knarren.
Pistoletto liegt auf dem Boden, auf bester deutscher Auslegeware, und kalkuliert kühl seine Chancen. Pistoletto ist klug. Den nimmst du nicht so leicht hops.
»Ey, Brüder«, sagt er und taucht wieder auf. »Macht euch locker. Pistoletto hilft euch mit euren Prügeln. Er trägt sie am Posten vorbei durch den Wald.«
Die Brüder prügeln ein bisschen auf Pistoletto ein, zurückgebeugt über die Nackenstützen, aber das ist kein Ding. Hauptsache, sie finden seine Idee interessant. Und schon braust Pistoletto im weißen Benz dahin. Und das ist eben nicht die Kürbiskutsche, die im entscheidenden Moment zur Klapperkiste wird. Das ist der Stolz der deutschen Autoindustrie und von ganz Rabotschi Gorodok. Pistoletto wird von positiven Fluiden erfüllt, wie das saftige Veilchen, das unter seinem Auge erblüht.
Fünfhundert Meter vor dem Posten setzen die Brüder ihn ab. Mit zwei Knarren in einer ranzengroßen Premiumhandgelenktasche schlägt Pistoletto sich durch den Streifen Wald. Alles geht nach Plan.
Doch plötzlich brechen diese Säcke in ihrem ollen Lada aus dem Gebüsch und nehmen Pistoletto auf die Hörner wie der Stier den armen Torero. Pistoletto ist verstimmt. Die Säcke sind weg. Nicht mal schießen kann er noch auf wen. Ihm ist schlecht. Der Streifen Wald verschwimmt. Aber Pistoletto hält sich wacker. Er muss da auf jeden Fall hin. Auch wenn er nichts mehr auf die Reihe bekommt. Pistoletto ist jetzt ein angezählter Boxer. Als hätt er mit dem Amboss auf den Kürbis gekriegt. Nicht den Kürbis von dem Loser-Mädel, sondern den, der bei Pistoletto sonst läuft wie ein Uhrwerk. Aber jetzt läuft fast gar nichts mehr. Er blickt kaum noch durch. Aber Pistoletto geht weiter.
Er kommt zum Posten, wo die Bullen die Benz-Brüder filzen. Die Brüder geben mit den Brauen zu verstehen, er wäre besser nicht hierhergekommen. Aber Pistolettos Kürbis ist jetzt gänzlich hinüber. Er grinst. Er freut sich, dass er seine Leute wieder hat.
Die Bullen sind von Pistolettos Anblick nicht erbaut. Sie fürchten, er kratzt ihnen hier gleich ab. Und eine Leiche können sie nicht gebrauchen. Wer will schon solche Schwulitäten. Sie rufen den Notarzt, soll er lieber da die Hufe hochnehmen. Die Ärzte sammeln Pistoletto ein. Sehnsüchtig sehn die Brüder ihrer Tasche nach.
Aber auch das Rotkreuz hat es in sich. Verzaubert wie der Kürbis ist es nicht, nur voll mit Hasch bis unters Dach. Das heißt, es macht bloß noch auf Notarzt. Nimmt höchstens ab und zu Patienten mit, zur Tarnung. Tatsächlich liefert es dem Chefarzt und Konsorten schnelles Geld. Klar, harte Zeiten. Krise überall.
Auch diesmal sind sie offensichtlich voll dabei. Nach zwei, drei Kilometern bricht nämlich besagter oller Lada aus dem Wald. Darin besagte Säcke. Und die sind scharf auf das, was die geldgeilen Mediziner transportieren. Aber an Bord ist Pistoletto mit der Brüdertasche. Und der hat eine Rechnung offen mit den Säcken.
Der Lada drängt das Rotkreuz an den Rand. Die Säcke halten ihre Knarren in die Fenster. Die Medizin bekommt es mit der Angst und ist bereit, die Ware rauszurücken. Doch Pistoletto hält sich wacker. Er zieht die beiden Prügel aus der Tasche und bittet einen Doktor, ihm die Hintertür zu öffnen.
»Aber mach nur ein bisschen auf. Nicht dass mein Schädel wieder brummt.«
Und ballert rechts wie links auf ihre Windschutzscheibe.
Der Lada kippt nach links und kippt nach rechts. Danach beginnen sie zurückzufeuern. Und Pistoletto ballert beide Magazine leer, da schwimmt hinter dem Lada, weiß und wunderbar, der Benz heran. Von seinen Wellen kommt der Lada gleich ins Wanken. Er tanzt auf diesen Wellen wie ein Streichholz hin und her. Den Säcken geht der Arsch auf Grundeis – sie kennen diesen Wagen nur zu gut. Und sie sind nicht im Bilde, dass die Brüder keine Waffen tragen. Gleich kriecht der Lada ins Gebüsch zurück. Und Pistoletto ist schon wieder glücklich. Die durchgeschossne Schulter juckt ihn nicht. Das ist wie nichts verheilt.
Solange ich das alles darlegte, verzog sich mein Vater in die Küche. Diese Ebene zwischen Babulja und mir war ihm nicht zugänglich. Er hatte keine Ader für Rap oder erfundene Figuren. Aber die Nikolajewna wusste meinen Freestyle zu schätzen. Sogar so sehr, dass die Wahrheit sie nicht weiter interessierte.
»Schreibst du das auch alles auf?«, fragte sie, als ich mein »Round« von mir gab und verstummte.
»Klar, Ba. Aber jetzt hab ich Knast. Bock auf Bliny.«
November 2016, Dortmund
Julia rief an, als gerade das Boarding begann.
»Hör mal zu, ich hab nachgezählt«, sagte sie. »Es waren genau vier.«
Der Kellner schob mir nach einem kurzen Blick in mein ratloses Gesicht den Teller mit dem Trinkgeld wieder hin.
»Nein, nein, nehmen Sie schon.« Ich nickte ihm zu. »Vier was?«
»Vier Tage. Diesen Monat warst du ganze vier Tage zu Hause. Neuer Rekord.«
»Weißt du, hier geht grad das Boarding los. Lass uns morgen sprechen. Ich komm an, wir schlafen uns aus, und dann sprechen wir … Oder wir lassen es und vergessen das Ganze.«
»Sogar wenn deine Musiker freihaben, sitzt du im Studio.«
»Ich kann grad wirklich nicht, Liebes.«
Ich war schon unterwegs zum Ausgang in Richtung Flieger. Vor dem Schalter tummelten sich kleine alte Chinesen mit hellen Fischerhüten. Wozu sie diese beschissenen Fischerhüte brauchten, wo praktisch schon der Winter vor der Tür stand, blieb ein chinesisches Militärgeheimnis.
»Nie hast du Zeit. Die Kinder kennen echt bald nur noch deinen WhatsApp-Avatar.«
»Hast du gehört, was ich mit Lisa gesprochen habe?«
»Nein. Sie kam danach zu mir ins Schlafzimmer. Ganz schön traurig übrigens. Sie konnte nicht schlafen.«
»Und jetzt?«
»Jetzt schläft sie.«
»Dann leg du dich auch hin. Morgen früh bin ich da.«
Die Frau hinterm Schalter nahm meine Bordkarte, riss routiniert den Abschnitt ab und wünschte mir einen guten Flug. Im Rüssel zum Flieger standen die Chinesen dicht an dicht.
»Was ist mit euch Brüdern?«, fragte ich. »Wollt ihr Russland bevölkern?«
Ich wollte meine Laune ein bisschen aufmöbeln. Irgendwie war ich nicht so gut drauf.
Sie lächelten, nickten höflich, irgendwo vorn sagte jemand auf Russisch: »Tolja ist der Beste!«
Gott sei Dank, da flogen nicht nur Chinesen nach Moskau.
Auf dem Display meines Telefons leuchtete es geräuschlos auf: Mitja.
»Ich hab’s geschafft, alles gut. Kann jetzt nicht sprechen, hier sind überall chinesische Spione.«
»Tolja, wir haben da … Die Polizei hat Michael mitgenommen.«
»Verarsch mich nicht! Wieso?«
Ich blieb stehen, keine fünf Meter von der offenen Flugzeugtür entfernt.
»Der Typ hat den Löffel abgegeben.«
»Welcher Typ? Was hat Michael damit zu tun?«
»Der Typ, der ganz am Ende auf die Bühne gesprungen ist. Michael hat ihn ein bisschen in den Arm genommen, als er ihn runtergebracht hat, na ja, und jetzt ist er halt tot.«
»Scheiße!«
»Vielleicht ein Infarkt … Oder sonst was. Egal, flieg nach Hause, wir regeln das hier.«
»Von wegen, flieg nach Hause!«
Ich drehte mich um und pflügte mich gegen den Strom zum Ausgang durch. Die Chinesen konnten nur noch beiseitespringen.
Manchmal denkt man echt über seltsame Dinge nach. Und das auch noch im unpassendsten Moment. Ich fuhr mit dem Taxi vom Flughafen zurück und versuchte mich an das Gesicht des Deutschen zu erinnern, der auf die Bühne gesprungen war. Was war das für einer? Jung? Alt? Was zum Teufel hat ihn über die Absperrung getrieben? Wahrscheinlich eher jung. Alte Leute springen nicht auf die Bühne.
Im Flackern der Straßenlaternen vor dem Fenster gedachte ich meiner lieben Toten, all jener, die zu früh verstorben waren. Abgesägt, abgestürzt, abgewürgt. Zu meinem Dreißigsten waren mir schon jede Menge Leute abhandengekommen. Eine Weile war es, als hätten sie sich abgesprochen. Fast wie ein Schwarm, der sich sammelt und in wärmere Lande zieht. Schon klar, warum so was passiert, aber traurig bleibt es trotzdem. Da arbeitet einer, lebt, tut und macht, wartet auf Ergebnisse, und dann heißt es zu den Früchten im reifen Alter – sorry, kannst du knicken. Die Saat geht irgendwie auf, alle fahren die Ernte ein, die Tische sind sogar für alle gedeckt, aber sie werden nicht eingeladen. Für sie heißt es – Exit.
Dabei will man doch immer leben. Nicht morgen, nicht noch ein paar Tage, kein Jährchen – immer. Wer würde diesen Wunsch infrage stellen?
Wünsche …
Wo kommen sie überhaupt her? Wer drückt die uns aufs Auge? Wieso schickt er sie hierher?
Woher weiß ein Kind, dass es auf dem Arm besser dran ist? Wieso brüllt es, wenn es wieder ins Bettchen gelegt wird? Wieso wünschen wir uns Partys, Besäufnisse, nette Leute? Wieso wollen wir den Escalade haben? Wer hat uns das eingeredet? Wieso jubiliert alles in dir, wenn dir eine schöne Frau zulächelt? Was soll der Scheiß? Wie funktioniert das alles? Ist vielleicht der Entzug, den wir durchmachen, wenn wir das Gewünschte nicht bekommen, der ganze Witz? Haben wir vielleicht schon vorher Angst vor dem Affen? Und versuchen ihm mit allen Mitteln zu entkommen? Und jagen im Endeffekt andauernd dem Unerreichbaren nach?
Wie der beschissene Hamster im Rad.
Und manchmal kommen dir Wünsche, die solltest du am besten gleich ins Sacktuch schnäuzen. Einmal ist mir morgens im Studio rausgerutscht: »Montags könnt ich jedes Mal einen umbringen.«
Und Michael, ohne eine Sekunde zu zögern: »Ich könnt ständig einen umbringen. Nicht nur montags.«
Was soll man dazu sagen? Jedenfalls macht er sich nichts vor. Den muss man doch gernhaben, oder?
Michael wollte also nicht den Cadillac Escalade, keine Partys, keine Besäufnisse, keine netten Leute. Er wollte jemanden umbringen.
Das war ihm, scheint’s, wieder mal gelungen.
Die erste Person, die mir auf der Polizeiwache begegnete, war Maika. Sie saß in dem engen Flur und sah mich an, als hätte sie von Anfang an gewusst, wie mein Konzert enden würde.
»Schöne Scheiße«, sagte ich und zuckte die Achseln. »Ich hab sogar meinen Flug sausenlassen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ist doch typisch für dich, Tolja. Ich hab diesen Club seit über zehn Jahren. Bis du gekommen bist, war alles sauber. Sogar die schwer verletzten Profikämpfer sind wieder auf die Beine gekommen. Aber kaum bist du hier, hab ich eine Leiche am Arsch. Die Bullen nehmen mir jetzt den ganzen Laden auseinander.«
»Ich hab mich ja nicht grade aufgedrängt mit dem Konzert. Ich wusste nicht mal …«
»Dass ich noch lebe?«, vollendete Maika den Satz für mich. »Ja, sorry auch.«
Sie kreuzte die Arme vor der Brust und wandte sich der grauen Wand zu. Aus dem Zimmer nebenan kam Mitja. Er wollte etwas sagen, verkniff es sich aber nach einem Blick in unsere Gesichter.
»Ich muss den ganzen Abend an dich denken«, sagte ich, nachdem er durch die Eingangstür verschwunden war. »An Rostow.«
»Ich nicht mehr«, sagte sie und blickte mich an, als richte sie eine Knarre auf mich.
Dass ich nicht zu Hause angerufen hatte, fiel mir erst viel später ein. Julia wartete immer noch auf meinen Flieger. Oder vielleicht auch nicht, was weiß ich. Vielleicht schlief sie längst. Jedenfalls war ich nicht losgeflogen. Und das musste ich durchgeben. Anrufen wollte ich nicht, um sie nicht zu wecken. Also WhatsApp.
»Papa, ich hab mir einen neuen Namen für dich ausgedacht.«
Kaum hatte ich das Telefon rausgeholt, als der Polizist hinter der Scheibe am anderen Ende des engen Flurs mir auch schon mit dem Finger drohte. So was hatte ich seit dreißig Jahren nicht gesehen. Es gab die unterschiedlichsten Drohungen, aber mit so was war es vorbei, seit ich sieben war. Und doch, es funktionierte.
»Ich geh kurz vor die Tür«, sagte ich zu Mitja, der auf dem Sitz neben mir vor sich hin pennte.
»Julia, ich kann heute nicht kommen. Bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Ich ruf nachher an und erklär dir alles.«
Sie war nicht online, als ich anfing zu tippen, aber kaum hatte ich die Nachricht abgeschickt, leuchteten darunter zwei blaue Häkchen auf. Sie schlief nicht.
»Wie, du kommst nicht? Was soll das?« Ihre Stimme klang tatsächlich kein bisschen verschlafen.
»Das geht nicht am Telefon. Wieso schläfst du nicht?«
»Weiß nicht … Ich bin irgendwie unruhig. Komm, du hast es den Kindern versprochen. Sie erwarten dich morgen früh. Mit einer Überraschung.«
»Was für eine Überraschung?«
Sie schwieg und seufzte dann: »Ist doch jetzt auch egal.«
»Ach, komm schon. Sag’s mir.«
»Vergiss es.«
Sie war weg, und ich stand noch eine Minute lang vor der Polizeiwache, das Telefon in der Hand.
Ich steckte es ein, als der verpennte Mitja herauskam.
»Also, die behalten ihn noch 48 Stunden da. Bis alles geklärt ist.«
»Bis die Obduktion durch ist?«
»Irgendwie so. Mordanklage gibt es erst mal nicht.«
Ich klopfte ihm auf die Schulter.
»Komm, ab ins Hotel. Ich kann keine Bullen mehr sehen.«
Mai 1996, Rostow am Don
Mein Bruder fand mich in der Garage von Wadik. Mein Bruder fand mich überall. Mein Bruder und ich waren das ideale Paar – Bratan und Bratan. Wir ergänzten einander so perfekt, dass Yin und Yang hinten in China sich vor Neid einen Knoten ärgerten.
Er war der Gute, ich der Böse. Er war Mutters Herzenstrost, ich ihr Kopfschmerz. Er war die verlässliche Stütze der Eltern im Alter, ich ihr Klotz am Bein. Er bereitete sich auf die Aufnahmeprüfung für das Studium vor, ich war eben von der Musikschule geflogen.
Na ja, nicht direkt geflogen. Formal betrachtet, war ich natürlich selber gegangen, aber hätte ich das nicht getan, hätten sie einen Schrieb an die Bullen rausgehauen.
Jedenfalls fand mich mein Bruder. Und ich war sogar froh, weil Wadik mir schon auf den Sack ging. Er hatte sich eine idiotische Flowtheorie zusammengesponnen und donnerte den Basketball gegen die Garagenwand.
»Is so!«, brüllte Coupé. »Deswegen läuft das bei den schwarzen Jungs! Ich hab’s kapiert! Richtiger Rap ist wie Basketball! Basketball und Rap ist das Wichtigste bei denen. Da ist der Flow so geschmeidig wie die Ballbehandlung. Hier, pass auf! Die gleiten praktisch über den Platz. Alle Bewegungen bei denen sind purer Rap. Kapierst du, Tolja? Basketball – das ist das Ding!«
»Nur dass bei dir überhaupt nichts geschmeidig kommt«, entgegnete ich ihm. »Du bist wie ein Krüppel auf Krücken. Nur halt mit Ball.«
»Ich lern das noch, Tolja! Ich lern das noch. Und dann gehen wir so was von ab! Der übelste Flow!«
Er ließ die Pille noch ein paarmal gegen die Metallwand wummern. Ein Donnern wie aus der Kanone.
»Und die Hosen, Tolja! Hier!«
Er zeigte auf das Poster mit den Jungs von N. W. A an der Garagentür.
»Die schwarzen Rapper haben diese weiten Dinger, Basketballerunterhosen. Ich sag’s dir, das ist alles eins. Ein Ding!«
Zum Glück fand mich mein Bruder in diesem Moment. Er fand mich überall. Wir waren das ideale Paar.
Coupé ging gleich rauchen. Er wusste, dass mein Bruder und ich wie Yin und Yang waren. Dass man sich also besser verzog, wenn wir uns so geplant über den Weg liefen.
Ich hatte mir übrigens schon mal hier und da Gedanken dazu gemacht, und ich kriege einfach nicht klar, wie die Jungs in China darauf kommen, dass Yin und Yang so geil sein sollen. Weil sie so gut in einen Kreis passen? Hat auch schon mal wer überlegt, wie die das finden? Vielleicht hängen die bloß so dicht aufeinander, weil sie sonst nirgends hinkönnen. In dem Kreis ist es halt verdammt eng.
Jedenfalls bekam ich von meinem Bruder zu hören, ich sei, wenn nicht ein Stück Scheiße, dann etwas dicht daneben. Zu Hause hätten sie es ohne meinen Bockmist schon schwer genug. Der Hauptmann bekam längst keinen Sold mehr ausbezahlt. Was er sich letztes Mal mit Raketentreibstoff zusammengedealt hatte, hatten wir vor zwei Wochen weggefuttert. Gut, dass niemand in die Luft geflogen ist, nachdem er seine Karre mit dem Zeug vollgetankt hat. Wobei, vielleicht war das sogar passiert. Wurde sowieso alles auf die Gangster geschoben, wer sonst würde Autos in die Luft jagen? Mama hatte längst ihr Moskauer Uni-Diplom unterm Schrank versenkt, sie verkaufte Joghurt auf dem Temernik-Markt. Jeden Morgen schleppte sie ihren Karton aus der uliza Metschnikowa durch die halbe Stadt, um uns alle irgendwie durchzubringen. Die gemeinsame Rente von der Nikolajewna und von Opa ging für die Miete drauf. Nur mein Bruder und ich steuerten nichts bei. Aber er bereitete sich ja auf die Uni vor. Und kam nicht mit zerschossener Schulter nach Hause.
»Hast du total den Arsch auf?«, fragte mich mein Bruder.
Sein Zorn war berechtigt, keine Frage. Aber ich hatte meine eigene Wahrheit.
»Ich hab da einen rausgehauen.«
Das Totschlagargument in Rostow. Dagegen konnte nicht mal mein Bruder etwas sagen.
»Und wen?«
»Djoma. Der saß richtig in der Scheiße.«
»Djoma?« Mein Bruder regte sich so auf, dass er sich setzen musste. »Also hast du echt den Arsch auf. Der ist doch der letzte Junkie. Baut einen Mist nach dem anderen. Der ist selber ein einziger Misthaufen. Und den hast du rausgehauen?!«
»Ja. Und ich würde es wieder tun, wenn es sein muss. Er ist mein Freund seit der vierten Klasse. Das zählt für mich. Dass er Mist baut, ist mir egal. Ich verurteile niemanden. Wer wäre ich denn, zu richten? Vielleicht bin ich selber das Allerletzte. Aber wenn’s drauf ankommt, bin ich da.«
Wadik donnerte den Ball von außen gegen die Garage, und wir sahen einander in diesem Gedonner in die Augen, bis ich schließlich die Musik anstellte und das Gedonner von hartem Rap übertönt wurde.
Du kannst in jeder verfahrenen Situation Slam von den lustigen Onyx-Jungs laufen lassen, das macht immer Laune. Die Jungs wissen echt, was fetzt.
Aber meinem Bruder ging die gute Laune am Arsch vorbei. Er wollte alles wissen. Nicht nur, was fetzt.
Und ich erzählte.
Djoma hieß Djoma, weil er mit Nachnamen Djomin hieß. Ist nicht der Punkt. Djoma ist tatsächlich schon ewig auf Drogen, aber das ist auch nicht der Punkt. Djoma hat eine Schwester, Maika, und da kommen wir dem Punkt schon näher. Ich war letztes Jahr mal kurz mit ihr zusammen, dann ging es wieder auseinander. Sie ist irre. Djoma war damals schon hart drauf. Er hat früh damit angefangen. In Rostow ging es da gleich zu Beginn der Neunziger heftig zur Sache. Vor einer Weile ist so ein Baschkire hierhergekommen und hat erzählt, bei ihm in Salawat sind die Leute auch abhängig, knallen sich aber nicht so zu wie hier in Rostow. Bei uns hauen sie sich die Rübe weg, dass sie gleich über den Don segelt. Auf Nimmerwiedersehen. Weil es besser ist ohne Kopf. Und ohne Körper. Und ohne die miese Welt ringsum. Alle Zerstreuung liegt im Innern, wie der Genosse Baschkire sagte. Dabei ist er überhaupt kein Baschkire, eher Armenier. Wohnt halt in Salawat. Die Familie ist aus Karabach raus, als da alle angefangen haben, sich gegenseitig kaltzumachen. Gorbatschow sei Dank, sie wollten eh schon lange weg, hatten aber nie einen Anlass. Jetzt wollte er zu uns nach Rostow kommen, der Poet, Freigeist und Armenier. Und Junkie noch dazu. So einer war hier genau richtig.





























