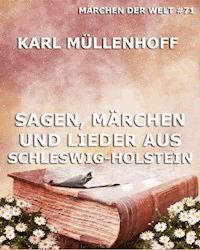
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: 1. Skeaf und Skild. 2. Die jungen Wölfe. 3. Offas Kampf auf der Eiderinsel. 4. Von Offas Gemahlin und ihrem Schicksal. 5. Siegfried und Starkad. 6. De Sassen un de Jüten. 7. Der treue Küchenjunge. 8. Graf Rudolf auf der Bökelnborg. 9. De Markgraaf to Sleeswik un de Buer to Boklund. 10. Die Stellerborg. 11. Wie Graf Geert die Dithmarschen überfiel. 12. De Holsten vorbidden (verteidigen) ehr Recht mit dem Schwerde. 13. Die Schlacht bei Bornhövede. 14. Graf Alf als grauer Mönch. 15. Erichs Leiche. 16. König Abel und Wessel Hummer. 17. Swarte Margret. 18. Der Hasenkrieg. 19. Split. 20. Hartwig Reventlow. 21. Die Dithmarschen in der Kirche zu Oldenwörden. 22. Schlacht am Hesterberge. 23. Graf Geert. 24. Schlacht auf der Lohheide. 25. Isern Hinrik. 26. Graf Klaas. 27. Herzog Adolf in England. 28. Klaas Lembeke. 29. Van dem edlen Helden Rolef Bojeken Sone. 30. Die adligen Frauen holen die Leichen ihrer Verwandten aus Dithmarschen. 31. Frau von Poggwisch. 32. Margarethas Tod. 33. Erich verwüstet Femern. 34. Herzog Alf der Achte. 35. Ralves Karsten. 36. Die Wogenmänner. 37. Klaas Störtebeker und Göde Micheel. 38. Die Räuber in der Engelsborg. 39. Der lange Peter. 40. Andere Seeräuber. 41. Peter Muggel. 42. Wesebye. 43. Adelbrand und Antolille. 44. Prinzessin Thyra. 45. Herr Hinrich. 46. Klaas Steen. 47. Die beiden Brüder in Sundewitt. 48. Die beiden Brüder auf Pellworm. 49. Die beiden Brüder in Borsfleth. 50. Bockwold und Walstorp. 51. Svend Graa und Tule Vogensen. 52.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1351
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg
Karl Müllenhoff
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Bibliographie der Sage
Einleitung.
Allgemeine Übersicht.
Erstes Buch.
1. Skeaf und Skild.
2. Die jungen Wölfe.
3. Offas Kampf auf der Eiderinsel.
4. Von Offas Gemahlin und ihrem Schicksal.
5. Siegfried und Starkad.
6. De Sassen un de Jüten.
7. Der treue Küchenjunge.
8. Graf Rudolf auf der Bökelnborg.
9. De Markgraaf to Sleeswik un de Buer to Boklund.
10. Die Stellerborg.
11. Wie Graf Geert die Dithmarschen überfiel.
12. De Holsten vorbidden (verteidigen) ehr Recht mit dem Schwerde.
13. Die Schlacht bei Bornhövede.
14. Graf Alf als grauer Mönch.
15. Erichs Leiche.
16. König Abel und Wessel Hummer.
17. Swarte Margret.
18. Der Hasenkrieg.
19. Split.
20. Hartwig Reventlow1.
21. Die Dithmarschen in der Kirche zu Oldenwörden.
22. Schlacht am Hesterberge.
23. Graf Geert.
24. Schlacht auf der Lohheide.
25. Isern Hinrik.
26. Graf Klaas.
27. Herzog Adolf in England.
28. Klaas Lembeke.
29. Van dem edlen Helden Rolef Bojeken Sone.
30. Die adligen Frauen holen die Leichen ihrer Verwandten aus Dithmarschen.
31. Frau von Poggwisch.
32. Margarethas Tod.
33. Erich verwüstet Femern.
34. Herzog Alf der Achte.
35. Ralves Karsten.
36. Die Wogenmänner.
37. Klaas Störtebeker und Göde Micheel.
38. Die Räuber in der Engelsborg.
39. Der lange Peter.
40. Andere Seeräuber.
41. Peter Muggel.
42. Wesebye.
43. Adelbrand und Antolille.
44. Prinzessin Thyra.
45. Herr Hinrich.
46. Klaas Steen.
47. Die beiden Brüder in Sundewitt.
48. Die beiden Brüder auf Pellworm.
49. Die beiden Brüder in Borsfleth.
50. Bockwold und Walstorp.
51. Svend Graa und Tule Vogensen.
52. Bockwold und Bülow.
53. Die Prinzessin auf Sonderburg.
54. Der Graf und die Müllerin.
55. Nehmten.
56. Der Kuchen im Wappen.
57. Röwerlöwe.
58. Die Edelfrau auf Tollgaard.
59. Die Gräfin Schack.
60. Böse Herrinnen.
61. Der verlorne Ring.
62. Der Burenklaas.
63. Die Pfenningwiese.
64. Wie die Lübschen Herren in Stakendorf den Zehnten holten.
65. Der alte Jakob.
66. Die treuen Bauern.
67. Die Leibeigenen.
68. Die Isemanschlacht.
69. Henning Wulf.
70. Was König Johann von den Dithmarschen wollte.
71. Lieder von der Schlacht bei Hemmingstede.
72. Peter Swyn.
73. Mettenwarf.
74. Friplov.
75. Der Mantel in der Bülderuper Kirche.
76. Als König Christian bei Brunsbüttel einen Einfall in Dithmarschen machen wollte.
77. Wiben Peter.
78. Wie der Grütztopf in das friesische Wappen kam.
79. Wallenstein vor Breitenburg.
80. Christian der Vierte.
81. Düerhuus.
82. Die halbgefüllte Flasche.
83. Die Riesburg.
84. Die keusche Sylterin.
85. Topphalten.
86. Herzog Hans Adolf.
87. Steenbock.
1. Merken van Hüt un Giestern.
88. Das Kegelspiel im Ratzeburger Dom.
89. Thiesburg bei Schleswig verteidigt.
90. Die Burg zu Rathjensdorf.
91. Franz Böckmann.
92. Der tapfere Bauer.
93. Die Polacken in Toftlund.
94. Die Moskowiter in Bordesholm.
95. Der Tempel zu Nordoe.
96. Der Brunnen am Segeberger Kalkberg.
97. Steinkreuz.
98. Hartsprung.
99. Die nächtliche Trauung.
100. Der vierundzwanzigste Februar.
101. Das Osetal auf Sylt.
102. Henscherade.
103. Der Scharfrichter in Sonderburg.
104. Alle neun.
105. Hans mit Gott.
106. Knaben entscheiden einen Rechtsfall.
107. Die Doppelhufner im Amt Schwarzenbek.
108. Wie die Wensiner Gericht halten.
109. Altona.
110. Wyk auf Föhr.
111. Da danzt Bornholm hen.
112. Die Zigeuner.
113. Die streitige Eiche.
114. Die Üfflinger Heide.
115. Höxholt.
116. Der große Wald in Nordschleswig.
117. Springhirsch.
118. Der Klawenbusch bei Kampen.
119. Die Füllenbeißer.
120. Die Jagler.
121. Die Hostruper.
122. Die erste Katze in Gabel.
123. Die Romöer.
124. Der Föhringer Kirchenbau.
125. Die Büsumer.
126. Die Bishorster.
127. Die Kisdorfer.
128. Die Thadener.
129. Die Fockbeker.
130. Der Gänsehirte.
131. Die drei Alten.
132. Martje Floris.
Zweites Buch.
133. Fositesland.
134. Der Geldsot.
135. Die Quelle auf dem Wellenberge.
136. Die Quelle zu Marienstede.
137. Die teure Zeit.
138. Der Hirschhornbrunnen.
139. Die Klause zu Ruekloster.
140. Die Grönnerkeel.
141. Quelle in Sommersted.
142. Quelle bei Rohrkarr.
143. Bischof Poppo am Hilligebek.
144. Die Kirche zu Sieverstedt.
145. Der Bischofswarder.
146. Der Ehrengang.
147. Die Brutkoppel.
148. Die Bridfearhoger auf Sylt.
149. Der Brutsee.
150. Die Linde in Nortorf.
151. Stiftung des Klosters Preetz.
152. Arensbök.
153. Neukirchen im Fürstentum Lübeck.
154. Unse leve Fru up dem Perde.
155. Ein weißes Pferd weiset die heilige Stätte.
156. Rinder weisen die heilige Stätte.
157. Rabenkirchen.
158. Schneefall bezeichnet die heilige Stätte.
159. Hörup.
160. Der Märtyrer in Borgdorf.
161. St. Annen Bild in Herzhorn.
162. Das eherne Kreuz zu Windbergen.
163. Arkelspang.
164. Die Doppeltürme zu Broacker.
165. Die Glocke in Keitum.
166. Die Brunsbüttler Glocken in Balje.
167. Glocken im Wasser.
168. Die Glocke in Krempe.
169. Mödebrook.
170. Stawedder bei Segeberg.
171. Der Bischof Blücher.
172. Abel und die Friesen.
173. Marienbild in Itzehoe.
174. Der Donner holt ein Klosterfräulein.
175. Hans Brüggemann.
176. Der Löwe mit dem Kinde im Rachen.
177. Pancratius halet sine Tüffelen wedder.
178. Die Kirchenräuber.
179. Der Steinhügel bei Hedehusum.
180. Der Mönch auf Helgoland.
181. Das Schwert im Schleswiger Dom.
182. Die Kirche unserer lieben Frauen in Schleswig.
183. Die abgehauene Zehe.
184. Der entweihte Taufstein.
185. Das gestorbene Hündchen.
186. Das verschüttete Dorf.
187. Ringkjöping.
188. Helgoland.
189. Woher die großen Fluten kommen.
190. Horsbüll.
191. Die Hausleute an der Milde.
192. Rungholt.
193. Das alte Plön.
194. Der Ecksee und der Kattsee in Dithmarschen.
195. Das gerettete Kind.
196. Am Ufer bei Schobüll.
197. Das brave Mütterchen.
198. Die Flut in Osterwisch.
199. Die übermütige Frau.
200. Hans Haunerland.
201. Die verlorne Quelle auf der Hallig Nordmarsch.
202. Die Heringe auf Helgoland.
203. Die vertriebenen Dorsche.
204. Die Möwen in Schleswig.
205. Die Bergenten auf Sylt.
206. Die Krähen verlassen Amrum.
207. Die verschworne Stätte.
208. Sark Hethk auf Amrum.
209. Die Eiche am Elbufer.
210. Die Eiche auf dem Galgenberg.
211. Der wachsende Pfahl.
212. Der gottlose Edelmann.
213. Der Frauenschuh im Stein.
214. Jochim von der Hagen.
215. Des Grafen Fußstapfen.
216. Das Hufeisen im Stein.
217. Der Stein auf dem Blotenberge.
218. Roßtrappe bei Segeberg.
219. Der Stein bei Hackelshörn.
220. Des Kindes Fußstapfen.
221. Die weinende Mutter.
222. Vicelins nasses Kleid.
223. Der eingemauerte König.
224. Der Stein bei Seeth.
225. Das versteinerte Brot.
226. Das liebe Brot.
227. Knaben in Stein verwandelt.
228. Das errötende Bild.
229. Die Tänzerin.
230. Der verwünschte Geiger.
231. Der Teufel holt den Letzten.
232. Die Teufelsbrücke.
233. Der Teufel und die Soldaten.
234. Der Teufel und die Kartenspieler.
235. Der Freischütz.
236. Der betrügerische Wirt.
237. Der diebische Müller.
238. De Möller von de Brackermœl.
239. Der Müller ohne Sorgen.
240. Die aufrichtige Lüge.
241. Die Wahrheit ohne Herberge.
242. Michel Hartnack.
243. Wie Frau Abel sich ein Ei holte.
244. Der liebe Gott und der Teufel.
245. De Knech un de Buur.
246. Die schwarze Greet.
247. Die Hand des Himmels.
248. Ewig lęwen.
249. Klaus Nanne.
250. Der Wanderjude.
251. Die beiden Drescher.
252. Die Schnitterin.
253. Das Licht der treuen Schwester.
254. Das Geisterschiff.
255. De Dood de ritt so snell.
256. Der Teufel und die Braut.
257. Der Uglei.
258. Van den Grafen, den de Düwel haalt.
259. Das Biikenbrennen.
260. Sonnabends Abend darf nicht gesponnen werden.
261. Das Totenhemd.
262. In den Zwölften.
263. Neujahrsnacht.
264. Die Weihnachtsfeier im Preetzer Kloster.
265. Gottesdienst der Toten.
266. Die Schimmelköpfe.
267. Der bestrafte Vorwitz.
268. Die silbernen Apostel in Meldorf.
269. De Kulengrawer.
270. Die unverträglichen Pastoren.
271. Tutland.
272. Die Seele im Kirchenbann.
273. Der Dikjendälmann.
274. Steenbock.
275. Der versunkene Wagen.
276. Die unruhige Totenmütze.
277. Der Strandvogt.
278. Sara Limbek.
279. Payssener Greet.
280. Das händeringende Weib.
281. Troyburg.
282. Das Gespenst auf Gramm.
283. Das Gespenst am Brunnen.
284. Die weiße Frau auf dem Sandfelde.
285. Gnade bei Gott.
286. Die Gongers.
287. Die Male des Mütterchens.
288. Der Bröddehoogmann.
289. Hark Olufs.
290. Der vergrabene Schatz.
291. Dat lütje Tümmeldink.
292. Der verwünschte Prinz.
293. Die Mäher.
294. Die Irrlichter bei Ullenbierge.
295. Die Irrlichter bei Jordkirch.
296. Der Scheidevogt.
297. Die Grenze verrückt.
298. Das Gespenst mit dem Grenzpfahl.
299. Der nächtliche Pflüger.
300. Schwarze Hunde.
301. Cyprianus.
302. Die schwarze Schule.
303. Der Mann ohne Schatten.
304. Der Teufel muß den Wagen tragen.
305. Geister gebannt.
306. Der Ziegenbock.
307. Der gebannte Knecht.
308. Der Teufel und der Schüler.
309. Das bezauberte Wirtshaus.
310. Ogen verschœlen.
311. Festlesen.
312. Festschreiben.
313. Siebdrehen.
314. Diebe bringen das Gestohlene wieder.
315. Mörder zitiert.
316. Der Zauberkessel.
317. Teufel über Teufel.
318. Der Liebestrank.
319. Die Windmühlen.
320. Der leibhaftige Teufel.
321. Der schwarz und weiße Bock.
322. Die Schatzgräber.
323. De Zigeunerin.
324. Der Schatz des Räubers.
325. Der geträumte Schatz.
326. Der Drache.
327. Die Teufelskatze.
328. Der Zauberhund.
329. Der verteufelte Stock.
330. Mönöloke.
331. Das Allerürken.
332. Von der Frau, die's Raten lernte.
333. Küster Hans.
334. Gott einmal verschworen, bleibt ewig verloren.
335. Die Hexen in Friesland.
336. Die Hexen.
337. Die Seele vor dem Schafstall.
338. Hexen erkannt und belauscht.
339. Salzstreuen.
340. Die Hexenfahrt.
341. Die drei Haare.
342. Das Geschenk der Hexen.
343. Die Hexen in Wilster.
344. Das Geistermahl.
345. In der Haddebyer Gemeinde gibt's keine Hexen.
346. Noch einen Stich.
347. Mutter Potsaksch.
348. Eine Hexe fliegt davon.
349. Die Schürze der Hexe.
350. Der Hexenschiffer.
351. Die Windknoten.
352. Das Johannisblut.
353. Das Wachsbild.
354. Die Hexen stopfen Unfrieden.
355. Die Hexen nehmen die Butter.
356. Vieh behext.
357. Kälber behext.
358. Der Dünenstrauch.
359. Hexen als Sturzwellen.
360. Die Wasserhose.
361. Eine Hexe als Pferd.
362. Die Hexe mit dem Zaum.
363. Die abgehauene Pfote.
364. Hexen als Katzen.
365. Die beiden Bräute.
366. Die weiße Katze.
367. Die blanken Hunde.
368. Hexe als Hase.
369. Hexe als Fuchs.
370. Die Frau mit dem Wolfsriemen.
371. Werwölfe.
372. Der Werwolf in Ottensen.
373. Werwölfe kommen in kein Roggenfeld.
374. Das lange Pferd.
375. Das Teufelspferd.
376. Weiße Pferde.
377. Das Riesenschiff Mannigfual.
378. Unheimliche Orte.
379. Der Basilisk.
380. Der Lindwurm in Eckwadt.
381. Das Viehsterben.
382. De Mözer Gloof.
383. Der Kuhtod.
384. Der schwarze Tod.
385. Die Teurung.
386. Das vergrabene Kind.
387. Die Nachtmähr.
388. Sęwenrand.
389. Der Sargfisch.
390. Hel.
391. Eins, zwei, drei.
392. Flämmchen im Wasser.
393. Feuer vom Himmel.
394. Wildes Feuer.
395. Der feurige Mann.
396. Feuer vorgewarnt.
397. Vorbrennen.
398. Das Hornblasen in der Nacht.
399. Der Friedensberg.
400. Kämpfe in der Luft.
401. Untergang der Schackenburg.
402. Vorhersehen.
403. Die weise Frau Hertje.
404. Vor dem jüngsten Gericht.
405. Die Walnüsse.
Drittes Buch.
406. Beowulf.
407. Der Wassermann und der Bär.
408. Der Dränger.
409. Der Teufel in Flehde.
410. Juchen Knoop.
411. Schwertmann.
412. Der Teufel in Klein-Wesenberg.
413. Der Teufel und die Alte im Hollenhoop.
414. Der Teufel in der Elbe.
415. De Uald.
416. Hans Heesch.
417. Die Riesen in Krumesse.
418. Riese steigt aus der Erde.
419. Der Riese holt einen Baum.
420. Die Sylter Riesen.
421. Der Teufel mit dem Hammer.
422. Die Teufel mit den Hämmern.
423. Riesensteine in Holstein.
424. Riesensteine in Schleswig.
425. Lubbes Stein.
426. Der unmäßige Teufel.
427. Der Teufel trägt Ohrfeld.
428. Die Teufelsspuren.
429. Der Klinkenberg.
430. Der Segeberger Kalkberg.
431. Der Alsinger Sund.
432. Die Teufelsbrücke.
433. Das Dannewerk gebaut.
434. Die sechs Kirchen.
435. Der Teufel ein Zimmermann.
436. Der Teufel beim Grasmähen.
437. Der starke Tabak.
438. Die Trauben sind sauer.
439. Hopsö.
440. Das Seemännlein.
441. Die Riesen bei der Flachsernte.
442. Die geteilte Ernte.
443. Die Riesen und die Bauern.
444. Die Erschaffung der Unterirdischen.
445. Die Unterirdischen.
446. Die Untererschen im Köpfelberg.
447. Die Ofensteine bei Alversdorf.
448. Die Onnerbänkissen im Fögedshoog.
449. Der Schatzgräber und die Unterirdischen.
450. Die unterirdischen Töpfer.
451. Die unterirdischen Schmiede.
452. Die geliehenen Kessel.
453. Der arme und der reiche Bauer.
454. Die Dragedukke.
455. Der Tisch der Unterirdischen.
456. Kaspers Lępel.
457. König Piper.
458. Das Butterbrot.
459. Kulemann.
460. Die Gevatter.
461. Die Trommelmusik.
462. Der Mühlstein am Seidenfaden.
463. Eisch is dood!
464. Pingel ist tot!
465. Vitte und Vatte.
466. Find und Kind.
467. Der Abendmahlskelch in Viöl.
468. Die Kirchenbecher.
469. Der gestohlene Becher.
470. Das Horn der Büsumer Brandgilde.
471. Die zerbrochene Schaufel.
472. Der zerbrochene Brotschieber.
473. Die Kindbetterin.
474. Die Salbe der Unterirdischen.
475. Der verschüttete Eingang.
476. Zi, der Baumeister.
477. Vater Finn.
478. Der rote Hauberg.
479. Vom Teufel ist nicht los zu kommen.
480. Der Pfenningmeister.
481. Der Teufel und der Glaser.
482. Der gestrichene Scheffel.
483. Die Zahlen eins bis sieben.
484. Hans Donnerstag.
485. Knirrficker.
486. Gebhart.
487. Tepentiren.
488. Ekke Nekkepenn.
489. Ein Mädchen heiratet einen Zwerg.
490. Die Unterirdischen wollen eine Frau stehlen.
491. Die geraubte Frau.
492. Die ausgehauene Liese.
493. Ein Unnererschen gefangen.
494. Wechselbälge.
495. De Kielkropp.
496. Sie wollen ausziehen.
497. De Ünnererschen in Eißendörp.
498. Des kleinen Volkes Überfahrt.
499. Die Wolterkens.
500. Das Klabautermännchen.
501. Dr. Faust und Niß.
502. Nu quam jem glad Niskepuks.
503. Niß Puk in Owschlag.
504. Neß Puk im Kasten.
505. Der gute Johann.
506. Thoms und der Niß.
507. Die gestohlene Kuh.
508. Die Unterirdischen schlecken Milch.
509. Pugholm.
510. Die diebischen Puge.
511. Der Hochzeitstag der Puke.
512. Das Glück der Grafen Ranzau.
513. Josias Ranzaus gefeites Schwert.
514. Die nackten Kinder.
515. Niß Puk in der Luke.
516. Der falsche Racker.
517. Der versöhnte Niß.
518. Wir ziehen um.
519. Der Flöter.
520. Nißpuk gebannt.
521. Die Zwerge verbrannt.
522. Die Meerweiber.
523. Die junge Hexe ersäuft.
524. Die weiße Frau am Mühlenteich.
525. Der Jungfernsee.
526. Die tanzenden Elbinnen.
527. Die drei Weiber.
528. Die schwarze Greet am Dannewerk.
529. Die schwarze Dorte.
530. Die Spinnerin.
531. De gode Krischan.
532. Die Prinzessin im Nobiskruger Holze.
533. Die weiße Frau in Hanerau.
534. Die Wittfruen.
535. Die Frau auf der Thyrenburg.
536. Die Duborg.
537. Die Prinzessinnen im Tönninger Schloß.
538. Das Fräulein in der Wittorfer Burg.
539. Der Bock mit der Leuchte.
540. Der schwarze Hahn.
541. Die gelbe Blume.
542. Die Schätze im Margretenwall.
543. Die goldnen Wiegen.
544. Am Oldenburger Wall.
545. Schatz gesehen.
546. Ein Vogel weiset den Schatz.
547. Der Goldkeller im Laböer Berge.
548. Die Schatzquelle.
549. Der Schlangenkönig.
550. Die Schlange in der Duborg.
551. Schnaken in Gold verwandelt.
552. Kohlen in Gold verwandelt.
553. Der Maulwurf.
554. Der Hagebuttenstrauch.
555. Der Donner.
556. Schnee und Regen.
557. Sonnenuntergang.
558. Die Sterne.
559. Der Mann im Mond.
560. Hans Dümkt.
561. Der wilde Jäger in Sundewitt.
562. König Waldemar.
563. König Abels Jagd.
564. Künnig Abel sine Hunde.
565. Der Pferdeschinken.
566. Der Sack mit Hafer.
567. Der wilde Jäger und die Holzdiebe.
568. Der Freischütz.
569. Herr von Wittorf.
570. Wau, wau!
571. Der wilde Jäger.
572. Der alte Au.
573. Der wilde Jäger eingefangen.
574. Das gesegnete Brot.
575. Der wilde Jäger auf der Putloser Heide.
576. Der Wohljäger.
577. Der Wode.
578. Grabhügel auf Sylt.
579. König Frode.
580. Boldershöi.
581. Roland.
582. Holger Danske.
583. König Dan.
584. Der verzauberte alte Kriegsmann in Tönningen.
585. Der Itzehoer Briefträger.
586. Das schlafende Heer.
587. Die weise Frau in Enge.
588. Der Hollunder in Nortorf.
589. Schwarze Greet prophezeit.
590. Der Hollunder in Schenefeld.
591. Der Hollunder in Süderhastede.
592. Der Wunderbaum in Dithmarschen.
Viertes Buch.
593. Ode un de Slang.
594. Vom goldenen Klingelklangel.
595. Der weiße Wolf.
596. Siebenschön.
597. Jungfer Maleen.
598. Goldmariken und Goldfeder.
599. Vom Mann ohne Herz.
600. Fru Rumpentrumpen.
601. De dree Süstern.
602. Der Freier.
603. Die dümmste Frau.
604. Das blaue Band.
605. Der starke Franz.
606. Vom Bauersohn, der König ward.
607. Der faule Hans.
608. Das Märchen vom Kupferberg, Silberberg und Goldberg.
609. Hans mit de isern Stang.
610. Dummhans un de grote Ries.
611. Die alte Kittelkittelkarre.
612. Peter und Lene.
613. Herr Nęgenkopp.
614. Rinroth.
615. Von dem König von Spanien und seiner Frau.
616. Die drei gelernten Königssöhne.
617. Vater Strohwisch.
618. Die reichen Bauern.
619. Die Sündflut.
620. Dree to Bett.
621. Das goldene Bein.
622. Der Teufel ist tot.
623. Fuchs und Wolf.
624. Warum de Swien ümmer inne Grund wrœten.
625. Die beiden Hähne.
Anmerkungen.
Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Karl Müllenhoff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603045
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchen ist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchenforschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Bibliographie der Sage
Wie sehr man auch bei uns sich der Vernachlässigung und Verachtung der mündlichen Überlieferungen des Volkes schuldig gemacht hat, beweist hinreichend die geringe Ausbeute, die die Literatur für diese Sammlung ergab. Das Verdienst zuerst den Vorsatz ausgesprochen zu haben, diese Schuld zu tilgen, gebürt meinen Freunden, dem Dr. jur. Theodor Mommsen aus Oldesloe und dem Adv. Theodor Woldsen-Storm in Husum. Sie theilten im Herbste des Jahres 1842 im ersten Jahrgange des Biernatzkischen Volksbuches aus ihrer Sammlung einige ansprechende Proben mit, kündigten ihr Unternehmen an und baten um Unterstützung und Förderung desselben. Geleitet von poetischem und patriotischem Sinn, war jeder schon in seinem Kreise thätig gewesen, und es war gelungen namentlich eine ansehnliche Reihe schöner Zwergsagen zusammen zu bringen. Zu gleicher Zeit hatte der jetzige Herausgeber in Ditmarschen zu sammeln begonnen, auch bereits mit der Durchsicht der Literatur zu jenem Zwecke angefangen, und stand eben im Begriff eine ähnliche Bitte auszusprechen, als die Freunde ihm unversehens zuvorkamen. Durch die freundlichste Bereitwilligkeit von ihrer Seite war leicht eine Verbindung zu gemeinsamer, eifriger Thätigkeit geschlossen und noch im Herbst desselben Jahrs eine neue Aufforderung zahlreich in alle Theile des Landes an solche Männer versandt, auf deren Theilnahme wir glaubten rechnen zu dürfen. Es war ein glücklicher Zeitpunkt getroffen. Bald giengen uns reichliche Mittheilungen zu, und wenn auch nicht überall unsre Bitte gleiches Gehör fand und gleichen Erfolg bewirkte, so ward unsre Erwartung doch fast übertroffen. Ohne Arndts unermüdliche Thätigkeit, ohne die Bereitwilligkeit Klanders und Herrn Schullehrer Hansens, mit der sie uns ihre eignen Sammlungen übergaben, ohne die gütige Förderung vieler anderer Männer, die durch zahlreiche Mittheilungen oder durch Aufmunterung anderer oder durch stets auf unsre Anfragen und Erkundigungen bereitwillig gegebene Auskunft uns beistanden, ohne solche vielfältige, aufopfernde Theilnahme wäre die Sammlung nicht so rasch gediehen. Ich freue mich, dafür allen, die mit geholfen haben und deren Namen ich nicht verschwiegen, hier öffentlich meinen wärmsten Dank sagen zu können. Was an feindseligen Stimmen vor und nach dem Erscheinen der Sammlung gegen dieselbe laut ward, als verbreite sie von neuem den alten Aberglauben, den man längst glaubte ausgerottet zu haben, und werde nun in den Augen der aufgeklärten und gebildeten Welt unserm Land und seinen Geistlichen nur Schande machen; ferner daß sie Gotteslästerung enthalte (Nr. 244), ein unchristliches, heidnisches Werk, kurzum »das aller verderblichste Buch sei, das je unter uns erschienen,« obwohl diese Stimmen, man weiß wohl von welcher Seite, sich zahlreich und selbst öffentlich so aussprachen, so will ich sie doch gerne auch ferner anhören, froh der Theilnahme, die dies Buch seit seinem Entstehen fand, und weil ich weiß, daß sie ihm nicht gar viel geschadet haben, und ich im stillen auch die Hoffnung hege, solche Meinungen und ähnliche nächstens bei einer neuen Auflage schon als Sagen benutzen zu können. Sie zu widerlegen, würde noch vergeblicher und nutzloser sein, als die Ausrottung des Aberglaubens.
Unterdes verließ uns Mommsen im vorigen Jahre und gieng mit königlicher Reiseunterstützung nach Italien; dadurch schied er von der fernern Theilnahme an der begonnenen Arbeit ab. Auch Storm trennte sich jetzt und so fiel der gesammelte Schatz mir allein zu. Je schmerzlicher ihnen der Rücktritt von einem so lieben Werke wird gewesen sein, je mehr ihnen dieses verdankt und ich ihre Hilfe entbehren muste, je mehr fühle ich mich ihnen verpflichtet. Was die jetzt vorliegende Arbeit an Tadel treffen mag, kann allein meine Schuld sein; die dabei befolgten Grundsätze sind diese gewesen.
Nur kurze Zeit konnte mir Mommsen bei der Durchsicht unserer vaterländischen Literatur helfen; die wenig erfreuliche Arbeit habe ich zum grösten Theile allein beschafft; ich möchte glauben, daß mir nichts bedeutendes entgangen ist. Mirakel und Heiligengeschichten aus Albert Kranzens Metropolis etc., wie sie sich freilich in andern Sammlungen finden, wurden meist bei Seite gelegt, ebenso für das, was an Zauber- und Spukgeschichten die mündliche Überlieferung bot, Beschränkung eingehalten; es wurden nur die nothwendigen Beispiele zur Übersicht des ganzen großen Reichs des eigentlichen Aberglaubens gegeben. Nachgiebiger fast, wie ich aber glaube mit gutem Grunde, war ich in der Aufnahme historischer Stücke, besonders aus dem Presbyter brem. Gleichwohl weiß ich, daß entstellte Geschichte noch keine Sage ist. Die späteren Chronisten schrieben ihn fast alle aus, und klüger besserten sie seine chronologischen Fehler. So giengen seine Nachrichten zum Theil in unsre Landesgeschichten über, und man hat sich vielleicht gewundert, jetzt manches als Sage vorzufinden, was bisher für Geschichte galt oder doch stillschweigend dafür passierte. Je unhistorischer der Presbyter ist, ich muste nur ihm folgen, mag er »der schwarzen Margaret auch allzuviel in die Schuhe schieben« und dieser wegen die Jahreszahl über Nr. 12. falsch sein. Ferner beim Beowulf werden Kundige nicht die Erwähnung des Ortes Bau bei Flensburg vermissen, oder nach einer Sage von den Dannebrogschiffen bei Gienner suchen, oder nach der Hertha bei Herrested, nach dem Gott Flins bei Flintbek und Flensburg etc. Man findet das und manches ähnliche zwar in vielen und neuen Büchern, die immer wieder von einander abschrieben, als Sage angegeben. Aber jenen Ort und den Helden hat erst der sel. Pastor Outzen in Brecklum vor ungefähr dreißig Jahren nach seiner Weise zusammengebracht, die ganze Geschichte von den Dannebrog oder (nach Major) Dannebodschiffen, die freilich Thiele2 auch für eine Sage hielt, ist ja nur eine Phantasie Arnkiels3, und die Gelehrten, die die falsche Lesart im Tacitus als Göttin in Nordschleswig verehren ließen, einen Flins erfanden, mögen das vor ihrem eignen Gewissen verantworten. Ich führe diese Dinge hier nur an, weil man sie hin und wieder hier zu Lande noch für was rechtes zu halten scheint. Ich habe sie und ähnliche Erfindungen natürlich absichtlich ausgelassen.
Man wird nicht sagen, daß diese Sammlung ohne Bewußtsein des großen Ganzen, dem wir angehören, gemacht sei. Doch schien mir ein streng provinzieller Charakter für sie die erste Forderung, so auch für die folgende Abhandlung. Dies Buch sollte zunächst ein Buch für unser Land sein, und wenn es diese seine Aufgabe recht erfüllt, glaube ich, wird es auch dem großen Vaterlande und der Wissenschaft seine völlige Pflicht zu leisten im Stande sein. Ich nahm daher sowohl die allerverbreitetsten und bekanntesten Sagen auf, die wohl hundert Mal schon aus anderen Gegenden mitgetheilt wurden, als auch die unseres Landes, die in Grimms deutschen Sagen sich fanden. Ich habe seine politischen Grenzen aber eingehalten, so gerne ich auch Hamburgs und Lübecks Sagen eingeschlossen hätte, und so sehr diese herzu gehören, weil es bald für sie an Raum gebrach. Es war anfangs Absicht, nicht über die Grenzen der deutschen Nationalität hinaus zu gehen, aber die Unmöglichkeit leuchtete bald hierfür ein, und das freundlichste Entgegenkommen von Seiten unserer nordschleswigschen Landesgenossen verbot die Absicht zu verfolgen. Nur Aröes Sagen glaubte ich ausschließen zu dürfen, zumal da sie, von Dr. Hübertz fleißig gesammelt, in Etatsrath Thieles trefflicher Sammlung der dänischen Volkssagen schon mitgeteilt wurden. Es ist lehrreich den Übergang und die Berührung zweier Nationalitäten auch in den Sagen zu verfolgen. In Nordfriesland zeigt nicht nur die Sprache, sondern auch der eigentliche Aberglaube starke Einwirkung des dänischen. Südlich der Schlei und der Trene ist es zwar in einzelnen Ortsnamen zu spüren, aber ich wüste keine Spur desselben sonst anzugeben; in Angeln aber treten dänische Reime neben niederdeutschen auf (Nr. 58. 119. 579), bei Flensburg jagt König Wollmer wie auf Seeland (Nr. 562), es wird Ballerune gespielt (Nr. 580 Anm.). Nordschleswig endlich nahm nicht nur ehedem Theil an dem dänischen Volksgesang im Ausgange des Mittelalters, das erste Auftreten reiner Elbensage (Nr. 526), der wunderbar fest ausgebildete Glaube an die schwarze Schule und Cyprianus Bücher, der nach Angeln und Friesland hinüber reicht, und manches andre beweisen eben so entschieden als die Sprache, daß die deutsche Nationalität hier ihre Grenze gefunden hat. Man könnte darnach für die Anlage der Sammlung die Form einer Districtseintheilung, wie bei den märkischen Sagen verlangen, doch habe ich eine freiere Anordnung, deren Faden ein aufmerksamer und nachdenkender Leser schon finden wird, vorgezogen, indem die Vortheile jener dadurch eingeholt wurden, daß genauer, als in manchen andern Sammlungen geschieht, die Heimat jeder Sage, der Ort ihrer Quelle und zugleich in den Anmerkungen ihre Verbreitung im Lande angegeben ward; endlich ist auch in dem angehängten Inhaltsverzeichnis die ungefähr angenommene Districtseintheilung neben jeder Nummer bezeichnet worden. Einzelne Irrthümer, die sich, wie begreiflich, leicht einschlichen, sind im Anhange, so weit sie bemerkt wurden, verbessert. Schwerlich möchten sie sich auch zahlreicher finden. Sonst bitte ich um Berichtigung.
In der Behandlung und Bearbeitung des gesammelten Stoffs war es das erste Bestreben, jedem Stücke eine ihm gemäße einfache Gestalt zu geben, in der sein thatsächlicher Inhalt frei und unverhüllt hervortrete. Das sogenannte volksmäßige suchte ich nicht, Provinzialismen aber ließ ich gerne einfließen; mit dem armseligen Plunder »des Modekleides der Novelle« mag man andre Stoffe, die dessen bedürfen, behangen. Mit Bedauern spreche ich es aus, daß Lübecks und Hamburgs schöne Sagen durch die Literatur auf diese Weise zu Schanden gemacht werden, und leider auch an andern Orten. Ich verhehle meinen Abscheu vor einer solchen Behandlungsweise nicht. Das mag mich zwar, besonders anfänglich, zu einer allzugroßen Strenge verleitet haben, mein Wunsch war nur so zu erzählen, wie man es schlichtweg mündlich thut. Was mir schriftlich mitgetheilt ward, war glücklicher Weise fast immer frei von jenem verschönernden Bestreben, und unsre Bitte um treue und einfache Aufzeichnung ist durchweg erfüllt worden. Daß aber dennoch selten ganz wörtlich wieder abgedruckt ward, wird hoffentlich keiner verübeln; es sollte diese Sammlung kein Itzehoer Wochenblatt und keine Sammlung von Stilproben werden. Nur wenn die Aufzeichnung genau die Worte aus dem Munde des Volkes und in seiner Sprache wiedergab, brauchte und durfte wenig geändert werden. Ich selbst konnte bisher fast nur in Ditmarschen unmittelbar aus dem Munde des Volkes schöpfen. Sonst stellte ich mich allen schriftlichen Mittheilungen so gegenüber, als hätte ich sie von dem gütigen Einsender mündlich empfangen, und erzählte dann nach meinem Sinn. Ich glaubte damit nur im Interesse der Sammlung zu handeln, und bin überzeugt, jeder, der eine so vielfältige bunte Masse vor sich gehabt hätte, würde dieselbe Pflicht empfunden haben.
Dieses Buch ist in viele und verschiedene Hände gekommen. Ich weiß, daß es in manche Häuser Eingang fand, wohin sonst selten Bücher gelangen, daß es da mit Freude aufgenommen und, von Hand zu Hand gehend, fast eher schon zerlesen ward, als es vollendet ist. Die Geschichten sind ja schnell gelesen und schnell wieder vergessen und ergötzen darum immer wieder von neuem; dies Lob hörte ich aussprechen. Die Sage bewährt also auch schwarz auf weiß ihre unverjährte Kraft gerade in dem Kreise, dem sie von Anfang angehörte, wo von Geschlecht zu Geschlecht sie ihre Pflege, ihren Schutz und ihre Freunde fand. Ich möchte diesem Buche lauter solche Leser wünschen. Für sie bedarf es keiner gelehrten Einleitung und Auslegung; ich habe diese versprochen, aber wahrlich dabei nicht an die gewöhnliche, hochdeutsche Lesewelt gedacht, für diese möchte ich keinen Federstrich gethan haben, sondern ich weiß, daß es Männer gibt, denen weder der einfache Sinn für die Sage mangelt, noch auch der vaterländische Geist, der Erkenntnis des Heimischen fordert, dem darum nicht die Vergangenheit, auch die fernste nicht, um der Gegenwart willen gleichgiltig ist, sondern welcher meint, daß diese nur durch jene recht begriffen wird und inniger geliebt werden kann. Diesen Männern liegt es am Herzen die Kluft, die Bildung, Sprache und Eitelkeit in unser Leben gebracht haben, wieder zusammen zu fügen. Wenn dazu dieses Buch schon mitgewirkt hätte und ferner wirken könnte, so löste es seinen höchsten Zweck. Die Gebildeten müssen einsehen lernen, daß in vieler Hinsicht die, über welche sie sich erhaben wähnen, ihnen voraus und überlegen sind, und daß sie mit aller ihrer Bildung nur das erstreben, was diesen gegeben ist, ein fest ausgeprägtes, in allem Wechsel beharrliches Wesen.
Wenn nun auch der Reichthum und die Vielseitigkeit des Volkslebens, so weit dieses in Sage und Poesie Sprache gewann, sich auf wenigen Blättern nicht darlegen läßt, so folge ich doch mit Freuden den Erinnerungen und Ermahnungen mancher Freunde, eine Seite desselben, wozu die Sammlung besonders Anlaß gibt, aufzudecken. Ich will den Versuch einer Geschichte unseres Volksgesanges geben; zwar muß ich da die allgemeine Geschichte desselben im gesamten Vaterlande herzuziehen, aber wir sind ja auch nur ein Theil des Ganzen, und dies eben darzuthun und zu sehen ist eine Lust. Anhängen will ich dann noch einige Bemerkungen, um darauf aufmerksam zu machen, wie vielseitige Betrachtung und wie zahlreiche Resultate eine jede solcher Sammlungen gewährt, zunächst für das Land aus dem sie hervorgieng. Das Feld ist fast unbegrenzt und so leicht nicht ausgebeutet.
Bei ihrem Eintritt in die Geschichte besaßen die Deutschen schon alte Lieder, die von den Göttern und den göttlichen Ahnen des Volkes und seiner Stämme handelten. Der Stamm der Ingävonen, der unsre Halbinsel ganz hinauf bis Skagen inne hatte, die Sachsen, Angeln und Jüten werden nicht allein von den ihrigen geschwiegen haben. Der ganze Haufe, wenn er in die Schlacht zog oder beim fröhlichen Opfermahle war, sang; die Lieder waren also von epischem Inhalt und hymnisch-chorischer Art, ganz an die Verehrung der Götter geknüpft, und man kann daher über die directen Zeugnisse hinaus mit aller Sicherheit schließen, daß, was von den Mythen der Götter in unmittelbarem Zusammenhange stand mit den jährlichen heiligen Festen, und Werken, wie vor allem die Schlacht, bei denen man die Götter gegenwärtig glaubte, daß so viel auch in Liedern vorhanden war. Aber dagegen darf man fast mit völliger Gewisheit (ein Zeugnis nur scheint zu widersprechen) das Dasein eines historischen Gesanges leugnen. Dieser setzt schon einen erhöhteren Bildungszustand voraus, nicht nur eine größere Freiheit und Ungebundenheit der Poesie, die wieder eine gewisse Behaglichkeit des Lebens fordert, sondern auch das Erwachen eines historischen Sinnes, was wir beides den halbnackten Deutschen, die die Römer schildern, nicht zuschreiben möchten. Beide Bedingungen aber traten ein in der Zeit der großen Wanderungen und Eroberungen unseres Volkes. Da sind einzelne Sänger da, die den Stoff wählen konnten und nun zur Lust und Erhebung der Helden und Edlinge den Gesang übten; das Lied war frei geworden und ward nicht mehr ausschließlich nur von Schaaren angestimmt, und war nicht mehr ein von altersher überliefertes, sondern ward neu geschaffen. Wie an den Höfen der fränkischen und gothischen Könige, so erzählen angelsächsische Gedichte, waren auch an dem Hofe eines holsteinischen Königs zwei Sänger, die »oft in schöner Rede vor ihrem Siegfürsten den Sang erhuben und hell zur Harfe den Hall erklingen ließen.« So ist auch im Beowulf ein Sänger, der beim Mahle und gleich nach der Heldenthat den Gesang zur Harfe beginnt. Da der thatsächliche epische Inhalt, das Wort Hauptsache ist, war das Singen jedoch mehr ein Sagen, als Gesang in unserm Sinne, beide Ausdrücke werden in der alten Kunstsprache verbunden und sind fast gleichbedeutend; die Harfe aber begleitete das feierlich Gesagte, ganz so wie im Homer die Phorminx. Der Sänger hieß Scôp4, und entweder war er bei einem Könige oder Edeling in festem Dienst, oder zog mit seiner Kunst, wie einer jener holsteinischen Sänger, an fremden Höfen umher, stets Lohn empfangend. Aber darum war er nicht weniger als irgend ein anderer Mann eines Königs; Könige und Helden dieser Zeit übten selbst den Gesang, und dieser stand mit dem gesammten Heldenleben im nächsten Zusammenhange. Indem nicht nur die alten Götter und Heroenmythen Gegenstand des Gesanges waren, sondern dieser auch unmittelbar die Gegenwart und ihre großen Ereignisse ergriff, sammelte sich ein großer Schatz nationaler Heldensage, worauf der ganze spätere Volksgesang sich gründet. Was die Angelsachsen an alten Erinnerungen bewahrt haben, dürfen wir um so mehr unserem Lande zusprechen, weil hier die Heimat ihrer Helden und der Spielraum ihrer Thaten ist. Eine große Reihe nennt ein altes Lied bei den Völkern an Ost- und Westsee5. Skeaf, Beowulf und Offa (Nr. 1. 3. 4) gehören hierher. Sagen und Gedichte melden ferner von der Freundschaft und Feindschaft der alten Holsteiner und ihrer südlichen Nachbaren jenseits der Elbe, der Langobarden, von den Kämpfen der Angeln und Dänen, der Dänen und Friesen, der Angeln und Holsteiner (Nr. 3), der Jüten und Schweden und anderer mehr; sie melden von Hygelacs und seines Helden Beowulf Zuge gegen die Franken und Friesen am Rhein, und von ihrer Freundschaft mit dem Dänenkönig Hrodgar (Nr. 406). Und an diesem Reichthum heimischer Stoffe war es nicht genug; zum Theil sind sichere Zeugnisse vorhanden, daß die Thaten und die Helden anderer deutscher Völker auch hier ihre Sänger fanden. Die Sagen von den Nibelungen und Welsungen, und von dem König Ermanrich, die der Norden aus Deutschland empfieng und in seinen Eddaliedern aufbewahrte, möchten ihre Wanderung doch am ersten durch unser Land gemacht haben. Die Namen der Hauptpersonen, wie Jakob Grimm nachwies, zeigen nicht alle die rein nordische Form, sondern verrathen ihren Durchzug durch Altsachsen. Das Schicksal hat es nicht gewollt, daß einheimische Lieder oder Nachrichten uns erhalten wären. Nachdem im sechsten Jahrhundert die Auswanderung zu Ende war und der gröste Theil der Halbinsel den Dänen zufiel, nahm das Volk die Sprache der Sieger an und seine alten Helden traten in die Reihe der dänischen, so der jütische Amleth, der anglische Offa und der gleichfalls anglische Frowin, deren Sagen Saxo in das dritte und vierte Buch seiner dänischen Geschichte aufnahm. In England hegte man, wie wir sahen, zwar die alten Erinnerungen, wenigstens während zweier Jahrhunderte. Aber früh verschmolz der mythische Göttersohn Beowulf mit dem historischen gleiches Namen, eine Erscheinung, die sich im deutschen Epos ähnlich überall wiederholt; Offa, der Kämpe auf der Eiderinsel, ward mit Offa II. von Mercien verwechselt und nun in England lokalisiert, und die schöne Sage von seiner Gemahlin (Nr. 4), die augenscheinlich auf dem ältesten Grunde ruht, ward legendenartig, durch Einmischung des Christlichen, umgebildet. Zwar Holstein bewahrte seine deutsche Nationalität, aber dennoch werden auch hier die einheimischen Sagenstoffe allmählich eingeschwunden sein, nachdem für sie der Halt des alten Volkskönigthums dahin war und endlich des Landes schönste Hälfte den Wenden zufiel. Als dieses wieder gewonnen ward, waren es nicht die alten Bewohner, die es von neuem bevölkerten, und zugleich die Marschen, sondern Einwanderer.
Den Untergang seiner alten landschaftlichen Heldenpoesie, um sie so zu bezeichnen, so reich auch der angesammelte Stoff war, hat fast jedes deutsche Land zu beklagen. Er war im achten und neunten Jahrhundert schon entschieden, wenn auch nicht vollendet. Denn wie nach der Zeit der Wanderung die deutschen Völkerschaften sich enger in größere Stämme zusammenschlossen und daraus endlich ein deutsches Reich erwuchs, so drängte auch die Poesie in denselben Jahrhunderten nach einem großen, umfassenden Ganzen hin, das allen deutschen Stämmen Gemeingut ward. Es gibt in der Zeit der Völkerwanderung keine wunderbarere Erscheinungen als das Reich des Attila und die zweimalige Größe des mächtigen Gothenvolks unter Ermanrich und Theodorich; ihr Sturz und Untergang war eben so jäh, als ihr Aufsteigen plötzlich und überraschend. Von hier aus fließt nun der große Strom der deutschen Heldensage, der in seinen Zug schnell eine Masse altheidnischer Heroenmythen aufnahm, und manche Trümmer der historischen Sage einzelner Landschaften mit sich fortriß, und bald hier, bald dort hin seinen Lauf wendend, erst nach einem Jahrtausend versiegt war; seine letzten Tropfen mögen wir noch aus unsern Volkssagen sammeln. Seine gröste Breite aber nahm er ohne Zweifel im achten und neunten Jahrhundert ein. Damals hatte die Dichtkunst nicht mehr den nahen Zusammenhang mit dem Heldenleben, dies war selbst vorüber, das Volk in Stände schärfer geschieden, die obern neigten sich mit den Geistlichen einer fremden Bildung zu und waren nur mit halbem Sinne mehr der alten Poesie zugewandt, deren Muse nunmehr erst recht die Mnemosyne war. Zwar kam sie zu Zeiten auch in die Häuser der Vornehmen und ward ehrenvoll empfangen und gerne angehört, Kaiser Karl selbst sammelte Lieder, und sein Sohn hatte in seiner Jugend sie auswendig gelernt; aber ihre Pflege und rechte Heimat hatte die Dichtkunst nur unter dem Landvolk. Aus diesem giengen die sagenkundigen Sänger dieser Zeit, wie auch der folgenden, hervor. Nur diese können es auch gewesen sein, die damals der ganzen großen Masse des Epos denjenigen Gedanken unterlegten und einprägten, den die spätern Jahrhunderte weiter auszuführen und zu verfolgen suchten; es kann nur in dieser Zeit das Streben begonnen haben den Untergang des Heldenalters darzustellen in einer Verknüpfung der drei großen Sagenkreise Ermanrichs, Etzels und Dietrichs zu einem gewaltigen Ganzen. Zu keiner Zeit kann der Schmerz über den Untergang der ruhmvollen Vergangenheit im Volke lebendiger gewesen sein, und keine Zeit war auch fähiger ihn dem Stoff mitzutheilen und dieser ihn zu empfangen. Fast alle deutsche Helden sind tragische Charaktere, ja das ganze Epos sollte eine große tragische Handlung werden, die nach wunderbarer Schicksalsverkettung aller mit dem Tode oder dem Verschwinden der letzten und grösten Helden endete. Kein Epos sonst hat so tiefsinnige Ideen wie das deutsche ausgesprochen, keins hat eine großartigere Anlage und so gewaltige Charaktere im Guten wie im Bösen. Zum völligen Abschluß kam jedoch die Durchführung der Idee im Ganzen nie, eben so wenig als das deutsche Reich vollendet ward; wie sie aber verfolgt und auszuführen versucht ward, hat die Geschichte unsers Epos darzustellen.
Nicht alle deutsche Landschaften werden an der Blüthe des Epos damals gleichmäßig thätigen Antheil genommen haben, eben so wenig als in den spätern Epochen; denn nicht alle sind gleich fähig. Aber man kann mit Sicherheit annehmen, daß jede damals ein gleiches Theil empfieng und auch dessen sich erfreute, wie in den jüngern Zeiten. Kein Zeugnis deutet direct auf unser Land, aber in England und im Norden selbst war der Ruhm der deutschen Helden verbreitet und ward in Liedern gefeiert. Doch wird von norddeutschen Markmannen erzählt, daß sie ihre Gedichte, Zaubersprüche und Weissagungen mit Runen aufschrieben. Wilhelm Grimm6 erklärte sie für Nordalbinge und Lachmann7 nannte die niederdeutschen Verse, die dem Runenalphabet in einer sangallischen Handschrift beigeschrieben sind, nordalbingisch. Aber es ist nur alte Weiber- und Kinderpoesie, jedoch in alter stabreimender Form. Alles dies räth einen Blick zu werfen auf unsre heute gesammelten Segen und Sprüche (Nr. 652).
Offenbar sind die meisten, z.B. 20. 27. 34. 17 etc., wenn nicht alle, ihrer Grundlage nach heidnisch und vom höchsten Alterthum. Das beweist nicht nur die Verbreitung vieler über ganz Deutschland, sondern auch die Vergleichung mit nordischen und englischen Sprüchen ähnlicher Art. Ich habe alle, auch die zerrüttetsten aufgenommen, eben um diese Vergleichung möglich zu machen und Zeugnis zu geben, wie langlebig und zäh diese Sprüche im Volke haften. 11. 31. 34 sind schon fast gleichlautend aus Handschriften des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts in Grimms Mythologie mitgetheilt. Ganz alterthümliche Form hat auch 22, verglichen mit dem einen Merseburger Zauberspruch von Wodan und Balder. Ebenfalls die Räthsel sind theilweise höchst alterthümlich und weit verbreitet, z.B. die Räthsel vom Ei (Enteputente etc.); ich habe nur ausgewählt. In einer nordischen Saga8 gibt Odin dem König Heidrek unter andern dieses Räthsel auf: »Wer sind die zwei die zum Thing eilen? Zusammen haben beide drei Augen, zehn Füße und einen Schwanz und so fahren sie über Land;« Heidrek antwortet, daß das der einäugige Odin auf seinem achtfüßigen Pferde sei. Man vergleiche damit, der Form und dem Inhalt nach, die Räthsel unter Nr. 651, besonders 22. 23. Ein zweites Beispiel noch größerer Übereinstimmung ist das Räthsel von der Kuh, das Odin auch dort aufgibt: »Vier wandeln, vier hangen, zwei den Weg weisen, zwei Hunden wehren, einer schleppt nach, ein Leben lang, der ist allzeit schmutzig,« welches bei uns lautet: »Veer Hengels, veer Gängels, twee wiest den Weg, twee seht den Weg, een slępt achterna; rade mal wat meen ik da?« Auch das erste Räthselmärchen (Nr. 650, 1) findet dort sein Gegenstück. Sprichwörter, für die es leider an Raum gebrach, ruhen zum Theil auf gleich alter Grundlage. Obgleich diese Räthselpoesie nur eine Nebengattung ist, die in der Geschichte der Poesie kaum von Belang wird, so lehrt doch das heute erst gesammelte, daß es auch in Deutschland in ältester Zeit, wie im Norden, dialogisch fortlaufende Räthsellieder gab, woraus die heutigen Räthsel nur Bruchstücke sind, wenn wir nemlich Lieder wie Nr. 627 hinzuhalten. Es sind übrigens ähnliche Lieder in Deutschland schon im zwölften Jahrhundert nachweisbar; und noch weit früher bei den Angelsachsen.
Läßt dies uns einen Blick in die Form und Manier einer gewissen Seite der alten Poesie thun, so wird einem aufmerksamen Leser die wunderbar symmetrische und doch freie, ungesuchte Anlage mancher Märchen und Sagen schon nicht entgangen sein. Ich will hier nicht auf die Art der Charakteristik, die Mannigfaltigkeit, die Gruppierung und die einfachen Gegensätze der handelnden Personen aufmerksam machen, sondern nur darauf hinweisen, wie z.B. in Nr. 317 die Handlung fortschreitet: Der Bauer reist erst zu Schiffe, dann zu Wagen, endlich zu Pferde, das erste Mal muß er einen Tag, das zweite Mal zwei, das dritte Mal drei Tage warten; oder als Dreibein in Nr. 467 den diebischen Bauern verfolgen soll, ruft Ein Unterirdischer, Zweibein aber wird von vielen Stimmen, Einbein endlich von Allen gerufen. Durch so einfache Mittel erreicht auch noch die heutige schwächere Sage Wechsel und Steigerung; wie ganz anders nimmt sich eine solche Gliederung in unsern alten inhaltsreichern Heldensagen aus! Freilich sie ist oft zerstört und wird auch heute nicht leicht von jedem erkannt, auch wenn sie sich erhielt; aber immer wird sie dennoch zur rechten Wirkung dienen, je ungesuchter und natürlicher sie allezeit war.
Die Blüthe der Heldenpoesie des karlingischen Zeitalters war, als wilde Stürme am Schlusse des Jahrhunderts über Deutschland herein brachen und lange anhielten, zu Ende. Bis dahin hatte der Poesie ja die alte Form des Stabreims gedient, der noch in formelhaften Ausdrücken, wie Mann und Maus, Haus und Hof, Frisch gewagt, ist halb gewonnen etc., haftet. Aber gerade diese Neigung zum Formelhaften die der Stabreim mit sich bringt, führte im Norden zur völligen Erstarrung der Poesie. In Deutschland war dieselbe Gefahr da. Schon im neunten Jahrhundert war eine Entartung der stabreimenden Poesie eingetreten; aber der gesunde Sinn des Volkes, dem natürlichen geneigt, fand einen Ausweg; man ließ die alte Form fallen und im Verlaufe des zehnten Jahrhunderts setzte sich der Endreim auch in der Volkspoesie durch. Das beweisen die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen Reste. Indem aber diese Form aufkam und durchdrang, war der allmählige Untergang der alten stabreimenden Lieder, die noch aus den frühern Zeiten erhalten waren, die natürliche Folge. Man kann nun recht wohl verfolgen, auf welche Seite vorzüglich sich die neue Poesie hinwandte. Mit den sächsischen Kaisern erreichte Deutschland die höchste Stufe seiner nationalen Kraft; die Stände hatten sich wieder genähert, die Bildung der Geistlichen hatte einen nationalern Charakter angenommen, als in der karlingischen Universalmonarchie, auch die Politik der Kaiser wirkte nach außen hin nur in einem großartigen, deutschnationalen Sinne; die Kämpfe und Parteien im Innern, zunächst aus alter Feindschaft der Stämme entspringend, dann genährt durch die Streitigkeiten der Kirche, wiederholten fast die Zeiten des alten Reckenwesens, weckten aber zugleich eine Fülle geistiger Bewegung; alles das wäre nicht geschehen ohne den eifrigen, nachhaltigen Antheil des gesammten Volkes. Diese Bewegung der Nation dauerte bis tief ins zwölfte Jahrhundert. Die Poesie wandte sich nun zunächst mit neuer Begeisterung der Gegenwart zu. Um Heinrich, Otto den ersten und zweiten und ihre Helden und Gegner und manche andre hervorragende Ereignisse und Persönlichkeiten sammelten sich eine Menge von Liedern und Sagen. Offenbar hängt es mit dieser Richtung des Volksgesanges auf das historische zusammen, daß nun auch diese Seite des alten Epos gerade vorwiegend kultiviert ward. Und erscheint später seine mythische Seite entweder vermenschlicht oder verwildert, so wird beides auch nur seinen Grund in dieser Zeit haben. Es erwuchs dem historischen Theil des Epos jetzt vielfältige Bereicherung und Erweiterung, nicht nur aus ältern landschaftlichen Sagen, sondern auch aus der Zeitgeschichte selbst. Eine große Wendung schreibt sich daher. Ermanrich hatte in frühern Jahrhunderten, wie angelsächsische Zeugnisse beweisen, sein altes gothisches Sagenreich in Norddeutschland; nachdem die römische Kaiserkrone das Haupt niedersächsischer Könige zierte, herrschte er zu Rom und in Italien; von da aus verleiht sein Nachfolger noch Länder in Norddeutschland, und in seinem Gefolge hat er fast nur norddeutsche Helden, und unter diesen einen Meizunc von Ditmarschen und einen Enenum von Westenlande, d.i. Nordfriesland9. Ich glaube bewiesen zu haben10, daß die Sage von Siegfried und Starkad (Nr. 5) eine altsächsische ist, wenn sie auch im Norden gangbar und aufbewahrt ward. Sie mag uns offenbaren, was man etwa im zehnten Jahrhundert den Landesfeinden gegenüber empfand, als die Kaiser unsre Grenzen noch zu schützen wusten; der ruhmvollste gröste Kämpe des Nordens muß dem Helden des Südens schimpflich unterliegen. Es gibt noch andre Beispiele, wo der alten Heldensage eine solch unmittelbare Beziehung auf die spätere Geschichte gegeben wurde. Auf der Grenze dieses Zeitraums steht jener sächsische Sänger Sivard, der mit einem Liede von »dem allbekannten Verrath der Kriemhild an ihren Brüdern« den Herzog Knud Laward vor den Nachstellungen seines Vetters Magnus vergeblich zu warnen suchte. Freilich es läßt sich nicht behaupten, daß der Sänger ein Holsteiner war. Dännemark ward aber häufig von niederdeutschen Sängern besucht; darum konnte Saxo die Sage von Kriemhild als allbekannt bezeichnen. Auch in späterer Zeit nahmen deutsche Sänger häufig ihren Weg durch unser Land und aus unserm Lande selbst nach Dännemark; denn nur durch neue mündliche Zuflüsse von Deutschland erklären sich manche Eigenthümlichkeiten der Sage in dänischen Kämpevisern, die den deutschen Heldenkreis betreffen. Gegen Schluß des dreizehnten Jahrhunderts kamen mehrere deutsche Sänger, die freilich keine Epiker waren, nach Holstein zu unsern Grafen, nach Schleswig und nach Dännemark; mehrere ihrer Lob- und Preislieder sind erhalten; und daß solche hungrige Gäste noch später hier durchkamen, lehrt die Anecdote von Greve Klaus (Nr. 26).
Gegen den Schluß des zwölften Jahrhunderts hatte das Epos einen neuen Aufschwung genommen, gleichzeitig der blüthenreichen Entfaltung des Minnegesangs und der romantischen Ritterpoesie. In Süddeutschland entstanden damals die Lieder von den Nibelungen, dann auch das Gedicht von Kudrun und eine Reihe anderer Heldenlieder, die theils ganz verloren, theils nur in Bruchstücken erhalten sind. In Norddeutschland war aber gleichfalls die Dichtung nicht müssig, im dreizehnten Jahrhundert schrieben nordische Männer in niedersächsischer Gegend, in Westfalen und um Bremen nach deutschen Gedichten, Liedern und Erzählungen ein großes Sagenbuch zusammen, das fast den ganzen Reichthum des damaligen epischen Stoffs Deutschlands umfaßt. Eine genaue Betrachtung vermag noch den Umfang einzelner Lieder und Gedichte zu erkennen. Aus dieser Zeit erwähnt nun Arnold von Lübek des alten Hildebrand, den noch heute das Märchen nennt, und an seinen Namen schließen sich unmittelbar Dietrich von Bern und die große Reihe seiner Helden. Und wenn der Ortsname Hettelingen11 bei Winterthur in der Schweiz auf die Sage der Kudrun weist, so mag man auch bei unserm Hettlingen an der Elbe an dieselbe Sage erinnert werden. Aber was das Gedicht von Ditmarschen und Holsteinern erzählt, die »gar ziere Degen« heißen, so muste die Kritik das nicht einmal als in echter Sage begründet, sondern als willkürliche Einschwärzung einer jüngern Hand erkennen.
Um das Jahr 1200 fällt die letzte Blüthe des Epos. Von da an läuft es in drei Wegen aus: entweder in das lyrische Volkslied des vierzehnten, funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, oder in die Prosa des Volksbuchs, oder endlich in Märchen und Volkssage. Die Spuren und Ansätze solcher Übergänge finden sich natürlich auch schon früher. Der Inhalt des Liedes12





























