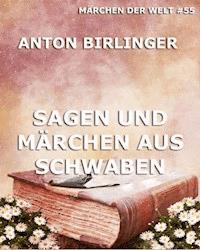
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Dieser Band bietet über 700 der schönsten und handverlesenen Sagen aus dem schwäbischen Teil Deutschlands.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sagen und Märchen aus Schwaben
Anton Birlinger
Inhalt:
Anton Birlinger – Biografie und Bibliografie
Bibliographie der Sage
Sagen und Märchen aus Schwaben
I.
1. Die drei Zauberfrauen im Heiligenthäle.
2. Die Duttfee. Duttenthal.
3. Das silberne Messerchen.
4. Weißes Fräulein in der Baumburg.
5. Das Burrenweible.
6a. Sage von der Laura im Laurathal.
6b. Laurasitz.
6c. Laura's Erlösung.
7. Die drei Fräulein in Reutlingen.
8. Der Breit- oder Langhut.
9. Der Lapphut auf dem Conzenberg.
10. Der Schlapphut im Urselenthäle.
11. Die Sage von dem Hosenflecker.
12. Der wilde Jäger.
13. Der wilde Jäger bei Vollmaringen.
14. Der Grünmantel.
15. Der Jäger auf der Wallenburg.
16. Der Kaplaneimann.
17. Der Fuchseck-Schäfer.
18. Der Brandjockele.
19. Der Jäger von Hofen.
20. Der Grubenholzmann.
21. Der Hollojäger auf dem Lemberg.
22. Der Hurexdex.
23. Der Wuchter.
24. Nächtlicher Reiter mit dem Wetterhut.
25. Der Reiter ohne Kopf und Gräfin Adelinde.
26. Der Schimmelreiter an der Egau.
27. Der Leonberger Schimmelreiter.
28. Der Schimmelreiter in Mergentheim.
29. Der Hardtreiter.
30. Gespenstische Reiter.
31. Der Reiter auf dem Bussen.
32. Der Burgstallreiter bei Herlikofen.
33. Der Ritter auf dem Wildenstein.
34. Der Reiter auf dem Graneckle.
35. Der Reiter am Tübinger Thor.
36. Wildes Heer im Kolmanswald.
37. Ritter Wilhelm der Wilde und das Muotisheer.
38. Das wilde Heer in Keuerstadt.
39. Nächtliches Kriegsvolk auf dem Klingenstein.
40. Muodersheer bei Huldstetten.
41. Muətisheer bei Albers.
42. Wildes Heer bei Kirchheim.
43. Das Muotisheer bei Poltringen.
44. Wildes Heer bei Mergentheim und im Bühlerthal.
45. Wildes Heer auf dem Göttelfinger Sträßle.
46. Die Muotisheer.
47. Vom wilden Heer.
48. Das Kistenmännlein oder Kellermännlein.
49. Zwerg bringt Geld.
50a. Die guten Erdleute in der Mühle.
50b. Die guten Erdluitle beim Schuhmacher.
51. Erdmännlein prophezeit.
52. Der Zwerg im Graneckle.
53. Die Erdweiblein im Bockstein.
54. Die Weiberfalle.
55. Das Grindenmändle.
56. Erdmännleins Höhlen.
57. Die Erdmändle beim Weggenthal.
58. Graumännlein auf Zeil.
59. Rotmäntele auf dem Spitzberg.
60. Dem Nidel ein Platz.
61. Der Poppele von Hohenkrähen.
62. Guter Hauskobold in Poppenweiler.
63. Kobold in Offingen.
64. Der Boppôle in Roth.
65. Einfüßle im Nonnenhaus.
66. Der gute Kapuziner.
67. Mönch als Hausgeist.
68. Weiße Frau als Hausgeist in Roth.
69. Klopfer.
70. Das Hoienmännlein.
71. Das Häftenmännlein.
72. Der Schlurkerle.
73. Der Klaubauf.
74. Die Ofenmännlein.
75. Der Tellerlistrapper in Wurmlingen.
76. Das Scherrəmändle, Kinderschrecken.
77. Das Kautenweibchen.
78. Das Kratenweible.
79. Spitzberger Weiblein.
80. Das Burrenweible.
81. Das Baurəweible.
82. Waldweiblein als Schlüsselweiblein.
83. Mauerholzweible.
84. Das Gilzenweiblein.
85. Das G'stäudemer Weible.
86. Hardtweible.
87. Das Schleierweiblein.
88. Das Falkenhofer Weible.
89. Das Buchələweible.
90. Ebacher Weiblein. (Ẽbach.)
91. Wäschweiblein in Röhlingen.
92. Das Heckenmännlein.
94. Kinderschrecken.
95. Das Fräle vom Spessartwald.
96. Die nächtlichen Arbeiter im Wurmlinger Wald.
97. Das Jungfernloch.
98. Ein Edelfräulein verwünscht.
99. Verwünschtes Fräulein.
100. Weißes Fräulein in Marbach.
101. Schlüsselfräulein auf dem Scheuerberg.
102. Die Jungfrau auf der Bernburg.
103. Das weiße Fräulein.
104. Das Schloßweible.
105. Drei Fräulein und der Schatz im Berg.
106. Schatz und Schlüsselfräulein im Flochberg.
107. Burgfräulein im Blutsberg.
108. Die Jungfrau im Hohlenloch.
109. Blume als Schlüssel.
110. Der Schatz im Räumlisberg.
111. Schatz im Pelzbuckel.
112. Der Schatz im Steinbühl.
113. Der Schatz in der Burghalde.
114. Der Schatz im Graneckle.
115. Der Schatz im Varrenwald.
116. Der Schatz auf dem Hohenkarpfen.
117. Der Schatz im Bussen.
118. Schatz im Höllenloch.
119. Der merkwürdige und weltberühmte Geist Baldian.
120. Der Schatz im Heilbronner.
121. Der Schatz im Schloßberg.
122. Der Schatz im Schlosse Niedernau.
123. Der Schatz in Handschuchsheim.
124. Der Schatz auf Alt-Kißlegg.
125. Schatzkessel.
126. Schatz im alten Schloß in Erbstetten.
127. Schatz auf Marstetten.
128. Schatz im Blutsberg.
129. Käser verschafft Geld.
130. Ein Schatz als Käferhaufen.
131. Drei Krauthäfen als Schatz.
132. Zwei Kohlenhäfen ein Schatz.
133. Spähne zu Gold geworden.
134. Erbsen zu Gold geworden.
135. Eierschalen zu Gold geworden.
136. Glucker zu Gold geworden.
137. Kirschensteine zu Gold geworden.
138. Laub zu Gold geworden.
139. Das Bürgle bei Beuren.
140. Goldener Becher sonnet sich.
141.
142. Schätze liegen verborgen.
143. Goldene Kegel auf dem Graneckle.
144. Vergrab kein Geld.
145. Schlangen.
146. Schlange auf dem Spitzberg.
147. Der Schlangenkönig.
148. Die Otternlinde bei Wurzach.
149. Der Wurm in der Tanhalde.
150. Der Lindwurm bei Stuttgart.
151. Der Drache im Keller.
152. Das Krokenthal.
153. Der Ochs am Bodensee.
154. Hinkender Hase.
155. Das Mohrentobler Rößlein.
156. Die drei Schimmel.
157. Weißes Rößlein Kinderschrecken.
158. Gespenstisches Pferd.
159. Pferd ohne Kopf.
160. Der Mühlebergfuchs.
161. Gespenstisches Pferd in Hundersingen.
162. Gaißlingenthier.
163. Wildschwein geht um.
164. Umgehendes Schwein.
165. Scheckiges Schwein geht um.
166. »Säulen« gehen um.
167. Weißes Säulein geht um.
168. Ochsgeist eingemauert.
169. Das Kalb in Oßweil.
170. Geisterhaftes Kalb.
171. Der Birkengockeler.
172. Der Wolfshund.
173. Die Frösche im Rechenberger See.
174. Von den Hunden und Katzen.
175. Vom Storchen.
176. Die Spinne.
177. Von Ratten und Mäusen.
178. Vom Pferd und Rindvieh.
179. Vom Schwein.
180. Vom Basilisk.
181. Von Raben und Elstern.
182. Vom Kukuk.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191. Die Bienen.
192.
II.
193. Der Geist Hudelmann.
194. Die Bachgeister im Röthenbach.
195. Weiblicher Wassergeist.
196. Wassergeist bei Zwiefalten.
197. Der Alt ist gestorben.
198. Wassergeist als Frosch.
199. Fischgeist in der Donau.
200. Hakenmann.
201. Der Blautopf.
202. Donau will ihr Opfer haben.
203. Meerfräulein prophezeihen.
204. Athem der Wassergeister.
205. Kind des Wassergeistes.
206. Der feurige Fischer.
207. Wasserweible und die Bären.
208. Waschende Klosterfrau.
209. Der Bröller.
210. Das Millbrönnle.
211. Das Wollenloch.
212. Die drei Fische.
213. Die verschwundene Quelle.
214. Teufelstisch im Bodensee.
215. Meersburg versinkt einstens.
216. Die Hundsknöpf sind giftig.
217.
218.
219. Kinderbrunnen.
220. Hungerbrunnen.
221.
222. Der Hagen und die Glocke in St. Georgen-Klosters Weiher versunken.
223. Der Glockengumpen.
224. Glocke in die Murr gebannt.
225a. Die Glocke in Bergfelden.
225b. Die Uttenweiler Glocke.
225c. Die Ellwanger Glocke.
226. Wetterglocke.
227. Die große Glocke in Weingarten.
228. Wetterglocken.
229. Die Breuningsglocke in der Tübinger Stiftskirche.
230. Die große Gulden-Glock.
231. Die Glocke auf dem Wurmlinger Berg.
232. Die Glocken auf dem Michelsberge.
233. Das Silberglöcklein in Stuttgart.
234.
235. Glocke zersprungen.
236. Das Wahrzeichen in Schönthal.
237. Ueberlinger Wahrzeichen.
238. Das steinerne Weib.
239. Der Teufel und der Maurersbub.
240. Die Baumeisterin in Gmünd.
241. Der steinerne Laib Brod.
242. Horn an der Alpirsbacher Klosterkirche.
243. Die Jungferneiche bei Hüttlingen.
244. Die beiden Tannen als Wahrzeichen.
245. Kette um die Kirche.
246. Roßeisen an der Kirchthüre.
247. Der böse Ritter Baldegger.
248. Der Näberle auf St. Salvator.
249. Der unbekannte Maler.
250. St. Wendelskreuzlein.
251. Die Lanze in der Kirche zu Glatt.
252. Wahrzeichen an der Kirchenwand.
253. Wahrzeichen auf dem Kirchhofe zu Glatt.
254. Pestkreuz bei Röttingen.
255. Nonnen in Fässern.
256. Der Bettelmann.
257a. Der Schwedenkopf.
257b. Der Schwedensarg.
258. Die Schwedenkugel am Rathaus in Tuttlingen.
259. Die Schwedenkugel in Ellwangen.
260. Der Schwedenkönig in Ulm.
261. Das Malefizkreuz auf dem Käppelisberg.
262. Wahrzeichen bei Stimpfach.
263. Wahrzeichen auf dem Leprosenberg.
264. Der Bühl bei Baisingen.
265. Finger in's Holz gebrannt.
266. Steine und Feldkreuze als Wahrzeichen.
267. Steinerne Kreuze als Büßerkreuze.
268. Stadt Wurzach.
269. Entstehung von Sipplingen.
270. Ursprung von Nellenburg.
271. Woher der Name Flochberg kommt.
272. Der Edelknab.
273. Woher Erolzheim seinen Namen hat.
274. Wie Spaichingen so genannt worden ist.
275. Woher der Name »Jaxt« kommt.
276. Schwenningen.
277. Woher Bulach so geheißen.
278. Woher Urach so geheißen.
279. Wie Leutkirch entstand.
280. Wie Kißlegg entstand.
III.
281. Zeichen vor dem Ende der Welt.
282. Weltende. Antichrist.
283. Der Weltfisch.
290. Irdische Paradies.
291. Kapuziner entrückt.
292. Der Holderbusch im Burgenlai.
293. Die Laustanne bei Leutkirch.
294. Die Linde bei Fellbach.
295. Flecken im Mond.
296. Nachtweible bringt leere Spindeln.
297. Vom Monde.
298. Von der Sonne.
299. Von den Sternen.
300. Des Windes Kinder.
301. Des Windes Hund.
302. Der Bauer als Wettermacher.
303. Das Wetterkreuz.
304.
305.
306. Wind.
307. Blitz.
308. Vom Donner.
309. Vom Regen.
310. Regenbogenschüsselein.
311. Vom Schnee.
312. Vom Thau.
313. Vom Feuer.
314. Besegnungen.
315. Ein Segen wider die Schweine.
316. Fiebersegen.
317. Segen gegen die Schweinung.
318.
319.
320.
321. Den Brand zu löschen.
322. Vom ewigen Juden.
323. Der ewig Jud in Hohenstatt.
324. Wie Doktor Faust wieder lebendig worden ist.
325. Des Doktor Phrastes Ende.
326. Churfürst Moriz von Sachsen in Marchtall.
327. Luther in Lauchheim.
328. Ein Prädikant in Marchtall.
329. Der Prädikant in Leinstetten.
330. Wie Hohenstatt lutherisch werden soll.
331. Wie die Tuttlinger lutherisch worden sind.
332. Bühl wird wieder katholisch.
333. Der Schwedentrunk.
334. Der Burgherr von Hohendießen.
335. Das Villinger Thalfräule.
336. Der Tyrann von Winzingen.
337. Die Sage vom wilden Ritter.
338. Die Freifrau von Lupfen auf Stühlingen.
339. Wie ein Conzenberger schwur.
340. Zur Welfensage.
341. Zwölf Knaben sollen ertränkt werden.
342. Kaiser Maximilian in Ulm.
343. Kaiser Friedrich III. in Tuttlingen.
344. Der Graf von Marstetten.
345. Der Graf von Hochberg.
346. Sagen von starken Rittern.
347. Das Rechbergische Wappen.
348. Der Pokal der Familie von Neuneck.
349. Die Limburg im Gaißthäle.
350. Reiter versunken.
351. Wie die Wallenburg zu Grunde ging.
352. Wurzach versunken.
353. Stadt im Federsee.
354. Stadt versunken.
355. Verschwundene Stadt.
356. Versunkene Burg.
357. Versunkenes Schloß.
358. Schloß versunken.
359. Templerburg versunken.
360. Schloß bei Aichstetten untergegangen.
361. Wirtshaus versunken.
362. Das versunkene Wirtshaus.
363. Heuwagen versunken.
364. Wie Schiltach verbronnen.
365. Lederne Brücken.
366. Singen unter der Erde bedeutet Krieg.
367. Im Felsen klingt's.
368. Die Prästeneck.
369. Die Kriegswiese.
370. Die Schreikapelle.
371. Sage vom schwarzen Tod.
372. Vogel bringt Bibernellen.
373.
374. Hungersnot.
375. Hirschgeweih blutet.
376. Blutquellen in Güglingen.
377. Die Uhr auf Beil.
378. Die Zehnglocke in Rottweil.
379. Die alte Jungfer.
380. Der Räuber und die Jungfrau.
381. Die feurigen Riesenmänner.
382. Kegelspiel.
383. Geisterhaftes Kegelspiel.
384. Verwünschungen.
385. Fluch einer Wöchnerin.
386. Fluch des »schwarzen Fehrle«.
387. Sonderbares Testament.
388. Testament nicht erfüllt.
389. Der Hungerberg.
390. Eiserne Kette abbeißen.
391. Langnase.
392. Kinderschrecken.
393. Die lange Jupp.
394. Bercht.
395.
396. Silberner Kreuzpartikel in Horb.
397. Die Heidenküche.
398. Der große Heide.
399. Der närrische Weber.
400. Die große Schlange im Brunnen.
401. Der große Hecht.
402. Der Hechtskopf.
403. Mädchen bettelt um Geld.
404. Die weiße Zipfelkappe.
405. Die feindlichen Brüder.
406. Die entrückte Braut.
407. Die zwei Flämmlein auf Gissenburg.
408. Unterirdische Gänge.
IV.
409. Die Hölle und der Teufel.
410. Der Teufel als Geldmäkler.
411. Des Teufels Buch.
412. Der Teufel im Täfer.
413. Der Teufel als Esel.
414. Der betrogene Teufel.
415. Teufel in der Kanne.
416. Teufels Garten.
417. Teufel bringt Spulen.
418. Mädchen dient in der Hölle.
419. Die zwei Teufel.
420. Teufel als Jäger.
421. Die Sage von Todris.
422. Teufelshand im Stein.
423. Der Teufel holt ein Kind.
424. Das Kuhloch.
425. Sage über die Wirthin von Hochdorf.
426. Bund mit dem Teufel.
427. Braut dem Teufel verschrieben.
428. Der Dreizehnte am Nikolausabend.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439. Das Sterben.
440. Das Begräbniß, »die Leicht«.
441. Von den armen Seelen.
442.
443.
444.
445. Die Strietemer Urschel.
446. Die Lichtlein im Ried.
447. Zwei feurige Ritter.
448. Blau Flämmchen.
449. Der Hörnlisgeist.
450. Feuriger Geist ruft in der Nacht.
451. Burggeist.
452. Schindersknechte gehen um.
453. Geist mit Eiszapfen im Haar.
454. Geist beim Schaubenkäppele.
455. Geist nieset, wird nicht erlöst.
456. Geist nieset.
457. Großer weißer Mann als Hausgeist.
458. Handwerksbursche von Geistern begraben.
459. Der Hegäuer.
460. Waldgeister.
461. Die zwei langbärtigen Berggeister.
462. Der Meßklingenschlapp.
463. Geist in die Krause gebannt.
464. Der fahrende Holzwart.
465. Geist ruft aus dem Fläschchen.
466. Der Poltergeist.
467. Ein Kirchenbetrüger geht um.
468. Der Spuk auf der Kirchlesmad.
469. Das Bild auf der Tafel.
470. Der nächtliche Schreiner auf Neuhaus.
471. Feurige Hand in der Mulde.
472. Eine Orgel in der Kirche zu Dinkelsbühl.
473. Das Pfannenkuchenhäuslein.
474. Der nächtliche Flammenzug.
475. Nächtlich erleuchtete Kirche.
476. Erleuchtete Kapelle.
477. Todter schaut zum Dachladen heraus.
478.
479.
480. Der Schmiedgesell und das Schrättele.
481. Fluchen vertreibt das Schrättele.
482. Weiße Maus die Seele.
483. Schrättele holt Kraut.
484. Schrättele ist haarig und zottig.
485. Schattamättele.
486. Schrättele hat plumpe Füße.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493. Von den Hexen.
494. Das Heuberger Hexlein.
495. Hexenritt.
496. Hausknecht beim Hexensabbat.
497. Der Geiger beim Hexentanz.
498.
499.
500.
501. Hexe stiehlt Kinder.
502. Hexen sitzen auf's Mühlrad.
503. Hexe durchstochen.
504. Hexenmeister macht Mäuse.
505. Hexe macht weiße Mäuse.
506. Hexenmeister heilt Beinbrüche.
507. Hexe milkt an der Handzwehl.
508. Hexenmeister siebt Geld.
509. Bote muß die Hexe tragen.
510. Hexenmeister läuft auf dem Dach.
511. Hexe von Heudorf.
512. Hexe beschlagen.
513. Hexe als Gans.
514. Die Hexe zu Obermarchtall.
515. Der Hexenmeister in Wurmlingen.
516.
517. Namen von Hexen.
518.
519. Schutz gegen Hexen.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541. Das »Walt Gott« der Hexen.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553. Handwerksbursch macht Gewitter.
554. Der Krieger Bâthle bannt die Schweden.
555. Der Keuerstadter Bauer.
556. Hannikels Hinrichtung.
557. Kröte legt Eier.
558. Wie Zwei Fahrsamen holen wollten.
559. Wie Einer einen Bindnagel schnitt.
560. Der Pfarrer bannt das Wetter.
561. Die Gänse haben ihre eigene Sprache.
562. Eisenspiegel.
563. Zauberer blindet.
564. Räuber und Diebe bannen.
565. Diebsspiegel.
566. Bergspiegel.
567. Zauberei bei der Lotterie.
568.
569.
570. Zahnwerfen.
571.
572.
573.
574.
575.
576. Festmachen.
577.
V.
578. Der Fischersohn, Märchen.
579. Der Palmen.
580. Graf Stadion und das Uebelmännlein.
581. Hans Bär.
582. Der Däumling.
583. Das starke Schneiderlein.
584. Märchen von Jesus und dem Pharisäer.
585. Christus und Petrus.
586. Petrus und das Bäuerlein.
587. St. Petrus und der Schmied.
588. Vom Riesen und dem Storken.
589. Die goldene Gans.
590. Der Teufel und der Schmied von Schnitabach.
591. Märchen vom Schmied und vom Teufel.
592. Der Räuber und die zwölf Müllerstöchter.
593. Der Jäger und die Müllerstöchter.
594. Das Räuber- und Mörderschloß.
595. Die Hirschauer Kapelle, Legende.
596. Legende von Mariä Flochberg.
597. Mutter Gottes segnet.
598. Mutter Gottes auf der Mauer.
599. Wunderthätiges Bild Mariä.
600. Maria winkt.
601. Marienbild weint.
602. Das Muttergottesbild auf der Mühlbruck.
603. Die Kapelle zur Tann.
604. Von der Mutter Gottes.
605. Gott Vater und Moses.
606. Gottesauge.
607.
608. Erdbeeren sättigen nicht.
609. Die Zigeuner dürfen stehlen.
610. Aussätzige Nachkommen.
611. Von den Juden.
612. Heilige Hostien im Sumpf.
613. Heilige Hostie unversehrt.
614a. Fronleichnam verweset nicht.
614b. Die heilige Hostie in Lauda.
615. Gründung von St. Moriz zu Rottenburg-Ehingen.
616. Gründung von Maria Kirchheim.
617. Sage vom Kloster Allerheiligen.
618. Das wunderbare Kreuz in Maria Kirchheim.
619. Kloster Ochsenhausen.
620. Kreuzlein vom Wildschwein ausgegraben.
621. Legende vom hl. Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen.
622. Entstehung des Klosters Beuron.
623. Wie Ellwangen entstanden.
624. Graf Ego von Landau gründet das Gotteshaus Heiligkreuzthal.
625. Das Weggenthal.
626. Der Bau der Steinkapelle zu St. Wendel.
627. Gründung des Klosters Inzighofen.
628. Die Kirchen in Hundersingen und Auernheim.
629. Die Zwiefalter Kirche.
630a. Der Allenberg.
630b. Die Kapelle unter dem Palmbühl.
631. Die fromme Edelfrau von Täbingen.
632. St. Loy der Schmied.
633. St. Tiberii Haupt.
634. Sagen von St. Ulrich.
5. St. Ulrichsbrunnen in Seibranz.
635. St. Ratperonius.
636. St. Luitpert.
637a. Der Bethenbrunnen.
637b. Der Bethenstein in Reute.
638. St. Gangolfsbrunnen.
639. St. Pelagiussteg.
640. St. Ottilienkapelle.
641. Ottilienloch.
642. Gnadenbild in Blaubeuren.
643. Die Kapelle zu Zöbingen.
644. Der Eremit auf Gschnaid.
645. Das wiederkehrende Heiligenbild.
646. Die beiden Gräber.
647. Prior Heinrich von Zwifaltach.
648. Das Heiligkreuz bei Geisingen.
649. Vom Uhrsprung, Anfang, Aufbau und Weyhung der heiligen Kreuz-Kappelen etc. bei Altshausen.
650. Das wunderbare Kruzifix in der Kreuzkapelle.
651. Das durchschossene Kruzifix.
652. Frevler bestraft.
653. Maria Schreikapelle.
654. Christusbild in der weißen Sammlung.
655. Schwed frevelt.
656. Der Schwedenthurm des Schlosses zu Ellwangen.
657. Muttergottesspötter bestraft.
658. Metzger frevelt.
659. Hirtenbub frevelt.
660. Holzbuben freveln.
661. Sage vom Rotweiler Honigdieb.
662. Der unversehrte Handschuh.
VI.
664. Die Obernauer.
665. Der Kukuk von Haiterbach.
666. Das Wurzacher Stadtwappen.
667. Die Karpfengasse in Biberach.
668. Die Eichelauer sind Bärenstecher.
669. Das Hasenei.
670. Wie die Emeringer gut Wetter kaufen wollen.
671. Mondfanger.
672. Die Riedlinger sind Sonnenspritzer.
673. Die Heudorfer sind Mondfanger.
674. Die Pfullinger sind die Fülles-Triller.
675. Die Oelkofer.
676. Die Daugendorfer.
677. Wie die Buchhorner die Kirche schieben.
678. Der Esel auf Asperg.
679. Die Unterdigisheimer heißen »Deichelmäuse«.
680. Die Unterjesinger.
681. Die Schwalldorfer.
682a. Die Hirschauer.
682b.
683. Die Moosheimer Eselshenker.
684. Die Beutelsbacher Hummelsbacher.
685. Die Rommelsbacher.
686. Die Rengershauser.
687. Der Gemeindebahnschlitten in Albers.
688. Hans Lapp und die Wittershauser.
689. Orts-Neckereien in Reimen.
690. Necknamen von Ortschaften.
692. Die drei Schweizer auf der Jagd.
693.
694.
Anton Birlinger – Biografie und Bibliografie
Germanist, geb. 14. Jan. 1834 in Wurmlingen, gest. 15. Juni 1891 in Bonn, war ursprünglich katholischer Theologe, habilitierte sich 1869 in Bonn und wurde 1872 zum außerordentlichen Professor der deutschen Sprache und Literatur ernannt B. hat sich besonders als Erforscher der Mundarten und der Volkskunde Schwabens verdient gemacht. Er veröffentlichte unter anderem: »Volkstümliches aus Schwaben« (Freiburg 1862, 2 Bde.); »Schwäbisch-Augsburgisches Wörterbuch« (Münch. 1864); »Die alemannische Sprache rechts des Rheins seit dem 13. Jahrhundert« (Berl. 1868, Bd. 1); »Aus Schwaben. Sagen, Legenden, Aberglauben, Sitten etc.« (Wiesbad. 1873–74, 2 Bde.); »Rechtsrheinisches Alamannien« (Stuttg. 1890); ferner mit Crecelius eine kritische Ausgabe von »Des Knaben Wunderhorn« (Wiesbad. 1874). Seit 1871 gab B. die »Alemannia, Zeitschrift für Sprache. Literatur u. Volkskunde des Elsasses« (Bonn, seit 1892 fortgeführt von Pfaff) heraus.
Sagen und Märchen aus Schwaben, A. Birlinger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849602895
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Bibliographie der Sage
Eine Sage istim allgemeinen alles, was gesagt und von Mund zu Mund weiter erzählt wird, also soviel wie Gerücht; im engeren Sinn eine im Volke mündlich fortgepflanzte Erzählung von irgendeiner Begebenheit. Knüpft sich die S. an geschichtliche Personen und Handlungen, indem sie die im Volke fortlebenden Erinnerungen an geschichtliche Zustände, Persönlichkeiten, dunkel gewordene Taten zu vollständigen Erzählungen ausbildet, so entsteht die geschichtliche S. und, sofern sie sich auf die alten Helden des Volkes erstreckt, die Heldensage; sind aber die Götter mit ihren Zuständen, Handlungen und Erlebnissen Gegenstand der S., so entsteht die Göttersage oder der Mythus (s. Mythologie) und auf dem Gebiet monotheistischer dogmatischer Religion die Legende (s. d.). Hastet die Erzählung an bestimmten Örtlichkeiten, so spricht man von örtlichen Sagen. Noch eine Sagengattung bildet endlich die Tiersage, die von dem Leben und Treiben der Tiere, und zwar fast ausschließlich der ungezähmten, berichtet, die man sich mit Sprache und Denkkraft ausgerüstet vorstellt. Ost hat sich um eine besonders bevorzugte Persönlichkeit, wie z. B. König Artus, Dietrich von Bern, Attila, Karl d. Gr. etc., und deren Umgebung eine ganze Menge von Sagen gelagert, die nach Ursprung und Inhalt sehr verschieden sein können, aber doch unter sich in Zusammenhang stehen, und es bilden sich dadurch Sagenkreise, wie deren im Mittelalter in germanischen wie romanischen Ländern mehrere bestanden und zahlreiche Epen hervorgerufen haben (vgl. Heldensage). Die echte S. erscheint somit als aus dem Drang des dichterischen Volksgeistes entsprungen. Wie alle Volkspoesie blüht sie am prächtigsten in der ältern Zeit, aber auch bei höherer Kultur verstummt sie nicht ganz; vielmehr ist der Volksgeist noch heute tätig, bedeutende Vorgänge und Persönlichkeiten mit dem Schmuck der S. zu umkleiden. Die Anknüpfung an ein gewisses Wirkliches ist hauptsächlich das Merkmal, das die S. vom Märchen (s. d.) unterscheidet. Wie das Märchen, liebt sie das Wunderbare und Übernatürliche, obwohl es ihr nicht unentbehrlich ist. Am häufigsten heftet sie sich an Burg- und Klosterruinen, an Quellen, Seen, an Klüfte, an Kreuzwege etc., und zwar findet sich ein und dieselbe S. nicht selten an mehreren Orten wieder. Um die Erhaltung der deutschen S. haben sich zuerst die Brüder Grimm verdient gemacht durch ihre reiche Sammlung: »Deutsche Sagen« (Berl. 1816–18, 2 Bde.; 3. Aufl. 1891). Nächst diesen sind die Sammlungen von A. Kuhn und Schwartz (»Norddeutsche Sagen«, Leipz. 1848), J. W. Wolf (»Deutsche Märchen und Sagen«, das. 1845), Panzer (»Bayrische Sagen«, Münch. 1848, 2 Bde.), Grässe (»Sagenbuch des preußischen Staats«, Glogau 1871) und Klee (Gütersloh 1885) als besonders reichhaltige Quellen zu nennen. Als Sammler von Sagen einzelner Länder, Gegenden und Örtlichkeiten waren außerdem zahlreiche Forscher tätig, so für Mecklenburg: Studemund (1851), Niederhöffer (1857) und Bartsch (1879); für Pommern und Rügen: U. Jahn (2. Aufl. 1890), Haas (Rügen 1899, Usedom u. Wollin 1903); für Schleswig-Holst ein: Müllenhoff (1845); für Niedersachsen: Harrys (1840), Schambach und Müller (1855); für Hamburg: Beneke (1854); für Lübeck: Deecke (1852); für Oldenburg: Strackerjan (1868); für den Harz: Pröhle (2. Aufl. 1886); für Mansfeld: Giebel hausen (1850); für Westfalen: Kuhn (1859) und Krüger (1845), Weddigen und Hartmann (1884); für die Altmark: Temme (1839); für Brandenburg: Kuhn (1843) und W. Schwartz (4. Aufl. 1903); für Sachsen: Grässe (1874) und A. Meiche (1903); für das Vogtland: Köhler (1867) und Eifel (1871); für das Erzgebirge: J. A. Köhler (1886); für die Lausitz: Haupt (1862) und Gander (1894); für Thüringen: Bechstein (1835, 1898), Börner (Orlagau, 1838), Sommer (1846), Wucke (Werragegend, 1864), Witzschel (1866), Richter (1877); für Schlesien. Kern (1867), Philo vom Walde (1333); für Ostpreußen etc.: Tettau (183f) und Reusch (Samland, 1863); für Posen: Knoop (1894); für den Rhein: Simrock (9. Aufl. 1883), Geib (3. Aufl. 1858), Kiefer (4. Aufl. 1876), Kurs (1881), Schell (Bergische S., 1897), Hessel (1904); für Luxemburg: Steffen (1853) und Warker (1894); für die Eifel: P. Stolz (1888); für Franken etc.: Bechstein (1842), Janssen (1852), Heerlein (Spessart, 2. Aufl. 1885), Enslin (Frankfurt 1856), Kaufmann (Mainz 1853); für Hessen: Kant (1846), Wolf (1853), Lynker (1854), Bindewald (1873), Hessler (1889); für Bayern: Maßmann (1831), Schöppner (1851–1853), v. Leoprechting (Lechrain, 1855), Schönwerth (Oberpfalz, 1858), Sepp (1876), Haushofer (1890); für Schwaben: Meier (1852) und Birlinger (1861–1862), Reiser (Algäu, 1895); für Baden: Baader (1851), Schönhut (1861–65), Waibel und Flamm (1899); für das Elsaß: August St ob er (1852, 1895), Lawert (1861), Hertz (1872); für die Niederlande: Wolf (1843), Welters (1875–76); für Rumänien: Schuller (1857); für die Schweiz: Rochholz (1856), Lütolf (1862), Herzog (1871, 1882); für Tirol. [417] Meyer (2. Aufl. 1884), Zingerle (1859), Schneller (1867), Gleirscher (1878), Heyl (1897); für Vorarlberg: Vonbun (1847 u. 1890); für Österreich: Bechstein (1846), Gebhart (1862), Dreisauff (1879), Leed (Niederösterreich, 1892); für Mähren: Schüller (1888); für Kärnten: Rappold (1887); für Steiermark: Krainz (1880), Schlossar (1881); für Böhmen: Grohmann (1863), Gradl (Egerland, 1893); für die Alpen: Vernaleken (1858), Alpenburg (1861) und Zillner (Untersberg, 1861); für Siebenbürgen: Müller (2. Aufl. 1885), Haltrich (1885). Die Sagen Islands sammelten Maurer (1860) und Poestion (1884), der Norweger: Asbjörnson (deutsch 1881), der Südslawen: Krauß (1884), der Litauer: Langkusch (1879) und Veckenstedt (1883), der Esten: Jannsen (1888), der Lappländer: Poestion (1885), der Russen: Goldschmidt (1882), der Armenier: Chalatianz (1887), die der Indianer Amerikas: Amara George (1856), Knortz (1871), Boas (1895); indische Sagen Beyer (1871), japanische Brauns (1884), altfranzösische A. v. Keller (2. Aufl. 1876); deutsche Pflanzensagen Perger (1864), die deutschen Kaisersagen Falkenstein (1847), Nebelsagen Laistner (1879) etc. Die Sagen bilden mit den im Volk umlaufenden Märchen, Legenden, Sprichwörtern etc. den Inhalt der Volkskunde (s. d.), die seit neuerer Zeit Gegenstand reger wissenschaftlicher Forschung ist. Vgl. L. Bechstein, Mythe, S., Märe und Fabel im Leben und Bewußtsein des deutschen Volkes (Leipz. 1854, 3 Tle.); J. Braun, Die Naturgeschichte der S. (Münch. 1864–65, 2 Bde.); Uhland, Schriften zur Geschichte und S., Bd. 1 u. 7 (Stuttg. 1865–68); Henne am Rhyn, Die deutsche Volkssage im Verhältnis zu den Mythen aller Völker (2. Aufl., Wien 1879); v. Bayder, Die deutsche Philologie im Grundriß (Paderb. 1883); Paul, Grundriß der germanischen Philologie, Bd. 2, 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901) und die Bibliographie in der »Zeitschrift des Vereins für Volkskunde«; Grünbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde (Berl. 1901).
Multum adhuc restat, multumque restabit etc.
Plinius.
Ludwig Uhland und Ernst Ludwig Rochholz zugeeignet.
Das sang- und sagenreiche Schwabenland ist für den Kulturhistoriker, den Sprach- und Mythenforscher eine nicht minder ergiebige Fundgrube, als das Erbetheil anderer deutscher Stämme. Zwar ist auch in Schwaben schon Vieles zu Tage gefördert worden, was im tiefen Schacht abgeschlossenen Volkslebens verborgen lag; aber wir hatten schon längst die Ueberzeugung gewonnen, daß noch viel des edelsten Erzes heraufzuholen sei. Der Beruf, dem wir – der eine als Seelsorger, der andere als Arzt – leben, die innige Beziehung, in der wir durch unsere Geburt zum Volke stehen, das langjährige Studium einschlägiger Disciplinen gaben uns Mittel und Wege an die Hand, Vieles der unvermeidlichen Vergessenheit zu entreißen, was mit Rieseneile unwiederbringlich verloren gehen will. Vor dem Taglicht der modernen Bildung sinkt das Uralte in den geheimnißvollen Schooß der Erde. Der Telegraph und die Tarnkappe vertragen sich nicht mit einander. Das Bewußtsein, der Wissenschaft vielleicht einen Dienst leisten zu können, hat uns den Mut gegeben, mit dieser Sammlung an die Oeffentlichkeit zu treten. Ueberdies glauben wir es unserem Volksstamme schuldig zu sein, dem Kulturhistoriker und dem Sprach- und Mythenforscher Denkmäler aus dessen Leben zur Würdigung zu übergeben, verhehlen es uns aber freilich auch nicht, daß wir eben damit die Verpflichtung übernommen haben, Alles, was wir aus dem Volksmunde gehört, splitternackt so wiederzugeben, wie wir es gehört, damit der Inhalt unseres Buches der unverfälschte Ausdruck seiner Tradition sei, so weit wie ihrer habhaft werden konnten. Wir haben nirgendwo weder etwas hinzugethan, noch davon genommen, und uns eben deßhalb jeglicher Deutung enthalten. Wir hoffen, daß man uns aus diesem Grunde die Unterlassung einer streng systematischen Eintheilung des Stoffes vergeben werde, weil wir den Fehler zu vermeiden glaubten, den wir an Andern so gerne tadeln, daß sie nämlich in der vieldeutigsten Sage oder Märe sofort eine bestimmte Göttergestalt zu erkennen glauben und nun durch kühne Erklärungsversuche weit ab vom Ziele schießen. Wir möchten schon in der Erklärung der Mythen die Altmeister, welche die modernen Deutereien nicht selten anekeln müssen, nicht ärgern: wir meinen J. Grimm und Ludwig Uhland, welch' lezterer Name ja an der Spitze unseres Buches steht. Was den ersten Band des Volksthümlichen, die Sagen, betrifft, ist er abgeschlossen; vielleicht ist uns später die Fortsetzung von Sagen möglich; wir sammeln immer wieder neue.
Und so übergeben wir denn unser Buch den prüfenden Sonden der Kritiker in dem festen Vertrauen auf ihre Gerechtigkeit, welche unsere gute Absicht zu würdigen wissen wird.
Schließlich danken wir allen denen von Herzen, die uns durch Beiträge unterstüzt haben, und bitten sie, uns auch fernerhin in der Sammlung von Sagen, Märchen etc. durch zahlreiche Mittheilungen rüstig unter die Arme greifen zu wollen.
Im Hornung 1861.
Dr.Anton Birlinger.
Dr.M.R. Buck.
Sagen und Märchen aus Schwaben
I.
1. Die drei Zauberfrauen im Heiligenthäle.
Mündlich von Tuttlingen und Möhringen.
Zwischen Möhringen und Tuttlingen ist ein Thälchen, »Heiligenthäle« geheißen. Dort, gar nicht weit vom Duttenthal, wo die »Duttfee« oder » Dupfe« hauste, hielten sich vor alten Zeiten zwei, andere sagen drei Heidinnen auf, die Zauberei verstanden. Die drei Frauen hatten drei wunderschöne Schimmel, die den ganzen Tag weiden und nichts ackern und nichts ziehen durften. Zu den Frauen kamen die Leute von weiter Ferne her, wenn ihnen oder ihrem Vieh etwas fehlte, und holten Heilsames. Vorher mußten die Leute den drei weißen Rossen Ehre erweisen: niederfallen und opfern. Die Zauberfrauen konnten für Alles helfen und hatten viele, viele Kenntniß in den heilsamen Kräutern, die sie in Wald und Feld sammelten. Ein Tröpflein aus einem Gütterchen verhalf von der Hexerei; andere Tröpflein ließen die Thiersprache verstehen, wieder andere machten, daß man Diebe und Uebelthäter sah und kannte.
2. Die Duttfee. Duttenthal.
Mündlich aus Tuttlingen.
Das Thal zwischen Tuttlingen und dem badischen Städtchen Möhringen heißt »Duttenthal«. Da soll einst, wie uralte Tuttlinger und Möhringer Leute von ihren Eltern sagen gehört, eine Göttin verehrt worden sein, die habe »Dutt« geheißen. »Tuttlingen« sei von ihr so genannt worden. Man hat auch vor alten Zeiten mal in dem Thal eine weibliche Figur unter dem Moos gefunden, von blauem Sandstein. Schlank, von Menschengröße, mit etwas kleinem Kopfe, zwei Gesichtern, und einer Doppelbrust von großem Umfange. Diese Göttin wurde nach Tuttlingen gebracht und mochte seit mehreren Jahrhunderten auf dem Stadtbrunnen gestanden haben. Endlich ward das Bild um ein Paar Batzen verkauft und von einem Maurer zerschlagen. Stücke in Mauern weiß man noch. In dem Duttenthal sei es auch sonst nicht geheuer. Vor vielen, vielen Jahren hütete ein Mädchen Pferde draußen, da sah es auf einmal eine große Menge Andächtiger mit dem Pfarrer an der Spitze, wolgeordnet daherkommen: in uralterthümlicher Kleidung. Wie im Nu flog Alles in die Luft, und das Mädchen sah Nichts mehr. Der mit dem langen schwarzen Rocke vornedrauß winkte ihr: sie ging aber nicht hin. Kaum waren diese sonderbaren Leute verschwunden, so stand das Mädchen vor einem großen Schlosse in alter Bauart, in dem Leute wahrgenommen werden konnten. Oben bemerkte man Frauenzimmer; eine Magd war unten mit Kübelfegen beschäftigt, zwei Ritter turnirten mit einander, hieben auch mit Säbel auf einander ein. Was sie redeten, verstand sie nicht und wußte sie nicht. Im Duttenthal soll mal ein Schloß gestanden sein1.
Fußnoten
1Dupfé ist der volksthümliche Name dieser mater mammosa. Wie der Name »Fee« in diese Gegend gekommen, weiß ich nicht: vielleicht durch Lektüre? Vielleicht noch aus alten Zeiten, was zur Annahme berechtigte, es hätten Celten hier einstens gewohnt. Diese Annahme würde noch unterstüzt durch unverkennbar celtische Berg-, Flur-, Wald- und Wassernamen. Ein Umstand aber hält mich ab, Celten hier anzunehmen: die Tuttlinger Gegend ist ganz von Alemannen bewohnt gewesen, was auch die alten, von Dürrich und W. Menzel untersuchten Oberflachter Heidengräber darthun; die Alemannen waren aber die erbittertsten Celtenfeinde, somit kann das Wort » Fee« schwerlich trotz celtischer Ortsnamen in der Gegend ein ächter Nachhall des untergehenden Druidinnencults in der Tuttlinger Heimat sein. Volksthümlich ist »Dupfé« ganz, und wenn die Sage Nr. 1 von den drei Heidinnen auf den Feencult zurückgeführt werden könnte, so wäre dieses für Geschichte und Mythologie ein nicht unbedeutender Wink. Die Grenzen des Celtenthums und somit auch des Druidinnencults, dessen Nachhall der Feencult, sind von Dr. H. Schreiber freilich über die Vogesen und höchsten Firsten der Alpen gezogen, und somit läge Tuttlingen weit ab und könnte kein Feencult heimisch gewesen sein. Dupfé ist in der Tuttlinger Gegend ein Kinderschrecken.
3. Das silberne Messerchen.
Mündlich von Fleischwangen.
In der Gegend von Fleischwangen, wo die Burg des Ritters Hans von Ringgenburg stand und jezt nur noch ein Bauernhaus ist, geht die Sage vom »silbernen Messerchen.« In der Nähe dieses Hauses kam zu den Dienstboten, während sie auf dem Felde arbeiteten, vor etwa 80-90 Jahren noch ein ausnehmend schönes Fräulein in schwarzseidenem Kleide; ihr Angesicht strahlte und Locken wallten über ihre Schultern. Tagtäglich kam das schwarze Fräulein zweimal zu den Knechten, allemal zwischen Morgen und Mittag, um 9 oder 10 Uhr, zwischen Mittag und Abend um 4 Uhr; brachte ein Krüglein köstlichen Weines und ein Laiblein schneeweißen Brodes. Fräulein brachte dazu ein gar hübsches silbernes Messerlein, sagte allemal: »gebt mir fein mein Messerlein wieder, sonst bin ich verloren!« So ging's lange fort und die Knechte gaben das Messerlein immer wieder her. Mal wandelte Einen von ihnen die Lust an, das köstliche Ding zu behalten. Wie gewöhnlich, brachte zu seiner Zeit schwarz Fräulein das Krüglein, das Laiblein, das Messerlein wieder. Einer war so roh und grob, und gab das leztere nicht mehr her. Fräulein bat unter Schluchzen und Thränen, ihr doch das Messerlein wieder einzuhändigen; aber Alles half nichts: der böse Knecht gab's nicht mehr heraus. Unter lautem herzzerreißendem Schreien und Klagen zerraufte sich schwarz Fräulein ihr schön Haar, zerriß ihre Kleider von Seiden und verschwand plötzlich, als ob sie die Erde verschlungen hätte. Seit jener Zeit kam das gute Fräulein nimmer. Die Knechte bekamen keinen Wein und kein Laiblein Brod mehr. Da, wo dieses geschehen, hört man noch oft ein Schluchzen und Weinen1.
Fußnoten
1 Müllenhoff 281. 286. 576, wo ein Junge eine silberne Gabel vom Zwerg behält. Wolf, Beitr. II. 319. Rochholz A.S. I. 282. 195. 14, wo der Zwerg ein silbern Messerlein hervorzieht. Auch die Zwerge verschwinden und kommen seit dem Verluste des Messerchens nicht mehr.
4. Weißes Fräulein in der Baumburg.
Mündlich von Hundersingen.
In der Baumburg bei Hundersingen sei ehedem ein Fräulein gewesen, das oft herauskam und den Leuten auf dem Felde Brod, Käs und Kuchen brachte. Ein Hundersinger hatte da einen Acker. Der nahm nie Brod oder sonst was mit. Deß wunderte sich die Bäurin und fragte ihn. Der erzählte ihr, daß ihm immer seit langer Zeit ein weißes Fräulein Brod, Wein, Käs und Kuchen brachte. Mal kam der Knecht hinaus, dem aber der Bauer auftrug, ja dem Fräulein nichts zu leid zu thun. Der Knecht bekam das Nämliche. Das andere Mal behielt er die Gabel, und das Fräulein kam nimmermehr, habe nochmal verzweiflungsvoll umgeschaut am Hügel1.
Fußnoten
1 Urkundlicher Name der »Baumburg« ist Buenburg, Buwenburg, Bawenburg. 1092: Dietrich von Buinburg. Eberhardus de Buwenburg. 1286 Ulrich von Buenburg. Von 1267 an erscheinen die Buwenburg fortlaufend in Kreuzthaler Urkunden. Riedl. Oberamts-Beschrbg. S. 196. »Die von der Baumburg« sollen gefürchtete Raubritter gewesen sein; sie haben den Bauern, die in der Nähe ackerten, oft das Saatkorn gestohlen. In der Baumburg soll ein Schatz liegen.
5. Das Burrenweible.
Mündlich von Hundersingen.
Das Burrenwäldle (bûərəwäldlẽ) ist zwischen Ursendorf und Beitzkofen im Ostrachthal, Oberamts Saulgau. Kam früher regelmäßig zu den Ackersleuten ein Weiblein und ließ Brod schneiden; hatte ein nettes Messerlein. Einer der Knechte behielt mal des Burrenweibleins Messerlein, das von dort an nimmermehr beim Burrenwäldle sich sehen ließ. Die Kinder sagen noch: »Wenn's Burrenweible nur auch wieder mit dem Messerlein käme!«
6a. Sage von der Laura im Laurathal.
Mündlich von Kißlegg.
Das »Laurathal« (Laurədâl) bei Schlier ist eine äußerst unheimliche Gegend. Man zeigt einem, wenn's Wolfegg zugeht, den Platz im Walde droben, wo einst die Burg stand, in der das Ritterfräulein »Laura« gelebt haben soll. »Laura« liebte einen Ritter. Dieser Ritter entfloh einst mit dem Kinde, dem Pfande ihrer Liebe, nächtlich und wollte die Sache auf der Lauren-Burg verheimlichen. Wie er über einen schwachen Steg der unten vorbeifließenden Scherzach sezte, brach er und »Laura« hörte droben das Platschen und Hilferufen. Sie sprang thalabwärts, wollte den Ritter und das Kind retten, versank aber auch. Seitdem muß sie umgehen und kommt zu gewissen Zeiten an's Brünnlein und trinkt aus einer Kürbißschale. »Laura« geht wieder, mit der Schale unter dem Arm, thalaufwärts, der alten Burgruine im Walde droben zu. Weiß wie Wachs, mit einem langen, eben so weißen Schleier kommt sie herab und Niemand kann davor ihr Gesicht sehen. Sie läuft wie auf einem Wölklein über dem Wasser dahin und ebenso wieder auf dem Wasser zurück.
Mal verirrte sich im Walde, da wo Fräule » Laura« gehen soll, ein Kind. Auf einmal kam ein warmes Lüftchen und es war da so grün und Alles so blühend, wie im Frühling. Es sei gerade gewesen, wie im Paradies. Erdbeeren seien da in Hülle und Fülle gestanden. Das Kind pflückte nach Herzenslust. Fräule »Laura« sei in diesem Garten schneeweiß spazieren gegangen, immer dem Kinde winkend. Das Kind brachte sein Erdbeersträußlein heim.
Fräule »Laura« soll unter einem Stein hervorkommen und dort wieder verschwinden. Viele seien auch schon von ihr in die Irre geführt worden1.
Fußnoten
1 Urkundlicher Name von Laurathal ist »Lurenthal« (Urkd. in der Weingart. Registratur). Schmähliche Verhunzung der Sage in Schönhuths Burgen und Schlössern etc.
6b. Laurasitz.
Mündlich von Weingarten.
Auf dem Weg von Weingarten nach Schlier ist der »Laurasitz« im Laurathal. Da sitzt ein Geist, eine Gräfin Laura »auf dem Sitz«, welche mit goldenen Kugeln und silbernen Kegeln kegelt. Das geschieht alle Nacht von 12 bis 1 Uhr.
6c. Laura's Erlösung.
Schriftlich.
Fräulein Laura mit ihrem weißen Kleid, einen Bund Schlüssel an ihr hängend und ein Wasserkrüglein in der Hand, erscheint in den heiligen Zeiten an einem unscheinbaren Brünnlein an der Scherzach (ganz in der Nähe der Brücke, die auf den Hallersberg führt, der Griesle-Mühle gegenüber) und schöpft Wasser, sprechend: »Ich muß eine Linde tränken, und zwar so lange, bis der Baum erstarkt ist. Alsdann wird aus diesem Baum eine Wiege gefertigt, und dasjenige Kind, welches in derselben gewiegt und auferzogen wird, erlangt von Gott die Gnade, mich erlösen zu können.« Und dann sezt sie ihren Weg dem Laurathal zu fort.
7. Die drei Fräulein in Reutlingen.
Mündlich.
Zu einem Gerber in der Altvorstadt Reutlingen, unweit vom See, seien vor Alters drei wunderschöne blondlockige Fräulein gekommen, ganz alterthümlich angezogen. Sie stellten sich vom ersten Tag nach Martini allabendlich bis zum Fastnachtsonntag ein. Um 8 Uhr etwa kamen sie vom Ursulenberg her, Schlag 10 Uhr brachen sie wieder auf gen Pfullingen ihrem Berge zu. Sprachen niemals ein sterbig Wörtlein, wenn sie kamen und wenn sie gingen. Hatten wunderschöne silberne Kunkeln, silberne Wirtel und silberne Spindeln; mit dem schönsten Flachs waren die Kunkeln angelegt. So trieben sie ihren Besuch viele Jahre fort. Anfangs hatten die Leute Angst, nach und nach gewöhnte man sich an die seltsamen drei Spinnerinnen und es fiel nicht mehr auf.
Mal, es war auch in der Lichtkarz, brach Einer ihr Faden schnell; eben so schnell sagte sie:
pfî, pfatz, dər pfâd işt brochṣ.
Die Zweite sagte:
Håt ett dər pfâ pfâdər gsṣit
Wenn dṣr pfi pfizzṣr konnt,
Sollişt ett pfi pfazzṣ.
Die Dritte sagte:
Und du pfî pfätscht.
Alle Drei brachen eiligst auf und kamen von selbigem Augenblicke an niemals mehr wieder1.
Fußnoten
1 Vgl. Meier S. 12. Nr. 3.
8. Der Breit- oder Langhut.
Mündlich von Hohenstatt.
Der »Breithut« oder »Langhut« ist im Gaißenthäle, Wiesensteig, Hohenstatt, Goßbach und Umgegend gar wol bekannt. Er soll ein berüchtigter böser Raubritter auf dem Reissenstein gewesen sein, der die Leute bis auf's Blut plagte. Tag und Nacht war Leben, Hab und Gut vor ihm nicht sicher. Nach anderen Sagen sei er ein alter bösartiger Burgherr von Wiesensteig selber gewesen, der, als man ihn begrub, oben zum Fenster herab gesehen haben soll. Wieder Andere meinen, es sei ein Helfensteiner gewesen. Wegen seiner Uebelthaten muß er umgehen. Bald kommt er zu Roß und Wagen, bald zu Fuß. Kommt er zu Wagen und Roß, so hat er zwei, auch vier kohlrabenschwarze Pferde ohne Köpfe, und fährt wie der Blitz von der Steig herunter von Hohenstatt her, wo er hinter den Gärten wegschnurrt, wie's Wetter. Oft kommt er bis von Blaubeuren her. Breithut fährt dann wie wüthend unter lautem Peitschenknallen vor das Thor, zieht die Thorglocke, und wenn man öffnet, rasselt und peitscht er schon von einem andern Thor herein durch das Städtchen Wiesensteig. Der alte Thorwärter versicherte, er hätte öfters zu ihm über die Mauer hereingeschaut. Mal fuhr er dem Müller in Wiesensteig in die Räder und stellte sie bis zum Morgen. Auch ohne Roß und Wagen kam Breithut. Gewöhnlich bringt er spät Heimkehrende in Angst. Einem, der ihm rief, saß er auf's »Räfft«, der ihn zur großen Plage ein Stück tragen mußte. In's alten Reuchlis-Haus in Wiesensteig sezte er sich vor das Küchenfensterbrett und schaute zu, wie man dem Kinde Brei kochte. Im Stöckhau bei Hohenstatt läßt er sich hie und da als Baumklotz, oder geradezu als Baum blicken. »Breithut« oder »Langhut« hat seinen Namen von seinem breiten Schlapphute, der ihm bis über die Achseln geht. Buben machten ihn an der Fastnacht noch vor wenigen Jahren nach. Einer fuhr auf dem Leiterwagen, hüben und drüben hing der große, künstliche Schlapphut hinab.
Der Breithut selber ließ sich schon lang nicht mehr sehen1.
Fußnoten
1
Mündlich.
Auf dem Conzenberg geht der »Lapphut« oder »Schlapphut« seit undenklichen Zeiten. Er heißt bisweilen auch blos der »Trallare«. »Trallare« ist sonst in Niederschwaben ein »roher, ungehobelter, grobdummer Kerl.« Der »Lapphut« hat, wie sein Name schon andeutet, einen ungeheuern, großkrämpigen Hut und treibt sein Unwesen auf den umliegenden waldigen Höhen. Mal kamen mehrere Männer in's Jägerhaus, das jezt nicht mehr auf dem Conzenberg ist, da hörten sie ganz in ihrer Nähe »jauchzen«, meinten, seien lustige Buben. Aber auf einmal jauchzte es wieder auf einer andern Halde, und gleich darauf auf der entfernten Brenntenhalde. Es war ihnen klar, daß dies Niemand anders sei, als der »Lapphut«. Mal stand »Lapphut«, das that er gerne, hinter einem Roßhirten, der mit andern wegen des übertretenen Mühlebachs nicht nach Wurmlingen konnte, auf dem Conzenberg übernachtete, wie er das Feuer im Ofen schürte. Auf dieses hin rannte dieser davon in die Stube, Alle sezten sich hinter den Ofen und starben fast vor Angst. Der alte Jäger kam mal heim, da lag »Lapphut« im Burggraben und hatte ein Kind im Arme. Der Jäger nahm es ihm und meinte, es wäre ein Schatz. Aber er hatte einen Stein und warf ihn hin. Im Augenblicke saß das Kind wieder auf dem Arm des »Lapphut«; der Jäger erschrack so, daß er bald starb. »Lapphut« soll öfters in's Jägerhaus und in die Schlafkammer gekommen sein. Wenn man das Jäger-Marîle fragte nach dem »Lapphut«, so sagte es: »håt ən weissə Ring um ṡ Maul.« Lapphut sezte sich auf's Bett der Kinder.
10. Der Schlapphut im Urselenthäle.
Mündlich.
Im Urselenthäle, das bei Nendingen auslauft, haust der »Schlapphut« seit vielen Jahrhunderten. In der Seelenwoche kommt er gerne nächtlicherweile. Seine Füße bedeckt eine Art Schuhe, worauf etwas Schneeweißes kommt, wie Tüchlein, und dann Hosen. Einen schwarzgrauen Jägerjuppen hat er um sich. Sein Gesicht ist das Schrecklichste: er hat schneeweiße zwei Augen, fast größer als Ganseier, und sein Hut hängt ihm wol weit über die Schultern hinab. Holzdiebe hat er schon arg in Angst gejagt. Leuchtende Feuer, die von Nendingen her wiederholt gesehen wurden, kommen von ihm her. Er kommt beim »Schlößlebergfelsen« unten über das Hag herunter, steht oft stundenweise um Mitternacht auf demselben Platz1.
Fußnoten
1 Vgl. über die Augen der Geister Rochholz A.S. I. 84. 2. 9. 112. 10. 36. 38. 50. 84. 33; wie Chaisenlaternen, Kartoffelkorb, Kirchenfenster, Marktzwiebeln, Pflugräder, Fleischteller etc. S. 159. 158. – Th. Vernaleken, Myth. u. Bräuche, S. 30 ff.
11. Die Sage von dem Hosenflecker.
Von Domcaplan und Cammerer Grimm in Rottenburg.
In den Wäldern, die sich von den Haiden an dem Ende der Markung Hüttlingens bis gegen Saverwang und Schretzheim bei Ellwangen hinziehen, da wo die alte Teufelsmauer jezt noch kenntlich ist, hauset seit unvordenklichen Zeiten ein Geist, von dem Volkswitz nur der »Hosenflecker« genannt. Woher dieser Name kommt, ist nicht auszumitteln. Die Sage berichtet: in diesen Wäldern habe vor alten Zeiten ein Jäger gewohnt, ein wüster, gottloser, frecher Geselle, der den friedlichen Wanderern allen Schabernack und Schimpf angethan habe. Zur Strafe für diese Frevelthaten sei er verurtheilt, auch nach seinem Tode ohne Rast und Ruhe als Geist bis zu seiner Erlösung auf dem Schauplatz seiner Lasterthaten zu bleiben. Er ist ein neckischer Geist und hat seine Freude, die Leute irre zu führen, und gelingt es ihm, einen verspäteten Wanderer die halbe Nacht in den Wäldern durch die Kreuz und Quere zu führen, dann zeigt sich seine Schadenfreude durch ein wüstes heiseres Gelächter, das der Wanderer aus den Büschen vernimmt. Bisweilen erscheint er auch in seiner Tracht als Waidmann, eine lange Hahnenfeder auf dem Hut. Am meisten wird sein Zorn erregt, wenn man ihn mit seinem Spottnamen »Hosenflecker« citirt. Das thut man aber nur, wenn man einmal die kleine Johanneskapelle erreicht hat außerhalb des Waldes. Denn da scheint sein Territorium aus zu sein, und er macht seinem unmächtigen Zorn nur durch gewaltiges Rauschen und Schütteln der Bäume mehr Luft. Einstmals wandelte einen Burschen die Laune an, den Geist mit seinem Spottnamen herauszufordern, ehe er die Kapelle ganz erreicht hatte; er mußte aber diesen unzeitigen Spott damit büßen, daß ihn der Geist bis frühe Morgens auf einer Stange festhielt, über die zu schreiten er gerade im Begriffe war. Ein andermal citirte ein Bursche in verwegener Kühnheit den Geist, als er vergebens Feuer für seine Pfeife schlagen wollte. Augenblicklich war der erzürnte Geist mit einem brennenden Scheite zur Hand, das er ihm vor die Nase hielt. Der Mensch kam fast todt nach Hause vor Schrecken. Eine besondere Freude macht es ihm, verliebte Paare zu schrecken, die sich bei ihrem Heimweg verspätet haben. Einmal äußerte ein solches Paar den Wunsch: in einer Kutsche nach Hause zu fahren. Augenblicklich war eine Chaise mit Pferd und Bedienung da; ehe das Paar von seiner Ueberraschung sich erholen konnte, wurde es in den Wagen genöthigt, und nun ging es die ganze Nacht über Stock und Stein, bis beim ersten Hahnenruf Roß und Kutsche bei dem Braunenbäumlein bei Aalen stille hielt. Viel zu kämpfen mit dem Geiste hatte ein kühner Bursche, der in seiner Jugend in einem Dörflein wandelte, wobei er das Bereich des Geistes zu passiren hatte. Einmal forderte er von dem Herrn des Waldes, seinen Durst zu stillen, und hatte die Unvorsichtigkeit, ihn bei seinem Spottnamen zu citiren. Da erschien der Jäger im höchsten Zorn mit einem Fäßlein, aus dessen Spunten ein feuriges Naß sich ergoß, und warf dann den muthwilligen Jungen mit solcher Gewalt in den Graben, daß er in der Frühe elend zugerichtet nach Hause wankte. – Gegen gute Leute, die den Weg betend zurücklegen, hat er keine Gewalt; vielmehr hat er solchen schon manche Dienste geleistet. – Holzfrevlern ist er auch nicht hold, denn er scheint dies als einen Eingriff in seine Forstgerechtigkeit zu halten.
Seitdem die Wälder in jener Gegend mehr und mehr gelichtet werden, zieht er sich mehr und mehr zurück und erscheint seltener.
12. Der wilde Jäger.
Königseggwald.
Im »Wagenhardt« ging vor Zeiten ein wilder Jägersmann, Namens »Laute«, geisten; er hat bei seinen Lebzeiten die Leute, welche in die Kirche gehen wollten, vom Kirchgang zum Jagen weggenommen. Er fährt nicht blos bei Nacht, sondern sogar zeitenweise bei Tag im Walde umher; man hört dann Hunde bellen, Hörner blasen, Peitschen knallen. Der Jagdzug fährt über die »Wischbel« (Tannenwipfel) weg. Er verführt die Leute, daß sie im Wald sich verirren und zwei, drei Tage lang im Walde herumlaufen. Dieser »Laute« ist sprichwörtlich geworden; man sagt daher, wenn man sich nicht zurechtfinden will: î moĩ dər Lautẽ häb' mẽ vərfüəhrt!1
Fußnoten
1 Das Abhalten von der Kirche, das Holen der Bauern aus derselben ist »Sagen von bösen Rittern« eigen. Es läßt dieses sogleich errathen, warum der Junker, oder wer er sei, in die Sage übergegangen und gebrandmarkt ist. Gleiches thut auch der Junker auf der Kocherburg; mündlich und bei Meier, Sagen S. 98, 99.
Betreffend das Wort »Wag« in Wagenhart kann ich folgende Beispiele anführen: Wagəlai (Wurml. Feld. Namen). Wagrõə (Wurml., Tuttl.). Orts- und Wasserbenennungen: Nërəwåg; Möhringer Wåg, Wåg (Wurml., Tuttl.). Wåg bei Mülheim a.D. Wågsautər, ehemaliger Thurm in Ueberlingen. Wagəhald, verschwundener Marchthaler Flecken; Hörschwag (Sigmaringen). Wëərəwåg (Heimat des Minnesängers Hugo, vgl. v.d. Hagen, Minnes. II. Nr. 82), mhd. Werbenwåg. Wâc, wâk, wâg strk. m. bewegtes Wasser, gurges. W. Wackernagel, Wrtb. z. altd. Lesebuch DLXVII. Lauchert, Rotw. Lautlehre S. 4.
13. Der wilde Jäger bei Vollmaringen.
Mündlich.
Im Vollmaringer Wald jagt der »wilde Jäger«, und sein Jagen sagt »Krieg« an. Mit lautem, fürchterlichem Halloschreien und Hörnerblasen fährt er wie der Blitz durch den Wald, bis hinein in die Nagolder Bezirke. Der »wilde Jäger« ist ganz grün angezogen, vom Kopf bis zum Fuß; hat zwei schneeweiße Hündchen; das eine billt wundersam hell, das andere grausig rauh1.
Fußnoten
1 Die beiden Hündchen erinnern an Will und Wall in der Pfalzgrafenweilersage von » Mändlin Eppen«. Pfeiff. Germania I. 2 ff. Die Heimat beider Sagen ist eine und dieselbe. Im Uebrigen kehrt die Rodensteiner Sage wieder.
14. Der Grünmantel.
Mündlich.
Im Harthauser Wald, der von Schönthal bis gen Neuhausen hin geht, treibt der »Grünmantel« sein Unwesen. Er führt gerne die Leute irre und fügt ihnen Uebles zu.
15. Der Jäger auf der Wallenburg.
Mündlich.
Wie man von Wurmlingen her in's Urselenthal kommt, ist links droben eine ausgegrabene, alte Mauer von der ehemaligen »Wallenburg«. Dort geht nächtlich ein »grüner Jäger« um, kommt zu Leuten, die noch spät im Wald sind, besonders zu Holzdieben; hat ein Gewehr umhängen, steht zu ihnen hin, thut aber Niemand was zu Leide.
16. Der Kaplaneimann.
Mündlich.
Im Westhäuser Walde haust der »Kaplaneimann« als »Jäger«, mit einem Pfeiflein im Mund. Der Jäger kam oft in die Ziegelhütte und guckte zum Fenster hinein. Die Hirtenbuben riefen allemal:
Kaplaneimann, Kaplaneimann,
Komm, und zünd' mir mein Pfeifle an!
Den Scherz mußten sie theuer büßen: auf einmal schnurrte er an ihnen vorbei und versezte ihnen ein Derbes hinter's Ohr.
Andern zufolge heißt er auch »Kapheira« (Kapfəirə)1.
Fußnoten
1 Vgl. Meier, Sagen, 121.
17. Der Fuchseck-Schäfer.
Schriftlich.
»Fuchseck« ist ein Bauernhof, zur Gemeinde Schlath gehörig, Oberamts Göppingen. Es geht eine Sage, daß da sich der »Fuchseckschäfer« mit Hund und Heerde an Sommerabenden blicken lasse. Da ist es nicht geheuer. Dieser Schäfer hat einstens, vor mehreren Jahrhunderten, gelebt und es mit dem Teufel gehabt. Mit dessen Hilfe soll er allemal seine Schafe in Raben verwandelt haben, damit sie ungestört in fremdes Gras konnten, es abfraßen, während er sich gütlich that bei einem Schoppen. Das Unrecht geschah der Gemeinde von Schlath. Er starb, und zum Lohne hat er keine Ruhe für seine Seele; er muß fahren, und zwar mit Hund und Heerde, über den Plätzen, wo er Unrecht verübte. Bald schwebt er hoch, bald nieder hunten. Um Bartholomäustag herum hat man den fahrenden Fuchseckschäfer schon acht Tage hintereinander in den Lüften gesehen1.
Fußnoten
1 Variante bei Meier, Sagen, S. 95.
18. Der Brandjockele.
Mündlich.
Im Walde Hinterbrand bei Keuerstadt geht der Geist »Brandjockele« (Brandjåckəlẽ) um als Jäger. Bei Lebzeiten war er fürstlich Ellwangischer Jäger, führte ein ausgelassenes böses Leben, schoß das Wild, wann's ihm einfiel, wohnte in einem der beiden Ellwangischen Höfe im Walde. Seine Dienstleute plagte er bis auf's Blut; ließ sie um 12 Uhr erst in's Bett gehen, um halb 1 Uhr schürte er grünes Holz, daß es gewaltig rauchte und stank, damit die Ehalten aufwachten. Nach seinem Tod wurde wegen dieses Bösewichts der Hof dem Erdboden gleich gemacht. Er selber aber geht, zur Plage seiner Seele und Angst anderer Leute, um als Jäger.
19. Der Jäger von Hofen.
Mündlich von Lehrer Käsberger.
Der Jäger von Hofen sei ein frommer Mann gewesen und habe sehr viel den Rosenkranz gebetet. Zwischen Hofen und Dunstelkingen liegt der Wald. Die Bauern stahlen sehr viel Holz, und ob diesem Frevel habe der Jäger von Hofen mal die Verwünschung gethan: »wenn diese Bauern in den Himmel kommen, dann will ich nicht hinein.« Als er starb, schaute er zum Fenster heraus, während man seinen Sarg wegtrug. Sein Tod erfolgte durch eine Kugel, von seinem eigenen Sohne abgeschossen. Der Sohn schoß auf einen Bock; die Kugel prallte an einem Steine ab und tödtete den Vater. Den Stein zeigt man wirklich noch im Hofener Wald. Seitdem hat der Jäger keine Ruhe, er muß im Walde umgehen und jagen. In der heil. Weihnachtszeit kommt er gerne bis in's Ort herein. Die Weiber, die Morgens früh in dieser Zeit zum Backen aufstunden, haben ihn schon ohne Kopf auf dem Gartenzaun sitzen sehen und haben ihn hören »juxen«. Der Jäger von Hofen führt gerne in die Irre1.
Fußnoten
1 Vgl. eine Variante bei Meier, Sagen, S. 21. Nr. 136. Ueber »Wilde Jägersagen« Schwartz, Ursprung d. Mythol. 3. 5 ff. 21. 22. 34. 62. 110. 113. 115. 119. 122. 124. 133. 151. 157. 182. 213. 219. 227. 228. 245. 248. 267.
Verstorbene Bösewichte läßt die Sage gern zum Fenster herausschauen, während ihre Leiche weggetragen wird. So auch Nr. 8. S. 9. etc. In Tauberbischofsheim entstand neuerdings eine ähnliche Sage.
20. Der Grubenholzmann.
Mündlich von Mögglingen.
In Mögglingen, Unterböbingen und der Umgegend wissen die Leute viel vom »Grubenholzmann« zu erzählen. Er sieht verschiedenartig aus. Bald läßt er sich als Fuhrmann, bald als großer, mehlsackähnlicher, kopfloser Körper, bald als winzig klein Hündlein sehen. Bei Mögglingen ist der »Grubenholzwald«, von dem er seinen Namen hat, weil er dorther kommt und dort seinen Wohnplatz haben soll. Von diesem Wald aus macht er seine Runde in der Mögglinger Markung. Von der »Teufelsmauer« her geht's durch den genannten Wald über den Hollohof den Wald herab, der eine Stunde lang ist, dann auf die Brakwang, den Gratwolhof; dort gibt's eine Schwenkung gegen Bäbingen, dem Barenberg-Grund zu. Als Fuhrmann kommt der Grubenholzmann gern mit sechs Rappen und fährt den Wolfertsberg hinauf. Einen Mann von Mögglingen, im äußersten Haus draußen, weckte der Fuhrmann mal und bat ihn um Vorspann. Weil er kein Roß hatte, spannte er seine Kühlein vor. Wie der Bauer seine Geißel schwingt und ruft: »nun so hott in Gottsnamen!« war das Fuhrwerk mit den Rossen schon den Wolfertsberg droben, und zwar ging's hinterfür hinauf. Der Bauer stand mit seinen Kühen da und schaute verwundert drein. Der Fuhrmann ging wieder dem Grubenholzwald zu, er aber heim. Auf den umliegenden Höfen weiß man noch manches Stücklein vom »Grubenholzmann.«
21. Der Hollojäger auf dem Lemberg.
Mündlich von Marbach.
Wenn man von Affalterbach nach Marbach geht, so liegt links von der Straße, etwa eine Viertelstunde drinnen, der Lemberg. Auf diesem Berge geht der »Hollojäger«, oder reitet er; gewiß kann man's nicht sagen. Er ruft oft in die Nacht hinein: » Hollo, Hollo!« Daher sein Name. Mal ging ein Taubenhändler von Marbach, wo Markt war, heim, Winnenden zu. Es war gegen Mitternacht. Wie er am Lemberg vorbeikam, hörte er überlaut »jagen« und »hollo« rufen. Taubenhändler meinte, es wären seine Buben, die ihm entgegenkommen sollten, und schrie ebenso aus Leibeskräften: »Hollo«. Plötzlich steht der Hollojäger vor ihm, versezt ihm eine so derbe Ohrfeige, daß ihm der Taubenkäfig vom Buckel herabfiel und die Tauben hinausflogen. Eiligst sucht er sie wieder zusammen und geht wieder rasch seines Weges. Immer und immer vernahm er noch das »Hollorufen«, aber er erwiederte nicht mehr. Seine Buben, die bald kamen, betheuerten, sie hätten nicht gerufen1.
Fußnoten
1 Der Name »Lemberg, Limberg, Lehmberg« kommt oft vor: Bei Goßbach ist ein »Lemberg«, auf dem einst den Helfensteinern edler Wein wuchs; am Hohberg bei Deilingen ist ein sagenreicher »Lemberg«; der Hintergrund von Monrepos heißt ebenfalls so. Limberg, Weiler der Pfarrei Michelfeld, O.A. Hall. Limberg heißt auch ein Hof, zu Seibranz gehörig, O.A. Leutkirch. Im Stuttgarter Vertrg. v. 1485 (Reyscher, Samml. I. 501) heißt unser Name »der Lynberg by Affalterbach.«
22. Der Hurexdex.
Mündlich.
In der Gegend von Aichstetten treibt ein wilder Jäger nächtlicherweile sein Unwesen. Er ruft durch die Wälder bei seinem Jagen immer: »Hurex, Hurex, dex, dax!« Leute, die nach Steinbach wallfahrten, wollen ihn schon oft gehört haben.
23. Der Wuchter.
Mündlich von Rottenburg.
Im Rottenburger Wald »Erlenrain« und »Zieglersteig« geht der »Wuchter« um. Er hat einen langen braunen Rock, einen Dreispitzhut, ängstigt die Leute gewaltig. Er soll ehmals Waldmeister gewesen sein und diesen Wald Erlenrain und Zieglersteig unrechtmäßiger Weise an sich gebracht haben, weßwegen er umgehen muß.
24. Nächtlicher Reiter mit dem Wetterhut.
Ertingen.
25. Der Reiter ohne Kopf und Gräfin Adelinde.
Mündlich von Joseph Rau aus Kappel.
Südlich von Buchau, da wo's in's Wiesenthal hinausgeht, auf dem schönen Berge, liegt der Ueberrest eines uralten Kirchleins. Die vier Wände stehen noch davon. Die Sage erzählt, es habe mal vor uralten Zeiten eine Gräfin »Adelinde« in der Umgegend gewohnt, von der die Kapelle gestiftet worden sei. Es seien mal die Hunnen bis in diese Gegend gekommen, wo es eine furchtbare Schlacht absezte. Auch der Gemahl Adelindens, der Graf, sei in Kampf gezogen und umgekommen. Bevor er Abschied nahm, gab er seiner Herrin noch das Versprechen, da und da werde er ihr erscheinen, entweder lebend zurückkehren, oder gefallen als Geist. Als er zu lange nicht wiederkehrte, zog die Gräfin mit ihrem Gefolge ihm entgegen, und siehe! auf dem blutigen Feld nach der Schlacht begegnete ihr ein Reiter hoch zu Rosse, sein Haupt auf einem weißen Teller tragend. In selbigem Augenblick rief die Gräfin aus:
Windle Windle wehe,
Bis daß ich meinen Herrn wieder sehe!
Auf der Stelle verschwand er, als die Gräfin die Worte sagte:
Windle Windle wehe,
Bis daß ich meinen Herrn nicht mehr sehe!
Da, wo dieses sich zugetragen, ließ Adelinde ein Kirchlein bauen, und das ganze Thal hieß von wegen ihren vielen vergossenen Thränen »Sankenthal«, d.h. Thränenthal. So oft man aber zwischen die noch stehenden Mauern tritt, so geht immer ein leises zartes »Windle«, auch wenn sonst kein Wind geht. Die Gräfin ging in's Kloster nach Buchau, das sie gründete, und soll Aebtissin geworden sein1.
Fußnoten
1 Die kopflosen Schimmelreiter, wilden Jäger und andere Geister sind gekennzeichnet als verstorbene, seelenlose. Vgl. Th. Vernaleken, Mythen und Bräuche, S. 47. Nr. 23 ff.
26. Der Schimmelreiter an der Egau.
Schriftlich.
In einem Kirchenbuche aus dem Neresheimischen ist vom Jahr 1722, 22. Mai, Folgendes aufgezeichnet: Einem Metzger von Balmertshofen verkam an der Egau ein Schimmelreiter, sicherlich war's der Teufel selber, in Gestalt eines Bekannten. Der Metzger ging auf ihn los, schnaubte ihn an: woher des Weges? wollte ihn anpacken und kalt machen, voll Eifersucht und Feindschaft, daß er ihm eine Metz entführt habe. Der Reiter sprengte abseits in die Egau und Metzger nach; wurde lezterem doch zu tief und schwamm noch ein Stück. Aber siehe, im Nu war Roß und Reiter in den Wellen verschwunden, und jezt merkte der Metzger erst, daß es nicht geheuer sei.
27. Der Leonberger Schimmelreiter.
Mündlich.





























