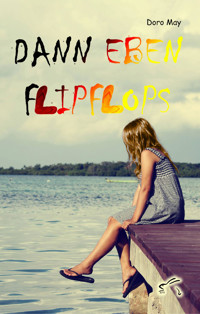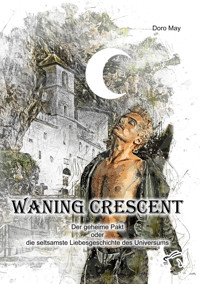Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lukas, Mariannes Enkel, provoziert mit seinem alten Auto Unfälle, um durch Schmerzensgeld sein Budget aufzubessern. Eines Tages unterschätzt er das Risiko und verunglückt schwer. Während seiner Genesung erfüllt ihm Marianne seinen Herzenswunsch: Sie erzählt ihm ihre Geschichte: Als jüdischer Säugling in fremde Hände gegeben, überlebt sie den Holocaust, gelangt nach dem Krieg im Zuge der Familienzusammenführung zu ihrer Großmutter. Als Fünfjährige wird sie 1947 Zeugin, wie am Küchentisch in der altehrwürdigen Villa, in der sie mit ihrer Großmutter lebt, ein Racheakt von Menschen ausgetüftelt wird, die Verfolgung, Zwangssterilisation und das Euthanasieprogramm überlebt haben. Ihr Ziel: Rudolf Meinberg. Bei ihm, dem damaligen Schreibtischtäter, wollen sie Gleiches mit Gleichem vergelten. Als Erwachsene Frau entdeckt Marianne nicht nur die Wahrheit über ihre Herkunft. Sie stößt auch auf die menschliche Seite des Schreibtischtäters, der im Krieg seine Obsession mit der jüdischen Tänzerin Paula ausgelebt hat ... Lukas lässt sich von der Geschichte fesseln. Am Ende überredet er seine Großmutter dazu, sie aufzuschreiben. „Wenn du das nicht tust, wäre es, als hätte deine Geschichte nicht stattgefunden.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
swb media publishing®
Doro May
SALOMES TANZ
Roman
swb media publishing®
Die Handlung und die handelnden
Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2017
ISBN 978-3-946686-28-6
Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.
© 2017 Südwestbuch Verlag
SWB Media Publishing, Gewerbestr. 2, 71332 Waiblingen
Printed in Germany
Titelgestaltung: Dieter Borrmann
Satz: Julia Karl / www.juka-satzschmie.de
Druck und Bindung: Rosch-Buch Druckerei GmbH, 96110 Scheßlitz
Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.
www.swb-verlag.de
Inhalt
Prolog
Ein beinahe tragisches Ereignis, ein Handschuh und ein Versprechen
Teil 1 Vergeltung
Kapitel 1
Was ich als Kind 1947 mit meiner Zeit anfing
Kapitel 2
Oma und ich und wie wir es gut hatten
Kapitel 3
Lukas hat nicht wirklich Ahnung vom Krieg
Onkel Hermann zieht bei uns ein und benimmt sich manchmal merkwürdig
Kapitel 4
Auch Pia ist scharf auf meine Geschichte
Onkel Hermann redet manchmal wirres Zeug und Oma hat mit den Aufräumarbeiten in Deutschland nichts am Hut
Kapitel 5
Pia will über Schule reden und ich weiche von der richtigen Reihenfolge ab
Warum ich meine Lehrerin geliebt habe und wie sich Onkel Hermann über Post aus Amerika aufregt
Kapitel 6
Lukas bekommt einen Leidensgenossen
Edith gerät in Panik und Onkel Hermann entführt die Königstochter
Kapitel 7
Wie ich heute wohne
Zu Onkel Hermann gesellt sich Onkel Otto und Oma mietet einen Raum in der Stadt an. Zwei weitere Personen werden erwartet
Kapitel 8
Soll ich meine Geschichte aufschreiben? Soll ich’s wirklich tun?
Unser Panoptikum wird um eine schwarze Attraktion reicher
Kapitel 9
Lukas hat Geburtstag und lächelt wieder mit fast echten Zähnen
Oma dreht durch und packt sich in Wolle, weil es so kalt ist. Ich bekomme ein neues Spielzimmer und Deutschland hat zu tun
Kapitel 10
Lukas findet meine Geschichte spannend und sorgt dafür, dass mein Laptop nichts verliert
Ein Joker namens Paula, der sich nicht als die Prinzessin meiner Phantasie entpuppt, aber fantastisch duftet
Kapitel 11
Das Varieté nimmt Formen an. Genau wie der Rachefeldzug
Kapitel 12
Ein Versprechen für Lukas
Oma singt alle Strophen von Weißt-du-wieviel-Sternleinstehen und wir fallen beinahe über eine Leiche
Kapitel 13
Das Mietshaus und mein Vermieter
Frostige Zeiten, die nach einem wärmenden Nest schreien. Doch wohin mit dem Neger?
Kapitel 14
Das Haus, in dem ich wohne, und wie ich den Garten zum Leben erwecke
Wie wir satt und zufrieden sind
Warum sich Onkel Otto an eine Rot-Kreuz-Schwester ranmacht
Kapitel 15
Ouzo und bayrischer Senf
Zweifel kommen auf, Onkel Otto macht auf Demokratie und fegt die Zweifel vom Tisch
Kapitel 16
Wie der Garten mir dankt. Mein Hassfreund – der Laptop.
Das Programm wird besprochen und ich bekomme eine Aufgabe. Onkel Hermann regt sich wieder mal auf
Bahnhofsszenen. Ein unauslöschlicher Eindruck
Kapitel 17
Unruhige Nächte
Die Angelegenheit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Wie ich heute darüber denke, dass ich damals an einer entscheidenden Stelle nicht WARUM gefragt habe
Kapitel 18
Tante Paula und ich treffen den, der da kommen soll. Onkel Otto gibt im Hintergrund den Beobachter
Kapitel 19
Ich bin keine Schrulle, Lukas darf nach Hause und Pia schwänzt die Schule
Ich sehne mich nach meinem Nest. Warum gibt es eigentlich immer noch kein Trümmer-Musical?
Kapitel 20
Es wird viel getrunken und ich wundere mich über Rattenrudi. Immerhin gibt es EIN glückliches Paar auf der Welt
Kapitel 21
Pia greift vor und macht sich Gedanken über meine Psyche
Das Ensemble schwingt sich zur Generalprobe auf. Anschließend wird getanzt und getrunken
Pia möchte heute Nacht auch mal in ein Nest schlüpfen
Kapitel 22
Ehrfurcht vor dem 1000jährigen Räderwerk?
In unserem Haus ist kein Stuhl, Oma benimmt sich wie eine Unke und Frieda verschwindet Auf Nimmerwiedersehen
Kapitel 23
Ein Mann ist ahnungslos, das Messer ist gewetzt und Angst wird geschürt
Kapitel 24
Ich gebe den Erinnerungsdetektiv und die Rache nimmt ihren Verlauf
Vollzug
Kapitel 25
Lukas findet mich nicht bekloppt, ›Vierschrötig‹ ist ein komisches Wort und Pia droht die Zwangsernährung
Die Vorstellung ist zu Ende
Kapitel 26
Die Truppe ist betrunken, das Opfer wird nachts bis Bredeney gekarrt und ich säe Radieschen
Kapitel 27
Onkel Otto nimmt sich eine Frau und ich darf nicht in die Wochenschau
Ein Vertrag mit Pia
Kapitel 28
Wer ist wer? Zeitungsausschnitte geben Rätsel auf, wir haben ein Hurenkind und es gibt eine Katastrophe.
Teil 2 Der Meister
Kapitel 1
Edith macht Druck. Brown Babys
Kapitel 2
Ich fühle meine Bestimmung
Wer hat Schlimmeres erlebt? Pia oder Edith?
Kapitel 3
Von ›Alice im Wirtschaftswunderland‹ über die rasende Hausfrau bis zum Pseudohippie: Nichts lasse ich aus . .
Kapitel 4
Peter und ein lebenswerter Alltag in völliger Ahnungslosigkeit
Kapitel 5
Tante Hetty schickt ein Paket und ich phantasiere mir eine Familie zusammen
Emil greift für alle das Wirtschaftswunder ab
Kapitel 6
Die bemerkenswerte Frau P., entspiegelte Korridore und mein Wunsch bei einem Dritten Weltkrieg
Kapitel 7
Meine Vision von Paula, Hermanns Ableben und ein entscheidendes Wort von Edith
Kapitel 8
Warum in Bethel Briefmarken gebraucht werden, bei mir die Alarmglocken schrillen und Edith und ich diskutieren, woran man alles verrückt werden kann
Nikotin und Hütchenspiel
Hermann und Rudolf und das Doppelte Lottchen
Kapitel 9
Oma rückt mit Details raus und redet wirres Zeug über den Belgier. Ich besteche die Behörde und meine Rechnung geht auf
Kapitel 10
Ich erinnere mich, dass sich Oma zwei Tage vor ihrem Ende an einen wichtigen Namen erinnert hatte und stelle Nachforschungen an
Kapitel 11
Der mutige Ostbelgier, Ottos Frau, die kleinen Leute und Omas Beerdigung
Kapitel 12
Nichts als Fragen, ein schlimmer Verdacht und ein Brief an Hetty
Kapitel 13
Schokolade für Pia, ein alter Don Juan und wie ich ohnmächtig wurde
Kapitel 14
Die Geschichte der ›Grauen Busse‹ und mein erster Kontakt mit Bethel
Kapitel 15
Mit dem Zug nach Bethel, doch ich hege arge Zweifel .
Kapitel 16
Ein liebenswürdiger Koloss, ein Aquarium mit fünf Fischen und in mir das Gefühl, am falschen Ort zu sein
Kapitel 17
Der fünfte Fisch
Kapitel 18
Ediths Kapitel über die skurrile Geschichte von einem Meister, der das Zeug hatte zu einem Marquis de Sade .
Kapitel 19
Immer noch Edith: Das fünfte Fischlein
Kapitel 20
Schwer verdaulich
… Nachschlag
Das Bild muss weg
Ich wäre gerne pervers. Ein bisschen wenigstens
Nach wem bin ich geraten?
Mein persönlicher Exodus, ich finde einen Schatz und warum ich mit der deutschen Post nicht mehr ins Geschäft kommen mag
Schluss
Zu diesem Buch
Prolog
Ich hatte das große Los gezogen: Obwohl ich die falsche Rasse hatte, war ich nicht tot.
Ab meinem dritten Lebensjahr gab es eine Oma, die mich umsorgte. Die Aussichten für mein Leben waren also nicht schlecht, zumal Oma über Goldreserven verfügte. Opa hatte sie hinter Bildern eingemauert und die meisten Wände standen noch. Oma war eine Meisterin im Bestechen. Und erpressen konnte sie auch. So gehörte ich im eiskalten Nachkriegswinter zu den Privilegierten mit einer gelegentlichen Sonderration Kohle.
An unserem Küchentisch braute sich der Plan eines fürchterlichen Geschehens zusammen. Der Tisch stand in einer kapitalen Villa in Essen, einer der kaputtesten Städte nach dem tausendjährigen Reich. Dank Omas Skrupellosigkeit hatte unsere Villa wieder ein komplettes Dach.
Ich wurde erwachsen.
Aus purer Neugier rannte ich in die eigene Vergangenheit und puzzelte mein gestückeltes Leben zusammen. Das Ergebnis war verblüffend.
Heute trinke ich zu viel. Und ich schlafe schlecht.
Sonst geht es mir gut.
Ein beinahe tragisches Ereignis, ein Handschuh und ein Versprechen
»Luki liegt im Krankenhaus”, brüllt meine Tochter Paula durchs Telefon. Ich höre Blasmusik, Trommeln und Karnevalsgegröle durch den Hörer. »Er hat es wieder getan, Mama. Es ist zum Verrücktwerden.«
»Wo haben sie ihn hingebracht?«
»Ins Klinikum«, schrillt meine Tochter. »Wohin sonst?«
»Ich komme.«
Meine Gedanken ein einziger Funkenregen. Durch den Telefonhörer brülle ich meine Adresse in die Taxizentrale. Dann die Treppe runter. Frau Röser im Hexenkostüm. Die Augen schwarzfett gerahmt. Künstliche Falten wie ein Spinnennetz übers ganze Gesicht. Auf dem Kopf ein alberner Hut.
»Kann jetzt nicht«, raunze ich die Frau an. Ich haste aus dem Haus. Dieser Junge. Dass er immer wieder solche bescheuerten Sachen macht. Die Haustüre knallt ins Schloss wie ein Gewehrschuss.
Da hupt das Taxi. »Zum Klinikum. Mein Enkel wird gerade zusammengeflickt. Autounfall!«, reihe ich die Fakten aneinander.
Mut hat Lukas. Mit seinem abgenudelten Corsa prescht er durch die Stadt, bis er punktgenau vor eine Ampel fährt, die gerade von Grün auf Gelb umschlägt. Für den Bruchteil einer Sekunde beschleunigt er und dann: Vollbremsung. Der provozierte Auffahrunfall war diesmal stärker ausgefallen als geplant.
Zwischen Schnapsleichen, blau angelaufenen Visagen und Schnittwunden frage ich mich zur Unfallchirurgie durch.
Da! Meine Tochter Paula hält sich an ihrem Mann fest, ein Taschentuch vor den Mund gepresst. Mechanisch hebe ich einen blauen Lederhandschuh auf, den jemand auf dem Flur verloren hat. Handschuhe habe ich schon als kleines Mädchen gesammelt. Ich umarme Tochter und Schwiegersohn gleichzeitig. In diesem Dreierknäuel warten wir auf das, was da kommt.
Es kommt ein kleiner Mann mit einem Resthaarkränzchen und im weißen Kittel, Ringe unter den Augen. »Sie müssen sehr tapfer sein.«
Paulas Hand verkneift sich in meinem Arm.
»Es kann sein, dass wir ihm das linke Bein abnehmen müssen.«
Meine Tochter schluchzt auf. Auch Schwiegersohn Achim kramt sein Taschentuch heraus. »Dürfen wir zu ihm?« Klar, dass ihm die Stimme nicht so ganz gehorcht.
»Ja. Aber erschrecken Sie nicht. Wegen der vielen Verbände sieht es schlimm aus.«
Mitternacht.
Ich liege im Bett. Mit nur einem Bein hopst Lukas durch meine müden Gedanken. Wie gut, einmal nicht über die eigene Geschichte zu grübeln. Ich werde wunderbar schlafen können.
Eine Woche später. Zehn Augen starren auf ein Bein.
Paula und Achim sind sprachlos, Lukas’ kleine Freundin Pia plappert irgendein Zeug und Peter, mein Lebensgefährte, und ich lächeln uns zu. Seit der Visite wissen wir, dass dieses Bein eine reelle Chance hat, an Ort und Stelle zu verbleiben. Auch, dass Lukas trotz der Kopfverletzungen geistig auf der Höhe ist und dass er noch lächeln kann. Ohne seine Schneidezähne. Dass er den Chefarzt gefragt hat, wann er heim dürfe, hat der Herr Doktor als guten Witz aufgefasst. »Sobald die Zähne nachgewachsen sind.«
Da hat Luki gleich noch mal gegrinst.
Jeder Auffahrunfall, den Lukas mit dieser Vollbremsung vor der gerade auf Gelb gesprungenen Ampel provoziert, beschert seinem ollen Opel den wirtschaftlichen Totalschaden. Mein cleverer Enkel streicht die siebenhundert Euro Zeitwert von der Versicherung des Unfallgegners ein. Anschließend lässt er seine Karre von einem Freund für einen Freundschaftspreis wieder freundschaftlich geradeziehen und das Spiel beginnt von vorne. Nur hat ihn diesmal ein Lieferwagen über die Kreuzung in die Autos auf der Gegenfahrbahn geschoben. Mit Schneidbrennern hat man den Jungen aus dem zusammengefalteten Blech herausgeschält.
»Marianne, ganz ehrlich, das war das letzte Mal«, lispelt Lukas durch den schneidezahnlosen Kiefer.
»Natürlich, mein Schatz.« Ich streichel ihn. »Und das Bein wird auch wieder.«
Dass ich mir vorher ein wenig Mut angetrunken habe, riecht er nicht. Ich habe immer Pfefferminz dabei.
»Und wenn nicht, ich bleib trotzdem mit dir zusammen«, tröstet ihn die verstörte Pia. Als sie sich über ihn beugt, verschwindet Lukas unter ihrer Kastanienhaarflut, was mit Abstand das Fülligste an dem ausgehungerten Mädel ist.
»Bin gespannt, was aus der Sache rausspringt«, sagt Lukas gut gelaunt. »Bestimmt fünfstelliges Schmerzensgeld.«
Bei so viel gelispelten Zischlauten müssen Pia und ich lachen.
Zwei Wochen später.
Es ist angenehm, dass Lukas das Zweibettzimmer alleine zur Verfügung hat. So sind wir ungestört.
»Schon als ich klein war, wollte ich deine Geschichte hören, Marianne.«
Mein Inneres mutiert zu einem Knubbel. Dann müsste ich das Ganze wiederkäuen wie eine alte Kuh.
»Mama hat immer mal was angedeutet.«
Ich sehe ihm ins Gesicht. »Du hast meine Augen.«
Als ich meine Hände in die Taschen meiner Strickjacke stecke, fühle ich den dünnen Lederhandschuh vom Krankenhausflur.
»Grau-grün.« Er lächelt sein rührend zahnloses Ich-hab-nochmal-Glück-gehabt-Lächeln.
Ich habe ihn unglaublich lieb.
Und also erzähle ich.
TEIL 1
VERGELTUNG
Kapitel 1
Was ich als Kind 1947 mit meiner Zeit anfing
Meine Spielplätze waren gefährlich.
Nichts Ungewöhnliches zu einer Zeit, in der viele Kinder keinen Schulranzen hatten. Und damit keine Riemen, unter die man die kleinen Daumen schiebt, um sich an ihnen festzuhalten.
Als Kind war ich an Gefahren gewöhnt. Richtige Gefahren. Und es gab keine Mami auf der Bank, die jeden meiner Kinderschritte überwachte. Zum Beispiel, wenn ich in nur provisorisch abgesperrte Bunker kletterte, in denen man noch die Angst riechen konnte. Das Herzklopfen beschwor ich geradezu herauf. Ich stellte mir vor, wie es wäre, aus einem Trümmerkeller nicht wieder hinauszufinden. Noch heute denke ich manchmal, dass eine Welt, in der man vor nichts Angst haben muss, wie fades Gemüse ist.
Trümmergrundstücke zogen mich magisch an. Edith, die auf mich aufpassen musste, ging es genauso. Bei dem kleinsten Geräusch hielt sie völlig still. Sie stellte das Atmen ein und öffnete halb ihren Mund. Gerade so weit, dass man ihre vorgedrängten Zähne sehen konnte. Dabei schwitzte sie und brummelte unverständliches Zeug in sich hinein. In ihrem Gesicht stand das Grauen. Wie oft wir diesen atemlosen Schreck geteilt haben.
Zu dieser Zeit begann ich, noch nicht einmal fünf Jahre alt, verloren gegangene Handschuhe zu sammeln. Fand ich ein komplettes Paar, bedeutete dies: Heute war ein Glückstag.
Aber das Beste kommt noch: Als Dreikäsehoch durfte ich zwei Jahre nach dem großen, deutschen Bankrott an dem teilhaben, was nach Habgier, Macht und Schadenfreude das Grundbedürfnis der menschlichen Spezies schlechthin ausmacht: Rache.
»Krass«, sagt mein geschundener Enkel leise. Beinahe ehrfürchtig. Wie süß er mich unter seinen geschwollenen Augenlidern anblinzelt. Über einem hat er jetzt eine breite Narbe. In Gedanken sehe ich ihn als kleinen Jungen, wie er den alten Holzkoffer öffnet, um mit meiner Handschuhsammlung zu spielen. Mal packte er Leder zu Leder, Wolle zu Wolle. Mal bildete er zwei Haufen, einen für die linken Handschuhe, einen für die rechten. Oder er unterschied Fäustlinge und Fingerhandschuhe. Danach machte er Farbhaufen.
»Krass ist noch gelinde ausgedrückt«, pflichte ich meinem Enkel bei. »Meine Geschichte läuft nämlich unter nicht jugendfrei.«
»Cool!«, sagt Luki.
Kapitel 2
Oma und ich und wie wir es gut hatten
»Mein Mariannchen hat eine Glückshaut«, schwärmte meine filigrane Großmutter zwei Tage vor meinem fünften Geburtstag. Sie schaukelte mich auf ihrem Schoß hin und her, bis ich genug davon hatte, weil mir ihre spitzen Knie weh taten. Ich war gerade die ausladende Treppe hinuntergefallen, ohne mir etwas zu brechen. Ich stand auf meinen Füßen, die dünnen Beinchen fest durchgedrückt. Obwohl ich mir nichts getan hatte, tröstete Oma mich auf das Innigste. Kurzum: Ich gehörte nicht zu den Kindern, die ganz alleine erwachsen werden mussten.
Meine Oma war eine für meine Begriffe immer schon uralte Frau gewesen. Mit grauem Knoten, graublauen Augen, einem Blümchenkittel am Vormittag und ab halb vier oft in einem dunkelblauen Seidenkleid mit angedeutetem Faltenwurf vor dem Bauch. Weil sie immer so strahlte, wenn sie das sagte, hatte ich längst beschlossen, für immer mit dieser Glückshaut durchs Leben zu gehen. Schließlich war es mir gelungen, durch mein umwerfendes Lächeln Leute auf mich aufmerksam zu machen, als meine totgeweihten Eltern dringend einen fünf Monate alten Säugling loswerden mussten. Ich war sozusagen übrig, als das Schicksal sie anderweitig verplant hatte. Soweit Omas Schilderungen über mein Leben als frischer Erdenbürger. Es blieb für lange Zeit das einzige Puzzleteil aus meiner Säuglingsphase.
Meine umsichtige Mutter hatte es noch rechtzeitig geschafft, in mein Babyhemdchen meinen Namen einzusticken. Und zwar mit hauchdünnem Seidengarn in grün. Diese Farbe steht ja bekanntlich für Hoffnung. Irgendwelche Ersatzeltern erbarmten sich und brachten mich wohlbehalten durch die letzten drei Kriegsjahre. Wie oft habe ich mich gefragt, wer sie waren, wie sie gewesen sind. Aber an jene Zeit fehlt mir die Erinnerung.
Schon als Neuling auf diesem Planeten hatte ich kapiert, dass ich ordentlich zu wachsen hatte und kräftig werden sollte. Wegen meines bestickten Hemdchens hatte ich als Dreijährige, als alles, aber auch wirklich alles vorbei war, das ungeheure Glück, im Sommer 1945 zu denjenigen zu gehören, für die im Zuge der Familienzusammenführung noch Verwandtschaft ausfindig gemacht werden konnte. Gleichgültig, um welchen Angehörigkeitsgrad es sich in unserer Ahnengalerie handelte, gleichgültig, ob man tatsächlich miteinander verwandt war: Emilie Landmann wurde für mich zu Oma.
Wie meine Großmutter es geschafft hatte, während der größten Aufräumaktion seit Bestehen der Welt jahrelang auf unsichtbar zu machen und den Schergen ein Schnippchen zu schlagen, ist mir heute noch schleierhaft. Jedenfalls sind Oma und ich Goebbels und seiner Endlösung durch die Maschen gegangen. Auch Omas Handtasche, zu der sie eine symbiotische Beziehung unterhielt, überlebte das Tausendjährige Reich. Nur wenn wir, als ich schon ein Teenager war, in der Villa Hügel eins der begehrten Kammerkonzerte besuchten, sagte meine Oma, heute gehe ich fremd. Sie packte ihr weißes Taschentüchlein, mit dem sie sich niemals die Nase putzte, sondern das ausschließlich einigen Tropfen 4711 vorbehalten war, ihr schwarzes Portemonnaie und das Parfümfläschchen um in eine schmale, henkellose Schatullentasche in sehr hellem Beige. Diese Farbe war so neutral, dass sie perfekt zu Omas vielfältiger Abendgarderobe passte. Auf Villa Hügel war lang angesagt. Meine Großmutter hatte optisch das Zeug zur Fürstin, so elegant schritt sie in ihrer Abendgarderobe einher, die von den Möglichkeiten des Lebens zu erzählen schien. Geradezu umwerfend sah sie in einem bordeauxroten Abendkleid mit den farblich auf die Tasche abgestimmten Pumps aus. Natürlich trug sie Pelz. Gerne eine kurze Persianerjacke. Aber sie liebte auch ihren Nerzmantel. Ihr Friseur stylte einen perfekt sitzenden Dutt auf ihr Haupt. Durch dieses kunstvolle Gebilde wirkte Oma größer und noch schlanker, als sie ohnehin schon war. An den Strasssteinchen auf der Verschlussklappe knibbelte sie während des Konzerts immer herum. Waren wir spät abends zu Hause, begrüßte sie ihr schwarzes Unikum mit den Worten Da sind wir wieder. Schön war’s, aber nichts für dich, und räumte alles wieder an Ort und Stelle. Die Tasche war so dankbar, dass sie bis zu Omas Ableben auf jegliche Löcher verzichtete. Wäre es mir nicht frevelhaft erschienen, hätte ich sie Oma mit in den Sarg gelegt. Auch Relikte büßen manchmal nach einer Schonfrist Pietät ein. Und so wanderte die Tasche Jahre später in die Mülltonne.
Zurück zum Jahr 1947, als ich, die kleine Marianne, fünf Jahre alt war. Oma und ich wohnten in Essen-Bredeney, einer recht feinen Ecke vom Ruhrpott. Die Zimmer im Erdgeschoss hatten seit zwei Jahren Einquartierung ausgebombter Essener, denn wir hatten intakte Decken und sogar ein Dach. Aber als man als Holocaust-Überlebender 1947 seinen Anspruch auf Eigentum anmelden durfte, was Oma umgehend tat, mussten die Leute raus aus ihrer Villa. Ich gehe davon aus, dass sie uns dafür gehasst haben, denn sie hinterließen einen Schweinestall.
Dank Krupp, über dessen Beteiligung am großen Krieg man mit wirtschaftlichem Weitblick rasch hinwegsah, und dank Thyssens stählernen Ambitionen begannen die Arbeiterküchen schnell wieder zu kochen. Die Industrie stellte für die Hochöfen in fliegender Hast funktionstüchtige Maschinen bereit, und also strömten viele Menschen ins Ruhrgebiet und peppten es auf. Darunter waren einige Typen, die bald in unserem Haus auftauchten und meinem Leben zu einer ungeahnten Richtung verhalfen.
Da mein Großvater vor seinem erzwungenen Ableben einen gut bezahlten Posten als hoher Beamter im öffentlichen Dienst innehatte, konnte meine Großmutter nun seine Pension einfahren. Pech für Deutschland – oder vielmehr dem, was davon übrig geblieben war. Mein Großvater hätte nach Kriegsende mit 56 Jahren durchaus noch arbeiten können, wie Oma bei jeder Gelegenheit vorrechnete.
Omas weitblickender Gatte hatte ganze Schmuckladungen der vormals umfangreichen Verwandtschaft in die Wände zementiert: Backstein raus, Schmuck rein, halbierter Backstein davor, Putz und Tapete drüber. Bild davor, damit man die Stelle besser wiederfinden konnte. Glück für Oma und mich, denn die Wände, übrigens auch der wesentliche Teil des Daches, waren stehen geblieben. Natürlich ohne die Bilder, wie überhaupt alles, was man für immer aufbewahren wollte, futsch war. Aber die Nägel steckten noch in ihren Löchern. Nun war es ein Leichtes, das Edelmetall und die hübsch eingefassten Steine wieder freizulegen. Man reinigte sie vom Trümmerstaub und knotete die kostbaren Vorräte in Handtücher. Ein Bündel ansehnlichen Umfangs kam da zustande. Opa muss ein Mann gegen alle Möglichkeitsformen gewesen sein. Statt Hätten Sie besser in Gold investiert, HATTE er in Gold investiert. In richtig viel Gold, wenn man seine überschaubare Nachkriegs-Verwandtschaft, Oma und mich, in Betracht zog.
Oma hatte die Skrupel der Zivilisation abgelegt. Gegen einen wohl bemessenen Teil ihrer Schätze entlockte sie den Leuten sogar die knapp rationierten Lebensmittel.
Erst sehr viel später habe ich mich gefragt, warum Oma nicht auf die Idee gekommen war, nach meinen vorübergehenden Zieheltern zu forschen. Meine Großmutter hätte sich erkenntlich zeigen können. Schließlich hatten diese unbekannten Menschen Kopf und Kragen riskiert, um ein kleines jüdisches Mädchen durchzubringen.
Meine Oma und ich waren die ersten, die es sich leisten konnten, ein kapitales Haus wie unseres wieder instand setzen zu lassen. Die Stuckdecken wurden restauriert und Teppiche aus anderen Häusern hinausgeschafft, damit sie für Gold in unseres einzogen. An der Straßenseite hatte Oma aufmauern lassen, etwa auf eine Höhe von zwei Metern, woran an der Außenseite das Efeu und innen weiße Rosen hochkletterten. Dazu ein schmiedeeisernes Tor mit einem Kleinod von einem kapitalen Schloss. Handgefertigte Schmiedearbeit, die heute als museales Schmuckstück gehandelt werden dürfte. Oma zückte beim Barzahlen ihren bestickten Stoffbeutel aus den Tiefen ihrer Altfrauenhandtasche. Das machte sie damenhaft, also weder hektisch noch in Zeitlupe und mit so einem ganz bestimmten Gesichtsausdruck, einer Mischung aus geschäftig und gönnerhaft. Das Wechselgeld versenkte sie in der ledernen Tasche und wandte sich ohne einen weiteren Gruß in die Richtung ihrer Wahl. Sie wirkte deshalb nicht unhöflich, aber äußerst bestimmt, was die klackernden Absätze ihrer ausschließlich schwarzen Alltagspumps unterstrichen.
Mit der Bahn ging’s ins heil gebliebene Holland auf Hamsterfahrt. Butter, Kaffee und je zwei Paar Schuhe für Oma und mich. Auch leisteten wir uns Edith, die mit mir zum Spielen oder Handschuhe Suchen hinausging, später ihre sommersprossige bleiche Stirne runzelte und meine Rechenaufgaben erledigte, stets von einem Dauerseufzen begleitet. Erst mit den Jahren begriff ich, was Edith bei uns außer Arbeit als Wirtschafterin und Kindermädchen gesucht und gefunden hatte: ein Zuhause. Ihres war ihr abhanden gekommen.
Mir gefiel es, dass man uns zu den reichen Leuten zählte, die sich ein intaktes Haus und Personal leisten konnten. Denn außer Edith engagierte Oma eine Reinemachfrau. Sie hieß Ingrid Scheffler, war ausgebombt und hatte die Nase voll von ihrer Einquartierung in einem zugigen Zimmer unter einem notdürftig reparierten Dach einer ehemaligen Bäckerei. Ihr Mann war nicht heimgekehrt, die Verwandtschaft weitgehend ausgelöscht und sie somit genauso übrig wie Edith.
In dem strengen Winter 47 verbrachten Oma, die blasse Edith, Ingrid Scheffler und ich die meiste Zeit vor dem Ofen in der Küche. Meist saß ich am Tisch und beschäftigte mich mit meiner Sammlung, die zu der Zeit noch klein war. Ich hatte vielleicht 12 Einzelexemplare gehortet. Oft malte ich mir zu den einzelnen Handschuhen Geschichten aus, stellte mir wohl auch die Hände vor, die in so einem Handschuh gesteckt hatten. Mein Liebling war lange Zeit ein kleiner roter Strickhandschuh. Seine Besitzerin, und wegen der Farbe war es natürlich ein Mädchen, wurde zu meinem Schwesterchen, mit dem ich mich gerne und oft unterhielt.
Weil wir zu wenig Kohlen für die anderen Öfen hatten, kühlten die anderen Räume aus.
Trotzdem: Eines Tages begannen sie, sich bei uns im Haus zu sammeln.
Kapitel 3
Lukas hat nicht wirklich Ahnung vom Krieg
»Habt ihr die Wertsachen einfach nur im Haus versteckt?«, fragt Lukas zwischen Stationsarzt und Mittagessen.
»Wo denn sonst? Die meisten Banken waren ausgebombt. Also gab es keinen Safe, den wir hätten mieten können«, stelle ich klar, als die Schwester den Deckel von zwei Scheiben Braten, zwei Klößen und Apfelmus nimmt. Geräuschvoll verlässt sie das Zimmer.
Schon dieser spezielle Krankenhausessensgeruch macht mich satt.
»Habt ihr das Zeug etwa in deine Handschuhe gestopft?«
»Natürlich nicht. Passende Verstecke sind Fußleisten, lose Mauersteine, Handtücher, Kleidung, in die man etwas einnähen kann.«
Ich schneide das Fleisch in mundgerechte Stücke und reiche Lukas die Gabel. Den linken Arm kann er wieder einigermaßen bewegen, der rechte ist eingegipst.
Lukas mag es, wenn ich über meinen Genuss der Angst spreche. Angst, wenn man nicht wirklich um sein Leben bangen muss. Keine Kassandraangst, die einem unweigerlich das Ende vor Augen führt. Ich glaube, dass Lukas mir ein wenig ähnlich ist. Jedenfalls, was dieses prickelnde Angstgefühl betrifft. Er ist bei den Autonomen. Zumindest behauptet er, dass er zu der Szene gehört. Zweimal hat er bereits bei den Hausbesetzern mitgemischt.
Als er aufgegessen hat, fahre ich das Kopfteil von seinem Bett wieder herunter und erzähle weiter.
Onkel Hermann zieht bei uns ein und benimmt sich manchmal merkwürdig
Den Anfang des seltsamen Völkchens, das unsere Villa magisch anzog, machte ein Mann. Ab sofort übernahm er Hausmeisterarbeiten. Er kreuzte am 28.Juni auf, genau zu meinem fünften Geburtstag, und half tüchtig, den Kirschkuchen zu vertilgen. Die Kirschen stammten von unserem kapitalen Kirschbaum, der im hinteren Teil des Gartens sämtliche Angriffe der Alliierten überstanden hatte. In diesem Jahr hinderte kein Luftzug die Früchte am Wachsen. Die Bomben gaben auch 1947 immer noch Ruhe – man konnte es nach wie vor kaum glauben – und die Vögel hatten uns reichlich übrig gelassen.
Der Mann hatte während des Kriegs ein ganzes Jahr lang als Gärtner verkleidet bei einem Pfarrer gehaust, der ihn bei Gefahr im Keller, im Wandschrank, auf dem zugigen Speicher, im Gartenhäuschen versteckte. Einmal sogar in einer Kiste unter der Erde im Garten des Pfarrhauses. Ein ehemaliges Abflussrohr hatte man zu seiner Luftzufuhr zwischen seinem Sarg und Rhododendren zweckentfremdet. Weil die Angelegenheit eilig war, bekam er auf die Schnelle eine angebrochene Weinflasche, die man kurzerhand mit Leitungswasser auffüllte, und den von Weihnachten übrig gebliebenen Christstollen von Tante Frieda aus Chemnitz mit in seine Notunterkunft im Erdreich. Einen kompletten Tag verbrachte er in dieser Kiste, dachte wohl auch des Öfteren, wie praktisch es doch sei, dass er unter dem Aspekt der letzten Bestimmung des Menschen schon am richtigen Ort angekommen wäre. Er versicherte meiner Großmutter mehrfach, dass er trotz der Ängste dort unter der Erde herzhaft habe lachen müssen. Das habe sich ganz merkwürdig angehört und angefühlt, wenn man seine Lage bedächte. Man verbrauche aber dabei mehr Sauerstoff als nötig. Deshalb habe er das Lachen eingestellt, denn seine größte Sorge war weniger die Entdeckung gewesen als vielmehr, dass er ersticken müsste. Als er das schilderte, waren Edith und Ingrid Scheffler so erschüttert, dass sie trotz aller Lächerlichkeit einige Tränen verdrückten.
Der Pfarrer hätte dicht gehalten. Dafür hatten sie ihn abgeholt. Ich war noch so klein, dass ich diesen Akt als Belohnung einstufte. Ich stellte mir vor, mit welch wundervollen Torten man den wackeren Mann mit dem komischen Hut, den schlotternden Hosen und den knochigen Wangen, den Oma mir auf einem Foto gezeigt hatte, verwöhnte.
Die Pfarrersfrau harrte noch den restlichen Tag im Hause aus. In der Nacht griff sie zur Hacke und öffnete das Grab des verfolgten Mannes, voller Angst, in welcher Verfassung sie den Hobbygärtner unter seinem ehemaligen Arbeitsplatz vorfände. Was er für eine Panik ausgestanden habe, als ihm bewusst geworden sei, dass die Schläge der Hacke ihm galten. Und dann der Augenblick, als der Sargdeckel geöffnet wurde.
»Gut, dattet dunkel war«, erklärte Onkel Hermann. »Meine Augen warn ja gar kein Licht mehr gewöhnt.«
Die Frau sei ihm wie ein Engel erschienen, wie sie da mit ihren langen, offenen Haaren im abnehmenden Halbmondlicht über seinem Gesicht aufgetaucht wäre. Trotz des sächsischen Stollens, der ja bekanntlich eine einzige Kalorienbombe ist, sei er derart leicht gewesen, dass die Frau es ganz allein geschafft habe, ihn aus der Grube zu ziehen.
»So was von Gliederschmerzen habe ich nie mehr erlebt«, versicherte Onkel Hermann, »obwohl ich früher halsbrecherische Figuren geübt habe, bei denen sich andere Tänzer sämtliche Bandscheiben ausgehebelt hätten.«
Wie froh er gewesen sei, als ihm in seinem Grab bewusst geworden wäre, dass er nie darauf aus gewesen sei, seine Zukunft geweissagt zu bekommen.
»Das hätte der renommierteste Weissager nicht für möglich gehalten, dass Sie vor Ihrem Ableben schon mal für einen vollen Tag die Radieschen von unten sehen würden«, sagte Oma.
Onkel Hermanns Gelenke kamen wieder in Gang, weil er jeden Tag ein bisschen mehr trainierte, im Garten oder bei Regen im groß bemessenen Entree, bis man wieder den Tänzer von früher erkennen konnte. Einen Tänzer mit scharfen Gesichtszügen und hellblauen Augen, die richtig strahlen konnten.
Oma bepflanzte mit Onkel Hermanns Hilfe eine Hälfte unseres Gartens mit Gemüse und Kartoffeln und hieß Onkel Hermann ein Pärkchen umzäunen für Frieda, Helga und Elsa, unsere Hühner. Mit ihnen verband mich eine innige Freundschaft. Stundenlang konnte ich am Zaun stehen und ihnen meine Kleinkindererlebnisse schildern.
Onkel Hermann ließ seinen Bizeps wachsen. Die Gürtelschnalle wanderte ein Loch nach außen. Und weil Oma schwarzmarktfischte, Tante Scheffler und Edith auftischten, abtischten und wieder auftischten, bald noch eins.
Onkel Hermann wusste nicht, was er aus lauter Dankbarkeit alles sagen sollte, sagte also nichts. Dafür haute er bei jeder Mahlzeit rein, als gäbe es kein Morgen. Die einzig richtige Einstellung, wenn man hörte, was sich zwischen Schutt und Asche erzählt wurde. Dass die Flieger wieder … und dass nicht klar wäre, was jetzt die Amis … und ob der Russe. Oma, Edith, Tante Scheffler und Mutter Deutschland machten Sorgenfalten.
Onkel Hermanns Gesicht sah bald nicht mehr so sehr nach Totenkopf aus. Allerdings blieben seine Ohren bei ihrer beachtlichen Größe. Ansonsten wirkte er auf mich schon bald wie ein ganz normaler Mensch. Wie einer, der mit der Zeit zurechtkam, auch wenn die Stadt noch ziemlich tot war, wie er es ausdrückte.
Seine Sätze, die er an Oma richtete oder auch einfach so vor sich hin sprach, bestanden häufig aus Fetzen.
Was der mit Paula … Dabei saß er in der Schule jahrelang neben mir und was hatten wir nicht alles zusammen … Aber, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß … Und wenn ich daran denke, dass sie mit ihm nach nebenan … Alles, einfach alles hab ich für sie … Bestimmt haben sie sie doch noch … Keine einzige Spur … Von ihm allerdings auch nicht … Aber der Tag wird kommen … Na ja, ich mach dann mal was im Garten. Mal sehn, ob schon paar Pflaumen …
Oma sagte zu alledem nichts. Der Mann stellte sich vor unseren Pflaumenbaum und schüttelte den Kopf.
Und ich sagte zu Edith: Onkel Hermann spinnt manchmal.
Kapitel 4
Auch Pia ist scharf auf meine Geschichte
Pia ist auf Zehenspitzen hereingeschlichen und fährt ihrem Freund sanft durchs straßenköterfarbene Zottelhaar. Ihre Fingernägel hat Pia abgefressen. Sie zieht die Schuhe von ihren knochigen Füßen und legt sich vorsichtig neben Lukas. Wie schmal sie ist. Als ich gehen will, sagt sie, dass ich bleiben soll. Lukas habe ihr gestern Abend gesagt, dass ich von früher erzählen würde und sie liebe Früher-Geschichten. Aber ihre eine Oma sei tot und die andere wohne in Bayern. Da käme es gut, dass wenigstens ich da wäre. Und Lukas würde ihr sowieso alles von meinen Schilderungen haarklein weitererzählen. Da mache es nichts, wenn sie nicht immer dabei wäre. Übergangslos liefere ich also die Fortsetzung.
Onkel Hermann redet manchmal wirres Zeug und Oma hat mit den Aufräumarbeiten in Deutschland nichts am Hut
In unserem Garten, einer wahrhaft gelungenen Symbiose aus Bäumen, Stauden, Sommerblumen, Sträuchern, einjährigen Pflanzen, die Oma mit den gesammelten Samen vom Vorjahr auf der Fensterbank in der Küche vorzog, und einem Teich wirbelte mich Onkel Hermann durch die Luft. Er tanzte mit mir an Margariten vorbei, hob mich einer Rosenblüte entgegen und sagte: »Mariannchen. Musste mal dran riechen.«
Dann ließ er mich über dem Teich schweben und Oma und Tante Scheffler applaudierten.
Trümmer hin oder her, wir gehörten zu denen, die nicht ununterbrochen von der schrecklichen Zeit sprachen. Allerdings sahen sich Oma und Onkel Hermann auch nicht genötigt, beim Wegmachen des Drecks zu helfen, den die Geschichte hinterlassen hatte.
Komisch fand ich, dass Onkel Hermann manchmal nachts durchs Treppenhaus rannte und herum schrie: »Paula, mir ist das zu eng. Paula, siehst du das denn nicht? Mein Gott, Paula!«
Meine Oma und ich sprangen erschrocken aus unseren Betten. Wir erwischten ihn dabei, wie er verkrümmt Richtung Küche ächzte, sich in dieser Fragezeichenhaltung auf die Zehenspitzen stellte, um den Riegel der Türe zum Garten aufzuschieben. War die Türe endlich offen, hastete er nach draußen. Erst dort richtete er sich zu voller Größe auf, flitzte ins Dunkel und rief immer wieder nach Paula. Beim ersten Mal ist Oma in ihre Hausschlappen gesprungen und losgerannt, um Onkel Hermann zu verfolgen. Mit dem offenen Haar und in ihrem weißen, langen Nachthemd sah sie aus wie ein Engel, der über unsere Wiese flatterte. Dazu jammerte sie in klageweibischer Art ins Dunkel, dass es richtig zum Gruseln war. Ich sprang mit nackten Füßen und ebenfalls im Nachthemd hinterdrein. Was sprach schließlich dagegen, nachts Fangen zu spielen und merkwürdig herumzujaulen. Endlich erschienen auch Edith und Tante Scheffler in der Türe, die sich aber nicht an der nächtlichen Hatz beteiligen wollten. Stattdessen starrten sie in den mondbeschienenen Garten wie auf eine Theaterbühne, auf der Oma ihre liebe Mühe hatte, an Onkel Hermann heran zu kommen. Dabei versuchte sie, ihm den Weg abzuschneiden und ihn mit Hermann, ist doch alles in Ordnung zur Räson zu bringen. Aber er entwischte ihr und schien im Übrigen taub zu sein. Also versuchte ich mein Glück. Natürlich war er auch für mich zu schnell. Wie er da wie eine knochige Furie umherirrte, als wolle er die Geister beschwören, gab er ein absolut groteskes Bild ab. Und so blieben Oma und ich irgendwann stehen und sahen zu, wie er seine Kreise drehte und mit Weltuntergangsstimme andauernd Paula, zu eng – viel zu eng rief.
Irgendwann war der Zauber vorbei und er kam zu sich, starrte uns an und sagte: »Aber Mariannchen, du wirst dich erkälten.« Er nahm mich auf den Arm, drückte mich an sich, dass ich seinen kantigen Körper fühlte, und wir kehrten in die Küche zurück. Dort setzte sich Onkel Hermann auf einen Stuhl und mich auf seinen Schoß. Ich musste die Beine anziehen, damit er an meine Füße kam. Mit seinen großen, knochigen Händen knetete er sie warm. Anschließend trug er mich ins Bett und deckte mich bis zur Nasenspitze zu. Bei seinem nächsten nächtlichen Ausflug rannten wir nicht mehr hinterher, sondern schauten von der Küchentüre aus zu. Schon bald blieben wir im Bett liegen und überließen ihn seiner Raserei.
Dies war der Zeitpunkt, an dem ich begann, mich zu fragen, wer Paula war.
Kapitel 5
Pia will über Schule redenund ich weiche von der richtigen Reihenfolge ab
»Was war mit Schule?«, will Pia wissen.
Und Lukas fragt: »War so scheiße wie heute?«
»Wenn ich der Reihe nach erzählen soll, dann ist Schule noch nicht dran«, sage ich in Lehrerinnenton.
»Will ich aber wissen«, piepst Lukas’ Freundin und kuschelt sich noch ein bisschen mehr an meinen Enkel. Dabei muss sie aufpassen, dass sie sich nicht in dem dünnen, langen Tropfschlauch verheddert, der aus Lukas` Arm zu wachsen scheint.
Also mache ich einen Sprung.
Warum ich meine Lehrerin geliebt habe und wie sich Onkel Hermann über Post aus Amerika aufregt
Nach den Verkettungen, die vom Hause meiner Großmutter aus ihren Lauf nahmen, durfte ich in der Volksschule von einer übrig gebliebenen Reformpädagogin nach Steiners Methoden völlig unversteinert lernen. Allerdings in einem wenig geheizten Gebäude. Mein Leben war immer noch glücklich, obwohl wir alle schon bald husteten. Immerhin war ich mit passenden, heilen Schuhen ausgerüstet, und meine Füße steckten in dicken Wollsocken.
Die notdürftig hergerichteten Klassenzimmer waren ab sofort nicht mehr verstummt. Sie wurden mit neuen kleinen Menschen gefüllt, damit es wieder Kinderbilder mit Schultüten geben würde und man die ertrunkenen, erschossenen, verschollenen, von schrecklichen Ungeheuern aufgefressenen Menschen, die sich einst Freundschaft fürs Leben geschworen hatten, durch kleine Frischlinge ersetzte, die die Geschichte übersehen hatte. Durch mein Fräulein ging das böse deutsche Erziehungsgrau an mir vorbei. So lernte ich Alphabet und Einmaleins ohne ständige Angst im Nacken. Ich musste nicht kerzengerade auf meinem Lehranstaltsstühlchen vorne an der Kante hocken, die Händchen stundenlang gefaltet vor mir auf dem Schultisch.
»Auf der Kante müssen wir zwar nicht hocken. Aber irgendwie ist den Lehrern scheißegal, wie es einem geht. Scheißegal. Da find ich Kante hocken zehnmal besser«, unterbricht mich die ahnungslose Pia, die in die Abschlussklasse der Gesamtschule Essen-Süd geht.
»Es gab richtige Sadisten«, erkläre ich ihr. »Wer als Offizier den Krieg überstanden hatte, durfte ohne Ausbildung als Volksschullehrer wüten. Und ich kann euch sagen, das waren oftmals harte, unangenehme Typen.«
Pia stützt sich auf den Ellbogen.
»Hampel nicht rum«, raunzt Lukas. »Wenn das Bett nur ein kleines bisschen wackelt, tut mir schon alles weh.«
Pia flüstert »Tschuldigung«. Ein Küsschen kriegt Lukas außerdem.
»Nichts für Kinderseelen«, kehre ich zum Schulthema zurück. »Kein Wunder, denn diese Sorte Lehrer kehrte gerade aus dem schrecklichsten aller Kriege nach Hause zurück.« Ich lege eine Kunstpause ein. »Meine Lehrerin war da die absolute Ausnahme.«
»Krass«, sagt Lukas. Und er sagt auch noch, dass ihn die Schulgeschichten echt wenig interessierten und dass er voll froh wäre, dass er sein Abi noch irgendwie hingekriegt hätte.
»Der Weg zum Abitur war eine einzige Entsetzlichkeit. Zu meiner Schulzeit war noch Demütigung angesagt. Und meine Berufsträume haben sich schon vor dem Abi in Luft aufgelöst, weil ich gelernt hatte, dass ich’s zu nichts bringen würde. Dabei wollte ich Richterin werden.«
»Wow«, machen Lukas und Pia gleichzeitig.
»Viele von uns hatten Großes vor. Aber die meisten meiner Mitschülerinnen sind Lehrerin geworden.«
»Selber Schuld«, sagt Pia mitleidlos.
Als Lukas seine Bettdecke mit den beinahe abgeschwollenen Fingern knetet und aus dem Fenster sieht, sage ich: »Dann mach ich jetzt in der richtigen Reihenfolge weiter.«
Wie gesagt: Der Krieg war seit zwei Jahren vorbei.
Wir hatten Spätsommer.
Onkel Hermann setzte mich oft mit Schwung auf seine spitzen Schultern und trabte mit mir eine Gartenrunde. Er beugte sich urplötzlich nach vorne, sodass ich einen Purzelbaum ins Leere machte, an den Händen gefasst wurde und ohne zu wissen, wie, auf meinen Füßen landete.